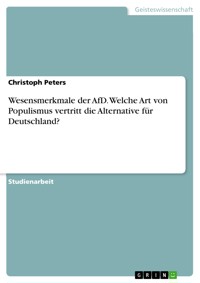10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die schonungslose Bestandsaufnahme der politischen Kultur eines ganzen Landes. »Als Leser dieses bitterbösen wie hochkomischen Buchs glaubt man manchmal geradezu im Kopf des Protagonisten zu stecken.« Christian Schröder / Der Tagesspiegel
Siebenstädter hat schon alles gesehen. Als Moderator einer Politsendung im Radio kennt er sich aus mit den Spielregeln der Berliner Spitzenpolitik, dem Schattenreich der Hinterzimmer, mit der Gnadenlosigkeit eines Betriebs, dem es nur um Machterhalt geht. Siebenstädter ist so beliebt wie berüchtigt, einer, der an gar nichts glaubt und sich prädestiniert fühlt, die Lügen der Eliten aufzudecken. Mit der Coronakrise jedoch verändert sich das Spiel: Siebenstädter hat ebenso Zweifel an den staatlichen Maßnahmen wie Abscheu gegenüber Verschwörungsgläubigen. Unerwartet erhält er das Angebot der Liberalen, die Seiten zu wechseln, während Maria Andriessen, aufsteigender Stern der Sozialdemokratie, sich mehr für ihn zu interessieren scheint, als es bei einem verheirateten Mann angemessen wäre. Vor allem aber spürt Siebenstädter, dass seine Zeit langsam abläuft - warum also nicht alles auf eine Karte setzen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Siebenstädter hat schon alles gesehen. Als Moderator einer Politsendung im Radio kennt er sich aus mit den Spielregeln der Berliner Spitzenpolitik, dem Schattenreich der Hinterzimmer, mit der Gnadenlosigkeit eines Betriebs, dem es nur um Machterhalt geht. Siebenstädter ist so beliebt wie berüchtigt, einer, der an gar nichts glaubt und sich prädestiniert fühlt, die Lügen der Eliten aufzudecken. Mit der Coronakrise jedoch verändert sich das Spiel: Siebenstädter hat ebenso Zweifel an den staatlichen Maßnahmen wie Abscheu gegenüber Verschwörungsgläubigen. Unerwartet erhält er das Angebot der Liberalen, die Seiten zu wechseln, während Maria Andriessen, aufsteigender Stern der Sozialdemokratie, sich mehr für ihn zu interessieren scheint, als es bei einem verheirateten Mann angemessen wäre. Vor allem aber spürt Siebenstädter, dass seine Zeit langsam abläuft – warum also nicht alles auf eine Karte setzen?
Christoph Peters hat einen Roman geschrieben, wie es ihn seit Wolfgang Koeppens »Das Treibhaus« nicht gegeben hat: eine schonungslose Bestandsaufnahme der politischen Kultur eines ganzen Landes.
Zum Autor
Christoph Peters wurde 1966 in Kalkar geboren. Er ist Autor zahlreicher Romane und Erzählungsbände und wurde für seine Bücher vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Wolfgang-Koeppen-Preis (2018), dem Thomas-Valentin-Literaturpreis der Stadt Lippstadt (2021) sowie dem Niederrheinischen Literaturpreis (1999 und 2022). Christoph Peters lebt heute in Berlin. Zuletzt erschienen von ihm bei Luchterhand der »Dorfroman« (2020) und »Tage in Tokio« (2021).
Christoph Peters
Der Sandkasten
Roman
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2022 Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: buxdesign/Ruth Botzenhardt unter Verwendung
eines Motivs von © Eric Forey / Trevillion Images
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-16363-1V003
www.luchterhand-literaturverlag.de
Der Roman Der Sandkasten hat mit den wirklichen Verhältnissen nur insofern zu tun, als diese in der Form, wie sie der Öffentlichkeit tagtäglich medial vermittelt werden, als Anregung für die Imagination des Autors gedient haben. Figuren, Schauplätze und Geschehnisse der Erzählung sind nirgends mit realen Personen, Orten und Vorgängen identisch. Erscheinungsbild, Eigenschaften und Handlungsweisen der Protagonisten wurden weder lebenden noch verstorbenen Menschen nachgebildet, sondern entsprechend der inneren Logik des Romangeschehens gestaltet. Sollten sich dennoch Ähnlichkeiten finden, verdanken sie sich dem Zufall oder den unabänderlichen Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Natur. Dagegen sind motivische und kompositorische Parallelen zu Wolfgang Koeppens Roman Das Treibhaus beabsichtigt und Teil des Spiels.
C. P.
Der eine ist dünn und hat rosa Augenlider. Der andere hat ein Mondgesicht und leidet. Es ist alles sehr schmerzhaft.
HAROLD NICOLSON
Wenn man den Leuten nur begreiflich machen könnte, daß es mit der Sprache wie mit den mathematischen Formeln sei – Sie machen eine Welt für sich aus – Sie spielen nur mit sich selbst, drücken nichts als ihre wunderbare Natur aus, und eben darum sind sie so ausdrucksvoll – eben darum spiegelt sich in ihnen das seltsame Verhältnißspiel der Dinge.
NOVALIS
I.
Er bewegte sich anonym durch die Stadt, auch wenn Hunderttausende seine Stimme kannten. Da er beim Radio und nicht beim Fernsehen arbeitete, wusste keiner, wie er aussah, zum Glück. Wiederum war er nicht auffällig geworden, hatte niemanden bei offenem Mikrofon beschimpft oder beleidigt, war nicht schreiend Amok gelaufen, weder im Sender noch auf der Straße, obwohl ihm danach zumute gewesen wäre, aber dazu hätte es einer Kraft bedurft, die ihm schon lange abging. Wenn bekannt wurde, was er dachte, wirklich dachte, einfach weil er wusste, was er wusste, wäre es trotzdem vorbei. Tag für Tag rechnete er mit dem finalen Shitstorm aus den Dunkelkammern des Internets, Folge einer unbedachten Bemerkung zwischen fünf und acht in der Frühe, die von unzähligen Leuten gehört worden wäre, während sie sich Kaffee brühten, die Lippen schminkten, eine Krawatte banden. Bevor die Empörung überkochte, waren sie vielleicht dankbar für den Aufreger, lachten kurz, dann blieb ihnen das Lachen im Hals stecken, sie schämten sich, die Scham wurde Wut. Die Empfindlichkeiten nahmen beängstigende Ausmaße an in letzter Zeit. Trotzdem musste er täglich aufs Neue versuchen, einen dieser abgeordneten Phrasendrescher, aalglatten Verbandssprecher, schmierigen Sportfunktionäre mit Hinterhalten, Provokationen aus der Reserve zu locken, ihnen klare, am besten entlarvende Antworten zu brennenden, heiklen oder auch einfach belanglosen Themen zu entlocken. De facto kamen ihm die meisten Themen belanglos vor nach über zwanzig Jahren beim Funk. Siebenstädter hatte schon alles gehört, aber in regelmäßigen Abständen schwappten die immer gleichen Geschichten als dritter, vierter, fünfter Aufguss ein weiteres Mal hoch. An den Strukturen änderte sich nichts, die Verfilzungen bestanden seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, vermutlich seit Beginn der Menschheitsgeschichte. Er riss sich zusammen, am Mikrofon genauso wie jetzt auf dem Heimweg, später zu Hause. Ein falsches Wort und die Meinungsgülle, abgesondert von Leuten, die sonst nichts zu tun hatten, würde sämtliche Kanäle fluten. Schnell hätte jemand ein Foto von ihm aufgetrieben, Google kannte längst jedes Gesicht, binnen Stunden würde es sich verbreiten, dann gehörte es der Vergangenheit an, das Leben, in dem er sich eingerichtet hatte, mehr schlecht als recht, aber dennoch auf Dauer. Es folgten verlogene Distanzierungen des Chefredakteurs, des Intendanten, selbstmitleidige Entschuldigungen, dass man sich habe täuschen lassen. Sicher würde auch Reisiger, der die Morgensendung im Wechsel mit ihm moderierte, ihm in den Rücken fallen. Diverse Hinterbänkler brächten ihre Empörung zum Ausdruck, nachgereichte Rache für hartnäckige Fragen zu nachtschlafener Zeit oder im Gegenteil dafür, dass sie nie gefragt worden waren. Vielleicht würde ein vorgesetzter Kopf rollen, einer aus den Aufsichtsgremien träte symbolisch zurück, um bei vollen Bezügen eine Anstandsfrist lang auf den nächsthöheren Posten zu warten. Schließlich würde die Sendeanstalt, öffentlich-rechtlich, wie es so schön hieß, zu seinem offiziellen Rausschmiss noch einmal ihre Bestürzung darüber erklären, dass man jemanden wie ihn so lange in einer derart wichtigen Position belassen habe, wo doch jeder, der in letzter Zeit seinen Moderationen zugehört habe, hätte wissen können, dass er längst abgedriftet sei in eine Richtung, für die es im Sender definitiv keinen Platz gebe.
… Laber Rhabarber. Siebenstädter saß in der Straßenbahn, eine hellblaue Einwegmaske vor Nase und Mund, roch den eigenen Atem, Kaffee und Pfefferminz. Drei Plätze vor ihm stank einer nach Schnaps, dagegen halfen die Masken nicht – Aerosole auch das. »Denken Sie an Alkohol, Knoblauch, Schweiß«, hatte Prof. Garbsen zu Beginn der Pandemie in einem Interview gesagt, um ihm stellvertretend für die Hörer zu verdeutlichen, wie man sich die Übertragung vorstellen musste: als schlechten Atem.
Die Bahn bog scharf nach rechts, die Bahn war grellgelb lackiert, die Bahn fuhr Werbung für Gorbatschows Wodka. Gedenkstätte Berliner Mauer. Heute vor einunddreißig Jahren war sie gefallen, »Sind Sie der Meinung, dass die Demonstration der sogenannten Querdenker, die gestern in Leipzig völlig aus dem Ruder gelaufen ist, tatsächlich irgendetwas mit der friedlichen Revolution von ’89 zu tun hatte?« war seine Frage um sechs Uhr zweiundvierzig an den innenpolitischen Sprecher der Neuen Rechten gewesen. An die Antwort erinnerte er sich nicht, er vergaß fast alles, was die Leute ihm erzählten, in dem Moment, wo das Gespräch endete. Bernauer Straße. Eine Schulklasse auf pädagogisch wertvollem Wandertag, Touristenspaziergänge vor dekorativ verrosteten Betroffenheitsinstallationen. Draußen an der frischen Luft sind sie vor Infektionen geschützt, hatte es im Frühjahr geheißen, inzwischen galten Jugendliche in Parks als Gefährder. Umsteigemöglichkeit in die U8, falls er nach Kreuzberg wollte oder – in entgegengesetzter Richtung – nach Wedding. Beiderseits fing nach ein paar Stationen der Orient an, Kopftuchfrauen und Shishabars, Erdoğan-Wähler, Clankriminelle. Wolliner Straße. Dekorativ verklinkerte Nachwendehäuser, letzte Brachen, Biomärkte, Flohmarktgelände. Die Bahn fuhr stockend, musste sich bis zur nächsten Ampel ihre Spur mit den Autos teilen. Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Die Türen öffneten, die Türen schlossen sich, Ausstiege, Einstiege. Auf dieser Strecke waren nur neue Züge unterwegs, breiter und tiefer, weniger rappelig als die Vorgängermodelle, angenehmere Sitzabstände, außerdem gut klimatisiert. Seit die Erderwärmung im Sommer die Temperaturen zu immer neuen Höchstwerten trieb, spielte auch das eine Rolle. Vor dem evangelischen Altenheim waren Leute in Rollstühlen abgestellt, damit sie rauchen, frische Luft schnappen konnten. Eberswalder Straße.
Er war nicht ausgerastet, weder hatte er den stinkenden Trinker angeschrien, dessen Maske unterhalb des Kinns hing, noch den Hipster-bärtigen Araber oder Türken, der breitbeinig zwei Plätze in Anspruch nahm und alle mit seinem dudelnden Handy terrorisierte, mit dem Kopf gegen die Scheibe geschlagen, bis Blut und Gehirn ausliefen. Es waren immer nur Bilder, das Synapsenkino im Kopf, Gewaltfantasien, Metzelvisionen. Im wirklichen Leben, ganz gleich, ob sich jemand an der Supermarktkasse an ihm vorbeidrängte, ihn beleidigte, weil er seinen Hund ohne Leine auf dem Bürgersteig laufen ließ, hatte er Mühe, sich zu wehren, auf seinem Recht zu beharren. Er war schwach auf die Welt gekommen, zu kraftlos, um irgendetwas entschlossen zu tun, rutschte von dieser Entscheidung in jene, ohne zu wissen, wie man eine zurücknahm, die sich als falsch herausgestellt hatte.
Husemannstraße. Rechts das Paparazzi, der einzige Italiener im Osten der Stadt, den es schon zu DDR-Zeiten gegeben hatte, vietnamesische Restaurants, Outdoorläden, Burgerbratereien; seit die Polizei den Druck auf die libanesischen Clans in deren Kerngebieten erhöhte, eröffneten sie eben hier ihre Barbershops, Shishabars, Sportwettenläden.
In zwanzig Minuten war er zu Hause, bei der Frau, mit der er sein Leben teilte, Mutter seiner Tochter, Miteigentümerin des Labradorrüden »Tibor«. Siebenstädter freute sich nicht, freute sich überhaupt nur noch selten. Er hatte Irene geheiratet, weil sie schwanger gewesen war, nachdem er sich dazu hatte hinreißen lassen, mit ihr zu schlafen, obwohl er innerlich längst fort war, aber die Worte nicht fand, mit denen man eine Liebe beendete: Es ist aus. Er hatte ein Kind gezeugt, versehentlich, es war eben passiert, wie alles irgendwie passierte. Dort wo er herkam, übernahm man die Verantwortung für die Schwachheit des Fleisches. So hatten die Landpfarrer dergleichen Vergehen in ihren Sonntagspredigten noch genannt, als die Gleichaltrigen in Köln, Hamburg, Berlin sich längst ohne Hemmungen vom Establishment frei vögelten. Weder ließ man Kinder wegmachen, noch verabschiedete man sich mit: Es tut mir leid, es war nicht persönlich gemeint, dein Bauch, dein Kind, deine Sache. Schon damals hätte er schreien, schlagen, töten wollen, ohne zu wissen, wen. Stattdessen hatte er ordnungsgemäß zu spät einen Antrag gemacht, bei der Mutter seiner vor der Zeit fruchtbar gewordenen Braut, denn der Vater, der dort, in der rheinischen Provinz, noch immer symbolisch die Hand seiner Tochter vergab, war tot. Irenes Mutter, vorzeitig gealtert, hatte die Stirn gerunzelt, »Drei-Monats-Kind« gemurmelt, »Wie gut, dass der Papa es nicht mehr erfährt« und zum Schluss: »Besser, als wenn sie es allein aufziehen muss.« Und wenn sie nicht gestorben sind, bis dass der Tod euch scheidet, lachenden Munds. Frau Schilling, die Tontechnikerin, mit der er damals am liebsten gearbeitet hatte, befand, als er mit der Nachricht ins Studio kam: »Sie sehen nicht aus, als wären Sie glücklich.« »Zu spät«, hatte er gedacht, »Ja und wenn schon«, hatte er gedacht, aber gesagt hatte er: »Das täuscht, Frau Schilling, Irene ist eine wunderbare Frau, mit der ich mir jetzt eine bürgerliche Existenz aufbaue, wie ich es immer wollte: Kinder, ein Haus mit Garten, gemeinsamer Urlaub am Meer – man kann ja nicht ewig in Provisorien leben.«
»Du bist jetzt ein verheirateter Mann«, hatte sein Vater am Abend der Hochzeit gesagt, ihm die Hand auf die Schulter gelegt, erstmals beinahe von gleich zu gleich, und: »Die Hörner hast du dir ja lange genug abgestoßen.«
»Ich bin ein verheirateter Mann«, sprach Siebenstädter sich selbst noch immer gelegentlich vor und erkannte den Menschen nicht, der vor dem Badspiegel stand und diesen ganz und gar falschen, gleichwohl der Faktenlage entsprechenden Satz formulierte. Die »Ja«-Wörter, erst vor dem Standesbeamten, dann vor dem Pfarrer, vor Zeugen, Verwandten, Freunden, Kollegen hatten seinen Aggregatzustand verändert, zwei Buchstaben hatten gereicht, um die künstlich verlängerte Jugend ein für alle Mal enden zu lassen. Seitdem gehörte er zu den Erwachsenen, zu denen, die wussten, wie man mit Autohändlern verhandelte, dem Fliesenleger erklärte, was er zu tun hatte, ein Kreditgespräch führte, daran änderte auch der Drei-Tage-Bart nichts, das letzte Zeichen seiner ewigen Jugend.
Ganz gleich, wie oft er sich klarzumachen versuchte, dass diese Kleinbürgervorstellungen, die er vor fünfundzwanzig Jahren aus der Provinz in die Hauptstadt mitgebracht hatte, ganz und gar vorgestrig waren, dass kein vernünftiger Mensch heutzutage einen Goldring am rechten Ringfinger zu einer Sache auf Leben und Tod aufblies, es drang nicht durch zu dem Punkt, an dem sich der Knoten gelöst hätte, und ein Schwert, um ihn mit einem verächtlichen Hieb durchzuhauen, stand nicht zur Verfügung, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld: Sie war unauslöschlich eingebrannt, seine Sündhaftigkeit, Verworfenheit, Niedertracht, ein suppendes Wundmal, das nicht abheilte, immer neu aufbrach, eiterte, stank. Selbst wenn es ihm gelungen wäre, sich an alle Regeln von Sitte, Anstand, Moral zu halten, hätte es nichts geändert.
Bevor Siebenstädter nach der Hochzeit zum ersten Mal wieder in den Sender gegangen war, hatte er bei einem angesagten Herrenausstatter Anzüge gekauft, drei Stück, dazu weiße und hellblaue Hemden, beste Baumwolle, easy iron, rahmengenähte Schuhe, Crockett & Jones, Full-Brogue Oxfords in Schwarz und in Braun, das Paar zu sechshundert Euro. Seit mehr als dreizehn Jahren verließ er jetzt morgens um vier, gekleidet wie einer, der sich auskannte, souverän, weltläufig, erst die Wohnung, inzwischen sein Haus. Die Verkäuferinnen im Backshop, Bahnhof Friedrichstraße, behandelten ihn mit Respekt, wenn er seine Croissants bezahlte, den Betrag möglichst passend mit der Hand, an der sein Goldring glänzte, auf den Verkaufstresen legte: Kurt Siebenstädter – ein verheirateter Mann. Wenn eine hübsch war, ihm einen vielversprechenden Blick zuwarf, stellte er sich vor, wie es wäre, eine schmutzige kleine Affäre mit ihr zu haben, ein oder zwei Mal pro Woche ein verkommener Fick im Albrechtshof, dem spießigsten Hotel weit und breit, denn natürlich kannte er sich mit nichts aus, verdiente er keinerlei Respekt, mit zwanzig so wenig wie mit dreißig und jetzt mit einundfünfzig immer noch nicht. Dass er ein verheirateter Mann war, änderte nichts an dem fahlen Hunger nach verbotener Haut, fremdem Fleisch, dem er nachgab, wenn sich die Gelegenheit ergab. Einstweilen bin ich nicht für Treue, sondern für gute Regie. Er kaufte die Insignien des guten Geschmacks, imitierte die Manieren der besseren Kreise und verriet doch in jeder Geste seine Kleinbürgerherkunft. Was auch immer er anstellte, er blieb ein Hochstapler, Falschspieler, der mit geschliffenen Formulierungen den Eindruck erweckte, hinter das Gerede, Geschwafel, Gelaber der anderen zu schauen, einer, der mit Hilfe seiner begrenzten Spezialintelligenz Phrasen sezierte, Worthülsen zum Platzen brachte. Die eine Hälfte der Hörer liebte ihn dafür, dass er es denen da oben allmorgendlich zeigte, die anderen hassten ihn, weil er keinen Respekt hatte, vor niemandem, ganz gleich, ob einer sich Minister, Kardinal oder Verbandspräsident schimpfte. Dabei hatte er lediglich einen mittelmäßigen Abschluss in Politikwissenschaft, der zu keinerlei Hoffnungen berechtigt hätte, wäre er nicht mit der Gabe der Rede zur Welt gekommen – einem Talent, das einem, wenn das Schicksal es wollte, seit den Tagen der alten Griechen fast jede Karriere eröffnete. Er hatte Glück gehabt, zwei oder drei Mal zur richtigen Zeit die richtigen Leute getroffen, die passende Mischung aus Scharfzüngigkeit und verkappter Anbiederung gezeigt. »Herr Siebenstädter, jemand wie Sie, das ist genau, was wir brauchen im Magazin am Morgen: Einer, der sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, egal wer am anderen Ende der Leitung hockt, schließlich trägt er doch auch bloß zerknitterte Boxershorts unter seinem Brioni.« Sonst stünde er jetzt neben dem Kaufhof, würde unter den verächtlichen Blicken veganer Gymnasiastinnen, dem Gelächter gelackter BWL-Studenten den letzten verbliebenen Hausfrauen in Mainz oder Kaiserslautern rasiermesserscharfe Gurkenhobel aus bestem Solinger Stahl anpreisen, Pfannen mit Weltraumbeschichtung, würde auf den Weihnachtsfeiern rheinhessischer Mittelständler die Erfolgsbilanz des zurückliegenden Jahres aufsagen, als wären es Nikolaus-Gedichte, dem abgehalfterten Schlagersänger und Stargast des Abends einen donnernden Applaus aus dem Publikum leiern.
So weit war es nicht gekommen, er galt als kompetent und unerbittlich, seine Fragen waren gnadenlos. Regelmäßig kamen Beschwerden von Abgeordneten, Parteivorsitzenden, Mandatsträgern, Kommentarschreibern. Die einen beschuldigten ihn, ein verkappter Rechter zu sein, die Nächsten hielten ihn für linksextrem, er galt als Kapitalismuskritiker, Kirchenfeind, Islamhasser, Frauenverächter – alle hatten recht und unrecht. In Wahrheit glaubte er nichts und letztlich nicht einmal das. Was nach seiner Überzeugung aussah, hielt gerade so lange, wie der Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung mit albernen Mätzchen versuchte, ihm, stellvertretend für Parteigänger und Gegner, Gläubige und Ungläubige, rhetorische Pirouetten als politische Agenda zu verkaufen. An guten Tagen redete er sich ein, dass er die Stimme des Volkes sei, mit der es seine Vertreter befragte, weshalb er das Recht hatte zu erfahren, wie der Gesundheitsminister dafür sorgen wollte, dass der in Deutschland entwickelte Impfstoff den deutschen Steuerzahlern als Erstes gespritzt wurde; warum das europäische Parlament den Polen, den Ungarn nicht endlich den Geldhahn zudrehte, wenn man sich dort weder an die Prinzipien des Rechtsstaats hielt, noch die Presse- und Meinungsfreiheit respektierte; weshalb der Prozess gegen den deutschen ISIS-Chef, Abu Walaa, 9,3 Millionen kosten durfte, statt dass der Innenminister einfach ein Flugzeug charterte, ihn in Bagdad absetzte, wo die Gefängnisse ungemütlich waren, die Ermittler Techniken für ergebnisorientierte Verhöre beherrschten, die Urteile zügig vollstreckt wurden.
Es klang wichtig, wenn er den Mund aufmachte, unnachgiebig und unbestechlich, doch in Wirklichkeit bedeutete es nichts, war das Fragespiel längst zum sinnfreien Ritual verkommen, Demokratietheater, um den Schein zu wahren, dass es ein Volk gab, das seine Vertreter wählte, und dass es Vertreter gab, die sich den Interessen des Volkes verpflichtet fühlten. Seine Darbietung als Radiotribun war überzeugend, er merkte es daran, dass die Interviewpartner am Mikrofon auf der gegenüberliegenden Seite des Tischs oder am anderen Ende der Leitung nach wie vor auf seine Fragen hin stockten, sich Blößen gaben, aus der Rolle fielen. Es gelang ihm noch immer, sie ungerührt ins offene Messer laufen zu lassen. Trotzdem waren die hohen Damen und Herren jedweder Parteizugehörigkeit gekränkt, wenn er sie nicht einlud, sich morgens um fünf von ihm bloßstellen, demütigen, zum Hanswurst machen zu lassen. Wie jeder gute Schauspieler glaubte er das, was er spielte, so lange, wie die Vorstellung dauerte, und wusste doch, dass er in Wirklichkeit nichts anderes war als die systemimmanente Simulation einer kritischen Stimme, um die Verhältnisse zu stabilisieren.
Laber Rhabarber … An dieser Stimme hatte Irene ihn erkannt, vor fünfzehn Jahren, auf dem 40. Geburtstag des Hauptstadtkorrespondenten der Rheinpfalz, Bernd Breker, dessen damalige Freundin – inzwischen schon wieder geschiedene Frau – ihre beste Freundin gewesen war. Sie kannten sich aus der Schule, waren zusammen das dekorative Element der Versammlung gewesen, die ansonsten zu vier Fünfteln aus Herren mittleren Alters bestanden hatte. Er war mit Brennecke vom Berlinspiegel über irgendetwas im Gespräch gewesen, hatte plötzlich ihre Augen gesehen, die an seinen Lippen hingen, als wären die Bewegungen seines Mundes ein Naturschauspiel, schön und unwiderstehlich. Ungläubiges Staunen hatte in ihrem Blick gelegen, sich mit Erkennen, Bewunderung, Zweifel abgewechselt. Natürlich fühlte er sich geschmeichelt, dass er ihr gefiel, stellte sich gerader, aufrechter hin, machte die Schultern breiter, und für kurze Zeit war die als Zynismus getarnte Verachtung, die er sich selbst gegenüber empfand, von ihm abgefallen.
Befeuert von ihrem Leuchten und dem erstklassigen Rotwein hatte er immer brillantere Gedankengänge immer glänzender formuliert, war emporgehoben worden von der Möglichkeit, eine schöne, deutlich jüngere Frau, die einzige weit und breit, die zu haben war, durch den Klang seiner Stimme, die Macht seiner Worte erst in seinen Bann und dann in sein Bett zu ziehen. Während er redete und trank, trank und redete, sich zu immer kühneren Thesen aufschwang, trafen sich ihre Blicke immer öfter, hielten sich gegenseitig fest, Brennecke wurde zur leeren Fläche, die nur dazu diente, ihm die eigenen Bälle für einen noch brillanteren Schlag vor die Füße zu spielen. Um seine Mundwinkel kräuselte sich ein Lächeln, vieldeutig, ironisch, galt ausschließlich ihr, denn die Nacht war lang und voller Versprechungen. Während er sich darüber ausließ, dass bei VW derselbe Vorstand, der im Auftrag des Kanzlers die Sozialhilfe abschaffte, Puffbesuche mit Geschäftspartnern als Spesen verbucht hatte, stellte er sich die Form ihrer Brüste vor, die Gestalt der Warzen, klein und mit dunklem Vorhof, malte sich die Festigkeit ihrer Schenkel aus, wie ihr Apfelarsch in seiner Hand lag. Schließlich, als könnte sie hinter seine Stirn blicken, seine Gedanken lesen, trat sie den letzten Schritt auf ihn zu, unterbrach Brennecke, der stolz und eine Spur zu laut erklärte, dass er es abgelehnt hatte, ein Exklusivinterview mit einer dieser Volkswagenvorstandsnutten zu drucken, »Entschuldigung, ich muss jetzt doch mal fragen: Kann es sein, dass ich Sie aus dem Radio kenne – das Magazin am Morgen?« »Wir siezen uns hier doch nicht«, hatte er gesagt und sich umgeschaut, wer sonst von den Kollegen, Parteiführern in der Nähe war, gesehen, gehört hatte, dass die jüngste und schönste Frau im Raum, vielversprechend in jeder Hinsicht, ihn an der Stimme erkannt hatte. Es war nicht das erste Mal, dass ihm so etwas passierte, aber jetzt stand er unter Kollegen, Konkurrenten, den Großschreiberlingen, deren Meinungen die Geschicke des Landes bestimmten, doch es war nicht die Brillanz ihrer Analysen, der Scharfsinn ihrer Prognosen, sondern seine Stimme, die den entscheidenden Faktor für den heutigen Ausgang des Paarungsspiels gab. Es würde sein Renommee unter den Korrespondenten, Redakteuren, Parteisprechern der Hauptstadt beträchtlich erhöhen, denn, ganz gleich was wer-weiß-wo behauptet wurde, natürlich ging es immer um Frauen – die Frauen kürten den Platzhirsch. »Irene«, stellte sie sich vor, und er erschrak einen Sekundenbruchteil, als er den Namen hörte – eine heilige Witwe aus spätrömischer Zeit, mildtätig, bescheiden, fromm. Die bigotte Schwester seines Vaters war nach ihr benannt worden. Gern hätte er eine Jeanne, eine Catherine oder eine Juliette mit nach Hause genommen, zumal sie aussah wie eine Französin, Sophie Marceau mit der Frisur von Mireille Mathieu, »La Boum« und der »Spatz von Paris«. Sie wirkte ähnlich kokett, ein bisschen naiv und auf nachlässige Art elegant – wie er es einer Frau namens »Irene« keinesfalls zugetraut hätte. Gemeinsam bewegten sie sich in eine ruhigere Ecke, um ungestört zu reden. Er war witzig, charmant, weder hochtrabend noch anzüglich, sorgte dafür, dass sie immer genug zu trinken bekam, interessierte sich für sie, hörte ihr aufmerksam zu, denn auch das hatte er gelernt: Wenn es sachdienlich war, die Klappe zu halten, das Gefühl zu vermitteln, die, mit der er sprach, sei das Zentrum der Welt. Und Irene wollte erzählen, ihm, dem bekannten Radiomann, dessen Stimme etwas in ihr in Schwingung versetzte, dessen boshafter Witz sie zum Lachen brachte. Er wunderte sich, wie viel sie von ihm wusste, wo er doch nie über sich sprach, doch er verriet sich in jeder Frage, jeder Hebung und Senkung seiner Stimme. Aus der Art, wie er seine Sätze modellierte, mit diesem Schuss Dunkelheit, der sich halb seinem Timbre, halb der Düsternis in den unteren Seelenlagen verdankte, hatte sie über Monate, Jahre ihre Schlüsse gezogen. Und jetzt befragte er sie, mit dieser berühmten Stimme, auf eine Weise, wie er sonst nie Leute fragte: Wo sie herkam, wohin sie wollte, wer sie war? Die Art, wie sie ihn anschaute, gestikulierte, die Hüfte vorschob, ihm das Allerpersönlichste anvertraute, ließ keinen Zweifel daran, dass sie wahrgenommen werden wollte und zwar von ihm, dass sie ihn wollte, als die, die sie war.
Prenzlauer Allee/Danziger Straße. Vietnamesische Schneider, der klassische Grieche, Gyros, Tsatsiki und Pommes, ein experimenteller Wohneigentumskomplex, Kaninchenställe für Besserverdiener, dahinter öffnete sich die Häuserzeile zur Grünanlage, ein paar ältere Bäume, Sträucher, jetzt herbstlich kahl, Wiesen und Hundespaziergänger. Aus den Augenwinkeln erkannte er den Besitzer einer gefleckten Dogge, den er regelmäßig im Volkspark Prenzlauer Berg traf. Dort grüßten sie sich, ohne mehr voneinander zu wissen, als dass sie beide bei schlechtem Wetter Jacken von Burberry’s trugen und also nicht arm waren. Auf der Plakatwand Asia Chicken vom Lieferdienst, die Bundeswehr als Selbstfindungsgruppe, niemand spielte auf der Hockeyanlage, Winsstraße, das Theater unterm Dach, dahinter drei Wohnmaschinen mit Spielstätte: das letzte städtebauliche Renommierprojekt der untergegangenen DDR. Greifswalder Straße/Danziger Straße.
Irenes Vater war Finanzbeamter gewesen, Vollstreckungsstelle, gehobener Dienst, katholisch, pflichtversessen, im Besitz der Wahrheit, Verkörperung der göttlichen Gerechtigkeit, wenn es darum ging, wer Aufschub verdiente, wer gepfändet wurde, bis er selbst aufgrund von Vorteilsnahme im Amt, Unterschlagung, Bestechlichkeit – angeblich wusste niemand, nicht einmal Irenes Mutter, was wirklich passiert war – aus heiterem Himmel vom Dienst suspendiert wurde. Die Untersuchungen zogen sich hin, interne Prüfungen, Verhöre durch Sonderermittler, Einleitung eines Disziplinarverfahrens, und dann die Nacht, als Irene von ihrer Mutter geweckt wurde, der Vater habe sich erhängt, in einem Waldstück oberhalb des Rheins, mit einer Wäscheleine. Die Nachricht hatte Irenes Jugend im Alter von siebzehn Jahren auf einen Schlag abgebrochen. Von heute auf morgen war sie nicht mehr jung, aber doch auch nicht erwachsen, unreif vom Baum gefallen, eine nutzlose Frucht. Dass ihr Vater, bis zu diesem Tag bewunderter und gefürchteter Hüter des in den höchsten Himmel reichenden Gesetzes, nicht nur gegen die heilige Ordnung des Staates verstoßen, sondern sein Leben einfach weggeworfen, keine Liebe für niemanden mehr empfunden hatte, nicht einmal für sein schönes Kind, war ein Schock gewesen, der Irene auch jetzt, sieben Jahre später auf einer ausgelassenen Party im Zentrum der Hauptstadt, noch die Tränen in die Augen trieb. Als ihr dann auf dem Schulhof, im Bus, im Supermarkt statt Trost oder Anteilnahme Hohn und Gehässigkeiten zugeraunt oder nachgebrüllt wurden, waren Irenes Lebensträume, die sie über siebzehn Jahre den Idealen der Eltern nachgeformt hatte, schlagartig in sich zusammengefallen: Dann eben nicht, dann weg von hier, raus aus diesem Kaff, wo alles Lüge, Hohlform, Fassade war. Ihre naive Hoffnung auf die große Liebe, die sie nach Antritt der ersten Studienratsstelle in die ruhigen Bahnen einer Lehrerehe geführt hätte, schlug um in Gier, wurde das Verlangen, sich wegzuwerfen für nichts, alles in jedem Augenblick zu verlieren. Er sah den unbändigen Willen, sich in Lust und Schmerz zu stürzen, während sie immer häufiger die allgemein akzeptierte Minimaldistanz zwischen Erwachsenen unterschritt, ihm die Hand auf den Arm legte, sich an seine Schulter lehnte, ihn mit ihren Blicken aufsaugte, bis er sich selber verschwamm.
Später, als sie zusammen im Taxi saßen, es vor ihrer Haustür halten ließen, sich verabschieden wollten, nicht verabschieden wollten, waren ihre Lippen von seiner Wange auf seinen Mund gerutscht, ihre Zunge hatte seine Zähne auseinandergeschoben, sich den Weg gebahnt, und als der Fahrer sich räusperte, zog sie ihn mit festem Griff an der Hand aus dem Wagen. Er erinnerte sich nicht, wie sie es die Treppe hinauf in ihr WG-Zimmer geschafft hatten, bis sie im Bett landeten, schon ohne Schuhe, Socken und Hosen.
Arnswalder Platz, der Blick auf die aufgepumpten Art-déco-Löwen aus rotem Sandstein, daneben einer dieser grässlichen Spielplätze, auf denen er sechs oder sieben Jahre lang nachmittags seine Zeit totgeschlagen hatte, sinnlose Streitereien mit besseren Müttern und Vätern, als er einer war, über Schaukelreihenfolgen, geliehene Förmchen, Ernährungsfragen ertragen hatte.
Natürlich war er davon ausgegangen, dass Irene die Pille nahm oder irgendein anderes Verhütungsmittel, sie fragte nicht nach einem Kondom, offensichtlich hatte sie auch keins in ihrer Nachttischschublade für genau diese Fälle, die sicher häufiger vorkamen. Erst am anderen Tag, als es schon auf den Nachmittag zuging und er sich, noch immer berauscht, hingerissen von ihrer Haut, ihrem Duft, erneut in sie hineinschob, murmelte sie: »Vielleicht sollten wir doch etwas vorsichtiger sein.«
Irene hatte nie genug bekommen während des ersten Jahres, als sie sich noch darüber einig waren, eine Affäre zu haben, nicht mehr, Siebenstädter, der umstrittene Moderator, Irene, dreizehn Jahre jünger, Referendarin mit den Fächern Deutsch und Geschichte, Aussichten auf eine Beamtenstelle. Ihre Arbeitszeiten vertrugen sich gut, er, seine Stimme, war das Aushängeschild der Frühsendung, auch wenn er sich mit Reisiger abwechselte, ansonsten Arbeit am Schreibtisch, Vorbereitung, Nachbereitung, Zeitungslektüre, Organisatorisches, Absprachen mit den Gesprächspartnern der kommenden Tage, Redaktionskonferenzen. Am frühen Nachmittag fuhr er nach Hause. Auch sie hatte meist gegen drei oder vier Schluss, arbeitete dann an Stundenkonzepten, bereitete Stoffe didaktisch auf.
Wann immer er zu ihr kam oder sie zu ihm in seine DDR-Bonzen-Wohnung am Strausberger Platz mit Blick auf den Brunnen, Margot Honeckers »Brosche« und die Riesenfontäne, waren sie übereinander hergefallen, hatten ganze Tage im Bett verbracht, immer wieder von vorn begonnen, zwischendurch Pizza bestellt, unten im Noi Quattro Trüffelnudeln und Seezungen gegessen oder Wiener Schnitzel im Borchardt. Irene liebte das Borchardt, weil sie dort immer Leute aus Film und Fernsehen erkannte, ihm war es ein Gräuel. Zu keiner Tages- oder Nachtzeit konnte er dort sitzen, ohne auf Bekannte aus Parteien, Redaktionen, Lobbyverbänden zu treffen, mit denen er ein Nicken, einen Spruch, Nettigkeiten, vielleicht den Bruchteil einer Information tauschen musste. Trotzdem ließ er sich breitschlagen, weil er Irenes Begeisterung mochte, ihren Hunger nach mehr, den unbedingten Willen, sich ins Leben zu stürzen, denn das Leben war kurz. Anschließend schleppte sie ihn in angesagte Clubs, das Cookies, das Berghain, das WMF, kannte sämtliche Türsteher, traf überall Freunde. Manchmal ging er direkt von dort in den Sender. Frau Schilling runzelte die Stirn, wenn er rot und grau zur Tür hereinstolperte. »Sie lassen es ja noch mal ganz schön krachen«, sagte sie. Siebenstädter nahm es als Kompliment, fühlte sich jung, obwohl er alt war, zu alt. Irene störte sich nicht daran, im Gegenteil, sie war stolz, mit ihm gesehen zu werden, selbst wenn ihm der Schweiß in Strömen lief, seine Gesichtshaut fleckig, seine Hemden triefnass waren. Oft trafen sie noch wildere Freundinnen, zogen Amphetamine oder Koks durch die Nase, dann wollte Irene, dass er sie auf dem Nachhauseweg in einer dunklen Ecke des Parks nahm, hart und schnell. Alles stand noch einmal auf Anfang, auch wenn seine Prostata schmerzte, mit der Sekretproduktion nicht mehr nachkam, es plötzlich in seiner Brust stach, als würde sein Herz aussetzen. Es gab Tage, da kam er so erschöpft und leer in den Sender, dass Frau Schilling Sorge hatte, er sei ernstlich krank, während Fettkötter von der FDP im Hintergrundgespräch grinste: »Immer noch die falsche Französin von Brekers Geburtstag im Bett?«
Wenn Irene erschöpft war oder er nicht mehr konnte, redete sie, ein ununterbrochener Strom von Worten sprudelte aus ihr heraus, endlose Geschichten von ihrer Familie, von früheren Professoren, Mitstudenten, Freundinnen, Co-Referendaren, grässlichen und genialen Lehrern, dummen und klugen, netten und aufsässigen Schülern. Eigentlich hätte er längst alle kennen müssen, mit denen sie jemals in ihrem Leben zu tun gehabt hatte, doch er vergaß die Namen, sowie sie ihr über die Lippen gingen, verwechselte den untreuen Ehemann der Westerwälder Tante mit dem schmierigen Cousin aus dem Hunsrück, der sich als Alkoholiker entpuppte, hoffte inständig, dass der Kelch an ihm vorüberging, all diesen Leuten vorgestellt zu werden, für die er der Hauptstädter, der Journalist, der Pressefuzziaus dem Radio wäre, bewunderter, beneideter, verachteter B-Promi, der mit den Berühmtheiten des Landes sprach, die Geheimnisse unter den glitzernden Oberflächen von Politik und Showbiz kannte.