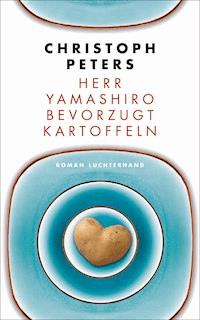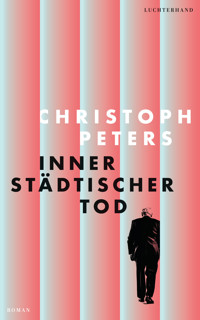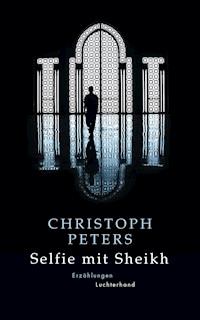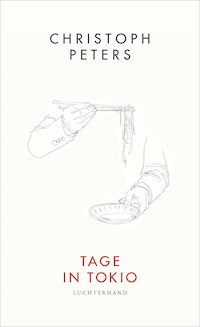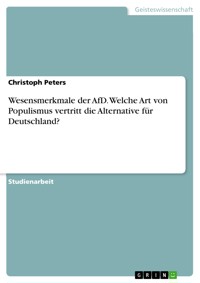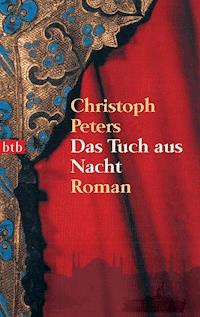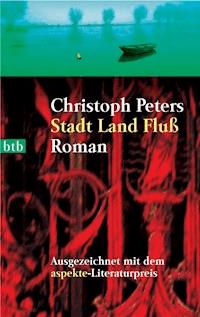7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schon seit jungen Jahren sieht Sven Hofestedt aus, als führe er Sportwagen und schliefe mit reichen Erbinnen. Aber obwohl er gerne den abgeklärten Finanzjongleur gibt, gilt sein eigentliches Interesse etwas ganz anderem: Japan und der Philosophie des Zen. Die Irrungen und Wirrungen der Liebe, die Faszination durch fremde Kulturen oder die Suche nach spiritueller Erkenntnis und Wahrheit – in dreizehn ungewöhnlichen Geschichten zeigt Peters, dass er nicht nur ein großer Romancier ist, sondern auch ein Meister der kurzen Form.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Sie sind Photographen, Schüler, Studenten, Zeichner, Webdesigner, Mafiakuriere, Finanzjongleure. Sie sind vielleicht manchmal Träumer oder Eigenbrötler, aber sie kommen zurecht. Bis unverhofft etwas Verstörendes geschieht, das sie in einen Abgrund der Verwirrung stürzt. Mal sind es bizarre Ereignisse, mal sind es nur die Liebe und die Leidenschaft, die ihnen jegliche Orientierung rauben und ihnen neue Räume und Wirklichkeiten eröffnen. Aber gleichgültig, ob sie die Herausforderungen des Unbekannten als bedrohlich empfinden oder als zutiefst verlockend, eines ist gewiß: Eine einfache Rückkehr in die Ordnung der Dinge kann es danach nicht mehr geben.
In dreizehn ungewöhnlichen Geschichten zeigt Peters, daß er nicht nur ein großer Romancier ist, sondern auch ein Meister der kurzen Form, daß er das Komische ebenso beherrscht wie das Ernste, das Leichte ebenso wie das Schwere, das Phantastische ebenso wie das Alltägliche.
CHRISTOPH PETERS wurde 1966 in Kalkar (Niederrhein) geboren und lebt heute in Berlin. Für seine Erzählungen und Romane wurde er vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem aspekte-Literaturpreis und dem Rheingau-Literaturpreis.
Christoph Peters
Sven Hofestedt sucht Geld für Erleuchtung
Geschichten
btb
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2010 by Luchterhand Literaturverlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile München, nach einem
Coverentwurf von R·M·E, Roland Eschlbeck
Covermotiv: © Image Source / Corbis
Satz: Greiner & Reichel, Köln
MM · Herstellung: BB
ISBN 978-3-641-11188-5V002
www.btb-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Für den besten Peter
Lichtverhältnisse am Berg
Das schmucklose Holzkreuz im Osten markierte eine Kuppe, die vom Tal aus ein Gipfel war.
Färber befand sich auf 3000 Meter Höhe, ohne einen Schritt gestiegen zu sein. Unten hatte es genieselt, aber der Monitor in der Talstation, der das Standbild einer Videokamera auf dem Joch zeigte, hatte ihn bereits vermuten lassen, daß er sich hier in einem Streifen zwischen zwei Wolkenfeldern befinden würde.
Am Schalter war keine Schlange gewesen, vor ihm lediglich ein älteres Ehepaar mit Skiern. Trotzdem hatte ihn die Frau an der Kasse nicht als Person wahrgenommen. Ihre Augen waren den Bewegungen der eigenen Hände gefolgt – beim Eingeben des Tarifs, beim Geldzählen, als sie das Ticket durch den Schlitz schob: Kein einziges Mal hatte ihr Blick den seinen gekreuzt.
Er stand an der niedrigen Mauer, die das Gebäude der Station und den Gletscher voneinander trennte. Scharfe Böen schnitten ihm ins Gesicht. Vor ihm lag ein erst sanft, dann steiler ansteigender Eishang, der beinahe ganzjährig als Piste genutzt wurde. Ein Schlepplift zog einzelne Skifahrer in den Nebel hinauf. Jetzt, Mitte November, herrschte kaum Betrieb. Auf der anderen Seite, Richtung Tal, schwebten blaue Sesselschalen aus dem Dunst und in ihn zurück, geleitet von farbigen Stangen in orangefarbenen Quadern, die dort lagen wie das Spielzeug außerirdischer Riesenkinder.
Färber schaute durch seine Nikon D3, sie war groß und schwer, 12,5 Megapixel, die beste, die zur Zeit gebaut wurde. Das Objektiv surrte – kurze, abrupt endende Visiergeräusche, denen kein Photo folgte. Er ließ die Kamera sinken, zog den rechten Handschuh aus, stopfte ihn in die Jackentasche, schaute erneut durch den Sucher. Endlich drückte er den Auslöser, immer noch halbherzig, setzte ab, prüfte das Bild auf dem Display, anschließend die Histogrammkurven, damit er tatsächlich wußte, wie das Licht sich auswirken würde, insbesondere im extrem hellen und im ganz dunklen Bereich. Das Display selbst war zu klein, als daß er allein anhand der Darstellung hätte erkennen können, was später auf dem Studiobildschirm oder im Ausdruck zu sehen sein würde.
Nicht weit entfernt glitt das Ehepaar, das vor ihm an der Kasse gestanden hatte, langsam zurück Richtung Lift. Er erkannte die Frau an ihrer grellgelben Skibrille mit dem leuchtend violetten Sichtfeld, neben der ihre gebräunte Wangenhaut wie antikisiertes Leder wirkte.
Vieles konnte mißlingen. Vor allem durfte es keine toten Bereiche geben, keine Fehlstellen oder undifferenziert körnigen Flächen. Für Bedingungen, wie sie hier herrschten, fehlten ihm Erfahrungswerte. Er hatte nie mitten im Schnee gearbeitet, umgeben von reinem Weiß, das einen früher oder später blind machte. Wenn er länger hinschaute, flimmerten winzige Punkte in allen Farben des Spektrums. Dann wieder schlug die Helligkeit ins Negativ um, oder es schoben sich phosphoreszierende Flecken durchs innere Auge wie Wanderlöcher in brennendem Papier. Er erinnerte sich an Kindheitswinter, an Schlittenrennen, schmerzende Kälte im Gesicht, Sekundenbruchteile totalen Orientierungsverlustes, während er sich überschlagen hatte.
Daß er jetzt hier stand, hatte nichts mit alten Empfindungen zu tun. Er wollte keine Erinnerungen ausgraben: weder Sentimentalität noch Bewältigung.
Nicht nur der Schnee, auch die Wolkendecke war weiß, eine Nuance dunkler, aber weit entfernt von Grau. Unmittelbar über ihm hatte sie eine andere Beschaffenheit als der Schnee zu seinen Füßen. Weiter oben, in einer für das Auge nicht abschätzbaren Entfernung, löste sich die Grenze auf. Kein Unterschied zwischen festem Boden und nasser Luft.
Er stellte sich vor hineinzufallen – nicht in das, was dort war, sondern in das, was seine Augen ihm vorgaukelten: schwerelosen Raum aus Licht. Die Wolken verteilten es gleichmäßig. Nichts und niemand warf Schatten. Der Schnee reflektierte die Helligkeit ohne erkennbaren Intensitätsverlust. Ein Hin und Her wie zwischen zwei Spiegeln, nur daß nicht die Gestalt eines vierzigjährigen Mannes mit Kamera ins Unendliche wiederholt wurde – kein »Ich«. Statt dessen Leere, Formlosigkeit.
Er schaltete auf Unterbelichtung, löste aus, kontrollierte erneut, schüttelte den Kopf.
Was unter diesen Bedingungen funktionierte oder nicht funktionierte, würde er erst zu Hause feststellen. Sein Studio lag zweieinhalb Autostunden von hier entfernt. Um diese Jahreszeit konnte die Fahrt doppelt so lange dauern. Schon deshalb mußte er alles tun, damit sich das, was er mitbrachte, als Arbeitsgrundlage verwenden ließ.
Färber wußte nicht, wie die Bilder am Ende aussehen sollten. Es gab keine Botschaft, die irgendein Werbekunde mit ihnen transportieren wollte, es gab gar keinen Auftrag, nur etwas in seinem Innern. Er hätte es nicht »Vision« genannt, obwohl das Wort sogar passend gewesen wäre: Er hatte etwas gesehen, das es nirgends zu sehen gab, und von dem er weder wußte, wie es sich herstellen ließ, noch was seine konkrete Gestalt war. Etwas wie den Kern einer Sichtweise, die er mittels Versuch und Irrtum am Rechner herausfiltern würde.
Was die Bilder auf keinen Fall vermitteln durften, wußte er hingegen genau: weder Wintersportsgeist noch Après-Ski-Laune, kein Bergsteigerpathos, kein Naturidyll, keine alpine Volkstümelei.
Er probierte jetzt Überbelichtungen, um aus den Durchschnittswerten herauszukommen, die der Apparat wählte. Fehlbelichtungen ließen später verschiedene Korrekturmöglichkeiten zu, wenn in den Dunkelheiten jedoch überhaupt keine Daten waren, konnte er auch nichts verstärken. In unmittelbarer Nachbarschaft des Schnees sah das Programm die Felsformationen als reines Schwarz. Tatsächlich bildete der Fels aber komplexe Linienstrukturen, ein Geschiebe aus schweren Farben und Grauschattierungen. Das aufgeworfene, zerborstene, in sich verkeilte Gestein bezeugte Verwerfungen, die vor Jahrmillionen stattgefunden hatten, während einer erdgeschichtlichen Epoche, die vorbei gewesen war, lange ehe es Menschen gegeben hatte, um sie zu bezeugen. Was sich vor ihm erhob, war der Brustkorb eines Riesenorganismus, der den Atem anhielt. Natürlich wurde in Wirklichkeit überhaupt nichts angehalten, der menschliche Wahrnehmungsapparat war nur einfach unfähig, das allmähliche Heben und Senken zu erkennen. Selbst eine Zeitrafferkamera wäre an ihre Grenzen gestoßen: ein Bild pro Jahr, um zweieinhalb Zentimeter Absacken des Bergrückens festzuhalten. Fünfundzwanzig Bilder pro Sekunde verrechnete das Gehirn zu einer flüssigen Bewegung. Vier Sekunden Film in hundert Jahren, während derer das komplette Massiv etwa zweieinhalb Meter an Höhe verlor. Das Auge erfaßte nur einen winzigen Ausschnitt aus dem Spektrum der Geschwindigkeiten. Es konnte auch nicht folgen, wenn eine Knospe sich allmählich entfaltete: Sie war geschlossen, sonst nichts. Dann einen Spalt weit geöffnet, ganz still. Schließlich das Stadium der Blüte: Eine-Rose-ist-eine-Rose-ist-eine-Rose. Das einzige, dem er zuschauen konnte, war das Fallen eines welken Blütenblatts, wenn er Glück hatte oder lange genug wartete.
Färber kehrte aus Sekundenbruchteilen Unendlichkeit zurück. Der Wind nahm an Härte zu, riß die mechanischen Rhythmen der Liftanlagen auseinander, wehte Halbsätze zu ihm herüber, die nicht ihm galten. Sein rechter Zeigefinger wurde steif. Ohne Handschuh zu photographieren war aussichtslos. Er zog ihn wieder an, büßte sein Fingerspitzengefühl ein, überlegte, das Ganze zu verschieben, in die nächste Sitzschale zu steigen und zurück ins Tal zu fahren. Im Frühjahr konnte er wiederkommen.
Statt abzubrechen und zu flüchten, wickelte er sich den Schal um den Kopf, so daß nur noch ein Schlitz für die Augen freiblieb. Kurz darauf stellte er fest, daß die feuchte Luft aus Mund und Nase in der Strickwolle zu einer eisigen Nässe wurde, die sich ekelhaft anfühlte und stank. Er schob den Schal zurück unters Kinn.
Im Grunde verabscheute er Natur. Fragte jemand danach, sagte er, sie interessiere ihn nicht, weder beruflich noch privat. Doch letztlich war es Abscheu, und an dessen Grund Angst, eine wahnsinnige, nur mit Mühe in Schach gehaltene Angst vor dem Unbeherrschbaren. Er ging auch nicht gerne zu Fuß. Für das kurze Stück Weg zwischen seiner Wohnung und dem Studio nahm er den Wagen und verwandelte sieben Minuten Gehen in zwei Minuten zum Aus- und Einparken, ein bis drei Minuten vor roten Ampeln und viereinhalb für die eigentliche Fahrt. Das Wetter hatte mit dieser Gewohnheit nichts zu tun. Zu Fuß war jedes Wetter schlecht. Wenn es regnete, wurde er naß, bei Eis und Schnee konnte man sich das Genick brechen. Abgesehen davon fror er, sobald er die eigenen Räume verließ, es sei denn, draußen herrschten über dreißig Grad Sommerhitze.
Der Wind ließ die Flaggen an den Aluminiummasten knallen: Europa blau mit gelbem Sternkreis; Österreich rotweiß, drei Streifen; Tirol rotweiß, zwei Streifen. Die obere Wolkendecke wurde auseinandergetrieben, so daß Lichtkegel durchbrachen, obwohl sich kein blauer Himmel zeigte. Ein Anstieg, der aus Schichtungen schwarzen Gesteins bestanden hatte, leuchtete in Ocker und Ziegeltönen. Auf Schneehängen überlagerten sich die Schatten von Felsvorsprüngen und dichteren Wolken, wurden mit großer Geschwindigkeit ineinandergetrieben.
Färber machte Bild auf Bild, kontrollierte die Ergebnisse. Für zweite Versuche blieb nie Zeit, denn im nächsten Augenblick erstarrte der Ausschnitt, der gerade noch belebt gewirkt hatte, statt dessen geriet ein Stück tote Steilwand in Bewegung. Neben hellen randlosen Schwaden erschienen dunkelgraue mit sauber zerfetzten Konturen.
Der Sturm verschärfte sich weiter. Das Windrad auf dem Dach der Station rotierte, als wollte es mitsamt Gebäude abheben. Die Aufheiterung war längst verflogen, es verfinsterte sich. Färber schaute auf die Uhr, sie zeigte fünf nach drei. Unwahrscheinlich, daß es bereits dämmerte. Die Sesselschalen an den Drahtseilen schaukelten bedenklich. Weiter oben peitschten Schneeböen Slalomtore. Dann plötzlich ein Abbruch, ein kurzer Moment, in dem alle Geräusche verstummten, um sich neu zu sortieren: verschiedene Stimmen des Windes im Fels, bremsende Skikufen, Gelächter. Etwas fehlte, er sah es jetzt: Beide Lifte standen still.
Aus den Lautsprechern, die am Gebäude montiert waren, meldete sich ein Knacken, ehe eine für hiesige Verhältnisse hochdeutsche Stimme sagte: »Verehrte Gäste, da die Sicherheit der Anlage infolge der Windstärke nicht mehr gewährleistet ist, wurde der Liftbetrieb eingestellt. Wir bitten um Ihr Verständnis. Die Seilbahn von der Sommeralm verkehrt weiterhin.«
Färber merkte, wie ihm trotz Kälte der Schweiß ausbrach, unmittelbar gefolgt von Panik. Er lief zum Stationsgebäude, warf die Schwingtür auf, stürmte hinein, hielt inne, sah sich um. Der Kiosk, an dem man vorhin noch Tee, Schnaps und Wiener Würstel hatte kaufen können, war geschlossen. Er klopfte an die Scheibe, obwohl dahinter kein Licht mehr brannte. Die zuständige Person war bereits gegangen. Er schlug gegen Türen, rief »Hallo« und »Entschuldigung!« Nirgends ein Mensch, der für die Steuerung der Anlage zuständig war, auch sonst keiner. Bei den Toiletten fand er eine Gegensprechanlage, darüber ein Schild mit der Aufschrift Notruf. Neben einem größeren Kreis aus gestanzten Löchern und einem kleineren, hinter dem das Mikrophon steckte, zeigte ein grünes Lämpchen an, daß das Gerät eingeschaltet war. Färber drückte die Sprechtaste, hörte Knistern und Rascheln, dann eine unfreundliche Männerstimme: »Was gibt es denn?«
»Daß der Lift aus ist«, sagte Färber, »wegen des Wetters, aus Sicherheitsgründen wurde gesagt, das kann ja sein, aber wie kommen die Leute jetzt wieder runter?«
»Wie sonst auch: auf die Ski.«
»Aber wenn man keine Ski hat?«
»Dann müssen S’ halt laufen.«
»Wissen Sie, was hier oben für ein Wind geht?«
»Eben darum ist der Lift aus.«
»Und wann wird er wieder eingeschaltet?«
»Heut’ nimmer.«
»Aber wenn sich eine Lawine löst, während ich dort bin?«
»Lawinen hat’s da herunter keine.«
»Ich meine: Wenn doch?«
»Dann kommt die Bergrettung mit’m Hubschrauber.«
Der Mann lachte schadenfroh, sagte: »Grüß Gott«, und brach den Kontakt ab.
Färber starrte den Lochkreis an, hinter dem es jetzt totenstill war, zog reflexartig sein Mobiltelephon aus der Hosentasche. Es hatte Empfang, wenn auch schwachen. Seine Stimmung hob sich kurz, bis er einsah, daß das Telephon ihm nichts nützte. Er könnte allenfalls versuchen, irgendwie an die Nummer der Bergrettung zu gelangen – die deutsche Auskunft funktionierte hier nicht –, und dann tatsächlich den Hubschrauber rufen. Das würde ihn an die 10 000 Euro kosten, die keine Versicherung übernähme.
Er schloß die Augen, lehnte sich gegen die eisige, mit rot lackierten Stahlblechen verkleidete Wand, dachte, seine Knie hätten alles Recht nachzugeben, entschied sich dann aber, stehenzubleiben.
Er stellte sich seinen Tod im Eis vor. Gestorben für die Kunst, bei dem Versuch, eine neue Sicht auf die Berge zu finden. Immerhin nicht für ein Luxushotel oder einen Campingausstatter. Er hatte sich eigens Skiunterwäsche gekauft, ein Himalaja-erprobtes Mikrofaser-Hemd sowie eine textiltechnisch optimierte Version der Daunenjacke. Die Sachen würden ihn im Ernstfall nicht retten. Wenn er stürzte, sich den Knöchel brach, würde er liegen bleiben und erfrieren. Morgen früh hätte der Neuschnee ihn zugedeckt. Er wäre ein Hubbel oder eine Schanze, die für kleinere Sprünge taugte.
Färber trat hinaus. Von der oberen Piste kam eine fünfköpfige Gruppe Skifahrer heruntergerast. Sie verlangsamten das Tempo, fuhren einen eleganten Bogen um das Gebäude herum, schwenkten in den nächsten Abschnitt ein. Die beiden vorderen nahmen mit ein paar kräftigen Stößen der Stöcke neue Fahrt auf, gingen in die Hocke und schossen davon, während die hinteren in lässigen Schwüngen folgten.
Nicht nur als Photograph fehlte ihm jede Erfahrung im Schnee, er hatte auch keine Vorstellung, wie lange er zu Fuß für den Abstieg benötigen würde. Die Station auf der Sommeralm, wo der Gondelbetrieb trotz des Windes fortgesetzt wurde, lag hinter einem Hang, inmitten einer Wolke. Färber hielt die Kamera umklammert, als wäre sie sein einziger Halt, schaute an sich hinunter: Er trug Halbschuhe, die zwar Profilsohlen hatten, aber nicht über die Knöchel reichten. Nach wenigen Schritten würde Schnee von oben eindringen, die Socken durchnässen. Er dachte an den Bergsteiger Messner, den er vor einigen Monaten photographiert hatte. Wenn es ganz schlecht lief, konnten die Zehen erfrieren und müßten amputiert werden.
Es war jetzt zwanzig nach drei, in anderthalb Stunden würde es stockdunkel sein. Er ging los, folgte den Stangen, den orangen Quadern, die die Piste markierten. Der Sessellift nahm einen anderen Weg, über schroffe Felshänge, nacktes Gestein. Die Strecke wäre kürzer gewesen, ließ sich aber zu Fuß kaum bewältigen. Weitere Skifahrer überholten ihn. Das Geräusch der Bretter im vereisten Schnee hatte etwas Gewalttätiges, wie Schwertstreiche, nur daß kein Kopf rollte. Es war glatt, er rutschte aus, ruderte mit den Armen, um die Balance zu halten, fiel dann doch, konnte den Sturz nicht abfangen. Mehr als alles andere mußte die Kamera vor Stößen geschützt werden. Ein stechender Schmerz am Steißbein schoß bis in seine Brust, nahm ihm den Atem. Er saß da, sammelte sich. Ein Snowboarder raste haarscharf an ihm vorbei, schrie etwas, das er nicht verstand, wedelte mit dem Mittelfinger. Färber dachte einen Moment, wie es wäre, einfach liegenzubleiben und das Ende abzuwarten. Das Erfrieren – hatte er in einem Buch über den Selbstmord gelesen – sei eine der angenehmsten Erscheinungsformen des Todes, vor allem, wenn man vorher eine Flasche Whisky getrunken habe. Bei dem Gedanken schüttelte es ihn. Auch wollte er jetzt heute nicht unbedingt sterben. Meistens ging es ihm gut oder zumindest nicht schlecht. Nur manchmal brach er ein, dorthin, wo kein Grund hielt – dann sah alles anders aus. Doch da waren die Bilder. Sie würden nichts ändern, weder am Zustand der Welt, noch an dem seines Innenlebens, aber sie wollten gemacht werden und sie hatten bestimmt, daß er dafür zuständig sei. Färber rappelte sich auf, ging weiter. Vor ihm zog eine weitere Wolke aus dem Abgrund über den Hang. Er entfernte sich einige Schritte von der Piste, um nicht von einem der Ski-Irren zum Krüppel gefahren zu werden. Auf den mit Neuschnee überzogenen Firnflächen, die weder planiert noch festgefahren waren, fand er besseren Halt. Das Licht bekam jetzt eine Schwere, die er nie zuvor gesehen hatte. Seine Schritte knirschten. Das Geräusch hallte im Kopf nach, es erinnerte an etwas Bestimmtes, das ihm nicht einfiel.
Zu seiner Rechten trat ein mächtiger Grat aus der Nebelwand. Er stieg steil an und mündete in eine glatte, schroff aufragende Felsspitze. Der Schnee hatte dort kaum Halt gefunden. Sie stand da als ein klar geschnittener Winkel aus blankem Fels, schwarzviolett, von schmalen geometrisch ineinandergefügten Eiskanten geordnet. So sah ein Gipfel aus, auf dem nie ein Bergsteiger gewesen war – keiner hätte es gewagt. Einen Augenblick lang versuchte Färber an dieser Illusion festzuhalten: Frühere Generationen hatten gewußt, daß Dämonen dort hausten, die der Mensch nicht stören durfte. Andernfalls brach Unglück über die Bewohner des Tals herein. Beispiele gab es genug, sie waren zu Geschichten geronnen, die in Winternächten erzählt wurden, den Kindern zur Warnung. Die geschnitzten Wurzelholzmasken, Waldschratfiguren mit Strohbärten in den Souvenirläden zeugten davon, sonst nichts mehr.
Färber vertraute weder auf überirdische Schicksalsmächte, noch glaubte er an Berggeister. Aber er hätte es gern gehabt, wenn ein paar Orte übriggeblieben wären, die nach Geheimnissen aussahen, selbst wenn dort keine waren. Der Mensch gehörte hier nicht her. Weder weil das Edelweiß geschützt werden mußte, noch wegen der Steinbockpopulation. Hier war die Todeszone. Nackter Fels, Eiswüste, Ödnis. Skifahrer hatten hier nichts zu suchen. Auch er hatte hier nichts zu suchen. Er starrte die Bergspitze an, deren Namen er nicht kannte, und ahnte, worauf die Bilder hinauswollten. Es befand sich außerhalb oder jenseits der Begriffe. Das, was für sich war, sich selbst genügte, dem er nichts hinzufügen konnte, vor dem die Leute der Vergangenheit sich niedergeworfen hatten, auf die Knie gefallen waren. Das andere, das Unbekannte. Es wandte all seine Macht auf, um ihn fernzuhalten. Ihn und die Sportler, die Touristen, die sich keinen Deut darum scherten. Deshalb gab es gelegentlich Tote.
Wieder und wieder photographierte er die Bergspitze, wartete neue Wolkenbänke ab, änderte die Belichtung, den Ausschnitt, die Brennweite. Erneut kamen zwei Skifahrer auf ihn zugerast, machten unmittelbar vor ihm eine scharfe Kehre, so daß ihm der Schnee bis an die Hüfte spritzte, jagten Richtung Sommeralm davon. Er schrie ihnen etwas nach, kein Wort, einen ungeformten Laut aus vollem Hals, der wie ein Fluch klang und verhallte.
Färber schnaufte, stolperte mehr als er ging den Hang hinunter. Rechterhand die dunkle Spitze, die mit jedem Schritt, den er abwärts tat, höher aufragte. Links, durch ein steiles Geröllfeld unerreichbar fern, öffnete sich jetzt eine breite Abfahrt, in der ein Slalom-Parcours gesteckt war, bunte Stangen, die ebenso lächerlich wie bösartig wirkten, dazwischen eine Gruppe Skifahrer, offenbar ein Kurs. Sie lernten gerade, wie man quer zur Steigung hinaufstapfte. Auf der gegenüberliegenden Seite sah Färber weitere Sesselliftstrecken vor einer gewaltigen Steilwand. Sie standen ebenfalls still. Der Schnee auf Felskanten, natürlichen Terrassen zeichnete ineinandergezwungene Strukturen nach, schälte gegenstandslose Formen heraus, die mal klar und hart, dann wieder wie verwischt aus dem Weiß traten. Inmitten des Geschiebes die ansteigende Gerade des Stahlseils mit im Wind schaukelnden Sesselschalen. In regelmäßigen Abständen setzen Stützpfeiler einen Taktstrich, an dem das Seil geknickt wurde. Die Plateaus, auf denen sie standen, waren in den Grund gesprengt, eingeebnet, die Fundamente und Sockel aus Beton. Färber photographierte auch das. Nicht nur die Erhabenheit des unbezwingbaren Berges, auch die Nadelstiche des Zwergenvolkes, dem er selbst angehörte. Das Gegeneinander der Rhythmen, die aus unterschiedlichen Sphären stammten. Keine Anklage, kein Vorwurf, bloße Formen, die einander kommentierten, ohne eine Meinung zu haben. Und hinter all dem Entsetzen. Er schwitzte, seine Knie zitterten, aber er photographierte weiter. Der Atem schmerzte in der Lunge, die Füße krampften vor Kälte, jeder Schritt war ein Schritt, der noch vor ihm lag, dann ein Schritt, der ihn der totalen Erschöpfung nähergebracht hatte. Das Heulen des Sturms trieb ihn vorwärts, als stammte es von Wölfen. Er zweifelte, ob es überhaupt zu schaffen war, ob er es schaffen könnte. Der Windgriff in seinem Genick wollte ihn zu Boden zwingen, ihn in den Schnee werfen, sein Gesicht hineinpressen, ihn ersticken. Seine Jacke wurde von den Böen gestaucht wie unter Schlägen. Färber dachte jetzt nichts mehr, er stolperte, taumelte, fing sich mal mit dem Knie, mal mit der Hand, schaute gleichzeitig durch den Sucher und drückte ab, drückte ab, drückte ab. Die Kamera war sein Auge, sie hielt alles fest, sah, was er selbst nie gesehen hatte und nie sehen würde. Sein Auge aus Fleisch und Blut war längst blind. Es brannte, produzierte unkontrolliert Tränen, hinter denen alles verschwamm. Der nächste Skifahrer, der von oben käme, müßte Hilfe schicken, doch es kam keiner. Färber photographierte wie im Wahn. Es sicherte sein Überleben. Deshalb hatte er seinerzeit damit angefangen: um nicht unterzugehen. Solange er photographierte, konnte ihm nichts passieren. Die Bergformationen wurden zu Ausschnitten, Fragmenten, die keine Ähnlichkeit mit Landschaftsbildern, mit Naturdarstellung mehr hatten. Was auf dem Chip war, würde überdauern, ganz gleich, wie dieser Abstieg endete. Spätestens morgen fände man ihn. Und neben ihm läge die Kamera.
Ohne daß er ihn hatte kommen sehen, begann plötzlich ein Anstieg. Färber zweifelte an seinem Gleichgewichtssinn, traute den eigenen Füßen nicht. Er erstarrte, weil er dachte, daß er sich verlaufen hätte. Doch links waren immer noch die Stangen, die die Abfahrt markierten. Ein unfaßbarer Gedanke platzte in seinem Kopf: Die Skifahrer hatten sie umgesteckt, um ihn in die Irre zu führen. Man wollte ihn umbringen, einfach so, aus Spaß. Er mußte die Kuppe erreichen, um sich neu zu orientieren. Das würde er schaffen. Vielleicht gewänne er von dort einen Überblick. Seine Oberschenkel schmerzten bei jedem Schritt, die Versuchung wuchs, einfach stehenzubleiben, zu verweigern wie ein Springpferd vor dem Hindernis. Es war weniger ein Gedanke, als ein körperlicher Impuls. Dann plötzlich konnte er über den Scheitelpunkt der Kuppe hinwegschauen. Es dauerte einige Sekunden, bis er die Höhen-und Größenverhältnisse des Raums um sich herum wieder begriff. Das unüberwindliche Geröllfeld, das ihn von der Schulpiste getrennt hatte, war, nachdem er es aus dem Blick verloren hatte, immer schmaler geworden, schließlich in einem spitzen Winkel ausgelaufen. Färber ging geradewegs auf die Teilnehmer des Skikurses zu, die in ihren albernen Leuchtwesten Rechts-Links-Schwünge übten, anschließend wieder ein Stück Hang hinaufkraxelten, und so fort. Hinter dem Ende der Slalompiste, nur noch zwei-, höchstens dreihundert Meter weit entfernt, sah er jetzt auch den aberwitzigen Gebäudekomplex der Sommeralm: Eine grausilberne Metallkapsel, in der sich die Seilbahnstation befand, hatte sich wie ein Raumschiff in einen alten Tiroler Berggasthof gebohrt. Färber erreichte den Höhenwanderweg, auf dem die Urlauber während des Sommers zur Alm gelangten. Er traf wiederum auf ein Kreuz, kein Gipfel-, ein Wegkreuz diesmal. Es hatte ein kleines Ziegeldach, und ein geschnitzter, farbig gefaßter Kruzifix hing daran. Das Blut aus den Wunden schimmerte frisch. Unmittelbar dahinter war einer der orangefarbenen Quader aufgestellt, damit kein Skifahrer aus Versehen hineinraste. Eine Gondel schwebte aus dem Stationsgebäude hinunter Richtung Tal.
Färber atmete durch, ohne zu begreifen, was geschehen war – weder jetzt, wo er sich in Sicherheit befand, noch während der vergangenen Stunde. Er betrat die Terrasse, auf der bei Sonnenschein die Skifahrer unter Wolldecken lagen und tranken. Der ebene Boden unter seinen Füßen irritierte ihn einen Moment. Anders als sonst hatten die rotweißen Fensterläden, die geblümten Vorhänge nichts mit Alpenkitsch zu tun.
Er öffnete die Tür zum Schankraum, hörte Gelächter und Schlagermusik. Von der gegenüberliegenden Wand starrten ein Mufflon und ein Gamsbock ihn unverwandt an. Darunter hingen gerahmte Auszeichnungen mit Goldsiegeln, Postkarten bekannter Persönlichkeiten, die schon hier gewesen waren. Ein Dutzend Menschen, hauptsächlich Männer, saßen an blank gescheuerten Holztischen, hatten Tassen, Bier- und Schnapsgläser vor sich, Teller mit Wurst oder Kuchenresten.
»Die Seilbahn fährt noch?« fragte Färber den Wirt, ehe er sich setzte.
Der Wirt nickte, ohne von seiner Zeitung aufzuschauen.
»Eine heiße Zitrone.«
Färber streifte Handschuhe und Mütze ab, öffnete die Jacke, ließ sich auf einen Stuhl beim Fenster fallen. Das Gespräch der Männer am Nachbartisch verstummte. Sie schauten ihn an, tauschten Blicke, denen zu entnehmen war, daß sie ihn für einen Idioten hielten: »Ah, der Herr Bergwanderer . . .«
Färber schaute auf.
»’s ist kein Spaß ohne Ski heute, oder?«
Er sah aus dem Fenster und antwortete nicht.
Tanzveranstaltungen, junge Liebe, ein Hund
Deine Spuren im Sand, die ich gestern dort fand. Wir üben Foxtrott zu toter Musik. Ich mit Kerstin, die mir vollkommen gleichgültig ist. Herr Stelzer diktiert Schrittfolgen ins Mikrophon. Seine Frau flüstert ihm etwas zu. Er schaut in unsere Richtung, bricht ab. Ich soll die Dame fester halten, heranziehen: »Nicht so schüchtern, der Herr.«
Er tritt näher, nimmt meine Hand von ihrer Hüfte, drückt sie in die Mitte des Rückens, schiebt uns zusammen: »Und etwas mehr Begeisterung, Sie haben keinen Sack Kartoffeln im Arm.«
Ringsum Gelächter.
Schöne Maid, hast du heut für mich Zeit? Sie heißt Svea. Unsere Blicke treffen sich. Nicht zufällig, nicht zum ersten Mal. Ihr Gesicht hat einen asiatischen Schnitt, die Augen mit Lidfalte, schwarz umrandet, der obere Strich zu den Schläfen verlängert, breite, hoch ansetzende Wangenknochen. Sie ist aber blond, glattes schulterlanges Haar, und bewegt sich wie eine Ginsterkatze nachts auf der Jagd durch die Steppe.
Wir sind weder freiwillig hier, noch wegen des Foxtrotts. Das Collegium Gregorianum hat mit der Ursulinenschule im zwanzig Kilometer entfernten Zülpen ein Abkommen, daß deren zehnte Klasse mit unserer zwölften Tanzen lernt. Zwanzig Kilometer sind weit auf dem Land, wenn keiner ein Auto besitzt, nicht mal ein Moped. Im Prinzip steht es jedem frei, dem Kurs fernzubleiben, aber wo sonst sollte man Mädchen treffen. Rund um das Gregorianum liegen Äcker und Wald, durch den die Kerpe fließt. Dahinter beginnt Holland. Drei Monate lang werden wir mittwochs per Bus zum Hubertushof gebracht, nach zwei Stunden wieder zurück, jedes Mal um eine Hoffnung ärmer. Darüber wird der Frühling Sommer, für die meisten allein, wie in den Jahren zuvor. Die Mädchen sind auf uns nicht angewiesen. In Zülpen gibt es neben der Ursulinenschule ein Jungengymnasium und ein normales. Viele haben feste Freunde, mit denen hätten sie lieber getanzt.
Kerstin ist zur Zeit mit niemandem zusammen. Sie hat es mir gesagt, in vielversprechendem Ton. Auch Svea nicht. Das weiß ich von Lamme, der sie als Partnerin für den Abschlußball gewinnen konnte. Ich saß zu weit von ihr entfernt und hörte Herrn Stelzers Gequatsche nicht zu, als plötzlich alle auf die andere Seite rannten, um ihre Favoritin aufzufordern. Dabei kam es zu Rangeleien, die für viele mit einer Enttäuschung endeten. Nachher hätte ich mit Smeetz Kerstin gegen Anja Fischer tauschen können, aber die langweilt mich genauso. Immerhin hat Vince Maren gekriegt, Sveas beste Freundin. Das bedeutet, ich werde sie treffen: außerhalb des Hubertushofs.
»Meine Damen, meine Herren, ich hoffe, Sie erinnern sich an letzte Woche: Der langsame Walzer. Bitte nehmen Sie Position ein.«
Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist. Lamme tanzt so innig er kann. Man sieht, daß ihm jegliches Rhythmusgefühl fehlt. Er rechnet sich trotzdem Chancen aus. Ich gebe ihm keine. Svea ist zu hart für ihn. In der Pause steht sie mit Maren abseits. Sie rauchen selbstgedrehte Zigaretten, Javaanse Jongens. Lamme stellt sich dazu, versucht witzig zu sein. Svea lacht nicht, antwortet knapp, schaut an ihm vorbei. Lamme folgt ihrem Blick, trifft meinen, wendet sich ab. Kerstin sagt: »Svea hält sich für was Besseres. Wir mögen sie nicht.«
Ich nicke, überlege, ob ich Svea mit der Andeutung eines Lächelns antworte oder unnahbar bleibe.
Nach der Pause ruft Herr Stelzer Damenwahl aus. Svea bewegt sich in meine Richtung, keinen Schritt schneller als sonst. Eine, deren Namen ich nicht kenne, kommt ihr zuvor: »Darf ich bitten?«
Ich schlucke das »Nein« hinunter. Svea dreht ab, fordert Ansgar auf, den Jahrgangstrottel.
Bevor wir den Saal verlassen, lädt Kerstin mich für Sonntag zu sich nach Hause ein. Ich habe wenig Lust, doch sie ist nicht so unerträglich, daß ich sie kränken müßte.
»Maren fragt, ob du Svea kennenlernen willst?« sagt Vince auf der Rückfahrt, »Svea hat seit anderthalb Jahren keinen Freund. Sie findet dich nicht schlecht. Maren glaubt, daß da mehr ist.«
»Ich weiß.«
»Woher?«
»Seh’ ich.«
»Maren und ich treffen uns Sonntag, wenn du mitfährst, wird Svea auch da sein.«
Anderntags rufe ich bei Kerstin an, habe die Mutter am Apparat, zum Glück: »Leider kann ich die Einladung nicht wahrnehmen, wir schreiben einen Physiktest, das weiß ich erst seit heute, grüßen Sie Kerstin.«
Zülpen hat an die siebentausend Einwohner. Die Wahrscheinlichkeit, ihr dort über den Weg zu laufen, ist hoch. Schlimmstenfalls tausche ich sie doch gegen Anja Fischer.
Sonntags regnet es in Strömen. Vince und ich sind die ersten an der Straße. Trampen ist verboten, aber abgesehen vom Fahrrad die einzige Möglichkeit wegzukommen. Meistens nimmt einen schnell jemand mit. Die Leute wissen, daß wir vom Gregorianum ungefährlich sind. Zurück wird es schwieriger. Vince sagt: »Scheiß Wetter.«
Ich: »Am Zoll steht ein VW-Bus, mit dem bin ich schon mal gefahren.«
Der Bus hält, ein Mann mit Zopf und Latzhose öffnet: »Wohin?«
»Nach Zülpen.«
»Ich muß nach Uedem.«
»Das ist schon die halbe Strecke.«
»Steigt ein.«
In Uedem halten wir eine Stunde den Daumen in die Luft, dann erbarmt sich der Kaplan. Um Viertel vor vier steigen wir durchnäßt am Ortsschild Zülpen aus, suchen eine Telephonzelle. Vince ruft Maren an. Svea ist bei ihr, muß aber vorher noch kurz nach Hause. Wir sollen ins Eulenspiegel gehen. Im Gregorianum heißt es, daß sie dort Drogen verkaufen. »Frag, ob das auch Kerstins Kneipe ist?«
»Aus ihrer Schule trifft man da keinen sonst.«
Es riecht nach Räucherstäbchen, feuchtem Holz. Die meisten Tische sind besetzt, hauptsächlich Freaks. In portugiesischen Weinflaschen stecken Kerzen, an denen Wachs heruntertropft. Hey there people I’m Bobby Brown / they say I’m the cutest boy in town.
»Nicht schlecht, der Laden«, sagt Vince. Er bestellt Tee, ich Alt. Alle Männer starren zur Tür, als Svea und Maren hereinkommen. Svea hat einen schwarzen Pudelmischling bei sich, der paßt zu ihr wie Marmelade auf Pommes frites. Ehe sie sich setzt, holt sie ein Handtuch aus der Tasche und trocknet ihn ab: »Das ist Frieda.«
»Es freut mich, Sie kennenzulernen, Fräulein Frieda«, sagt Vince.
»Du klingst wie Stelzer.«
Svea nimmt auch Bier, obwohl sie noch fünfzehn ist, Maren Kaffee. Wir reden über den Tanzkurs, Eltern, Musik, das Gregorianum. Svea spricht wenig, statt dessen schaut sie mich an. Es fällt mir schwer, ihrem Blick standzuhalten. Als Vince Maren in den Nacken greift, weiche ich aus. Sie hat die erste Runde gewonnen. »Und was machst du sonst so, Svea?«
Diese Augen schlucken alles andere.
»Meistens langweile ich mich.«
Nach dem dritten Alt erzähle ich persönlicher: »Weißt du, ich bin Künstler. Ich male gegen den Schmerz, wenn du verstehst, was ich meine.«
Sie nickt. Vince streichelt Marens Schenkel, Maren schlingt ihm die Arme um den Hals, ihre Zungenspitzen berühren sich. »Alle Kunst entspringt einer offenen Wunde.«
Svea tätschelt unterm Tisch ihren Hund, hebt ihn auf den Schoß, läßt sich das Gesicht lecken. Sie stimmt auch zu, als ich sage: »Das Leben ist eine Zumutung. Niemand hat uns gefragt, ob wir wollen.«
Vermutlich weiß sie noch nicht, ob sie in mich verliebt ist. Ich kann warten, gebe mich eine Spur desinteressierter. Maren und Vince haben sich in die dunkelste Ecke zurückgezogen, liegen mehr als sie sitzen, er hat ihr seine Hände unter den Pulli geschoben. If looks could kill they probably will / in games without frontiers – war without tears. »Ich denke über Selbstmord nach.«
»Klar.«
»Andererseits sehe ich ein Werk vor mir.«
»Malen kann ich überhaupt nicht.«
Um halb acht gehen Vince und ich zur Straße. Nach neun sind alle Türen des Gregorianum geschlossen, man muß die Dachrinne hinaufklettern und durch ein Oberlicht steigen. Es regnet nicht mehr. Zum Abschied küßt Svea mich auf die Wange. Maren und Vince können sich kaum auseinanderreißen. Nach fünf Minuten hält ein Wagen. Der Mann fährt einen Umweg eigens für uns.
Wir sind rechtzeitig im Kolleg, essen Tütensuppe mit Toast. Anschließend schreibe ich Svea einen Brief. Vince sitzt auf dem Boden und spielt Gitarre: »Ich sage dir, Svea ist kompliziert.«
»Sie versteht mich ziemlich.«
Bis Mittwoch sind es drei lange Tage.
Tanze Samba mit mir, Samba, Samba die ganze Nacht. Ich bin an Kerstin vorbeigelaufen, habe ihr lediglich »Hallo« zugerufen und Svea aufgefordert. Es ist kein Gesetz, daß man den ersten Tanz mit der Ballpartnerin macht. Wir sind eng, es geht mühelos trotz der Musik für halbverweste Tankwarte. Während der Pause stehen Vince und ich bei Svea und Maren. Als Lamme kommt, sage ich: »Schade, daß du mitten in ein sehr privates Gespräch platzt.«
Er wird rot, sonst fällt ihm nichts ein. Da Svea ihn nicht zu bleiben bittet, haut er ab.
Herr Stelzer beendet die Pause mit einer Erklärung: »Meine Damen, meine Herren. Es wurde mehrfach der Wunsch geäußert, ausländische Popmusik zu spielen. Ich sage dazu nur: Wir leben in Deutschland, hier wird deutsch gesungen!«
Der Puppenspieler von Mexiko, war einmal traurig und einmal froh. Kerstin bewegt sich steif wie immer. Offenbar weiß sie nicht, daß ich am Sonntag in Zülpen war. Sie will mich für eins der nächsten Wochenenden einladen. Leider habe ich anderweitige Verpflichtungen, familiäre, schulische, und Pfingsten fahre ich mit Vince zum Jazzfestival. Ich verabschiede mich hastig, um noch ein paar Sätze mit Svea zu wechseln. Wir stehen am Rand des Parkplatzes. Es dauert von Mal zu Mal länger, bis alle im Bus sind. »Wie sieht es Sonntag aus?« frage ich.
»Weiß ich noch nicht, ruf mich übermorgen an.«
»Samstag ginge auch.«
»Da kann ich auf keinen Fall.«
Sie wirkt gereizt.
»Schreib mir, wenn du Lust hast.«
»Ich schreibe nie Briefe.«
»Warum?«
»Keine Ahnung.«
Als fast alle im Bus sitzen, greift sie mir ins Haar, preßt ihre Lippen auf meine, schiebt mir die Zunge in den Mund, so tief, daß mir der Atem stockt, so warm, daß mir Schweiß ausbricht. Sie hört nicht auf, als ich versuche, mich zu lösen. Nicht, weil mir Küssen keinen Spaß macht. Ich bin der letzte draußen, habe Angst, den Bus zu verpassen. Das falsche Gefühl für den ersten Kuß. Sie soll es nicht merken. Natürlich merkt sie es. Die anderen johlen, schlagen von innen gegen die Scheiben. Der Fahrer hupt zum zweiten, zum dritten Mal. Ich reiße mich los: »Schätzungsweise kann ich nicht bei dir übernachten?«
»Nein.«
»Wir telephonieren morgen.«
»Morgen bin ich nicht da.«
»Freitag.«
Beim Einsteigen drehe ich mich noch einmal um, da ist sie bereits fort.
Jetzt bin ich mit Svea zusammen, alle haben es gesehen. »Wurde langsam Zeit«, sagt der Fahrer. Ich zucke bloß mit den Schultern. Drinnen tobt der Mob. Pfiffe, Geschrei. Der Neid der Besitzlosen. Ich verziehe keine Miene, ignoriere Lammes Haß, lasse mich auf den Platz neben Vince fallen, schließe die Augen: »Ein Hammer, die Frau.«
Am Sonntag hat sie keine Zeit. Was sie macht, verrät sie mir nicht. Vince fährt allein nach Zülpen, während ich auf dem Zimmer sitze und mir den Kopf zerbreche, hoffe, daß er früh zurückkommt. Maren weiß sicher, was Svea vorhatte. Ich versuche einen weiteren Brief, auch wenn sie nicht antwortet. Soll ich »Liebe« oder »Liebste Svea« schreiben? Ich entscheide mich für: »Meine über alles geliebte Svea, schmerzlich getrennt sind wir durch endlose Räume, entleerte Zeit.«