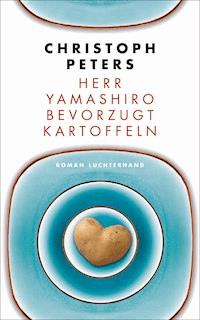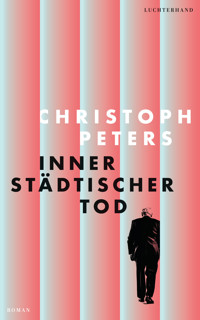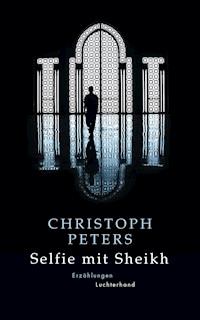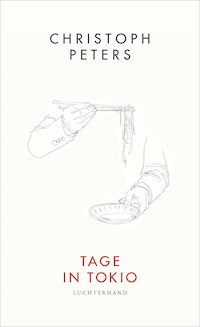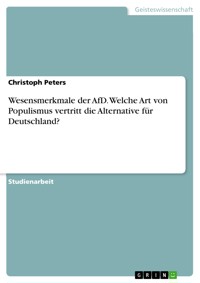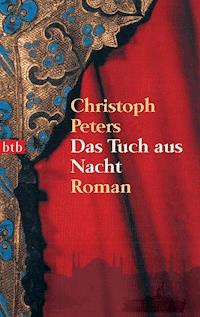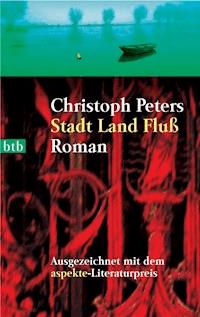6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Schatten des Reaktors – ein fulminanter Rückblick auf die idyllische Weltfremdheit der 70er Jahre.
Alles scheint noch vertraut in Hülkendonck, einem Dorf am Niederrhein. Als wären die dreißig Jahre, in denen der Erzähler hier nicht mehr lebt, nie gewesen. Sein Besuch bei den Eltern beschwört die Vergangenheit wieder herauf: die idyllische Weltfremdheit der 70er Jahre, den Beginn einer industriellen Landwirtschaft, die das bäuerliche Milieu verdrängt. Und den geplanten Bau des "Schnellen Brüters", eines neuartigen Atomkraftwerks, das die Menschen im Ort genauso tief spaltet wie im ganzen Land. Es ist jene Zeit, in der der Erzähler zu ahnen beginnt, dass das Leben seiner Eltern nicht das einzig mögliche ist – und in der er Juliane kennenlernt, eine Anti-Atomkraft-Aktivistin, die ihn in die linke Gegenkultur einführt...
Einfühlsam und packend erzählt Christoph Peters von den inneren Zerreißproben eines jungen Mannes und eines ganzen Dorfes. Es ist der große Roman über den turbulenten Aufbruch in jene Bundesrepublik, in der wir heute leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zum Buch
Alles scheint noch vertraut in Hülkendonck, einem Dorf am Niederrhein. Als wären die dreißig Jahre, in denen der Erzähler hier nicht mehr lebt, nie gewesen. Sein Besuch bei den Eltern beschwört die Vergangenheit wieder herauf: die idyllische Weltfremdheit der 70er Jahre, den Beginn einer industriellen Landwirtschaft, die das bäuerliche Milieu verdrängt. Und den geplanten Bau des »Schnellen Brüters«, eines neuartigen Atomkraftwerks, das die Menschen im Ort genauso tief spaltet wie im ganzen Land. Es ist jene Zeit, in der der Erzähler zu ahnen beginnt, dass das Leben seiner Eltern nicht das einzig mögliche ist – und in der er Juliane kennenlernt, eine Anti-Atomkraft-Aktivistin, die ihn in die linke Gegenkultur einführt …
Einfühlsam und packend erzählt Christoph Peters von den inneren Zerreißproben eines jungen Mannes und eines ganzen Dorfes. Es ist der große Roman über den turbulenten Aufbruch in jene Bundesrepublik, in der wir heute leben.
Zum Autor
Christoph Peters wurde 1966 in Kalkar geboren. Er ist Autor zahlreicher Romane und Erzählungsbände und wurde für seine Bücher mehrfach ausgezeichnet, unlängst z. B. mit dem Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg (2016) und dem Wolfgang-Koeppen-Preis (2018). Christoph Peters lebt heute in Berlin. Zuletzt erschienen von ihm bei Luchterhand der Erzählungsband »Selfie mit Sheikh« (2017) sowie der Roman »Das Jahr der Katze« (2018).
Christoph Peters
Dorfroman
Roman
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Bau des Schnellen Brüters ist Zeitgeschichte. Die handelnden Figuren dieses Romans sind fiktiv. Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt.
Copyright © 2020 Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: buxdesign, München
Covermotiv: Peter von Felbert; Plainpicture/BY
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-23526-0V002
www.luchterhand-literaturverlag.de
Meinen Eltern gewidmet, in Liebe und Dankbarkeit.
… und für Charlie: Ungefähr so war es vielleicht.
I.
Schwarzweiß. Alles, was wichtig ist, ist schwarzweiß. Es ist auf unangenehm riechendes Zeitungspapier gedruckt und wird vor Sonnenaufgang in unseren Briefkasten gestopft, oder es flimmert hinter einer leicht gewölbten Scheibe in einem großen Holzkasten. Ein schwarzweißer Mann mit Brille, einer kräftigen Stimme und ernsthaftem Gesichtsausdruck sitzt dort in Anzug und Krawatte vor einer grauen Fläche mit fettem Schriftzug, der in eine Weltkarte übergeht. Er liest klare, manchmal auch umständliche Sätze von einem akkurat zurechtgestoßenen Stapel Papier ab, wobei er sich Mühe gibt, so selten wie möglich auf seine Blätter zu schauen. Dazwischen erscheinen kurze Filme, in denen der Bundeskanzler oder Menschen aus anderen Weltgegenden gezeigt werden – zum Beispiel aus Amerika, Afrika oder Vietnam. Wer nach Amerika, Afrika oder Vietnam reisen will, muss ein Flugzeug nehmen, so weit sind diese Länder von uns entfernt, weshalb es meistens Präsidenten, Generäle oder Könige sind, die man dort sieht. Häufig liegen sie miteinander im Krieg, dann steigen Rauchwolken über Städten und Landschaften auf, Menschen mit vor Angst verzerrten Gesichtern rennen weg, die Kinder haben keine Kleider am Leib, stattdessen tragen sie verbrannte Lumpen oder sind von einer Schicht schwarzer Fliegen bedeckt und sogar zu schwach zum Weinen. Der schlimmste Krieg ist zur Zeit in Vietnam, davor war er in Biafra. Meine Mutter sagt jedes Mal, wenn darüber berichtet wird, dass sie gar nicht hinschauen kann, und oft bittet sie meinen Vater umzuschalten. Ihre Stimme klingt dann bedrückt, als müsste sie weinen. Das hängt damit zusammen, dass sie selbst, als bei uns Krieg war, ausgebombt wurde – in Essen – und auch gehungert hat.
Wenn die Präsidenten, Könige und Generäle nicht miteinander im Krieg sind, besuchen sie sich gern gegenseitig. Sie weihen neue Wolkenkratzer ein oder moderne Fabriken, taufen Ozeanriesen oder zeigen sich gegenseitig ihre Paläste. Dabei führen sie lange Gespräche darüber, wem dieses oder jenes Gebiet gehört oder wie sie gemeinsam Feinde erschrecken können, um zu verhindern, dass ein neuer Krieg ausbricht. Nachdem der Gastpräsident, -general oder -könig, meist in Begleitung seiner Frau, die hinter ihm aus der Luke tritt, gemessenen Schrittes die breite Treppe aus dem Flugzeug hinuntergestiegen ist, schüttelt er dem Gastgeber, der neben dem Rollfeld mit einer großen Zahl seiner Minister, Untergebenen und Fotografen wartet, ausgiebig die Hand. Anschließend gehen sie gemeinsam durch ein Spalier von Soldaten, die in schmucken Uniformen, wie mit dem Lineal gezogen, dastehen, ihre Gewehre auf Kommando vorstrecken, in die Luft stoßen oder auf den Boden stampfen. Manche der Präsidenten, Generäle und Könige haben eine schwarze Hautfarbe, hauptsächlich in Afrika. Auch in Amerika gibt es viele Schwarze, dort sind sie aber meist Sportler. Sie laufen in großen Stadien um die Wette, spielen Korbball oder tragen Boxkämpfe aus. Der berühmteste von ihnen heißt Cassius Clay. Mein Vater hat mich einmal nachts aus dem Bett geholt und auf den Schoß genommen, damit ich Cassius Clay nicht verpasse, denn er ist der beste von allen Boxern. Ich glaube schon, dass Schwarze gut boxen können, sie haben größere Muskeln als wir, obwohl auch mein Vater einen sehr dicken Bizeps hat, den er mich manchmal fühlen lässt, damit ich weiß, wie stark er ist, und dass ich keine Angst haben muss, weder vor Einbrechern noch vor den Leuten von der Baader-Meinhof-Bande und auch nicht vor dem Krieg.
Ich bin erst ein Mal echten Schwarzen begegnet. Das war in Calcar, wo mein Vater und ich Werkzeug kaufen wollten – er einen Fuchsschwanz, ich eine Laubsäge –, da kamen uns zwei schwarze Soldaten auf der Straße entgegen. Sie sprachen in einer Sprache, die wir nicht verstanden, und spazierten durch die Stadt, als wäre es das Normalste der Welt. »Kick ou dat aan: Da he chey twey ganze Schwatte«, sagte mein Vater, und wir staunten beide. Allerdings waren sie von der Farbe her viel weniger schwarz, als die Fernsehbilder einem vorgaukeln wollen. Sie hatten sich die Haare auf dem Kopf abrasiert, und ihre Haut glänzte wie weiche Bronze.
Neben den Präsidenten, Generälen und Königen werden auch häufig Ölscheichs gezeigt, wenn sie aus Flugzeugen steigen, Hände schütteln und Soldatenreihen abschreiten. Sie herrschen im Nahen Osten. Diese Gegend wird zwar »nah« genannt, ist in Wirklichkeit aber doch auch so weit entfernt, dass man ein Flugzeug nehmen muss, wenn man ihre Länder besuchen will. Die Ölscheichs tragen lange weiße Kaftane und auf dem Kopf karierte Tücher, die mit einer Kordel befestigt sind. »Ölscheich« ist bei den Rosenmontagszügen eine beliebte Verkleidung. Es scheint, dass sie viele Probleme haben, die sich direkt auf uns auswirken, weil unsere Autos mit Benzin oder Diesel fahren, die aus Öl gemacht werden. Wir haben außerdem eine Ölheizung im Keller. Das Öl der Scheichs wird in riesigen Schiffen über verschiedene Meere zu uns gebracht. Wenn die Ölscheichs unzufrieden sind, stoppen sie die Lieferungen oder nehmen Wucherpreise, so dass wir es uns nicht mehr leisten können. Mein Vater studiert immer die Anzeigen in der Zeitung, wann das Öl am billigsten ist, um den besten Zeitpunkt für den Kauf abzupassen. Ein- oder zweimal im Jahr kommt dann der Tankwagen und pumpt eine große Menge davon in unseren Heizungskeller.
Ganz gleich, wohin die wichtigen Leute reisen, nachdem sie das Flugzeug verlassen, Hände geschüttelt und Soldaten begutachtet haben, steigen sie immer in prächtige Limousinen und fahren in Begleitung blinkender Polizei- oder Militärfahrzeuge davon. Manchmal winken ihnen Leute am Straßenrand zu oder schwenken Fähnchen. Die größte und beste Limousine, die es auf der Welt gibt, ist der 600er Mercedes, weshalb sie nahezu allen Staatsführern zur Verfügung steht. Natürlich hat auch der Bundeskanzler einen 600er. Er heißt Willy Brandt und meine Mutter nennt ihn »Whisky-Willy«, weil er so viel trinkt, dass er eigentlich kein guter Bundeskanzler sein kann. Auch sonst gefällt er meinen Eltern nicht, denn er hat sich scheiden lassen und danach eine andere Frau geheiratet, was an sich schon von fragwürdigem Charakter zeugt, doch damit nicht genug: Obwohl er bereits einmal die Frau gewechselt hat, soll er zusätzlich noch »Freundinnen« haben. Meinen Eltern wäre es deshalb lieber, wenn Rainer Barzel Bundeskanzler würde, aber so einfach, wie sie es gern hätten, lässt sich ein Bundeskanzler nicht auswechseln.
Ganz gleich, wer in den 600er Mercedes steigt – mein Vater ist jedes Mal stolz, wenn er eine solche Limousine sieht, nicht nur, weil sie in Deutschland gebaut wird, sondern weil auch wir einen Mercedes fahren, einen 200er D. Das »D« steht für »Diesel«. Mein Vater sagt, dass ihm kein anderes Auto in die Garage kommt als ein Mercedes.
Das, was in den Nachrichten gezeigt wird, ist eigentlich nichts für uns Kinder, deshalb werden wir abends schon um sieben ins Bett gebracht. Wenn ich aber nicht einschlafen kann, weil sehr viel passiert auf der Welt, worüber ich mir Gedanken mache, schleiche ich die Treppe wieder hinunter, verstecke mich hinter der halb geöffneten Tür zwischen Küche und Esszimmer und schaue durch den Spalt, um in Erfahrung zu bringen, was meine Eltern vor uns verheimlichen. Es kann nämlich sein, dass auch bei uns bald wieder ein Krieg ausbricht, da die Russen unser Land erobern wollen, oder dass die Terroristen von der Baader-Meinhof-Bande auf dem Weg in unsere Gegend sind, um uns zu ermorden.
Sonntags, nach dem Internationalen Frühschoppen mit Journalisten aus verschiedenen Ländern und Werner Höfer als Gastgeber, läuft über Mittag die Tagesschau mit dem Wochenspiegel, so dass ich doch ungefähr Bescheid weiß, was gerade vor sich geht. Wenn meine Großeltern zu Besuch sind, schauen mein Vater und mein Großvater den Frühschoppen gemeinsam an. Obwohl sie einander nicht besonders gut leiden können, prosten sie sich mit Bier und Cognac zu, während meine Mutter und meine Großmutter ein Glas Wein trinken. Sobald das Essen auf dem Tisch steht, sagt meine Mutter, dass mein Vater den Apparat ausschalten soll, aber mein Großvater und er wollen nichts verpassen, weshalb der Fernseher meistens weiterläuft. Ich bleibe lieber still, denn wenn ich meinen Vater und meinen Großvater unterstützen würde, wüsste meine Mutter, dass ich genau hinschaue, und würde sich wieder Sorgen machen, dass ich schlecht träume.
Manchmal verwackelt das Bild mitten in der Übertragung oder es reißt ganz ab und man sieht nur Schnee: ein Flimmern aus winzigen schwarzen und weißen Punkten, das einen regelrecht wütend macht, wenn man länger hinschaut. Selbst meine Mutter, die sonst immer behauptet, dass es sie sowieso nicht interessiert, was im Fernsehen kommt, schimpft dann: »Ich sag doch, dass etwas nicht stimmt mit dem Apparat: Du musst den Schmitz anrufen.«
Der Schmitz ist unser Radio- und Fernsehhändler. Bevor mein Vater zum Telefonhörer greift, öffnet er erst einmal das kleine Schubfach mit den nummerierten Rädchen rechts unten neben dem Bildschirm. Es kann sein, dass das Bild sich fängt, wenn er das entsprechende Rädchen ganz vorsichtig in die richtige Position dreht – das ist Millimeterarbeit. Oft verschwindet es aber auch ganz. Mein Vater versucht dann herauszufinden, ob es eine allgemeine Übertragungsstörung ist oder an unserem Apparat liegt, indem er auf die beiden anderen Programme und den Holländer umschaltet. Der Holländer ist sowieso immer verschneit, weil er von jenseits der Grenze, aus der Stadt Hilversum gesendet wird, aber man kann trotzdem erkennen, was gerade läuft. Mein Vater versteht sogar, was sie dort sagen. Die Wettervorhersage beim Holländer soll sehr viel zuverlässiger sein als bei uns, allerdings findet meine Mutter die holländische Sprache so hässlich, dass sie lieber unsere eigene Wettervorhersage schaut. Wenn die anderen Programme und auch der Holländer ordnungsgemäß zu sehen sind, liegt der Fehler wahrscheinlich an unserer Antenne, die vom Wind verdreht oder verbogen wurde oder sich aus anderen Gründen nicht mehr in der richtigen Position befindet. Das will mein Vater lieber erst einmal selbst überprüfen, bevor er den Schmitz kommen lässt, zumal der Schmitz Geld kostet. Er geht in die Garage, holt die lange Leiter, die dort an der Wand hängt, und steigt aufs Dach, während meine Mutter neben dem Fernseher steht und das Fenster öffnet, damit sie hören kann, was er von oben ruft. Meine Mutter hat immer Angst, dass mein Vater herunterfällt und sich den Hals bricht, wenn er auf dem Dach ist. Sich den Hals zu brechen ist eine der Gefahren, die überall drohen, ganz gleich, ob man auf Bäume klettert, zu wild Fahrrad fährt oder auf dem Dach herumspaziert. Meistens gehe ich mit meinem Vater nach draußen und schaue vom Rasen aus zu, wie er die Antenne zurechtrückt. Außer dem Schmitz und dem Schornsteinfeger traut sich niemand dort oben hin, weshalb ich stolz bin, dass mein Vater sich so sicher auf den Ziegeln bewegt und sogar die Antenne reparieren kann, wofür man eigentlich einen Fachmann braucht.
Für uns Kinder gibt es eigene Sendungen mit »Skippy«, dem Buschkänguru, »Lassie«, dem Collie, und »Flipper«, dem klugen Delfin. Diese Tiere sind echte Freunde, wie man sie selbst unter Menschen selten findet – eigentlich gar nicht. Sie helfen bei der Aufklärung von Diebstählen, Schmuggel oder sonstigen Verbrechen, so dass man sich keine Sorgen mehr machen muss, wenn man eines von ihnen an seiner Seite hat. Leider gibt es solche Tiere bei uns nicht, obwohl sehr viele Tiere im Dorf leben: Kühe, Schweine, Pferde, der Esel von Bauer Seesing, Katzen, Hühner, Enten und Gänse, ganz zu schweigen von Wildtieren wie Füchsen, Mardern, Rehen, Hasen, Fasanen und Rebhühnern, die nach der Treibjagd auf dem Platz vor der Gaststätte Pooth ausgebreitet sind. Hunde gibt es natürlich auch, aber keinen wie Lassie. Die hiesigen Hunde sind angekettet oder in Zwingern eingesperrt. Die meisten beißen, und man soll sich ihnen nicht nähern. Da meine Mutter keinen Hund im Haus will und mein Vater eine Abneigung gegen Katzen hat, haben wir lediglich Kaninchen und das Meerschweinchen Mary. Sie wohnen in Ställen draußen unter dem Küchenfenster. Manchmal bekommen die Kaninchen Junge, die ganz nackt sind und geschlossene Augen haben. Wenn es zu viele geworden sind, schlachtet mein Vater eins von ihnen und es wird am darauffolgenden Sonntag gegessen. Das Meerschweinchen Mary ist weiß und hat rote Augen. Es scheint klüger zu sein als die Kaninchen, die, ganz egal, wie viel ich mich mit ihnen beschäftige, nicht den Eindruck machen, als verstünden sie irgendetwas von dem, was ich ihnen sage, so dass wir weit entfernt von einer Freundschaft sind, wie Sonny sie mit Skippy oder Jeff mit Lassie hat.
Verglichen mit den anderen Kindern in der Nachbarschaft, dürfen mein Bruder und ich nur wenig fernsehen. Uwe Fonck, Wilfried Fischer, Werner Terhorst und auch meine Vettern schauen regelmäßig Sendungen, die bis in die Nacht dauern und eigentlich für Erwachsene gedacht sind, zum Beispiel »Der Kommissar«, »Tatort«, »Raumpatrouille« oder auch die »Winnetou«-Filme. Meine Mutter ist trotzdem nicht bereit, ihre Meinung zu ändern, als ich ihr davon erzähle: »Was die anderen tun, interessiert uns nicht«, sagt sie.
Wenn der Fernsehapparat aus ist, glänzt die Scheibe anthrazitfarben und spiegelt das ganze Esszimmer auf merkwürdig verkrümmte Art: der Tisch mit der weißen Stickdecke, die Frau Heinen für uns gemacht hat, davor die Eckbank, in der die Spiele, die dicken Versandhauskataloge und das Stopfzeug aufbewahrt werden, dazu drei Stühle, der Fernsehsessel, in dem normalerweise mein Vater sitzt – oder eben mein Großvater, wenn er zu Besuch ist, denn er ist der Ältere. Man sieht sogar den kleinen Wandteppich mit der Begegnung von Maria und der Base Elisabeth, den meine Mutter während ihres Studiums selbst gewebt hat, und den »Sämann« von van Gogh mit der riesigen dunklen Sonne und dem knorrigen Weidenstamm in der Scheibe schimmern.
Tritt man ganz nah heran, so dass man das Glas fast mit der Nasenspitze berührt, ist man selber verzerrt wie in einem Kirmesbudenspiegel. Wenn man dagegenbläst, beschlägt es vom Atem. In das runde Feld, das dann entsteht, kann man mit dem Finger ein Punkt-Punkt-Komma-Strich-Gesicht zeichnen, das sich schnell wieder in Luft auflöst, aber nur fast: Der Umriss bleibt ganz schwach erhalten, weshalb meine Mutter sagt, wir sollen das lassen, wenn sie uns dabei erwischt, da sie sonst den Ärger damit hat – wobei es eigentlich Tante Rieke ist, die die Scheibe blankwischt.
Bislang ist in unserer Gegend nie etwas passiert, das wichtig genug gewesen wäre, um im Fernsehen gezeigt zu werden. Der bedeutendste Mann, der je unser Dorf besucht hat, war Weihbischof Kerventropp, um den Jugendlichen, unter anderem auch meiner Cousine Gerda, die Firmung zu spenden. Vorher sind alle zwei Wochen lang mit Vorbereitungen beschäftigt gewesen. Als der Weihbischof kam, auch in einer Mercedes-Limousine, aber doch nur in einem 280er, haben die Leute ihm der Reihe nach den Ring geküsst, meine Mutter jedoch nicht, weil sie nie irgendwo gehört hat, dass Jesus sich einen Ring hat küssen lassen – er hatte wahrscheinlich gar keinen Ring.
Als meine Mutter nach dem Frühstück die Samstagszeitung liest, sagt sie: »Wir dürfen nachher nicht vergessen Hier und Heute zu gucken: Da sind wir nämlich drin.«
Mein Vater sagt: »Die waren bei Fritz Opgenrhein auf dem Hof und haben mit Ernst Winkels gesprochen. – Wie sie an den gekommen sind, weiß ich auch nicht.«
Ich glaube erst, dass sie Witze machen, weil mir die ganze Woche über nirgends etwas Besonderes aufgefallen ist, aber dann sprechen sie beim Mittagessen wieder darüber, mein Vater hört anderthalb Stunden früher als sonst mit der Gartenarbeit auf, wir fahren auch nicht in die Vorabendmesse, sondern gehen morgen ins Hochamt.
Das Dritte Programm ist schon zehn Minuten vor Beginn der Sendung eingeschaltet, damit wir auf keinen Fall etwas verpassen und mein Vater noch reagieren kann, falls Schnee kommt. Heute ist das Bild aber zum Glück klar. »Jetzt bin ich mal gespannt, was sie daraus gemacht haben«, sagt meine Mutter, als endlich der Hier-und-Heute-Vorspann mit der Elektroorgelmelodie und dem kreisenden Würfel anfängt, auf dem sich ein Kohleberg, grasende Schweine, Schwäne im Park, Fachwerkhäuser, der Hafen von Duisburg, der Kölner Dom und Berge aus dem Sauerland drehen.
Tatsächlich erscheint jetzt der Rhein im Bild, wie er bei uns hinter dem Haus fließt, genauso schwarzweiß wie Tom Saw-yers Mississippi oder der Nil in Ägypten. »Der Verbrauch von elektrischem Strom wird auch in Zukunft aufgrund seiner besonders umwelt- und anwendungsfreundlichen Eigenschaften ständig zunehmen …«, sagt eine Männerstimme, während ein Schubschiff und ein Kohlefrachter unter der Schanzer Brücke hindurchfahren. »Wissenschaftler und Techniker in der ganzen Welt arbeiten zur Zeit an der Entwicklung schneller Brutreaktoren. Es sind Kernkraftwerke der zweiten Generation, die nach einer längeren Erprobungsphase in einigen Jahren zum kommerziellen Einsatz kommen sollen.«
In den Rheinwiesen steht noch ein Rest vom letzten Hochwasser und spiegelt den weißen Himmel als weiße Fläche, darin die Kopfweiden, die wir oft als Baumhäuser nutzen – auch die, in der ich neulich das Käuzchen gesehen habe. Sie zeigen die Wiesen mit den schwarzweißen Milchkühen von Bauer Seesing gleich vor dem Deich, die ich genau kenne, weil ich ihm nachmittags manchmal helfe, sie von dort in den Stall zu treiben. Es sind nicht Wiesen, die so ähnlich aussehen, sondern genau diese Wiesen, daran besteht kein Zweifel. Sie enden an Haus Hülkendonck, dem Hof von Bauer Seesing, der früher die Burg des Raubritters Hilbert war. Daneben steht unsere Kirche, Sankt Verafredis, mit dem Friedhof und der alten Schule, wo wir bis vor drei Jahren gewohnt haben, daran angrenzend die Höfe der Bauern Praats, Seesing und van Elst. Mit Frau Seesing, Frau Praats und Frau van Elst fährt meine Mutter einmal im Monat zum Kaffeeklatsch nach Schloich. Dort essen sie Schwarzwälder Kirschtorte, während ich mit meinem Großvater im Stadtpark die Enten füttere oder in die Zoohandlung Bruns gehe, wo es Aquarienfische, Papageien und sogar Affen zu kaufen gibt, die genauso aussehen wie Herr Nilsson von Pippi Langstrumpf. Leider hat mir meine Mutter verboten, so einen Affen zu halten. – Man erkennt die Küsterei mit der riesigen alten Kastanie, dann die Gaststätte Pooth, keine zweihundert Meter von unserem Haus entfernt, und mein Vater sagt zu meiner Mutter: »Wenn sie die Kamera ein bisschen weiter rechts aufgestellt hätten, wäre dein Haus drauf gewesen.«
Auch wenn wir schon gewusst haben, dass Hülkendonck im Fernsehen sein würde, staunen meine Eltern jetzt doch und sagen bei jedem Gebäude, das auf dem Bildschirm erscheint, wem es gehört oder wer dort wohnt. Ein Professor tritt ins Bild und erklärt: »Brutreaktoren sind ein wichtiger Schritt hin zu einer langfristigen und preisgünstigen Stromversorgung. Mithilfe der Brutreaktoren kann die Energieerzeugung aus den vorhandenen Uranvorkommen vervielfacht werden, da diese Reaktoren den in den bisherigen Kernreaktoren nicht spaltbaren Teil des Urans in spaltbares Plutonium umwandeln. Um dieses ungeheure Energiepotential wirtschaftlich nutzen zu können, arbeiten derzeit alle führenden Industrienationen an der Brüter-Technologie.«
Danach spricht ein Minister und sagt, dass der Standort Calcar in jeder Hinsicht ideal für das Projekt ist und dass es keinen vernünftigen Grund gibt, an der Sicherheit der Anlage zu zweifeln. Sie wird sogar gegen Erdbeben und Flugzeugabstürze gewappnet sein. Es folgen Bilder vom Calcarer Marktplatz, dann aus der Nikolai-Kirche, wo wir zur Messe gehen, wenn meine Mutter unseren Pastor und sein Gequassel nicht mehr hören kann. Vor dem Rathaus ist gerade Wochenmarkt. Man sieht den Käsewagen, den Fischwagen und Blumenstände. Etwas abseits davon haben sich einige Leute versammelt und treten jetzt näher. Ein Mann, der so alt ist wie mein Vater, wird gefragt, was er darüber denkt, dass hier ein Kernkraftwerk gebaut werden soll, ob er es begrüßt oder sich doch eher Sorgen macht? Er sagt: »Ich finde das eine gute Sache, man muss ja dem Neuen gegenüber aufgeschlossen sein, und die Ingenieure wissen schon, was sie tun, das sind ja auch Leute mit Verantwortungsgefühl.« Ein anderer sagt: »Es wird höchste Zeit, dass hier in der Gegend mal investiert wird, es gibt doch kaum Arbeitsplätze für die Leute, und Strom wird immer mehr gebraucht.«
Der Mann, der als Letzter gefragt wird, sieht es allerdings anders: »Das ist viel zu gefährlich mit der Atomspaltung, deswegen wollen sie das ja bei uns in der Gegend bauen, weil es hier so dünn besiedelt ist, und wenn dann was passiert, gibt es halt weniger Opfer unter der Bevölkerung … Daraus wird nicht einmal ein Geheimnis gemacht von den Politikern in Bonn und Düsseldorf.«
Während er noch redet, sagt mein Vater zu meiner Mutter: »Kennst du den? – Eigentlich müsstest du den kennen.«
Meine Mutter schüttelt den Kopf.
»Das ist Hein Thissen, der die Samenhandlung in der Monrestraße hat. Es heißt ja, dass er so gut wie pleite ist, aber reden konnte der immer gut, ganz egal, ob er was davon versteht oder nicht. Enen rechtigen Schwätzbüll is dat.«
2.
Bei Schanz verlasse ich die Autobahn, fahre über die Bundesstraße durch das weite Grasland Richtung Rheinbrücke. Gestaffelte Wolkenbänder vor blauem Himmel, Frühsommerwetter. –
Fast sechshundert Kilometer Fahrt liegen hinter mir. Auf dem Weg durch Brandenburg habe ich mich zum wiederholten Mal gefragt, ob ich die dortige Landschaft von der hiesigen unterscheiden könnte, wenn ich nicht wüsste, wo ich bin. Beim Überqueren der Elbe ein fehlgeleitetes Gefühl von Vertrautheit, gefolgt von Irritation. Verlassene Wachtürme, die mich noch immer nichts angehen. Entlang der A2, hinter der ehemaligen Zonengrenze, dann eine Reihe von Städten, die jahrzehntelang lediglich Fußballmannschaften waren: Eintracht Braunschweig, Hannover 96, Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund, Schalke 04, Rot-Weiß Oberhausen. Dort der Wechsel auf die A3, die durch Holland an die Nordsee, in entgegengesetzter Richtung gen Süden führt.
Rechts der Straße zerfällt eine ehemalige Ziegelbrennerei. Das Dach ist eingestürzt, die Scheiben zerschlagen, zwei Schornsteine stehen noch, notdürftig von Eisenmanschetten zusammengehalten; links das dunkle Klinkergebäude der Raiffeisen Futter- und Düngemittelhandlung, um 1900 aus den Backsteinen der Brennerei gegenüber errichtet. Die unteren Fenster sind mit Sperrholzplatten vernagelt. Ein alter Passat vor der Rampe zum Eingang zeigt, dass jemand dort wohnt. Oben halb geschlossene Gardinen, eine kümmerliche Yucca-Palme.
Hülkendonck, das Dorf, aus dem ich stamme, befindet sich auf der anderen Seite des Flusses: linksrheinisch.
Es folgt der große Kreisverkehr mit der geometrischen Skulptur aus dünnen, ineinandergesteckten Edelstahlrohren. Sie stellt ein Symbol für irgendetwas dar, wahrscheinlich Wissenschaft und Technik, Fortschritt und Transparenz. Kurz darauf Flachbauten aus Betonplatten: das vorgelagerte Einkaufszentrum samt Tankstelle, Waschstraße.
Das Einkaufszentrum gab es schon Anfang der 70er Jahre. Damals hieß es Selbego und man brauchte eine spezielle Karte, um dort einzukaufen, die meine Mutter sich manchmal von einer Nachbarin – vielleicht Frau van Elst – auslieh. Außerdem stand in Schanz das einzige Schwimmbad weit und breit, so dass mein Vater und ich regelmäßig abends, nachdem er von der Arbeit gekommen war, auf die andere Rheinseite fuhren. Im Gefolge dieses Begriffs zum ersten Mal die Unterscheidung zwischen uns und den anderen.
Der Pegelstand ist niedrig; breite Sandstrände zwischen tief in die Strömung reichenden Basaltaufschüttungen zum Schutz des Ufers. Als Kind habe ich dort Vögel aus gelbem Lehm geformt und auf Wunder gewartet, Flaschen mit Briefen ins Wasser geworfen: erfundene Hilferufe aus Piratenkerkern, Freundschaftsanfragen an die ganze Welt. Es hat nie jemand geantwortet. Der Fluss roch nach verklapptem Öl, tote Fische trieben bauchoben zwischen den Steinblöcken. Eigentlich hätten wir nicht einmal mit nackten Füßen darin waten dürfen, aber da nie Erwachsene mit uns am Fluss waren, sind wir bis zu den Knien hineingegangen, hatten einen schmierigen, stinkenden Film auf den Beinen und die heimliche Angst überwunden, von der Strömung fortgerissen zu werden.
Das Wasser fließt ruhig und stahlgrau dem Meer zu. Von Holland kommend fährt ein Frachter stromaufwärts, auf dem Container aus China oder Korea gestapelt sind. Ich sehe den Kühlturm des Schnellen Brüters, der jetzt »Kernwasserwunderland« heißt und ein Freizeitpark ist, mit Kirmesattraktionen für die Kinder, dazu Spielcasinos und All-you-can-eat-Angebote für die Erwachsenen. Sie kommen in Reisebussen, angeblich hauptsächlich aus Holland. Im Dorf lässt sich nie einer von ihnen blicken – wozu auch?
Tatsächlich ändert sich etwas, sobald ich die Brücke überquert habe – schwer zu fassen, nicht vernünftig begründbar.
Unmittelbar nach der Abfahrt von der Schnellstraße folgt die Gärtnerei Rath, in der die meisten wichtigen Blumengebinde meines Lebens gefertigt wurden: Kränze für die Beerdigungen der Großeltern, zweier Onkel; Geburtstagssträuße, Hochzeitsschmuck. Rechterhand grast ein Dutzend Milchkühe der alten Rasse »Schwarzbuntes Niederungsrind«. Früher waren sie fester Bestandteil der Landschaft, seit fünfzehn Jahren nimmt ihre Zahl kontinuierlich ab. Stattdessen sieht man »Charolais«-Herden, in denen die Kälber und der Bulle mitlaufen, und riesige schmucklose Hallen mit Wellblechdächern. Darin befinden sich die vom Besamer per Hand gezeugten Nachfolgerinnen der Kühe, die ich als Kind in den Melkstall getrieben habe. Die Tiere in den Hallen kennen weder Sonne noch frisches Gras, lassen sich ihre Milch von computergesteuerten Melkrobotern entnehmen, wenn ihnen danach zumute ist. Unmittelbar im Anschluss werden, ebenfalls automatisiert, biochemische Analysen der frischen Milch durchgeführt. Bei ersten Anzeichen einer Krankheit erfolgt mit der nächsten Fütterung chipgesteuert die entsprechende Medikamentengabe. Auf diese Weise werden Entzündungen des Euters frühzeitig erkannt und können schonender behandelt werden, so dass sich weniger Antibiotikarückstände in der Milch befinden.
Links der Golfplatz: Wo früher Ackerland war, ziehen sich jetzt Rasenflächen, künstliche Teiche, Sandkuhlen und kleine Hügel hin, dazwischen neu angepflanzte Büsche, Hecken, Baumgruppen. Sie imitieren eine Landschaft, die es nirgends gibt. Man muss weder besonders reich noch Mitglied eines Clubs sein, wenn man dort spielen will, sondern lediglich einem Trainer vorführen, dass man keine Löcher ins Grün schlägt.
Dann, unmittelbar neben der Straße auf einem hohen Mast: das Hülkendoncker Storchennest. Seit einigen Jahren brüten wieder Störche im Dorf. Ich müsste mich ganz nach vorn über das Steuer beugen, den Kopf scharf zur Seite drehen, um festzustellen, ob sie gerade da sind oder irgendwo über die Äcker stolzieren auf der Suche nach Mäusen, Fröschen, Heuschrecken. Ab den zwanziger Jahren, noch vor der Geburt meines Vaters, waren sie weggeblieben, ich weiß nicht, warum: Die Flurbereinigung lag noch in weiter Ferne, der Rhein überschwemmte regelmäßig das Land, viele Wiesen waren wochenlang sumpfig.
»Wenn die Störche zurückkehren, ziehe ich auch wieder an den Niederrhein«, habe ich zu meinem Vater gesagt, als die Möglichkeit noch völlig ausgeschlossen war. Bislang hat er mich nicht daran erinnert.
Das Ortsschild »Hülkendonck, Stadt Calcar, Kreis Cleve«.
Kurz vor dem Deich liegt der Gebäudekomplex, der einmal der Hof meines Onkels, meiner Großeltern gewesen ist. Der Vater meines Vaters ist sechs Jahre vor meiner Geburt gestorben – ich kenne ihn nur aus Geschichten und von einem verschwommenen Foto: einem vergrößerten Passbild, das gerahmt im Esszimmer meiner Eltern hängt. Auch dort, wo wir herkommen, keine Tiere, keine Landwirtschaft mehr. Schon zu Lebzeiten meines Onkels zeichnete sich ab, dass von den Cousinen niemand Bäuerin werden wollte. Abgesehen davon wäre der Betrieb zu klein für die agrarindustrielle Zukunft gewesen. Es fehlte das Kapital, ihn durch Landkäufe, die Anschaffung moderner Maschinen wieder markttauglich zu machen. Das Leben dort war so, wie ich mir vorstellen möchte, dass das Landleben in früheren Zeiten gewesen ist: ruhige, wenn auch schwere körperliche Arbeit jahrein jahraus, kein Gedanke an Urlaub; Nachbarn, die einander helfen; achtungsvoller aber unsentimentaler Umgang mit den Tieren: Sie ziehen den Pflug, geben Milch, legen Eier, werden geschlachtet; im Gegenzug erhalten sie sichere Versorgung, Schutz vor Kälte und Raubtieren, werden vom Tierarzt behandelt, wenn sie krank sind. Verglichen mit dem Verhungern, Erfrieren, dem Krepieren an Verletzungen, Krankheiten und mit dem lebendig Zerrissenwerden durch Bären oder ein Wolfsrudel ist der Schuss mit der Bolzenpistole ein gnädiger Tod.
Mag sein, dass das Verklärungen sind.
Die jüngste meiner Cousinen hat an die Stelle des alten Schweinestalls, der – obwohl erst in den fünfziger Jahren errichtet – für mich das Urbild aller Ställe gewesen ist, ihr Wohnhaus gesetzt. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich daran vorbeifahre, aber als sie den Stall hat abreißen lassen, hat niemand auch nur darüber nachgedacht, sie davon abzuhalten. Nicht einmal mein Vater hatte etwas daran auszusetzen: Man baut an und um, erweitert, modernisiert, immer den aktuellen Erfordernissen entsprechend. Wozu soll man einen Schweinestall stehen lassen, wenn keiner Schweine hält und sich damit ohnehin kein Geld mehr verdienen lässt. Zu diesem Zeitpunkt, fünfzehn Jahre nach dem Tod seines Bruders, meines Onkels Koeb, der eigentlich Jakob hieß, hatte die Auflösung des Dorfes längst alle Bereiche erfasst: Architektur, Landmaschinentechnologie, Tierhaltungsstandards, Nachbarschaftsverhältnisse, den Glauben an Gott. Denen, die geblieben waren, erschienen die Veränderungen ohnehin nicht wie Auflösung, sondern als Fortschritt: Stahlbeton, PVC, Plastik, leistungsstärkere Traktoren, optimiertes Saatgut, leichtere Arbeit, verbesserte Hygiene, Urlaubsreisen, Fernsehunterhaltung; die Freiheit, selbst zu entscheiden, mit wem man schläft, ob man heiratet oder nicht.
Ich biege rechts in den Feldweg ein, fahre vorbei am Hof von Onkel Erwin und Tante Mia, der auch schon lange stillgelegt ist. Sie sind nicht direkt mit uns verwandt. Onkel Erwin ist der Bruder von Onkel Herm gewesen, der Tante Leni, die ältere Schwester meines Vaters, geheiratet hat.
Es folgt das vergitterte Heiligenhäuschen, das bei der Fronleichnamsprozession als einer der vier Stationsaltäre dient. Weiter vorn, unmittelbar vor dem Deich, die Kläranlage, deren Gestank manchmal zu uns herüberweht; daneben zwei Windräder, die mit ihren Flügeln die Luft zerhacken.
Obwohl ich seit dreißig Jahren nicht mehr hier wohne, scheint mir alles vertraut, als wären es meine Besitzungen. In Wirklichkeit ist fast nichts mehr so wie zu der Zeit, als ich hier gelebt habe.
Ich erreiche die Straße, in der unser Haus steht. Meine Eltern hatten es in Rufweite der Neuen Schule geplant, weil meine Mutter dort Lehrerin war. Doch noch ehe wir in das Haus einzogen, anderthalb Jahre nach der feierlichen Einweihung, wurde die Schule geschlossen, denn Hülkendonck war Teil der Stadt Calcar geworden und hatte seine jahrhundertelange Selbständigkeit eingebüßt. Neue Verwaltungseinheiten wurden gebildet, um Abläufe zu verbessern, Kosten zu reduzieren. In der Folge mussten die meisten Kinder eine Dreiviertelstunde mit dem Bus fahren, um in den Nachbardörfern zur Schule zu gehen. Die überflüssigen Gebäude wurden im Lauf der Jahre für Näh-, Koch- und Töpferkurse, Gemeindefeste, als öffentliche Bücherei, Antiquitätengeschäft und Sitz verschiedener Unternehmen genutzt, die sich allesamt nicht lange hielten. Daneben weideten Rinder, die häufig ausbrachen und unseren Garten verwüsteten. In den Dornenhecken zwischen Kopfweiden brüteten Neuntöter, Wachteln, im Frühling hatten unzählige Raupen die Äste eingesponnen. Links von unserem Haus war eine Wiese, auf der Sauen und ein Eber liefen, hinten reichten die Getreidefelder bis an den Deich. Das ist lange her. Inzwischen liegt das Haus inmitten einer dichten Siedlung. Das Land war bereits ab Ende der 1960er zum Bebauungsgebiet erklärt worden, doch solange es noch so aussah, als ob der Schnelle Brüter bald als richtiges Atomkraftwerk Strom erzeugen sollte, wollte sich niemand hier niederlassen. Erst nachdem feststand, dass es nicht in Betrieb gehen würde, kauften und bebauten Leute die Grundstücke. Die meisten von ihnen stammten von irgendwoher, aus dem Ruhrgebiet, Düsseldorf, später auch vermehrt Holländer, da die Grundstückspreise hier günstiger waren als jenseits der Grenze, außerdem Spätaussiedler aus Russland und Polen. Sie wussten nichts über das Leben im Dorf Hülkendonck, und wenn sie etwas darüber gewusst hätten, wären sie kaum bereit gewesen, sich all den ungeschriebenen Gesetzen, Nachbarschaftsregeln und katholischen Ritualverpflichtungen zu unterwerfen. Sie setzten ihre Einfamilienhäuser in mittelgroße Gärten, als würden sie irgendwo im Niemandsland die Heimstatt für einen Lebenstraum errichten, der ihnen ganz alleine gehört. Jetzt stehen dort kanadische und schwedische Modelle in Holzbauweise, ein postmodern avantgardistischer Reihenhausversuch, ebenfalls mit hohem Holzanteil, dazu rostfreier Stahl und großzügige Glasfronten. Es gibt eine Katalogvilla mit weißem Klinker, blauglasierten Schindeln und Betongusssäulen in pseudo-antikem Stil, diverse Einzelgebäude ohne Eigenart, Mehrfamilienhäuser in rotem Backstein, wie er in der Gegend von alters her verbaut wird. Der Spielplatz wurde aufwendig neu gestaltet, doch man sieht nie Kinder dort spielen. Sie rasen auch nicht mehr mit ihren Tretrollern, Fahrrädern oder Kettcars die Straße rauf und runter. Wahrscheinlich ist es den Eltern zu gefährlich oder die Kinder verbringen sowieso den ganzen Tag in Kindergärten und Schulen mit angeschlossener Hortbetreuung, wo sie pädagogisch wertvollen Beschäftigungen ausgesetzt sind, statt am Rhein oder bei den letzten Bauern, die auf ihren produktionsoptimierten Höfen ohnehin keine Verwendung für Kinder mehr hätten, ihre Zeit zu vertrödeln. Die alte Schmiede samt Aloys, dem Schmied, wurde ebenso überflüssig wie der Schreiner, die Schneiderei und der Bäcker Gerritsen mit angeschlossenem Laden. Dort gab es alles, was man brauchte, aber es war teurer als im Supermarkt, und beim Bezahlen musste man sich Frau Gerritsens niemals endenden Monolog über die Weltlage im Kleinen und Großen anhören, was nicht jeder mochte.
Ein knatterndes Mofa kommt mir entgegen. Ich weiche auf den Grünstreifen aus. Der Mann ist zwischen siebzig und neunzig, trägt eine Prinz-Heinrich-Mütze und grüßt, indem er kurz die Hand vom Lenker hebt. Vermutlich kenne ich ihn seit Kindertagen: Zugezogene grüßen nicht auf diese Weise, und vor allem fahren sie nicht Mofa. Sie strampeln sich unter aerodynamischen Helmen in neonfarbenen Radlerhosen auf individuell zusammenmontierten Rennrädern oder Mountainbikes ab; die Älteren leisten sich Pedelecs.
Ich setze den Blinker, biege in die Einfahrt, halte vor unserem Haus. Mein Vater ist vierundachtzig geworden im vergangenen Jahr, meine Mutter wird ihm diesen Winter folgen – »so Gott will«, wie sie sagt. Noch können sie hier zu zweit ohne Hilfe leben. Niemand weiß, wie lange noch – niemand hat eine Idee, was zu tun ist, wenn es nicht mehr geht.
Ich stelle den Motor ab, betrachte die sorgsam gepflegten Blumenbeete und Rasenflächen, um die sich jetzt nicht mehr mein Vater kümmert, sondern ein Gärtner, den er bezahlt. Er hat damit auch nicht seinen Neffen Rolf, den jüngsten Sohn seiner vor zwanzig Jahren verstorbenen Schwester Leni beauftragt, der ausgebildeter Gärtner ist, sondern einen Kosovo-Albaner, Herrn Gjokaj, den ihm eine ehemalige Kollegin meiner Mutter empfohlen hat.
Ich öffne die Wagentür, zögere.
Es gab diesen Moment, als ich vor dem frisch gebauten Haus, auf dem mit grauen Natursteinplatten gedeckten Weg zur Tür stand. Wir waren vom Einkaufen gekommen und gerade aus dem Wagen gestiegen. Der Rasen war noch nicht einmal ausgesät, die serbische Fichte noch nicht in die Mitte der Fläche gepflanzt, die der Rasen werden sollte, umgeben von Blumenbeeten. Ich weiß nicht, ob es gewesen ist, bevor oder nachdem die Lupinen geblüht hatten, weiß aber, dass irgendwann zu dieser Zeit die Fläche ein Lupinenfeld war, weil Lupinen den Boden mit Stickstoff anreichern – dann wächst das Gras später besser. Demnach muss es 1969 oder ’70 gewesen sein. Ich war drei, höchstens vier Jahre alt, und strenggenommen dürfte ich an diese Zeit keine Erinnerung haben. Hinter mir meine Mutter, mein Vater, die unsere Körbe oder Plastiktüten aus dem Kofferraum ins Haus tragen. Vielleicht habe auch ich eine Tüte, weil ich mich nützlich machen und nicht mit den Händen in den Hosentaschen herumstehen soll. Ich weiß, dass das Licht hell aber nicht sonnig war, unter einer dünnen gleichförmigen Wolkendecke, die keinen Regen ankündigte, sondern einfach den Himmel verhängte. Es war warm, nicht heiß. Ich hätte mich wohl fühlen müssen in meiner Haut. Vielleicht habe ich mich auch wohl gefühlt, das ist durchaus möglich. Vielleicht ist das Wohlfühlen, die Sicherheit – meine Eltern sind da, wir haben genug zu essen, leckere Sachen, auf die ich mich freue – sogar der Auslöser gewesen. Aus irgendeinem Grund bin ich, mit oder ohne Einkaufstasche, auf die geharkte Erde getreten, obwohl ich es eigentlich nicht sollte, weil ich dann den ganzen Dreck ins Haus tragen, frische Keime zertreten würde. Möglicherweise bin ich einem bunten Vogel gefolgt, einem Rotschwänzchen, das während der ersten zwei oder drei Jahre unter dem Dach genistet hat, bevor der Giebel von dünnen Schieferplatten verschlossen wurde, danach nie wieder, so dass meine Mutter regelmäßig im Frühling sagte: »Ich hab das Rotschwänzchen noch gar nicht gesehen.«
Ich habe mich gedreht, ganz langsam um mich selbst, während mein Vater mit meiner Mutter über irgendetwas gesprochen hat, das mit dem Haus oder den Einkäufen in Zusammenhang stand, sicherlich freundlich, denn sie haben immer freundlich miteinander gesprochen in all den Jahren, die ich sie kenne. Ich habe sie dort stehen sehen, beide mit ihren großen, fast rechteckigen Hornsonnenbrillen vor den Augen, obwohl die Sonne verdeckt war, und auf einmal senkte sich eine Glocke über mich oder die Luft dickte ein, so dass ich ganz abgeschottet von allem war, und auch den Vogel, den ich vielleicht gesucht hatte, gab es nicht mehr. In diesem Moment wusste ich, dass sie mich nicht schützen konnten, mein Vater nicht und meine Mutter nicht – dass ich allein war.
III.
Unser nächster Nachbar ist Herr Hampel mit seiner Familie. Herr Hampel ist der Melker von Bauer Seesing. Zwischen ihrem Haus und unserem liegt eine Rinderweide. Hampels haben vier Kinder: Frank, Hubert, Britta und Christel. Frank ist schon siebzehn. Er macht eine Lehre und fährt Mokick, aber man sieht ihn selten auf der Straße. Sein Mokick ist viel schneller als die frisierten Mofas der anderen, so dass es für ihn langweilig wäre, Rennen gegen sie zu fahren. Hubert ist vier Jahre älter als ich, Britta zwei, Christel eins. Hubert und ich spielen oft zusammen Fußball auf der Wiese vor der Neuen Schule. Sie wird regelmäßig gemäht und gegen Unkraut gespritzt, weshalb weder Disteln noch Brennnesseln dort wachsen. Anders als auf den Weiden rund um unser Haus, wo man auch spielen könnte, solange die Tiere anderswo stehen, ist sie nicht voller Löcher und Kuhfladen. Längs der Wiese, zur Straße hin, sind dichte Büsche, dahinter verläuft eine flache Mauer, so dass wir nicht ständig dem Ball hinterherrennen müssen, sobald einer danebenschießt. Manchmal spielen Werner Terhorst, Wilfried Fischer oder Uwe Fonck mit, aber oft sind es nur Hubert und ich. Jeder von uns ist dann die ganze Mannschaft in einer Person, hauptsächlich aber der Torwart, und Hubert ist immer Wolfgang Kleff. Ich wäre auch gern Wolfgang Kleff, denn Borussia Mönchengladbach ist genauso meine Lieblingsmannschaft wie seine. Die Gladbacher sind nicht so überkandidelt wie die Bayern, sagt meine Mutter. Nur Günter Netzer mag sie nicht, weil er langhaarig ist, mit seinem protzigen Ferrari durch die Gegend rast und sowieso nur gut spielt, wenn er gerade Lust dazu hat. Ansonsten steht er herum wie eine trübe Tasse, was eine Frechheit ist, bei dem, was er verdient. Wolfgang Kleff hat zwar ebenfalls längere Haare, und meine Mutter findet, dass er sehr ungepflegt aussieht, aber doch nicht so schlimm wie Günter Netzer. Außerdem ist er weniger arrogant. Arroganter als Günter Netzer ist nur Franz Beckenbauer, wobei meine Mutter Franz Beckenbauer außerdem für strohdumm hält. Deshalb kann sie ihn von allen Fußballern am wenigsten leiden.
Hubert hat festgelegt, dass der, der als Erster »Ich bin Kleff« sagt, auch Kleff ist. Im Prinzip mag das gerecht sein, aber es gefällt mir trotzdem nicht. Ich nehme mir immer vor, beim nächsten Mal selbst zuerst »Ich bin Kleff« zu sagen, aber wenn Hubert bei uns an der Tür klingelt, seinen Lederball unterm Arm, und fragt, ob ich mit ihm Fußball spiele, vergesse ich es doch wieder. Mir bleibt dann nichts anderes übrig, als Sepp Maier zu sein. Eigentlich wäre das in Ordnung. Sepp Maier ist immerhin Torwart der Nationalmannschaft und Kleff nur sein Ersatzmann, auch wenn Hubert und ich es lieber andersherum hätten. Obwohl Sepp Maier bei den Bayern spielt, mögen ihn alle, denn er ist sehr lustig.
Bevor wir anfangen, schreitet Hubert erst auf meiner, dann auf seiner Seite mit fünf großen Schritten das Tor ab. Anstelle von Pfosten nehmen wir unsere Jacken, leere Flaschen oder einen dicken Ast. Ein Spiel dauert, bis einer von uns zehn Tore hat. Hubert schießt härter als ich, weshalb er meistens gewinnt. Erst sucht er sich eine gute Position für den Abschlag, der zugleich auch eine Ecke, ein Freistoß, ein Elfmeter sein kann – manchmal auch eine passgenaue Flanke, die diagonal über das Feld geschlagen wurde und sich langsam in den Strafraum senkt. Er legt sich den Ball zurecht, wie es auch die Spieler im Fernsehen tun: am besten auf einem dicken Grasbüschel oder auf einem plattgetretenen Maulwurfshügel. Während er sich vorbereitet oder einfach nur seinen Schuss hinauszögert, um mich zu verunsichern, ist er zugleich der Sportreporter und kommentiert, was gerade passiert: »Bonhof hat sich den Ball geschnappt und marschiert Richtung Eckfahne. Er ist gefürchtet für seine gefühlvollen Hereingaben. Am Elfmeterpunkt lauert Allan Simonsen, der Däne.« Erst jetzt nimmt Hubert Anlauf. »Der Ball kommt scharf angeschnitten, mit viel Effet, Simonsen erwischt ihn mit dem Vollspann …«
Hubert schießt, ich grätsche nach rechts, doch der Ball fliegt neben meiner Jacke ins Aus und rollt auf den Schulhof, so dass ich ihm doch hinterherrennen muss.
Hubert kennt alle, die in der Gladbacher Mannschaft spielen, wohingegen ich von den Bayern nur die wichtigsten Namen weiß: Neben Sepp Maier und dem dummen Beckenbauer gibt es Paul Breitner, der Kommunist ist, Uli Hoeneß und Gerd Müller. Außer Sepp Maier und Gerd Müller gönne ich eigentlich keinem von ihnen einen Treffer, weshalb ich nur eine geringe Auswahl an Spielern zur Verfügung habe. Meist schießt Sepp Maier seinen Abschlag bis weit in die gegnerische Hälfte, wo Gerd Müller ihn gekonnt aus der Luft fischt. Mit einer Körpertäuschung versetzt er Berti Vogts, der eigentlich zu meinen Lieblingsspielern zählt, und zieht aus der Drehung ab. »Kleff macht sich ganz lang und lenkt den Ball gerade noch um den Pfosten – eine Glanzparade, die seine ganze Klasse zeigt«, ruft Hubert, während er sich ins Gras wirft, was gar nicht nötig wäre, da mein Schuss nicht besonders platziert war.
Obwohl Hampels unsere direkten Nachbarn sind und schon dort gewohnt haben, bevor wir in unser neues Haus gezogen sind, sind sie doch nicht unsere Nachbarn im eigentlichen Sinn. Genaugenommen ist ihr Haus auch kein Haus, sondern eine Katstelle, also Teil des Hofs von Bauer Seesing, der zu weit von uns entfernt liegt, als dass wir Nachbarn sein könnten. Nur Leute mit eigenen Häusern auf einem Grundstück, das ihnen selbst gehört, können richtige Nachbarn sein. Die meisten in Hülkendonck sind immer schon Nachbarn gewesen, das heißt, sie haben es von ihren Eltern und Großeltern übernommen, und normalerweise ändert sich nichts daran, außer jemand zieht weg und das Haus wird an Fremde verkauft. Wenn man gebaut hat und neu in einer Straße ist, muss man sich bei denen, die man gern als Nachbarn hätte, zu einem Besuch anmelden und offiziell um die Nachbarschaft bitten. In dem Fall, dass man akzeptiert wird, kommen bestimmte Rechte und Pflichten auf einen zu. So schmücken sich die Nachbarn bei Silber- oder Goldhochzeiten gegenseitig mit Kränzen und Papierröschen die Tür und bei Beerdigungen tragen sie den Sarg von der Friedhofskapelle zum Grab, es sei denn, der Tote ist in der Schützenbruderschaft oder bei der Feuerwehr gewesen, dann müssen sie sich mit den Schützen beziehungsweise den Feuerwehrleuten einigen, wer welche Aufgaben übernimmt. Einer von den Nachbarn ist der erste Nachbar. Das hat nichts mit der Reihenfolge oder dem Abstand der Häuser zu tun, sondern es bedeutet, dass er für all diese Aufgaben die Hauptverantwortung trägt. Die Nachbarn werden außerdem zusammen mit den Verwandten und den Kollegen an runden Geburtstagen in eine Gaststätte eingeladen und bewirtet. Meist treffen sie sich vorher und studieren ein Lied oder ein Gedicht ein, das bei der Feier vorgetragen wird. An normalen Geburtstagen klingeln sie abends nach der Arbeit, ohne dass man sie eigens einlädt, und bekommen Schnaps, Bier und Zigaretten angeboten, obwohl meine Eltern nicht rauchen.
Hampels sind bei nichts von alledem dabei, weshalb man sie kaum einschätzen kann. Auch bei der Fronleichnamsprozession, wenn sich alle in der Straße zusammen um den Aufbau des Altars und die Gestaltung der Blumenbilder auf dem Boden kümmern, machen sie nicht mit. Tante Rieke sagt, dass sie von der anderen Rheinseite stammen, wogegen an sich nichts zu sagen wäre. Aber wenn einen niemand kennt und keiner weiß, von welcher Art Charakter jemandes Eltern oder Großeltern waren, ist es schwer, bei den anderen Vertrauen zu finden, da doch viele Eigenschaften, und gerade die schlechten, von Generation zu Generation weitervererbt werden.
Es ist nicht so, dass meine Eltern persönlich etwas gegen Hampels hätten, obwohl meine Mutter sie von ihrem Erscheinungsbild her schmuddelig findet und kritisiert, dass man von der Familie nie jemanden in der Kirche sieht. Herr Hampel geht auch nicht zu den Versammlungen wegen des Schnellen Brüters, die jetzt überall stattfinden, was nicht verwunderlich ist, denn die Meinung eines Melkers zählt nirgends viel. Da Hampels zugezogen sind, wissen sie sowieso nicht, was gut für das Dorf ist und was nicht. Unabhängig davon käme meine Mutter nicht auf die Idee, Frau Hampel auf einen Kaffee hereinzubitten, wenn diese bei uns klingeln würde, weil ihr beispielsweise die Margarine ausgegangen ist – was Frau Hampel im Übrigen noch nie getan hat. Meine Mutter möchte auch nicht, dass Hubert mit mir in mein Zimmer geht oder bei uns fernsieht, weil wir keine Lust auf Fußball mehr haben oder der Regen zu stark ist. »Ich habe nicht gern fremde Leute im Haus«, sagt sie.
Wenn Herr Hampel nach der Arbeit mit seinem Moped von Bauer Seesing kommt, kümmert er sich um das Gemüse und die Kartoffeln in dem kleinen Garten, der zur Katstelle gehört. Anders als wir zieht er weder Schnittblumen noch Rosensträucher, sondern ausschließlich Gemüse und Kartoffeln, die er für sich und seine Familie behalten darf, obwohl der Grund und Boden, auf dem sie wachsen, natürlich Bauer Seesing gehört. Sie haben außerdem ein paar Hühner und einen Hahn, die dort herumspazieren und nachts in einen Stall aus Draht gesperrt werden, wegen der Füchse und Marder. Einmal im Jahr bekommt Herr Hampel, genau wie wir, eine halbe Karre Mist, den er dann untergräbt, wobei sein Mist von Bauer Seesing stammt, unserer hingegen von Onkel Koeb. Vor einigen Monaten wollte mein Vater, dass ich diese Arbeit bei uns im Garten mache, aber der Mist hat so gestunken, dass mir schlecht wurde, und weil ich nicht besonders geschickt mit dem Spaten war, hat mein Vater ihn mir schließlich aus der Hand genommen und gesagt: »Wenn ich sehe, wie du dich anstellst, mach ich es lieber selber.«
Außer mit Hubert spiele ich manchmal mit Britta und mit Christel. Britta ist ziemlich dick und hat glatte dunkle Haare, die immer fettig auf ihre Schultern herunterhängen. Von allen Hampels findet meine Mutter sie am unsympathischsten. Das war von Anfang an so. Trotzdem hat sie mir nicht verboten, mit ihr zu spielen. Britta darf schon auch bei uns auf dem Grundstück sein, wenn wir die Kaninchen laufen lassen oder Sandburgen bauen, die dann unter Wasser gesetzt werden, dass es aussieht, als stünden sie auf richtigen Pirateninseln im Ozean. Das geht nur bei uns, weil wir einen eigenen Brunnen haben und deshalb so viel Wasser laufen lassen können, wie wir wollen, ohne dass wir Geld an die Stadt bezahlen müssen.
»Britta ist nicht hinten wie vorne«, sagt meine Mutter.
Ich kann nichts Schlechtes über sie sagen, außer vielleicht, dass sie schnell beleidigt ist und immer gleich wütend wegrennt, wenn ihr etwas nicht gefällt. Meine Mutter fand ihre negative Meinung über Britta dann bestätigt, als sie durchs Küchenfenster gehört hat, wie Britta abfällig über sie gesprochen hat. Der Grund war, dass ich keine Eisschnitten für uns aus dem Gefrierschrank holen durfte, obwohl es ein sehr heißer Nachmittag war und unser ganzer Schrank sowieso immer voll mit Eis ist, da wir regelmäßig vom Eiswagen der Firma Boqoui beliefert werden. In dem Fall war es so, dass das Verbot meiner Mutter mich in eine sehr peinliche Situation brachte, denn Britta gegenüber hatte ich es so dargestellt, als könne ich uns jederzeit Eis besorgen. Als meine Mutter dann »Nein« sagte, stand ich wie ein Trottel da. Deshalb habe ich Britta teilweise zugestimmt in ihrer Kritik und selbst etwas wie »Meine Mutter ist manchmal ziemlich blöd« und »Ich mag sie eigentlich auch nicht besonders« gesagt. Unglücklicherweise hat meine Mutter es gehört, weil sie gerade in der Küche Gurken zum Einkochen geschnitten hat und das Fenster gekippt war. Als ich später he-reinkam, stand sie am Herd und rührte den Würzsud und ihr liefen Tränen übers Gesicht. Meine Mutter ist sehr empfindlich, was Streit in unserer Familie anlangt. Sie will immer, dass alles harmonisch zugeht. Als sie noch ein Kind war, wurde bei ihr zu Hause von Seiten meines Großvaters viel geschrien und geschlagen, seitdem erträgt sie es nicht mehr. Sie drehte mir demonstrativ den Rücken zu und sprach kein Wort, was sonst nicht ihre Art ist. Normalerweise sagt sie immer direkt, wenn sie findet, dass ich etwas falsch gemacht oder mich schlecht benommen habe. Da sie auf meine Frage, was denn los sei, nicht antwortete, sondern nur mit zusammengekniffenem Mund den Kopf schüttelte, hatte ich Sorge, dass vielleicht jemand, den wir kennen, womöglich sogar mein Vater, verunglückt oder krank geworden wäre. Mein Gespräch mit Britta hatte ich da längst vergessen. Man sagt leicht schon mal dies und das, wenn die Situation für einen selbst anders nicht zu retten ist, und denkt sich nicht groß etwas dabei. Irgendwann räusperte meine Mutter sich und sagte, ich solle mir mal überlegen, was ich von mir gegeben hätte und weshalb sie so enttäuscht sei, vielleicht falle mir der Grund ja wieder ein. Dann schnäuzte sie sich, und ich sah, dass schon eine ganze Reihe zerknüllter Papiertaschentücher auf dem Tisch lagen. Mir schoss mein Gespräch mit Britta durch den Kopf, aber weil ich mir beim besten Willen nicht vorstellen konnte, dass meine Mutter es mitgehört hatte, fragte ich sicherheitshalber nach, was sie meine, denn es wäre eine sehr blöde Situation gewesen, wenn ich etwas zugegeben hätte, das bis dahin gar kein Problem gewesen wäre. Sie wollte es mir aber nicht sagen, sondern wiederholte nur mit gepresster Stimme: »Wenn du es nicht weißt, musst du vielleicht noch ein bisschen länger nachdenken.«
Ich versetzte mich in ihre Lage und stellte mir vor, wie ich mich fühlen würde, wenn ich gehört hätte, wie meine Mutter zu jemand anderem sagt, dass sie mich eigentlich nicht mag. Im selben Moment erinnerte ich mich an die Geschichte von Judas Iskariot, der Jesus für dreißig Silberlinge verraten hatte. Dann fiel mir Petrus ein, wie er Jesus nach dessen Festnahme im Hof des Hohepriesters drei Mal verleugnete, nachdem er vorher lauthals verkündet hatte, er würde alles für ihn tun, sogar sein Leben für ihn hingeben. Die Tränen meiner Mutter waren jetzt wie meine eigenen, nur schlimmer, und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Schließlich fragte ich, ob es wegen der Eisschnitten sei? »Um das Eis geht es zuallerletzt, und das weißt du genau«, sagte meine Mutter.
Seitdem ist Britta für sie gestorben.
Gegen Christel hat meine Mutter eigentlich nichts. Manchmal macht sie Christels Sprachfehler nach. Christel hat schiefe, vorstehende Zähne und kann kein »s« sprechen, sondern sagt stattdessen ein »t«, so dass alle sie »Krittel« nennen. Das ist aber nicht böse gemeint. Christel ist lieb, allerdings insgesamt keine Leuchte, wie meine Mutter es ausdrückt. Sie bekommt immer schlechte Noten und wahrscheinlich bleibt sie sitzen. Vielleicht muss sie auch auf die Sonderschule. Wegen ihres Sprachfehlers klingt alles, was sie sagt, irgendwie komisch, und es ist schwierig, sich normal mit ihr zu unterhalten. Vermutlich denken deshalb auch die Lehrer, dass sie dumm ist. Sie guckt am liebsten »Lassie« und will immer mit mir darüber reden, wie ich die Folge verstanden habe, wen ich gut finde und wen nicht und was ich glaube, wie es weitergeht. Manchmal gucken wir zusammen bei ihr zu Hause, weil es bei uns nicht geht, obwohl Hampels Fernseher kleiner und schlechter ist als unserer, so dass das Bild sich oft mit Schnee mischt. In Hampels Wohnzimmer ist kaum Platz, und die Sessel sind alt und abgewetzt, einer hat sogar Löcher, aber Christel guckt gern mit mir zusammen, und mir ist es auch recht, weil ich mich dann weniger fürchte, wenn die Gefahr für Lassie zu groß wird.
Wir gehen immer von hinten durch die Tenne ins Haus. Auf der Tenne ist es dunkel, es gibt nur ein winziges Fenster, das eher an eine Dachluke erinnert. Der Boden besteht aus welligem, gestampftem Lehm, wie bei Tante Rieke und ihrer Schwester, Tante Ada, die auch eine Tenne haben. Im Dämmerlicht sieht man, dass neben Harken, Hacken, Schippen, Spaten, Heckenscheren, Gießkannen allerhand Gerümpel in den Ecken herumliegt, das teilweise Bauer Seesing gehört, jedenfalls holt er manchmal eine Zange oder einen Hammer von Hampels Tenne, wenn er mit seinem Trecker auf den Feldern hinter der Katstelle zu tun hat. Die Schubkarre steht da, wo der Vorgänger von Herrn Hampel sein Schwein gehalten hat. Man erkennt es am Trog. Hampels haben allerdings kein eigenes Schwein. Neben dem Koben befindet sich das Plumpsklo. Einmal habe ich die grüne Tür mit dem Herzloch aufgemacht und das Licht eingeschaltet, aber es hat so gestunken, dass ich zu uns nach Hause gelaufen und auf unser richtiges Klo gegangen bin. Ich glaube, solche unpraktischen Dinge wie Plumpsklos sind normal bei Katstellen, auch wenn ich nur die, in der Hampels wohnen, von innen kenne. Auch die von den Bauern Praats, Otten, Geerck und van Elst sind ziemlich heruntergekommen und uralt, so dass der Klinker sich schon schwarz verfärbt hat. Die Mauern haben Risse, die Aloys, der Schmied, notdürftig mit Eisenklammern flickt, damit die Häuser nicht einstürzen. Bei manchen sind Dachziegel zerbrochen oder sogar Löcher über der Tenne. Wegen der kleinen Fenster herrscht in den Zimmern auch tagsüber Dunkelheit, so dass man sich nicht wundern muss, wenn die Melkerkinder, wie bei Hampels, immer auf der Straße herumlungern.
Melker ist ja kein Beruf wie Schlosser, Schmied, Bäcker oder auch Lehrer. Wobei der Lehrerberuf wiederum eine andere Stellung hat, weil man dafür in der Stadt studieren muss. Wie genau man Melker wird, weiß ich nicht. Ich glaube, man braucht dazu nicht einmal einen Hauptschulabschluss. Melken kann eigentlich jeder Bauer, aber wenn ihm der Betrieb gehört, hat er noch eine Menge andere Dinge zu tun, deshalb nehmen sich Großbauern, die ungefähr zwanzig bis dreißig Kühe besitzen, dafür Leute, die sonst keine Arbeit finden. Seit es Melkmaschinen gibt, ist das Melken selbst nicht mehr so schwierig wie früher mit der Hand und es geht auch viel schneller. Tante Friede hat es mich einmal versuchen lassen und es kam nicht ein Tropfen Milch heraus. Hauptsächlich muss der Melker jetzt darauf achten, dass die Zylinder gut sitzen und sie wieder herunterziehen, sobald das Euter leer ist. Der Melker füttert auch und mistet die Ställe aus, das heißt, er schiebt das mit Kuhscheiße und -pisse vermischte Stroh, das unter und zwischen den Kühen liegt, auf das Fließband dahinter, mit dem der Mist auf den Misthaufen transportiert wird. Bei Ställen, die kein Fließband haben, muss er es in die Schubkarre schaufeln und selbst dort hinbringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das besonderen Spaß macht, aber wenn man sonst nichts gelernt hat, ist es immerhin eine Beschäftigung, von der man Essen, Kleider und sogar ein Moped kaufen kann. Zum Wohnen hat man ja die Katstelle, auch wenn sie natürlich nicht gerade eine Luxusvilla ist. Früher haben hauptsächlich Knechte diese Arbeit gemacht. Knechte gab es schon zur Zeit Jesu, der sie oft in seinen Gleichnissen erwähnt. Manche waren ein gutes, andere ein schlechtes Beispiel dafür, wie man sich seinem Herrn – also eigentlich Gott – gegenüber verhielt. Der Herr ist in den Gleichnissen immer streng und gerecht, was sich dann wohl auf die Bauern übertragen hat. Mein Großvater war auch zuerst Knecht, aber dann hatte er Glück und konnte meine Großmutter heiraten, die den Hof in Hülkendonck geerbt hat. Allerdings ist dieser Hof, den jetzt Onkel Koeb und Tante Friede haben, immer so klein gewesen, dass unsere Familie nicht zu den Bauern zählte. Wir waren nur »Landwirte«, weshalb wir auch keine Knechte hatten. Ein Knecht gehörte in früherer Zeit mehr oder weniger dem Bauern, der ihn beschäftigt hat. Er schlief über den Tieren im Stroh und musste sich jede Laune des Bauern gefallen lassen. Diese Stellung wurde dann abgeschafft, so wie es auch keine Mägde mehr gibt. Wobei die Mägde es in gewisser Weise noch schwerer hatten als die Knechte. Da sie unverheiratet und arm waren, konnten sie nicht einfach weggehen, wenn der Bauer ein Auge auf sie geworfen hatte, was ziemlich oft vorkam, wie mein Vater sagt. Die alten Bauern Opgenrhein und Geerck waren dafür bekannt, dass sie sich an alle Mägde herangeschmissen haben. Sobald die Bäuerinnen davon Wind bekamen und ein Geschrei veranstalteten, mussten die Mägde in Schimpf und Schande den Hof verlassen, und ihr Ruf war ruiniert, denn so etwas sprach sich schnell in der ganzen Gegend herum. Das ist einer der Gründe, weshalb mein Vater den Bauern gegenüber Vorbehalte hat. Auch meine Mutter hat sich, als es die Schule in Hülkendonck noch gab, oft mit den Bauern gestritten und deren Söhnen die Grenzen aufgezeigt, da sie sich benahmen, als wäre das Dorf ihr Eigentum. Um ihren guten Willen zu zeigen, haben die von den Bauern, die auch Jäger sind, ihr dann nach der Treibjagd manchmal Hasen oder Fasane geschickt, wobei meine Mutter immer, wenn sie so ein Tier im Topf hatte, erklärte, dass sich niemand einbilden solle, davon irgendwelche Vorteile zu haben.
Viel besser als früher den Knechten geht es den Melkern heute auch nicht, sagt mein Vater. Die einzige Ausnahme ist Bauer van Elst: Dort werden die Melker wie Menschen behandelt.
Vielleicht liegt es daran, dass Bauer van Elst im Krieg einen Arm verloren hat und besonders auf seinen Melker angewiesen ist, vielleicht hat er auch einfach ein gutes Herz. Ihr jetziger Melker, Eeg Müskens, hat die Stellung von seinem Vater übernommen, dessen Vater ebenfalls schon dort Melker war, woran man ja sieht, dass es ihnen nicht schlecht ergangen ist, sonst hätten zumindest die Söhne versucht, anderswo Fuß zu fassen. Aber die meisten Bauern behandeln ihre Melker schlechter als ihr Vieh, sagt mein Vater.
4.
Die Rasenfläche auf dem Flachbildschirm leuchtet in synthetischem Grün und so grell, dass man denkt, es ist gar kein echtes Gras, sondern Polyethylen oder Polyamid. Die Spieler bewegen sich zügig, ganz rot und ganz schwarz, zwischen ihnen der Schiedsrichter in seinem taubenblauen Poloshirt. Der gelbe Torwart hat schon vier Treffer kassiert und beugt sich gespannt nach vorn, in Erwartung des nächsten Angriffs.
Irgendwann in den 1970er Jahren hatte mein Vater die Idee, den Fernseher im Sommer abends auf die Terrasse zu tragen, damit wir beim Grillen wichtige Fußballspiele und die Sportschau sehen konnten. Es muss nach der Weltmeisterschaft 1974 gewesen sein, denn Deutschland gegen die DDR, Deutschland gegen Schweden, gegen Polen und das Finale gegen Holland haben wir im Esszimmer angeschaut. Damals war der Apparat genauso hoch wie tief, ein schwerer, massiver Block, dabei sehr empfindlich: Eine unachtsame Bewegung, ein Stoß gegen den Türrahmen, schon hatte sich irgendwo ein Drähtchen gelöst und das Bild baute sich nicht mehr auf.
»Heute Morgen haben sie Frau van Ackeren ins Krankenhaus gebracht«, sagt meine Mutter. »Sie muss schon mindestens einen Tag in ihrer Wohnung gelegen haben, weiß aber von nichts. Am Telefon klang sie ziemlich durcheinander.«
Frau van Ackeren ist ein Jahr jünger als meine Mutter und war meine Lehrerin in der ersten Klasse. Ich habe sie sehr geliebt. Ihr Mann ist vor gut zehn Jahren gestorben. Seit er tot ist, hat sie sich meinen Eltern gelegentlich auf Busreisen nach Frankreich oder an die Mosel angeschlossen. Sie ruft auch oft an, um mit jemandem zu reden, der in der Nähe lebt. Ihr Sohn arbeitet als Finanzbeamter in der Gegend von Hannover, ihre Tochter betreibt einen ökologischen Gemüsehof in Mecklenburg. Sehr große Entfernungen, selbst für Telefonstimmen.