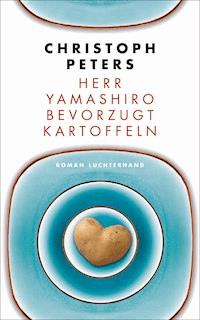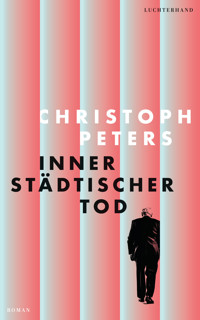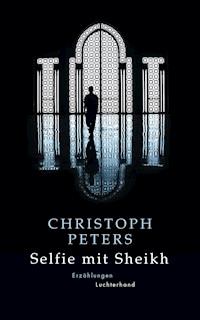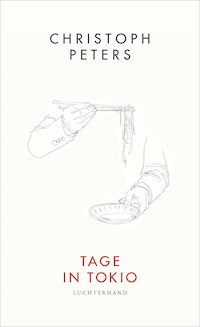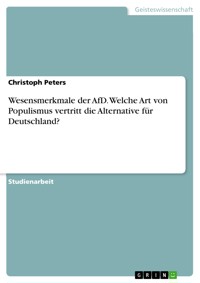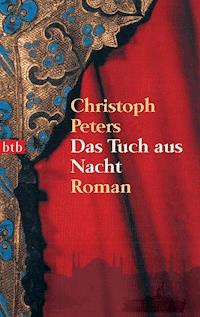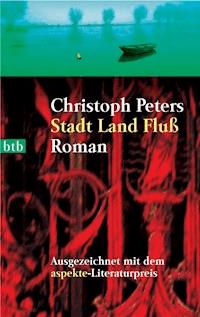2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine herrlich sinnliche Komödie über Schönheit, Genuss und Liebe
Solange sie sich erinnern können, sind die beiden Freunde Achim und Wolf Japan- Fans. Da entdecken sie eines Tages in einem rustikalen Vereinsheim am Mittelrhein ein japanisches Spitzenrestaurant. Und dessen geheimnisvolle Chefin Mitsuko. Eine subtil komische Geschichte über die schwärmerische Suche nach strenger Schönheit, purem Genuss und dem ganz Anderen in Gestalt einer Frau nimmt ihren Lauf …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Aus Freude am Lesen
Seit ihrer Schulzeit begeistern sich der Gelegenheitsschauspieler, -koch und -dichter Achim Wiese und sein Freund Wolf für japanische Kultur und Küche. Da entdeckt Achim, inzwischen Mitte zwanzig, 1992 bei einer Waldwanderung ausgerechnet im rustikalen Vereinsheim der Wanderfreunde Gurschebach e.V. ein japanisches Spezialitätenrestaurant. Von der Entdeckung elektrisiert, beginnt er mit Wolf, Lokal und seine Küche zu erkunden: eine erstklassige Küche, wie sich bald herausstellt, betrieben von der schönen und geheimnisvollen Japanerin Mitsuko. Achim gibt sich fortan große Mühe, Mitsuko näherzukommen und ihr mit seinem Halbwissen über japanische Kultur zu imponieren. Und schiebt alles beiseite, was nicht in sein schwärmerisches Bild passt ... »Mitsukos Restaurant« ist eine wunderbar leichthändige und doch tiefsinnige Komödie über die Geheimnisse erlesener Kochkunst und die Rituale der Verführung, über Verwirrspiele der Liebe und die nicht selten burleske Begegnung gegensätzlicher Kulturen.
CHRISTOPH PETERS wurde 1966 in Kalkar (Niederrhein) geboren und lebt heute in Berlin. Für seine Erzählungen und Romane wurde er vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem aspekte-Literaturpreis und dem Rheingau-Literaturpreis. Zuletzt erschien bei Luchterhand der Erzählband »Sven Hofestedt sucht Geld für Erleuchtung«.
Inhaltsverzeichnis
Für Veronika – nur so.
Eines Tages fragte Meister Kyōzan Ejaku den Meister Isan Reiyū auf dem Berg Isan im Tan-Distrikt: »Wenn Hunderte, Tausende und Zehntausende von Umständen gleichzeitig auf mich einstürzen, was kann ich dann tun?«
Isan Reiyūerwiderte: »Blau ist eine andere Farbe als Gelb. Etwas Langes unterscheidet sich von etwas Kurzem. Alle Wesen haben ihren eigenen Ort im Universum. An uns sind sie nicht interessiert.«
Daraufhin warf sich Meister Kyōzan vor Meister Isan nieder.
Dogen Zenji (1200-1253)
1
Anfangsschwierigkeiten
Am frühen Abend des 19. Mai 1984 fuhren die Abiturienten Achim Wiese und Wolf Erben aus dem niederrheinischen Kaff Huiswyck rund hundert Kilometer nach Düsseldorf, um zum ersten Mal in ihrem Leben japanisch zu essen. Sie hatten sich auf dieses Essen gründlicher vorbereitet als auf irgendeine der zurückliegenden Prüfungen und wußten doch nur schemenhaft, was sie erwartete. Alle, denen sie in den voraufgegangenen Wochen von dem Plan erzählt hatten, waren der Ansicht gewesen, daß es der bei weitem absonderlichste Einfall sei, den ihre für absonderliche Einfälle berüchtigten Köpfe bis dahin hervorgebracht hätten.
Zu dieser Zeit waren japanische Spezialitäten hierzulande noch wenig verbreitet und die Straßen aus der Provinz in die Städte um ein Vielfaches länger. Niemand, den sie kannten, hatte je japanisch gegessen oder auch nur die Karte eines japanischen Restaurants in Händen gehalten. Die meisten Menschen verzogen schon bei dem Wort Sushi den Mund wie sonst höchstens, wenn die Rede auf das Hirn aus den offenen Schädeln lebendiger Affen kam, das Indiana Jones im Tempel des Todes serviert worden war. Achim und Wolf hatten beträchtliche Schwierigkeiten gehabt, überhaupt ein japanisches Lokal in erreichbarer Entfernung aufzutun. Jenseits der holländischen Grenze florierten eine Reihe Chinesen und Indonesier, die trotz des bereits damals abgedroschenen Verdachts, bei ihnen werde Hundefutter verarbeitet, beliebte Ziele niederrheinischer Feinschmecker waren, aber von einem Japaner hatte nicht einmal der berühmte Genneper Tankwart Henk Praats je etwas gehört, der für nahezu alle Wünsche deutscher Autofahrer die passende Adresse kannte. Achim und Wolf wären beinahe aufs Geratewohl nach Amsterdam gefahren, wo man angeblich jede Küche der bekannten Welt probieren konnte, hatten sich aber dann aus Angst, von einem betrügerischen Meister mit vergammeltem Fisch vergiftet zu werden, dagegen entschieden. Zwischenzeitlich berichtete das Kulturjournal facetten über die Eröffnung der ersten Sushi-Bar in München, die Mishimas Garden Palace hieß und wie Witzigmanns Aubergine und Winklers Tantris täglich mit fangfrischer Ware aus den legendären Pariser Hallen beliefert wurde. In Mishimas Garden Palace betrieb man zusätzlich eine Aquarienanlage, damit der Gast sich die Barbe oder Brasse selbst auswählen konnte, die ihm wenig später perfekt zugeschnitten, aber roh, serviert werden sollte. Allerdings lag München über siebenhundert Kilometer von Huiswyck entfernt, so daß Achim und Wolf dort hätten übernachten müssen, was angesichts der Menüpreise, die in dem Fernsehbeitrag genannt worden waren, weit über ihre finanziellen Möglichkeiten gegangen wäre. Schließlich hatte der Zufall oder das Schicksal in Gestalt ihres Kunstlehrers Heinrich van de Kerkhoff ihnen den Katalog einer Ausstellung japanischer Keramik zugespielt, die seit kurzem im Düsseldorfer HetjensMuseum gezeigt wurde. Am Ende des Katalogs waren sie auf die Anzeige eines ebenfalls in Düsseldorf ansässigen Restaurants namens Kabuki gestoßen: »Erleben Sie japanische Küche, zubereitet von Meistern aus Tokio und Osaka, in original japanischen Räumlichkeiten. – Einmalig in Deutschland!«
Mittlerweile war ihnen von Dr. Riebsamen, dem Direktor des Adam-Rainer-Lynen-Gymnasiums in Cleve, offiziell mitgeteilt worden, daß sie das Abitur bestanden hatten: Wolf mit – in den Worten des Direktors – »unübertrefflichem Ergebnis«, Achim hingegen mit Noten, die seine tiefe Verachtung für das, wie er selbst es ausdrückte, »faschistische Gleichschaltungssystem Schule« widerspiegelten. In neun Tagen würde ein Festakt samt Zeugnisübergabe diese trostloseste aller vorstellbaren Lebensphasen beenden. –
»Verdammter Mist«, brummte Achim, weil ihm zum wiederholten Mal durch plötzliches Abknicken des Blättchens der Tabak auf den Sitz gefallen war und es zusehends unwahrscheinlicherwurde, daß die im Beutel verbliebenen Reste für eine Zigarette reichten.
»Du saust alles voll«, sagte Wolf.
DerWagen, ein dunkelblauer Mercedes 190, war das Abiturgeschenk seiner Eltern, weshalb Wolf sich verpflichtet fühlte, die Mitschüler daran zu hindern, ihn schon vor der Verabschiedung in eine rollende Müllkippe zu verwandeln. Achim gab trotzdem nicht auf, und sein nächster Versuch endete mit einem Tabakstäbchen von gut doppelter Streichholzdicke, das wegen der Trockenheit und des hohen Verdichtungsgrads der Krümel einen scharfen kobaltblauen Rauch ergab.
»Wo bleibt eigentlich der Frühling?« fragte er.
»Wo soll er denn bleiben?« erwiderte Wolf.
»Du meinst, daß schon die Erwartung ein Fehler ist?«
»Wahrscheinlich.«
»Wie bei rohem Fisch.«
»Würde ich nicht vergleichen.«
»Warum?«
»Hört sich komisch an.«
Achim überlegte einen Moment, nickte zustimmend, kurbelte das Fenster hinunter und warf die in wenigen Zügen verglühte Kippe auf die nasse Fahrbahn.
Es hatte den ganzen Tag auf eine dunkle, gleichförmige Weise geregnet, aber kurz hinter Moers war das Grau plötzlich aufgebrochen, und jetzt glänzte die Autobahn golden. Langgezogene Pfützen spiegelten die untergehende Sonne, und in den Baggerseen längs der Strecke kräuselte sich das fahle Gelb des östlichen Himmels wie ein Seidentuch, das langsam auf eine Schwertklinge zutrieb.
»Aquaplaning«, stellte Wolf fest.
»Ich dachte, das Auto ist neu.«
»Halt einfach die Klappe.«
Am Horizont strahlten Industrieanlagen im Zwielicht, als wären sie Kulissen für einen schmutzigen Ruhrgebietskrimi, und über den Schloten räkelten sich Rauchschwaden wie dicke Nutten am Tatort. Wolf fuhr deutlich zu schnell, trotzdem würden sie es heute nicht mehr schaffen, die Ausstellung zu besuchen. Ihre Abfahrt hatte sich um Stunden verzögert, weil Wolfs Freundin Maria am Vormittag von einem ihrer plötzlichen, wenngleich nicht grundlosen Eifersuchtsanfälle überwältigt worden war. Achim hatte Wolfs Anruf um kurz vor elf kommentarlos hingenommen. Er war auf die überdachte Terrasse seines Elternhauses getreten, hatte sich in einen der mit Plastikplanen verpackten Liegestühle gesetzt, in den Regen gestarrt und der Tatsache gedacht, daß er diesen Ort bald für immer verlassen würde. Obwohl es philosophisch gesehen falsch war und die Zukunft so nah wie nie zuvor, hatte er sie herbeigesehnt.
»Eigentlich schmeckt grüner Tee fies«, sagte Achim.
»Den besseren bekommen wir gar nicht, den behalten die Japaner für sich«, entgegnete Wolf.
»Ich meine: ohne Zucker.«
»Mein Vater ist mal von einem französischen Kollegen zum besten Chinesen in Paris eingeladen worden und wollte Zucker zum grünen Tee. Der Kellner hat genickt und ist gegangen. Fünf Minuten später hat mein Vater den Kellner noch mal gerufen und ihn an den Zucker erinnert. Der Kellner hat sich entschuldigt und ist wieder gegangen. Nach dem dritten Mal hat der Kollege, dem das Ganze ziemlich peinlich war, zu meinem Vater gesagt: ›In diesem Restaurant für diesen Tee Zucker zu verlangen, ist so, als ob Sie im Maxim’s Zucker für ihren Château Lafite bestellen würden. Der Mann will Sie nicht brüskieren, deshalb sagt er nichts, aber er wird Ihnen keinen Zucker bringen.‹«
»Das waren Chinesen.«
»Für Chianti classico würde dasselbe gelten.«
»Du meinst für Sake.«
»So oder so.«
»Der schmeckt nicht schlecht.«
»Mag sein.«
»Solltest du probieren.«
»Hast du schon – ich weiß.«
Wer von ihnen sich als erster mit Japan beschäftigt hatte, war eine Streitfrage, die sich nicht mehr klären ließ. Fest stand, daß ihre Beschäftigung unterschiedliche Ursprünge hatte: Während Wolf über seine Begeisterung für traditionelles Kriegshandwerk und Kurosawas Historienfilme auf Japan gestoßen war, hatte Achim, ausgehend von eigenen Holzschnittversuchen, mit van de Kerkhoffs Büchern über Hokusei und Utamaro zunächst die japanische Kunst für sich entdeckt. Später war er bei seiner Suche nach den Schlüsseln der Weltweisheit auf die Schriften Suzukis und Okakuras gestoßen.
»Neulich habe ich eine Dokumentation gesehen, da hieß es, Rikyū sei des öfteren voll mit Sake durch die Gegend getorkelt«, sagte Wolf.
»Kann sein.«
»Darf er das als Tee-Meister und Zen-Priester überhaupt?«
Achim überhörte die Provokation und antwortete nicht.
Wie immer freitags um diese Uhrzeit geriet der Verkehr, je näher sie dem Stadtzentrum kamen, zunehmend ins Stokken. Tausende hatten sich in Kleinwagenverbänden und Bus-Konvois aufgemacht, um die Sinnlosigkeit ihres Daseins für ein Wochenende in der Düsseldorfer Altstadt zu ertränken. Im Gegensatz zu Wolf, der dieses Revier selbst zuweilen nutzte, um ohne Mühe und frei von späteren Komplikationen Frauen für spontanen Geschlechtsverkehr zu werben, fand Achim den Bezirk billig.
»Der Mob auf dem Weg in die Versenkung«, sagte er, als sie neben einem mit fünf winkenden Mädchen besetzten Opel Corsa zum Stehen kamen, woraufhin Wolf in obszönes Gelächter ausbrach, »Schneckchen« schmatzte und zurückwinkte, als hätte er seine Pläne für den Abend soeben geändert.
»Arschloch«, brummte Achim. Einige hundert Meter weiter auf der Oberkasseler Brücke, immer noch im Schrittempo, deutete er nach rechts und sagte: »Da hinten wohnt Beuys.«
Wolf zuckte mit den Achseln.
»Beuys hat sich auch viel mit Japan beschäftigt«, sagte Achim.
»Ein Mißverständnis.«
»Die Japaner sehen das anders.«
»Die Japaner verstehen uns heutzutage besser als sich selbst.«
Mittlerweile war es kurz vor sieben, das Museum hatte seit einer Stunde geschlossen, Wolf schimpfte: »Scheiß-Weiber«, und Achim sagte: »Ach Quatsch.«
Sie schoben sich von Ampelphase zu Ampelphase über die Hofgartenrampe in Richtung Königsallee, wo Wolf ein bestimmtes Parkhaus im Visier hatte, weil er später eine Diskothek in der Nähe aufsuchen wollte. Dort trafen sich, wie er einem Düsseldorfer Stadtmagazin entnommen hatte, die Töchter der ortsansässigen japanischen Geschäftsleute zur Drogen- und Kontaktaufnahme.
»Japanische Mädchen«, erläuterte Wolf beim Aussteigen, »werden dazu erzogen, ihren Männern zu dienen, um sie glücklich zu machen, aber nicht durch christliche Sexualmoral genau daran gehindert.«
Achim seufzte.
Als sie auf die Straße traten, hatte es zu nieseln angefangen, so fein und schwebend, daß Schirme nutzlos gewesen wären. Wolf fuhr sich mit der Hand durchs Haar, dachte, daß Regenwasser seiner Frisur noch immer gut bekommen sei. Achim maulte: »Wegen deiner Scheiß-Disko latschen wir jetzt eine halbe Stunde durch den Regen.«
»Zehn Minuten.
»Fünfzehn.«
»Stelle dich auf Regen ein, auch wenn es nicht regnet, lautet eine der sieben Regeln Rikyūs.«
»Es regnet aber.«
»Dann dürfte es erst recht kein Problem für dich sein.«
Da die Geschäfte bereits um halb sieben schlossen, waren Viertel, in denen weder Bierkneipen noch Speisegaststätten vorherrschten, um diese Uhrzeit bereits ausgestorben.
»Ich bin wirklich gespannt«, sagte Achim.
»Auf rohen Fisch.«
»Vielleicht auch auf etwas anderes.«
»Du bist doch der Authentizitätsfanatiker.«
»Ich meine nur, daß ich völlig offen hingehe.«
Zu Beginn der Bolker Straße schwenkten sie rechts in die kaum beleuchtete Grabbe-Straße, an deren Ende unter einem ziegelgedeckten Vordach eine voluminöse rote Laterne den Eingang des Restaurants Kabuki markierte. Das Haus war ein schäbiger Zweckbau aus der Nachkriegszeit, hatte aber im unteren Teil mit Hilfe dunkler Balken und weißer Blendplatten, auf die mächtige Schriftzeichen kalligraphiert waren, ein leidlich japanisches Gepräge erhalten. Hinter die Fenster waren traditionelle Papierwände montiert, so daß die Gäste im Innern ebenso vor neugierigen Blicken bewahrt blieben wie die Geheimnisse der Küche. Selbst der breite Schaukasten rechts der Tür war japanischer Herkunft, was man an den aufwendigen Holzverbindungen sah, die ein deutscher Schreiner ohne Zweifel durch Baumarktschrauben ersetzt hätte.
Achim und Wolf versuchten zunächst, sich auf den verschiedenen Speise- und Getränkekarten zu orientieren. Sie lasen, räusperten sich, lasen weiter, schwiegen. Vom Anfang der Straße her wehte ein Klanggemisch aus volkstümlicher Musik, elektronisch erzeugten Tanzrhythmen und bierseligen Stimmen herüber. Achim trat von einem Fuß auf den anderen, Wolf zupfte sich am Ohr.
Es standen vier Menüs zur Auswahl, das kleinste mit fünf, das größte mit elf Gängen. Roher Fisch spielte darin, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle. Die Begriffe Sushi und Sashimi fehlten völlig, und auch von Tempura, der angeblich vollkommenen Technik, Gemüse und Meeresfrüchte auszubacken, war nirgends die Rede. Es gab Abalone mit grünem Spargel; Chrysanthemensalat; fritierten Tofu in Bernsteinsauce; Taschenkrebsfleisch auf Zweischicht-Ei; gefüllte Lotuswurzeln; marinierten Bonito-Fisch; Hähnchenbrust nach Chikozen-Art; Makrele in Miso-Sauce; Teriyaki-Ente; gegrillten Tintenfisch mit Seeigelrogen; Herzmuscheln auf Mangold; marinierte Spanferkelschulter mit Kapuzinerkresseblüten; Süßkartoffelküchlein; Grüntee-Eis; Azukibohnen-Gelee; außerdem einige Dinge, die keine deutschen Namen hatten, und frisches Obst. Letzteres war das einzige Gericht, unter dem sie sich etwas vorstellen konnten, vorausgesetzt, daß in Japan nicht Früchte wuchsen, von deren Existenz sie nie gehört hatten. Das preiswerteste Menü kostete siebenundachtzig Mark, das teuerste einhundertneununddreißig. Außerdem hätten sie sich – allerdings mit dreitägiger Vorbestellung – zum Preis von hundertneunundvierzig Mark pro Person eine traditionelle Chanoyu-Teezeremonie einschließlich des dazugehörigen, der Jahreszeit entsprechenden Kaiseki-Menüs im separaten Teeraum des Hauses zubereiten lassen können.
»Glaubst du, daß das da authentisch japanische Küche ist?« fragte Achim.
»Ich weiß nicht«, sagte Wolf. »Spanferkel? Kapuzinerkresse?«
»Klingt komisch.«
»Kein roher Fisch.«
»Marinierter Bonito vielleicht?«
»Andererseits ...«
»Und sie haben nur die Menüs.«
»Nur Menüs.«
»Daß japanisches Essen teuer ist, wußte ich ja ...«
»In dieser Münchner Sushi-Bar soll eine Portion, alles drum und dran, vierzig Mark kosten.«
»Wieviel hast du dabei?« fragte Achim.
Wolf holte sein Portemonnaie aus der Hosentasche und zählte: »Etwas über neunzig.«
»Ich Mitte achtzig.«
»Wenn wir zusammenlegen, könnte es für zwei Menüs reichen.«
»Aber nicht mehr für Sake. Die billigste Flasche liegt bei fünfzehn Mark.«
»Dann ist es sinnlos.«
»Ja. Es ist sinnlos.«
Der Nieselregen hatte sie trotz des schützenden Vordachs mit einer silbrigen Schicht winziger Tröpfchen überzogen. Die Luft war schwer wie ein nasser Lappen. So geduckt, mit hochgezogenen Schultern im Licht der roten Laterne, hätten sie ebensogut Nachwuchs-Yakuza auf der Flucht in einem Thriller der frühen siebziger Jahre sein können, die an ihrem ersten Auftrag gescheitert waren. Das würde sie ein Fingerglied kosten, wenn nicht ein Wunder geschähe. Doch weder ein barscher Leibwächter noch ein geheimnisvoller Alter, dem sie vertrauen konnten, öffnete die Tür.
»Und jetzt?« fragte Achim nach einer Weile.
»Mein Vater geht immer zu einem Chinesen auf der Kö. Der ist nicht schlecht. Jedenfalls besser als das Peking in Cleve.«
»... und trinkt grünen Tee mit Zucker.«
»Bier.«
»Das berühmte chinesische Bier ...«
»Genau: nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut.«
Einige hundert Jahre zuvor in Japan
Schwer ruht die Nacht auf den Bergen des Hinterlands. In der Kiefer am Tor des vereinzelten Hofes nördlich von Tokoname wacht vor dem unermeßlichen Himmel im bleichen Licht des schwindenden Mondes der Schattenriß einer Eule, gesammelt und schwarz. Nichts entgeht ihrem Blick. Was sie auch sieht, es verbleibt in ihrem von Selbstsucht und Alter befreiten Gedächtnis. Das Vergangene und das Künftige sind ihr eins. Sie entstammt dem Reich der Zeichen und weiß sie zu deuten: Etwas kündigt sich an. Lautlos stürzt sich der Vogel ins Leere, gleitet davon, als berührten seine Flügel die Luft nicht.
Der Mann, der hier lebt und dem der Gedanke, den Hof sein eigen zu nennen, fremd ist, kennt keine Furcht. Man sagt ihm besondere Kräfte nach. Es heißt, Raum und Zeit beschränkten ihn nicht. Anders die Menschen der Stadt. Verzagt vom Kampf mit den Mächten des Wassers, der Erde, kauern sie in ihren Hütten und erwarten den Schlaf des Vergessens voll Angst.
Es knarrt im Gebälk. Buschwerk raschelt. Wie ein Griff in den Nacken plötzlich die Schläge galoppierender Hufe. Sie nähern sich rasch, fallen in Schritt, stehen still. Schnaubende Nüstern – es ist mehr als nur ein Pferd. Das Klirren von Zaumzeug, jemand springt aus dem Sattel. Seine Sohlen treffen auf gestampften Lehm, sorgsam von allem Unrat gereinigt. Der Fremde öffnet das Tor, geht auf das Haus zu, nimmt die Treppe in einem Satz, hält vor der Tür inne. Schwaches Licht dringt durch Ritzen, beleuchtet die kantigen Züge: ein Mann in mittlerem Alter von erkennbar edler Geburt. Er bewegt sich zögernd, hebt die Hand, tritt ein. Im eisernen Becken am Boden glimmt noch die Kohle des Tages.
»Meister«, sagt der Mann, »Meister Tsujimura. Vergebt mir, daß ich in Euer Haus eindringe, ohne daß Ihr mir Einlaß gewährt habt. Vergebt die späte Stunde, seht mir meine würdelose Erscheinung nach. Ihr kennt mich nicht. Niemand hat mich Euch angekündigt. Ich weiß: Selten kommt Gutes aus dem Dunkel, und die Nacht ist der Mantel des Diebes. Doch ich stehe hier in lauterer Absicht: Hört mich an.«
Über der Feuerstelle steigt Hitze als zitternde Säule dem offenen Dach zu. Mondschein fällt auf irdene Formen, Schalen, Teedosen, Wassergefäße, in rohen Gestellen aufgereiht wie die stummen Diener einer Zeremonie. Ein Schemen, der ein Mensch sein könnte oder sein Schatten, vielleicht nur ein Tuch, ein Gewand, bewegt sich kaum sichtbar im Luftzug.
»Meister Tsujimura«, wiederholt der Fremde. »Ich komme von weit her. Euer Ruhm ist über die Hügel des Akaishi-Gebirges, durch die Schluchten des Tenryū-Flusses, zwischen den Gipfeln von lide-San und Azume-San, vorbei an hochaufragenden Burgen und waffenstarrenden Feldlagern bis zu mir gedrungen. Und ich habe mich aufgemacht, ohne zu wissen, ob ich Euch fände und ob Ihr mich anhören würdet. Bis zu der unglückseligen Schlacht, die mir alles genommen hat, war ich Herr. Meine Besitzungen reichten vom Meer im Westen bis zu den Bergen im Osten. Wer auf dem höchsten Gipfel meines Landes stand, sah seine Grenzen nicht. Doch jetzt bin ich niemand.«
Abermals bricht die Rede des Fremden ab. Seine Augen suchen in der Dunkelheit den Mann, dessentwegen er ein nichtswürdiges Leben statt des stolzen Todes gewählt hat.
›Ein Strich, und ich bin ausgelöscht‹, denkt er, als hinter ihm eine Stimme, weder bebend vor Zorn noch gespannt vor Erwartung, fragt: »Wie heißt du?«
»Takanosu Norishige«, antwortet der Fremde und wendet sich um.
»Ich kann nichts für dich tun.«
2
Wie im Flug waren acht Jahre vergangen
»Bier«, murmelte Achim, »Weizenbier«, und zündete sich die erste legale Zigarette seit Stunden an. Angesichts der zwanzigtausend Mark Geldstrafe bei Verstoß gegen das Rauchverbot im Wald hatte er die letzten so hastig in sich hineingesaugt, daß ihm jedesmal schlecht geworden war.
Der Sommer 1992 entwickelte sich zum heißesten seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Einige Klimaforscher prognostizierten die Überflutung der norddeutschen Tiefebene in hundert Jahren, was jedoch – abgesehen von den Bauern Frieslands und Mecklenburgs, die unter Ernteausfällen litten – niemanden beunruhigte. Die Weltuntergangsstimmung früherer Jahre war nach dem Ende des Kalten Krieges einer lustlosen Ergebenheit gewichen, der sich mehr und mehr ein Anspruch auf angenehme Umstände im allgemeinen beigesellte. Dementsprechend wurde das schöne Wetter von weiten Teilen der Bevölkerung begrüßt und führte, bei insgesamt sinkender Produktivität der Wirtschaft, zu Umsatzsteigerungen im Gastgewerbe und einer nachhaltigen Belebung der Innenstädte.
Das Theater Herz-und-Hirn, an dem Achim Wiese auf Vermittlung Kurt Rübners, eines Freundes aus gemeinsamer Münchner Zeit, während der vergangenen Saison in kleineren und mittleren Rollen zu sehen gewesen war, hatte Ferien, und ob Achims Engagement für die kommende Spielzeit verlängert werden würde, stand in den Sternen. Seine Rücklagen reichten bei großzügigerem Lebensstil bis Mitte November, so daß er jetzt einer seiner nutzlosen Lieblingsbeschäftigungen nachging: Er machte Waldspaziergänge. Streng genommen handelte es sich dabei längst nicht mehr um Spaziergänge, sondern um ausgedehnte Wanderungen, die ihn nur deshalb nicht quer durchs Land führten wie Handwerksgesellen vergangener Epochen, weil die unterwegs anfallenden Kosten seine Rücklagen früher aufgezehrt hätten, als er nach neuen Verdienstquellen Ausschau halten wollte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!