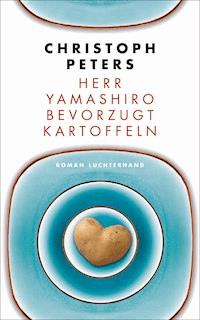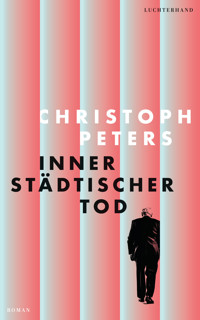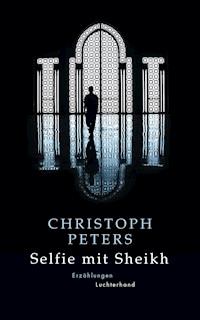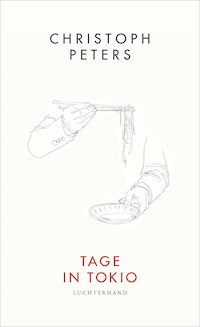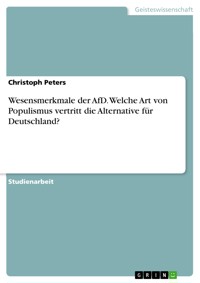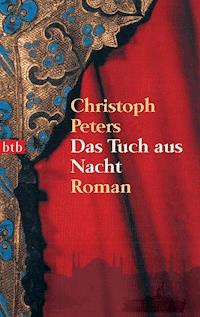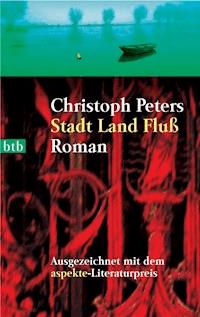7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein ungewöhnlicher Thriller in der Tradition eines Cormac McCarthy oder Quentin Tarantino und das faszinierende Panorama einer bizarren japanischen Unterwelt, die noch immer die Traditionen der Samurai-Zeit beschwört, auch wenn ihre goldene Zeit längst der Vergangenheit angehört.
Früher verstand sie sich als eine ehrenwerte Gesellschaft. Heute ist japanische Yakuza zunehmend eine Organisation gewöhnlicher Krimineller, verwickelt in Drogenhandel und schmutzige Immobiliendeals. Staat und Polizei haben die jahrhundertelange Toleranz und Koexistenz aufgekündigt und der Yakuza den Kampf angesagt. Da kommt es äußerst ungelegen, dass Fumio Onishi bei einer Aktion im Auftrag der Yakuza in Berlin eigenmächtig übers Ziel hinausgeschossen ist. Auf der Flucht vor den deutschen Behörden hat Onishi sich zwar mit seiner deutschen Freundin Nikola nach Tokio absetzen können. Doch hier erwartet der Yakuza-Boss Takeda ein unmissverständliches Opfer von ihm...
Hat Christoph Peters in seinen Romanen "Mitsukos Restaurant" und "Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln" die helle, ebenso faszinierende wie manchmal skurrile Seite der Kultur Japans beleuchtet, taucht er nach "Der Arm des Kraken" auch in seinem zweiten Roman um Fumio Onishi ein in die Abgründe des Reichs der aufgehenden Sonne - in einen zutiefst widersprüchlichen Kosmos voll rätselhafter Traditionen zwischen höchster Eleganz und Kultiviertheit einerseits und blinder Grausamkeit und fragwürdigen Atavismen andererseits, in eine Unterwelt, die ebenso geprägt ist von dem alten Ethos der Samurai wie von irritierenden Werten, fremdartigen Ritualen und verstörender Gewalt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Früher verstand sie sich als eine ehrenwerte Gesellschaft. Heute ist japanische Yakuza zunehmend eine Organisation gewöhnlicher Krimineller, verwickelt in Drogenhandel und schmutzige Immobiliendeals. Staat und Polizei haben die jahrhundertelange Toleranz und Koexistenz aufgekündigt und der Yakuza den Kampf angesagt. Da kommt es äußerst ungelegen, dass Fumio Onishi bei einer Aktion im Auftrag der Yakuza in Berlin eigenmächtig übers Ziel hinausgeschossen ist. Auf der Flucht vor den deutschen Behörden hat Onishi sich zwar mit seiner deutschen Freundin Nikola nach Tokio absetzen können. Doch hier erwartet der Yakuza-Boss Takeda ein unmissverständliches Opfer von ihm …
Hat Christoph Peters in seinen Romanen »Mitsukos Restaurant« und »Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln« die helle, ebenso faszinierende wie manchmal – zumindest in westlichen Augen – skurrile Seite der fremdartigen Kultur Japans beleuchtet, taucht er nach »Der Arm des Kraken« auch in seinem zweiten Roman um Fumio Onishi ein in die Abgründe des Reichs der aufgehenden Sonne – in einen zutiefst widersprüchlichen Kosmos voll rätselhafter Traditionen zwischen höchster Eleganz und Kultiviertheit einerseits und blinder Grausamkeit und fragwürdigen Atavismen andererseits, in eine Unterwelt, die ebenso geprägt ist von dem alten Ethos der Samurai wie von irritierenden Werten, fremdartigen Ritualen und verstörender Gewalt.
»Das Jahr der Katze« ist ein ungewöhnlicher Thriller in der Tradition eines Cormac McCarthy oder Quentin Tarantino und das faszinierende Panorama einer bizarren japanischen Unterwelt, die noch immer die Traditionen der Samurai-Zeit beschwört, auch wenn ihre goldene Zeit längst der Vergangenheit angehört.
Zum Autor
CHRISTOPH PETERS wurde 1966 in Kalkar geboren. Er ist Autor zahlreicher Romane und Erzählungsbände und wurde für seine Bücher mehrfach ausgezeichnet, unlängst z. B. mit dem Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg (2016) und dem Wolfgang-Koeppen-Preis (2018). Christoph Peters lebt heute in Berlin. Zuletzt erschienen von ihm bei Luchterhand der Roman »Der Arm des Kraken« (2015) sowie der Erzählungsband »Selfie mit Sheikh« (2017).
Christoph Peters
Das Jahr der Katze
Roman
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2018 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Buxdesign | München
Covermotiv: Plainpicture / Bill Brennan
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-16362-4V002
www.luchterhand-literaturverlag.de
Wenn Sie in Ihren Sarg steigen und Ihr Lebenvon dort aus betrachten, erscheint es Ihnenweder gut noch schlecht.
TAISEN DESHIMARU ROSHI,»FRAGEN AN EINEN ZENMEISTER«
1.
»Wenn du willst, bist du um halb zwölf an der Tankstelle Spanische Allee.«
Nachdem der Satz zusammen mit Onishis Nummer auf dem Display ihres Telefons erschienen war, hatte Nikola den Fernseher ausgeschaltet und war in die Küche gegangen, lediglich aus dem Bedürfnis, sich zu bewegen, nicht, um dort etwas Bestimmtes zu tun. Unmittelbar zuvor war in einer grellen Computeranimation die Magmablase unter dem Yellowstone-Nationalpark explodiert. Aschewolken und eine monatelange Sonnenfinsternis hatten die gegenwärtige Welt in den Untergang gestürzt. Im Nachrichtenticker war gemeldet worden, dass die Berliner Polizei Waffen und Sprengstoff bei einer rechtsextremen Splittergruppe gefunden hatte und einen Zusammenhang mit der aktuellen Mordserie an vietnamesischen Geschäftsleuten im Osten der Stadt vermutete.
In Nikola hatten sich gegenläufige Empfindungen überlagert: Aufregung, die an Glück grenzte; Schmerz über verschiedene Abschiede; Staunen. Beim Gedanken an Yukis Tod waren ihr Tränen in die Augen gestiegen, denen sie jedoch keine Beachtung geschenkt hatte.
Im ersten Moment war sie sicher gewesen, Onishi würde sie irgendwohin mitnehmen, im nächsten dachte sie, dass er sie ebenso gut erstechen, erschießen, aus dem fahrenden Wagen stoßen konnte, weil sie zu viel wusste oder weil er ihr Verhalten ihm gegenüber nicht respektvoll genug fand.
Sie zog das Messer mit der langen, schmalen Klinge aus dem Block, das Yuki, bevor er ermordet wurde, manchmal benutzt hatte, um ihr Bewegungsabläufe für die Selbstverteidigung zu zeigen, bildete sich aber nicht ein, dass sie damit gegen Onishi eine Chance hätte. Trotzdem spürte sie keine Angst.
Seit Onishi in der Frühe weggegangen war, hatte sie allein in ihrer Wohnung gehockt und darauf gewartet, dass es dunkel wurde. Die Welt, in der sie die vergangenen vierundzwanzig Monate zugebracht hatte, existierte nicht mehr, eine andere, in die sie hätte zurückkehren können, gab es nicht. Sie hatte keine beste Freundin, und ehe sie wieder zu ihrer Mutter nach Boppard zog, ließ sie sich lieber von einem Japaner abknallen, der zumindest darauf achten würde, dass es nicht wehtat.
Sie holte die lederne Reisetasche aus dem Schrank, die Yuki ihr geschenkt hatte, als sie zum ersten Mal zusammen nach Essaouira geflogen waren, warf das Messer hinein, überlegte, was sie sonst mitnehmen sollte: MacBook, Unterwäsche, Rei in der Tube, falls es länger dauerte, bis sie irgendwo Wäscheservice oder eine Waschmaschine hatten; T-Shirts, Shorts, Socken, Jeans, zwei Trainingshosen, einen Hoody; das schwarze Trikotkleid, wenn sie ausgingen; Tampons. Im Grunde spielte es keine Rolle, ob sie etwas vergaß. Mittlerweile konnte man fast überall rund um die Uhr alles kaufen, und auf ihrem Konto lag eine Menge Geld, von dessen Existenz niemand wusste. Streng genommen gehörte es ihr nicht, doch das ließ sich schwer nachweisen. Ohne ihre Unterstützung hätte Yuki in diesen zwei Jahren mehr oder weniger nichts zustande gebracht: In technischer und organisatorischer Hinsicht war er eine Null gewesen. Sie sah das Geld als eine Art Gehalt, das er für ihre Mitarbeit gezahlt hatte, auch wenn Teile davon erst noch hätten investiert werden sollen, in Haifischflossen oder was auch immer. Dann hätte sie ihren Anteil in einem oder zwei Monaten erhalten, jetzt war es eben dieses Geld. Es stand ihr zu. Sobald sie wieder eine halbwegs feste Bleibe hätten, musste sie versuchen, es auf ein neues Konto zu transferieren, und das alte auflösen, möglichst ohne dass Onishi es merkte, denn irgendwann würden sogar die Deppen von der Berliner Polizei auf ihren Namen stoßen, und ob sie dann noch Zugriff darauf hätte, war fraglich.
Sie packte ein Paar Ersatzturnschuhe ein, zog den Reißverschluss zu, warf die Tasche über die Schulter und trat aus der Wohnung in der Gewissheit, nie wieder zurückzukehren. Im Treppenhaus dachte sie, dass sie weder wusste, was Onishi vorhatte, ehe er sie abholte, noch konnte sie sicher sein, dass er es überlebte. Für einen Moment spürte sie die Demütigung, falls sie spät in der Nacht vielleicht doch wieder allein vor ihrer Tür stünde. Dann fiel ihr Manji ein, der nicht sterben konnte wegen der Kessenchu-Würmer, die in ihm lebten und alle Wunden heilten, und sie entschied, sich keine weiteren Gedanken zu machen.
Am Automaten der Sparkasse hob sie tausend Euro von ihrem Konto ab, zog bei der Volksbank noch einmal ebenso viel mit der Kreditkarte. Danach stieg sie in die S-Bahn und fuhr zum Nikolassee, ging zur Tankstelle, setzte sich auf die Bordsteinkante und wartete, abwechselnd aufgeregt wie mit siebzehn vor ihrer Interrail-Tour und so mutlos, dass sie nicht einmal in der Lage gewesen wäre, das ganze Unternehmen abzublasen. Ein Spruch von Onishis dubiosem Meister Harada, der die Leute der Nekodoshi-gumi in Karate und Schwertkampf trainierte, drehte sich in ihrem Kopf: »Die Art, wie du wartest, entscheidet über den Ausgang des Kampfes.«
Wenn das stimmte, hatte sie schon verloren.
Um zwanzig vor zwölf bog ein großer dunkelblauer BMW auf den Platz vor den Zapfsäulen. Das kühle Laternenlicht ließ Onishis Haut bleicher erscheinen, als sie tatsächlich war. Er stieß die Beifahrertür auf, sagte »Steig ein«, und fuhr ohne zu tanken zurück auf die Autobahn.
Seitdem waren acht Tage vergangen. –
Nikola stand auf dem schmalen Balkon und zündete sich eine Zigarette an. Der Regen prasselte herunter wie in einem japanischen Film. Allerdings erinnerte ihre Aussicht über die nächtlichen Dächer eher an eine amerikanische Vorstadt als an Tokio. Die Wohnung befand sich im fünften Stock eines achtstöckigen Hauses, das weder besonders neu noch besonders alt war. Seit dem Morgen hatte sie fast eine komplette Packung Marlboro light geraucht. Normalerweise kam sie damit eine Woche aus. Der Wind wehte so schwach, dass kaum ein Tropfen sie traf. Gern hätte sie sich nass regnen lassen, um überhaupt etwas zu spüren.
Seit dreieinhalb Tagen hockte sie in diesen beiden Zimmern, die Friedemann Weinzierl, einem deutschen Freund Onishis, und dessen japanischer Frau Masumi gehörten. Friedemann arbeitete freiberuflich als Jurist und Journalist, Masumi war Kunsthistorikerin und betreute seit Kurzem das Kulturprogramm für die ausländischen Unternehmensgäste bei Honda. Offenbar hatte Onishi sie überredet, auf seine Kosten spontan Urlaub in den Bergen zu machen.
Nikola konnte nicht überprüfen, ob die Geschichte stimmte, aber es sprach einiges dafür: Neben dem Fernseher lag ein Stapel deutscher DVDs, im Regal standen deutsche Bücher: »Stiller«, »Frau Jenny Treibel«, »Der Richter und sein Henker«, alles ältere Taschenbuchausgaben, außerdem juristische Fachliteratur und mehrere Bildbände.
Onishi hatte ihr gesagt, sie dürfe auf keinen Fall ohne ihn vor die Tür gehen, es sei sehr gefährlich, auch wenn im Augenblick außer Friedemann und Masumi niemand wisse, dass er sie hier untergebracht habe. Er müsse ein paar Dinge klären. Welche genau, hatte er nicht gesagt, doch sein Ton war düster gewesen – sie hatte gar nicht erst versucht, mit ihm zu diskutieren.
Immerhin hatte er ihr ein japanisches Telefon dagelassen, auf das er in unregelmäßigen Abständen Textnachrichten schickte: »Tut mir leid, ich habe den, den ich sprechen muss, nicht angetroffen«; »Keine Sorge, es dauert nicht mehr lange«; »Harada Sensei hat gesagt, dass er es sich überlegt.«
Gerne hätte sie ab und zu einen Satz gelesen, in dem das Wort »Liebe« oder etwas in der Art vorkam, doch das war wohl zu viel verlangt von einem Japaner, der normalerweise Nutten als Freundinnen hatte.
Sie war froh, dass sie hier wenigstens ein Telefon benutzen durfte. In Berlin hatte Onishi ihr, drei Tage nachdem er zum ersten Mal in ihrer Wohnung aufgetaucht war, verboten, bei ihm anzurufen, und in Amsterdam hatte er darauf bestanden, dass sie ihr iPhone in eine Gracht warf, nachts von einer kleinen Brücke, als weit und breit kein Mensch zu sehen war, SIM-Karte und Gehäuse getrennt.
Im Rahmen seiner Möglichkeiten bemühte er sich, ihr das Gefühl zu geben, nicht vollkommen verlassen in einer fremden Riesenstadt zu sein. Neben den Nachrichten zum Stand der Dinge kam zwei Mal täglich eine SMS: »Ich habe dir Essen bestellt«. Wenig später klingelte ein Mann, der ihr nicht ins Gesicht sah und unter eckigen Verbeugungen eine Bentō-Box überreichte. Das Essen schmeckte fast immer gut, auch wenn sie oft nicht wusste, was sie eigentlich aß.
Sie schaute auf die Uhr – es war Viertel nach zehn –, drückte die Kippe in den Aschenbecher auf dem Klapptisch, konnte sich aber nicht dazu durchringen, in die Wohnung zurückzukehren. Im ununterbrochenen Surren der Klimaanlage wurde die Leere laut. Sie beugte sich über das Geländer, sah unten auf der Straße Autos und Fußgänger, ab und zu ein Fahrrad, von allem deutlich weniger, als sie es sich vorgestellt hatte.
Jahrelang hatte sie davon geträumt, nach Japan zu reisen, wegen der alten Tempel, vor allem aber wegen des pulsierenden Lebens in Tokio: gewaltige Lichtexplosionen, wohin man auch schaute, die ganze Stadt ein einziger wummernder Rhythmus, dem sie sich übergeben – in dem sie sich aufgelöst hätte. Sie wollte sich tätowieren lassen und endlich lernen, wie man ein Katana zieht. Jetzt war sie hier, und es passierte nichts. Offenbar gab es in Tokio Bezirke, die langweiliger waren als die Fußgängerzone von Koblenz.
Sie dachte an ihre Mutter, der sie noch immer keine Nachricht geschickt hatte. Vermutlich war inzwischen die Polizei bei ihr aufgetaucht und hatte behauptet, ihre Tochter Nikola sei in eine Reihe von Morden an Berliner Vietnamesen verwickelt und habe sich ins Ausland abgesetzt. Sobald sie dort anriefe, würde ihr neues Telefon mittels einer Fangschaltung registriert werden, wenig später hätte man ihren gegenwärtigen Aufenthaltsort ausfindig gemacht, die deutschen Ermittler würden bei den japanischen Kollegen Amtshilfe anfordern, kurz darauf säße sie in Auslieferungshaft. Eine E-Mail von Friedemanns Computer sei erst recht zu riskant, hatte Onishi gesagt.
Sowieso hätte sie nicht gewusst, wie anfangen. Sie liebte ihre Mutter und hatte ihr immer alles erzählt, was in ihrem Leben wichtig gewesen war. Dann war Yuki im Fitnessstudio aufgetaucht, irgendwann hatte sie ihn mit nach Hause genommen, sich schließlich ernsthaft in ihn verliebt. Lange Zeit war ihr nicht klar gewesen, womit er sein Geld verdiente. Weil er ein paar deutsche Gedichte auswendig kannte, hatte sie ihrer Mutter erzählt, er sei Germanist, habe ein Promotionsstipendium und reiche Eltern. Später war es ihr zu peinlich gewesen, all das richtigzustellen, abgesehen davon, dass Yuki ihr verboten hatte, mit jemandem über seine Arbeit zu reden. Die ständigen Flüge nach Marokko hatte sie ebenso verschwiegen wie die Tatsache, dass sie nicht mehr als Fitnesstrainerin arbeitete. Mehrmals waren sie auch zu dritt unterwegs gewesen, in Berlin und zu Hause am Rhein. So hatten sich einzelne Notlügen allmählich zu einem riesigen Lügengebäude zusammengesetzt. Bestimmt fand ihre Mutter den Vertrauensbruch schlimmer als die Tatsache, dass Nikola einen japanischen Gangster geliebt und sich jetzt mit dessen bestem Freund nach Tokio abgesetzt hatte.
In einigen Fenstern des Hochhauses schräg gegenüber flimmerten Fernseher. Gelegentlich bewegte sich jemand durch ein Zimmer. Alle waren so weit entfernt, dass Nikola meist nicht einmal Frauen von Männern unterscheiden konnte.
Sie ging in die Wohnung zurück, schloss die gläserne Schiebetür zum Balkon und ließ sich aufs Bett fallen. Es war ein richtiges Bett – kein Futon – mit einer weichen Matratze und vielen Kissen, drei davon in Form von Emojis oder Mangafiguren, die sie nicht kannte. In der Nische dem Fußende gegenüber hing ein sonderbares Gebilde, wahrscheinlich ein Kunstobjekt, das aus einer hellbeigen, zweifach geknickten Fläche bestand. Wenn sie es länger anschaute, schien es ihr, als ginge sie entlang einer endlosen Wand geradewegs ins Nichts. Links davon stand ein mittelgroßer Ficus, wie man ihn in jeder deutschen WG hätte finden können.
Sie warf sich auf den Rücken und starrte die makellos weiße Decke an, in deren Mitte eine runde Lampe aus Mattglas fahlgelbes Licht absonderte. Japanische Leuchtstoffröhren hatten ein besonders unangenehmes Spektrum. Jedenfalls kam es ihr so vor. Sie spielte mit dem Gedanken, ihre Sachen zu packen, hinunter auf die Straße zu gehen, ein Taxi heranzuwinken und sich zum Flughafen bringen zu lassen. Irgendein Fahrer würde das Wort »Airport« schon verstehen, und dort reichte Englisch, um ein Ticket zu kaufen. Mehr als tausendfünfhundert Euro würde es nicht kosten. Allerdings bestand die Gefahr, dass sie bei der Einreise in mehr oder weniger jedes Land, das mit den Computern von Interpol verbunden war, festgenommen wurde.
Eine Welle Selbstmitleid schnürte ihr den Hals zu. Sie war achtundzwanzig und nichts in ihrem Leben hatte geklappt. Demnächst würde vielleicht jemand versuchen, sie umzubringen, und nicht einmal das würde ihr persönlich gelten, sondern ihr Tod sollte vor allem Onishi treffen. Am liebsten hätte sie geheult, weil das manchmal befreiend wirkte, doch ganz gleich, wie fest sie die Augen zusammenkniff – es wollten keine Tränen kommen. Nicht einmal ein richtiges Schluchzen brachte sie zustande. Sie drehte sich auf den Bauch, grub den Kopf in die Kissen, bis die Luft knapp wurde, wandte das Gesicht zur Seite, wo die tiefhängende Wolkendecke hinter dem Fenster in einem kränklichen Grün erschien, sah sich selbst von außen, wie sie dalag und sich bedauerte, als hätte jemand anderes ihre Situation zu verantworten.
Es dauerte einen Moment, bis sie begriff, dass das metallische Geräusch im Eingangsbereich von einem Schlüssel herrührte. Augenblicklich verflog ihre Weinerlichkeit, sie rutschte fast lautlos vom Bett auf den Boden, atmete flach und versuchte mit dem Fuß die Balkontür aufzuschieben.
»Ich bin’s«, rief Onishi.
Nikola setzte sich auf, holte tief Luft und schüttelte den Kopf.
Er stand im Türrahmen, die Arme vor der Brust verschränkt, lachte, als er sie neben dem Bett hocken sah.
»Sehr witzig.«
»Du hast Angst gehabt.«
»Wieso schickst du mir keinen Text, dass du kommst, verdammt?«
»Es war spontan. Ich hatte in der Gegend zu tun.«
»Kann ich jetzt endlich mit, dass ich mal was anderes sehe als dieses Loch?«
Er trug weder einen schwarzen Anzug noch Trainingskleidung, sondern Jeans und seine braune Lederjacke. Niemand auf der Straße sollte ihn als Yakuza identifizieren.
»Das ist eine sehr schöne Wohnung. Sogar ziemlich groß für eine Einzelperson in Tokio.«
Das Wort »Einzelperson« hatte sie zum letzten Mal aus dem Mund ihrer Großmutter gehört, die seit über zehn Jahren tot war. Schon damals hatte es sonderbar geklungen.
»Kann ja sein, aber ich werde hier irre.«
»Das glaube ich nicht.«
Sie verdrehte die Augen.
»Hast du geregelt, was du regeln musstest?«
»Bald.«
»Was machst du eigentlich den ganzen Tag? – Musst du erst deine Liebhaberinnen hier beruhigen, dass sie kein Theater veranstalten?«
»Keine Liebhaberinnen.«
Sie stand auf, um entschlossener zu wirken, und wusste dann nicht, wohin.
»Ich erkläre es dir später.«
»Das ist Scheiße. Selbst wenn du mir nicht vertraust – wem sollte ich es denn bitte schön weitersagen? Ich kann mir ja nicht mal Pizza auf Japanisch bestellen.«
Sie fragte sich, ob ihre Stimme wirklich so schrill klang oder ob es ihr nur so vorkam, weil sie sich seit Tagen nicht richtig hatte sprechen hören.
»Wenn ich dir nicht vertrauen würde, hätte ich dich in Berlin gelassen.«
»Also?«
»Ich wollte sehen, ob es dir gut geht. Obwohl es vielleicht klüger gewesen wäre, nicht zu kommen.«
»Nein.«
»Was bedeutet ›nein‹?«
»›Nein‹ bedeutet, dass es mir nicht gut geht.«
Onishi sah sich hilfesuchend um. Er war es nicht gewohnt, von einer Frau Antworten zu bekommen, die ihm nicht gefielen.
»Wir können uns an den Tisch setzen«, sagte er.
Sie schlug sich mit der flachen Hand an die Stirn, was wie eine Ohrfeige klang.
»Die Stühle sind unbequem.«
»Das kann sein, aber es sind keine anderen da.«
Er ist völlig gestört, dachte sie, noch gestörter als Yuki: Fast vier Tage hatten sie sich nicht gesehen, nicht angefasst, doch er war weder imstande zu sagen noch zu zeigen, dass er sie wollte, jetzt, hier, als Frau, als Nikola. Wenigstens zur Begrüßung oder als er gemerkt hatte, wie erschrocken sie war, hätte er ihr seine Lippen auf den Mund drücken können. Das war allgemeiner Standard, wahrscheinlich sogar in Japan. Doch Onishi setzte sich an den Tisch und deutete auf den leeren Stuhl gegenüber.
Vielleicht wollte er es nicht – vielleicht wollte er sie überhaupt nicht mehr, jetzt, wo er zu Hause war, sondern hatte sich während der letzten Tage mit irgendeiner Ex beschäftigt oder sich durch die Clubs der Nekodoshi-gumi gefickt – wäre sie in seiner Situation gewesen, hätte sie es wahrscheinlich auch nicht zugegeben.
Sie sah, dass er eine Waffe unter der Jacke trug.
»Ok, und jetzt?«
Onishi schaute auf seine Hände, die flach vor ihm auf der Tischplatte lagen, schnaubte durch die Nase, räusperte sich: »Ich bin gekommen, weil ich dir sagen wollte … Um zu sagen, dass ich mich sehr freue, mit dir hier in Tokio zu sein, und dass ich alles tun werde, damit du nicht in Gefahr kommst und selber zufrieden bist.«
»Danke, das ist nett.«
»Aber du musst auch dabei helfen.«
2.
Überhaupt ist es nicht einfach für eine junge Frau aus Deutschland, in Tokio zu leben, besonders mit einem japanischen Freund, der eine sehr traditionelle Einstellung hat. Man muss auch berücksichtigen, dass eine Tätigkeit, wie Onishi sie ausübt, viele Belastungen im Privaten mit sich bringt. Deshalb habe ich den jungen Männern immer gesagt, wenn sie zu mir gekommen sind, dass es einfacher ist, sie verzichten auf eine enge Bindung zu einem bestimmten Mädchen, bis sich ihre Stellung gefestigt hat, sowohl in ihrem Inneren als auch äußerlich. Ich meine damit nicht Enthaltsamkeit. Von Enthaltsamkeit bin ich wenig überzeugt, vor allem nicht für die, die anspruchsvollere Aufgaben zu erledigen haben. Wenn sie ganz ohne Frauen sind, baut sich eine Spannung auf, die dazu führt, dass sie unberechenbar werden in ihren Handlungen, für sich selber genauso wie für die anderen. Und das hat nichts mit der Art Unberechenbarkeit zu tun, die wir in jahrelanger Übung zu erreichen versuchen, damit der Gegner sich niemals auf unsere nächste Bewegung einstellen kann.
Der Paarungstrieb bringt eine Menge Durcheinander hervor. Obwohl sie eigentlich erwachsen sind, machen die Leute sich zum Affen oder sie gefährden sogar ihre Gruppe. Insofern ist es nicht falsch, dass sie mit Frauen schlafen, aber besser mit solchen, die ein sachliches Verhältnis dazu haben. Dann findet eine Entlastung statt, ohne dass ihr Herz zu sehr beteiligt ist. Eine solche Beziehung muss nicht schlechter sein als andere. Gerade wenn die Frau Erfahrung im Umgang mit dem Temperament der Männer hat und weiß, wie man sie zufriedenstellt, ohne dass sie den Kopf verlieren, erfüllt es denselben Zweck wie eine Ehe, nur dass man sich nicht um Kinder kümmern muss.
Wir werden sehen, von welcher Art dieses Mädchen aus Deutschland ist – Nikola. Fest steht, dass sie keine Woche gebraucht hat, um sich von Ozawa Yuki auf Onishi Fumio umzustellen. In früherer Zeit war so etwas normal bei denen, die mit Yakuza zusammen gewesen sind: Sobald einer gestorben ist, hat der Nächste sich um die Frau gekümmert. Wenn sie diese Anpassungsfähigkeit hat, lässt es auf einen funktionierenden Verstand schließen, der sich den Gegebenheiten entsprechend verhält. Trotzdem wird die Eingewöhnung schwer werden. Selbst Japanerinnen finden es heutzutage nicht mehr erstrebenswert, mit einem Yakuza zusammenzuleben, obwohl sie doch, anders als die Frauen im Westen, ihre ganze Kindheit dahingehend erzogen wurden, nicht zuerst auf sich selber zu achten. Natürlich ist es möglich, dass ein Mann wie Onishi über Monate, vielleicht sogar Jahre verschwindet, ohne dass sie etwas von ihm hört, weil er einen Auftrag zu erledigen hat oder weil er sich besser für eine Weile im Hintergrund hält. Abgesehen davon, geht er immer ein hohes Risiko ein bei dem, was er tut. Aber selbst wenn er viel Geld verdient und teure Geschenke kauft, reicht es den Frauen mittlerweile nicht mehr, um zufrieden zu sein. Durch die Köpfe der jungen Generation schwirren diese Ideen von romantischen Gefühlen, die sie aus amerikanischen Filmen kennen. Aber das ist auch nur die halbe Wahrheit: Wenn der Liebhaber nicht genug verdient, tauschen sie ihn schnell gegen einen anderen aus, der sich mehr lohnt, ganz gleich, wie groß die Liebe vorher angeblich gewesen ist.
Ich weiß nicht, wie deutsche Frauen in dieser Hinsicht denken. Geld dürfte jedenfalls nicht Onishis Problem sein. Er wird sehr gut bezahlt. Und er hat einen zuverlässigen Charakter. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er seine Freundinnen schlägt, wie Ozawa Yuki das getan hat. Im Gegenteil: Wenn es um sein Privatleben geht, ist er großzügig und lässt den Frauen den Freiraum, den sie wollen. Aber natürlich braucht er für seinen Beruf auch Härte, die sich möglicherweise insgesamt auf seine Persönlichkeit auswirkt oder von Anfang an schon darin verankert war.
Bevor wir irgendetwas in die Wege leiten, müssen wir abwarten, wie sich der Oyabun Takeda zu Onishis Vorgehen in Berlin stellt. Bis jetzt hat sich niemand deswegen bei mir gemeldet. Das kann ein gutes Zeichen sein oder ein schlechtes, für Onishi genauso wie für mich.
Wenn man eine bestimmte Verpflichtung eingegangen ist, bleibt sie lange erhalten. Der Lehrer muss vielleicht sein ganzes Leben für das einstehen, was der Schüler tut. Zumindest kann man so denken, und ich zähle nicht zu denen, die meinen, dass sich darin eine falsche Auffassung spiegelt. Alle Menschen sind untereinander verbunden, sie bilden einen Organismus, umso mehr Meister und Schüler. In anderer Hinsicht sind sie natürlich getrennt, das ist auch wahr. Es handelt sich um verschiedene Ebenen, die man nicht verwechseln soll, sonst gerät alles in Verwirrung.
Allerdings bin ich seit einiger Zeit nicht mehr derjenige, mit dem die Führung der Nekodoshi-gumi sich berät, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden. Ich weiß nicht, in welche Zukunft der Oyabun Takeda die Gruppe führen will, doch ich glaube, dass er den traditionellen Weg verlassen wird oder schon verlassen hat.
Man kann natürlich zu dem Ergebnis gelangen, dass Onishis Handlungsweise in Berlin eigenmächtig gewesen ist. Es scheint, als würde sich Takedas Einschätzung mehr und mehr dorthin neigen. Demzufolge hätte Onishi seine Verpflichtungen vergessen und sich nur für sich selber und seinen Zorn interessiert. Wenn dem so wäre, frage ich mich, was ihn dazu gebracht hat, sich dermaßen gehen zu lassen? Eigentlich entspricht es ihm nicht. Verglichen mit den meisten Yakuza ist er zurückhaltend in allem. Wutausbrüche habe ich bei ihm nie gesehen. Er stammt aus einer alten Familie, die es insgesamt schwer hat, wegen des Karmas, das einer seiner Ahnherren, Onishi Naruhiko, angesammelt haben soll. Solche Geschichten können einen großen Einfluss ausüben. Ähnlich wie der Meister seinen Schüler auf den Weg bringt, bestimmen die Taten der Vorfahren die Geschicke der Lebenden. Doch das ist nur eine Weise, die Dinge zu verstehen.
Vielleicht haben die letzten beiden Wochen ihn aus der Ruhe gebracht, weil er vor lauter Unvorhergesehenem das tägliche Zazen vernachlässigt hat. Das Zazen ist unverzichtbar, um sich die Klarheit des Geistes zu bewahren, ganz gleich, was um einen herum passiert. Bestimmt wollte er das Mädchen beeindrucken, damit sie nicht länger Ozawa Yuki hinterherweint, und sei es bloß in ihrem Innern. Wenn der Schwanz nach vorne zeigt, läuft der Mann hinterher. So ist es nun einmal.
Natürlich kann der Oyabun Takeda nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Drei tote deutsche Polizisten und acht tote Vietnamesen innerhalb einer Woche, darunter eine hochrangige Führungspersönlichkeit, werden den reibungslosen Verlauf der geschäftlichen Aktivitäten auf internationaler Ebene empfindlich stören, egal wer zuerst Gewalt angewendet hat. Man kann die Konsequenzen noch gar nicht abschätzen. Die Vietnamesen werden einen Ausgleich fordern und vielleicht Krieg anfangen. Selbst wenn es für sie hier nichts zu gewinnen gibt, können sie in Amsterdam oder Bangkok, wo wir in der Unterzahl sind, großen Schaden anrichten. Einige sind mit chinesischen oder koreanischen Gruppen verbündet, die Heroin und synthetische Drogen auf dem Festland von vietnamesischen Kurieren übernehmen und hierher bringen. Insofern haben sie doch Möglichkeiten, den Konflikt zu uns zu tragen. Sicherlich werden die Polizeikräfte der verschiedenen Länder ihre Zusammenarbeit verstärken, und wie das Sprichwort sagt: »Wer einen Misthaufen umgräbt, fördert eine Menge alter Scheiße zutage.«
Er hätte wenigstens die Polizisten heraushalten müssen, ganz gleich, wie berechtigt es war, den Vietnamesen ihre Grenzen zu zeigen. Sie verstehen ja nur diese Sprache. Aber die Erfahrung lehrt, dass es besser ist, den Staat nicht als Gegner zu haben, weder bei uns und erst recht nicht im Ausland. Das hat immer Vorrang vor allem anderen. Zumindest war es so, bis die Regierung das Einvernehmen, das bei uns viele hundert Jahre herrschte, mit dem Gesetz über die Verhinderung von Straftaten durch Mitglieder gewalttätiger Gruppen aufgekündigt hat.
Man sagt, es sind die Amerikaner gewesen, die so lange Druck auf unser Parlament ausgeübt haben, bis es eingeknickt ist. In Amerika wissen sie nicht, wie man die schlechten Aspekte einer Gesellschaft in die Ordnung einbindet. Dort haben sie Abertausende von Kriminellen, die niemand unter Kontrolle hält. Sogar die Polizisten sind ohne Disziplin. Manche schießen unkontrolliert um sich, andere laufen zum Staatsanwalt, weil sie meinen, etwas gesehen zu haben – Korruption, unangemessene Gewalt bei Festnahmen … Dann zeigen sie ihre eigenen Kollegen an, ohne vorher mit den Vorgesetzten gesprochen zu haben. So wurde es mir von Leuten erzählt, die dort gewesen sind. Auf diese Weise erzeugt man immer nur neue Probleme, statt Lösungen zu schaffen. Die Amerikaner begreifen nicht, dass ein Körper verschiedene Organe benötigt, um gesund zu bleiben. Sie klemmen sich das Gedärm ab und wundern sich dann, wenn sie kotzen. Weil sie außerdem meinen, dass außer ihnen niemand auf der Welt den richtigen Weg kennt, können sie nicht akzeptieren, dass wir diese Dinge auf unsere Art regeln. Es gibt viele Japaner, die Geschäfte in San Francisco oder Los Angeles machen, wo es um eine Menge Geld geht. Trotzdem habe ich nie von einem gehört, der dort in der Todeszelle sitzt. Das liegt daran, dass ein Japaner, der eine gute Ausbildung durchlaufen hat, weiß, wie man sich den Gegebenheiten entsprechend verhält, und nicht glaubt, dass sein Kopf härter ist als eine Wand, und wäre sie nur aus Papier. Aber wahrscheinlich wird es auch bei uns nicht mehr lange auf diese Weise ablaufen.
Die Traditionen lösen sich auf, nicht nur in Japan. Die Werte des Bushidō, mit denen wir dieses Land lange davor bewahrt haben, unter fremde Herrschaft zu geraten, gelten nicht mehr. Nach dem Krieg, und obwohl Tennō Hirohito abgedankt hatte, sah es eine Zeitlang so aus, als könnten wir uns aus der Vergangenheit heraus erneuern und den Westen mit seinen eigenen Waffen schlagen. Aber am Ende war es zu viel Anpassung, und wir haben es nicht geschafft, sie nur im Äußeren zu belassen. Sie ist bis in unser Mark vorgedrungen, ohne dass wir es gemerkt haben. Dann kam die Wirtschaftskrise, und es hat sich gezeigt, dass wir im Ganzen zu schwach sind. Man kann nicht erwarten, dass einem Angestellte oder Untergebene ihr Leben schenken, wenn sie gleichzeitig wissen, dass sie vor die Tür gesetzt werden, sobald Schwierigkeiten am Horizont auftauchen.
Heute steht der Profit an erster Stelle. Daneben breiten sich Träume und Schwärmereien aus. Die Kälte des Geldes soll mit der Hitze des Gefühls ausgeglichen werden. Das ist so, als würde man glauben, dass glühende Kohlen einem nicht die rechte Hand verbrennen, solange man Eiswürfel in der Linken hält. Erstaunlicherweise sind solche Ansichten weit verbreitet.
Wenn man die Veränderungen in Japan sieht, kann man natürlich der Meinung sein, es wäre besser gewesen, der Shōgun Tokugawa Iesada hätte damals nicht mit Admiral Perry verhandelt, sondern den Samurai befohlen, zu kämpfen und zu sterben – wenn das eben der Ausgang des Kampfes gewesen wäre. Oder Tennō Hirohito hätte den Obersten Kriegsrat angewiesen, niemals zu kapitulieren, egal wie viele Atombomben die Amerikaner über uns abwerfen. Allerdings hat die Idee, dass andere Ereignisse denen, die eingetreten sind, vorzuziehen gewesen wären, nichts mit der Buddha-Lehre zu tun, wie wir sie verstehen. Wir nehmen die Gegebenheiten an und handeln doch mit äußerster Entschlossenheit, denn es gibt nichts anderes. Sobald man auf den Zweifel hört, ist man verloren, dann hat man selbst beim Kartenspiel keine Chance.
Obwohl es wegen der tausend Hindernisse, die nach der Einführung der Gesetze gegen die Yakuza aufgebaut worden sind, sehr schwierig geworden ist, in den traditionellen Bereichen mit Erfolg zu arbeiten, geben sich die meisten Vereinigungen immer noch Mühe, Konfrontationen mit der Polizei und den Behörden zu vermeiden. Manche Aktivitäten wurden in den legalen Sektor verlagert, Börse, Immobilien, Filmindustrie. Aber gerade dort verlangen die Leute nach Drogen und Nutten, und irgendjemand muss sich darum kümmern, dass derlei zur Verfügung steht, sonst fallen Organisation und Verdienst an ausländische Banden, die sich nicht an unsere Regeln gebunden fühlen. Das passiert ja schon.
Wenn die Entwicklung in diese Richtung weitergeht, werden unsere Politiker den Yakuza der früheren Zeit bald nachweinen, denn sie standen niemals in Gegnerschaft zum Staat – eher war es andersherum: Sie haben dafür gesorgt, dass die Ordnung in den schmutzigen Bereichen aufrechterhalten wurde.
Jeder Ermittler, auch wenn es sich im Prinzip um einen guten Menschen handelt, ist dort, wo Frauen oder Drogen angeboten werden, vielfältigen Gefahren ausgesetzt. Vor allem sind es natürlich Gefahren, die in ihm selber lauern, aber das ändert nichts. Wenn ans Licht kommt, dass er Schwäche gezeigt hat, beschädigt es das Ansehen des gesamten Staates bei den normalen Bürgern. Was zur Folge hat, dass diese schließlich glauben, auch sie müssten sich nicht mehr an die Gesetze halten, egal ob sie nun aufgeschrieben sind oder von alters her überliefert. Das schaukelt sich gegenseitig hoch. Am Ende wächst die Gewalt in alle Richtungen und bedroht die Ordnung der gesamten Gesellschaft.
Für die meisten Menschen bringt Chaos großen Schaden und wenig Nutzen. Bei einigen ist es umgekehrt, aber dass sie besser sind als die anderen und deshalb größere Ansprüche auf ein zufriedenes Leben haben, wird kaum einer behaupten. Niemand kann vorhersagen, welche Folgen es hat, wenn die Leute nicht mehr darauf vertrauen, dass die Regierung ihre Sicherheit gewährleistet. Vielleicht tun sich am Ende Geschäftsmänner, Ladenbesitzer und Privatpersonen in ihren Vierteln zusammen, sammeln Geld und wenden sich doch wieder an Yakuza, die traditionellen Prinzipien folgen, damit sie die Straßen von den gewöhnlichen Kriminellen säubern. Wenn die Verhältnisse sich stark verschlechtert haben, erinnern sich viele daran, wie es gewesen ist, als es besser war. Es wird eine Menge Blut fließen, und wer in die Konflikte verwickelt ist, kann sich nirgends sicher fühlen.
Auch deswegen weiß ich nicht, was wir mit Onishis deutscher Freundin anfangen sollen. Nicht nur, weil sie eine Ausländerin ist, die nicht versteht, wie die Gegebenheiten in Japan sind. Frauen haben ja insgesamt ein anderes Verhältnis zum Tod. Sie tragen das Leben in sich, bringen die Kinder auf die Welt, dann geben sie ihnen Milch, päppeln sie hoch – all diese Dinge. Deshalb wollen sie es beschützen und können schwer ertragen, wenn es weggenommen wird.
Onishi sagt, Nikola sei eine Frau, wie ich noch keine getroffen habe, und dass es sich lohnt, sie zu unterrichten. Allerdings hatte ich überhaupt noch nie mit einer Frau aus dem Westen zu tun. Ich muss mir ein eigenes Bild machen, auch wenn die Lage im Grunde zu angespannt ist, um mit so etwas zu beginnen. Da kann er mir hundertmal versichern, dass sie keine Anfängerin ist, weil Ozawa Yuki ihr bereits vieles beigebracht hat. Anderseits hat Onishi einen guten Blick. Er sieht, wer das richtige Herz mitbringt. Aber es liegt ein harter Weg vor ihr. Drei Mal härter, als wenn sie ein Mann wäre. Auch für Onishi wird es mit ihr schwerer als ohne sie. Selbst wenn er jetzt für viele in der Nekodoshi-gumi wie ein Held dasteht, weil er den Vietnamesen den Arsch aufgerissen hat.
Hoffen wir, dass der Oyabun eine Entscheidung zu seinen Gunsten trifft. Was noch lange nicht heißt, dass eine Frau akzeptiert wird. In der Yakuza hat es keine kämpfenden Frauen gegeben. Es kann natürlich sein, dass sich diese Dinge jetzt ändern, ganz gleich, ob es mir gefällt oder nicht. Vielleicht gefällt es mir sogar. Wir haben ja heutzutage große Probleme mit jungen Männern, die ihre Kraft schon verloren haben, bevor ihnen überhaupt Haare am Sack wachsen. Statt etwas zu tun, das Stärke und Entschlossenheit fordert, schließen sie sich in ihre Zimmer ein und machen Computerspiele. Einige Wissenschaftler behaupten, es liegt an den Plastikweichmachern oder an den Hormonen im Wasser und im Essen, dass sie keine Männlichkeit mehr ausbilden. Im Westen sind die Frauen schon länger dabei, die Männer zu überflügeln, heißt es. Insofern kann es interessant sein, jemanden wie diese Nikola als Schülerin anzunehmen.
Sowieso sollte man, wenn man den Weg des Schwertes geht, ohne allzu feste Meinungen über dies und jenes sein. Im Kampf verhält sich niemand so, wie es die Regeln verlangen. Wenn dein Gegner die Chance hat, dir mit einem schmutzigen Hieb die Eier zu spalten, wird er es tun. Wer etwas anderes behauptet, lügt, und wer es seinen Schülern beibringt, schickt sie in den sicheren Tod: Der Schwertmeister Suzuki Kenji traf im Alter von siebenundvierzig Jahren auf eine junge Frau, die sehr schön war und ihr langes schwarzes Haar offen über der Schulter trug. Sie grüßte ihn, lächelte unter ihrem hübschen Seidenschirmchen, machte eine schmeichelhafte Bemerkung, dass sie sagenhafte Dinge über seine Manneskraft gehört habe, die sich auch gleich zu regen begann, und nachdem Suzuki Kenji in mehr als fünfzig Kämpfen unbesiegt geblieben war, sah er im nächsten Augenblick, während sein abgetrennter Kopf in den Sand fiel, den Himmel über sich und wie sie ihre Klinge zurück in den Schirm schob.
Ich werde sie mir anschauen in den nächsten Tagen: Nikola.
Hauptsächlich wegen Onishi. Weil er ein sehr guter Schüler war. Und weil er wahrscheinlich demnächst eine Menge Ärger am Hals hat, wo es am Ende vielleicht auf jeden ankommt, der den Umgang mit einer Waffe beherrscht.
Je nachdem, wie der Oyabun entscheidet, können sich auch für mich Schwierigkeiten ergeben, wenn sie erfahren, dass ich Onishi und seine Freundin unterstütze. Vielleicht müssen wir uns für eine Weile ins Hinterland zurückziehen. Nicht wegen mir. Ich bin alt. Seit über vierzig Jahren habe ich mich an keinem Kampf mehr beteiligt.
Andererseits liegen gerade darin Möglichkeiten. Wenn man alt ist, sollte man erst recht darüber nachdenken, etwas Neues anzufangen. Im Grunde gibt es keinen besseren Zeitpunkt dafür. Alle Illusionen, dass man etwas zu verlieren hätte, sind weg. Die jungen Leute sollen ja immer an die Zukunft denken. Man sagt ihnen, morgen und in zwanzig oder dreißig Jahren hätten sie Großes zu erwarten, deshalb müssten sie sehr vorsichtig sein und alle ihre Entscheidungen genau abwägen, besonders in Sachen Geld und Gesundheit. Dann kommt ein Tsunami oder der Lungenkrebs, und die ganze Warterei war umsonst. Abgesehen davon ist nichts erbärmlicher als ein Großvater, der sein Leben lang Wege mit Herz gegangen ist und dann zu Hause vor der Glotze hockt und den Enkeln mit seinem jämmerlichen Gerede von den alten Zeiten auf die Nerven geht. Es wäre besser, so jemand hätte mit zwanzig aufrecht und bei klarem Verstand eine Kugel in den Kopf bekommen. Wenn man die Siebzig hinter sich hat, spielt es keine Rolle mehr, wann man draufgeht. Dann wird alles so einfach, wie es von Anfang an gewesen wäre, wenn man es mit den richtigen Augen betrachtet hätte.
3.
Nikola hockte in einem Becken, das zu hoch für eine Dusche und zu kurz für eine Badewanne war. Es gab keinen Vorhang, so dass sie sich im Sitzen abbrauste, um nicht den winzigen Raum samt angrenzender Toilette zu überfluten.
Onishi telefonierte im Nebenzimmer. Sie hörte alles und verstand kein Wort. Offenbar führte er mehrere Gespräche hintereinander. Anfangs klang er unterwürfig, dann wurde sein Ton lockerer, er lachte kindisch. Nach einer längeren Stille bekam seine Stimme eine Härte, die selbst durch die Wand beängstigend wirkte, unabhängig davon, wem die Drohung galt.
Sie war anderthalb Jahre mit Yuki zusammen gewesen, hatte das Leben jenseits der Legalität als eine Art Strategiespiel betrachtet, mit dem sich ziemlich einfach viel Geld verdienen ließ, und das eine Menge Spaß machte. Wenn Yuki von Risiken gesprochen hatte, vor allem, nachdem er auf die Idee gekommen war, sich auf eigene Faust neue Einnahmequellen zu erschließen, hatte sie es immer nur halb ernst genommen, sich manchmal sogar eingeredet, dass er lediglich die Spannung erhöhen wollte. Doch dann hatten ihn die Vietnamesen erschossen, seine Leiche in einen Teich geworfen, und das Spiel war vorbei gewesen. Fünf Tage später hatte Onishi vor ihrer Wohnung gestanden. Ihr war nichts anderes übrig geblieben, als ihm bei der Suche nach Yukis Mördern zu helfen. Sie wusste nicht genau, wie viele Leute er während dieser Woche in Berlin getötet hatte, sei es, weil sie tatsächlich an Yukis Hinrichtung beteiligt gewesen waren, sei es, weil es sich nicht hatte vermeiden lassen. Im Grunde spielte es auch keine Rolle. Die Toten waren Leute gewesen, für die Gewalt zum Beruf gehört hatte, einschließlich der Möglichkeit, dabei auf der Strecke zu bleiben.
Ihr floss Shampoo ins Auge. Es brannte. Sie begann zu reiben, obwohl es dadurch schlimmer wurde, nahm eine Handvoll Wasser, versuchte es herauszuwaschen, noch eine und noch eine, kniff die Augen zusammen, warf den Kopf in den Nacken, um Reste vom Schaum auszuspülen. Es spritzte nach allen Seiten. Sie drehte den Hahn zu, fluchte auf Sitzbadewannen, hockte eine Weile einfach nur da.
Onishi hatte den Fernseher eingeschaltet. Eine japanische Frauenstimme sprach in entschiedenem Ton, ein Mann entgegnete etwas mit dem abgehackten Pathos zorniger Samurai. Die Frau klang auch danach nicht, als ob sie ihm recht geben würde. Pferde wieherten, jemand rannte durch trockenes Laub.
Nikola schaute an sich hinunter, knibbelte einen Pickel oberhalb ihrer linken Brust auf, bis Blut kam, überlegte, ob die Falten, die ihr Bauch in dieser Haltung warf, normal waren oder schon Fett, streckte den Rücken durch, spannte die Muskeln an. Sie fand sich nicht schön, hatte aber auch nichts an sich auszusetzen. Ihre Oberschenkel zeigten keine Cellulite, was nicht selbstverständlich war.
Sie griff nach dem kleineren Handtuch, das einen Schwall Wasser abbekommen hatte, trocknete ihre Haare, so gut es ging, schlug sich einen Turban um den Kopf, nahm das große Laken mit dem aufgestickten Yves-Saint-Laurent-Logo und wickelte sich darin ein.
Draußen schien die Sonne. Einen Moment hatte sie Lust, Onishi zurück ins Bett zu ziehen, gleichzeitig knurrte ihr der Magen vor Hunger, vor allem wollte sie raus aus dieser Wohnung, bevor der nächste Regen kam.
Sie nahm einen Lappen aus dem Regalfach unter dem Waschbecken und beseitigte die Überschwemmung, trat in die Wohnküche, öffnete noch einmal das Handtuch, stand einen Moment nackt da, damit Onishi sie sah, doch er hielt seinen Blick auf den Bildschirm gerichtet, wo heftig gekämpft wurde.
Also ging sie allein ins Schlafzimmer, um sich anzuziehen.
Das blaue Manga-Männchen mit den rosafarbenen Ohrmuscheln, das an einen bösartigen Teletubby erinnerte, starrte zu ihr herüber. Sie spürte Wut – am liebsten hätte sie das Kissen vom Balkon geworfen – und ging zurück in die Wohnküche.
»Können wir etwas essen? Ich meine draußen?«
»Schlecht.«
»Weil du das gucken willst oder warum?«
»Die Gegend ist ungünstig.«
»Dann lass uns woanders hinfahren.«
»Ich muss überlegen.«
»Von mir aus einfach Nudelsuppe oder Sushi. Irgendetwas wird es hier doch wohl geben. Als wir neulich abends gekommen sind, habe ich alle möglichen Läden gesehen.«
Noch immer tönte Schlachtenlärm aus dem Fernseher, berstendes Holz, Geschrei, unterlegt mit dramatischer Musik: Shamisen über großem Orchester.
Nikola zog den zweiten Stuhl an Onishis Seite, setzte sich, legte ihre Beine quer über seine Oberschenkel.
»Worum geht’s da?«
»Japanische Geschichte. Hōjō Tokimune, der Japan gegen die Mongolen verteidigt.«
»Haben die Mongolen Japan erobert?«
»Sie haben es versucht, aber wir konnten sie mit Hilfe des Himmels zurückschlagen.«
»Wir?«
»Wer sonst?«
»Klar.«
Die Kamera schwenkte vom Meer, wo einzelne Schiffe Richtung Horizont trieben, zurück auf den Strand. Tote und Verwundete lagen verkrümmt in Wasserlachen, zuckten oder stöhnten. Kurze Trommelwirbel, eine klagende Bambusflöte. Möwen kreisten über dem Schlachtfeld, von der Landseite her näherte sich ein Krähenschwarm. Einige ließen sich auf den Leichen nieder, begannen, ihnen die Augen auszuhacken.
Nikola nahm ihre Beine von Onishi: »Bisschen hart ohne Frühstück.«
Ein Mann in lederner Rüstung, dem rasierten Schädel nach ein Samurai, richtete sich auf, fiel dann mit dem Gesicht in den blutdurchtränkten Sand. Aus seinem Rücken ragte eine abgebrochene Lanze.
»Normal.«
»Lass uns rausgehen.«
Sie griff nach der Fernbedienung, drückte auf »POWER«. Der Bildschirm wurde schwarz.
Onishi zog seine Zigaretten aus der Brusttasche, stieß sich die Packung auf den Handrücken und hielt sie ihr hin.
»Ich muss erst was essen.«
Er zuckte mit den Schultern, zündete sich dann selber eine Zigarette an.
»Wieso ist das so schwierig? Du hast mir erzählt, hier ist ein ruhiges Viertel, und dass du es genau deshalb ausgesucht hast.«
Er nickte, blies Rauch auf die Tischplatte, der sich über das braune Holz bewegte wie eine auslaufende Welle über den Strand.
»Das stimmt auch.«
»Aber?«
»Du bist eine deutsche Frau.«
»Das weißt du schon länger.«
»Es sind kaum Leute aus dem Westen auf der Straße, und selbst wenn du das Gefühl hast, alle schauen an dir vorbei, sieht dich doch jeder.«
»Ja und?«
»Dann erzählt vielleicht jemand einem anderen, dass er in Itabashi einen großen Japaner mit einer Blondine …«
»Ich bin keine Blondine!«
»Du hast blonde Haare, also bist du eine Blondine.«
Er lachte.
Sie wollte ihm mit der Faust auf den Oberschenkel schlagen, doch seine Hand war schneller und fing ihre ab, ehe sie ihn auch nur berührte.
»Dann lass uns rausfahren aus der Stadt, ans Meer, was weiß ich, es wird ja wohl einen Ort geben, wo sich niemand für dich interessiert.«
Onishi schüttelte den Kopf.
»Wir können erst einmal Tee trinken.«
»Von mir aus auch in ein Teehaus – dann esse ich halt was Süßes.«
»Hier.«
»Von Tee auf leeren Magen wird mir schlecht.«
»Ich habe dich nach Japan gebracht, also ist es meine Verpflichtung, dich zu schützen.«
Sie verdrehte die Augen: »Pass auf: Ich bin achtundzwanzig. Ich habe allein entschieden, dass ich mit dir mitkomme, und ich wusste, als ich das entschieden habe, welche Art Leben du führst. Zumindest ungefähr. Dass es gefährlich werden kann. Wenn ich darauf keine Lust mehr habe, setze ich mich ins nächste Flugzeug und fliege zurück nach Hause.«
»Sie werden dich ins Gefängnis stecken.«
»Yuki hat niemanden umgebracht, und mit dir hat mich niemand gesehen.«
»Als wir in dem Supermarkt bei dir um die Ecke waren.«
»Und?«
»Dort sind kurze Zeit später ein paar Leute gestorben.«
»Du warst ein Bekannter meines ermordeten Freundes und hast so getan, als wolltest du mir helfen. Woher hätte ich wissen sollen, dass du ein Massaker planst. Wusste ich ja auch nicht.«
»Ich diskutiere nicht mit dir, was getan wird.«
»Dann gehe ich eben allein raus.«
Sie stand auf, trat ans Fenster, schob die Gardine zur Seite, um ihrer Drohung Nachdruck zu verleihen, ließ den Blick über die Dächer schweifen, war Zuschauerin ihrer eigenen Inszenierung, wunderte sich einmal mehr, wie improvisiert und billig die Stadt von oben wirkte. Wellblech und Kabel. Futons hingen zum Auslüften über Brüstungen und Balkongittern. In der Ferne ragten ältere Baukräne in den Himmel, von denen sich lediglich einer bewegte, darüber staffelten sich Wolkenbänder. Immerhin sah es so aus, als würde der nächste Regen auf sich warten lassen.
Onishi zeigte keine Reaktion.
Nikola lächelte. Sie war ihm gegenüber im Vorteil, weil sie ähnliche Situationen bereits mit Yuki erlebt hatte, wohingegen Onishi nie näher mit einer deutschen Frau zu tun gehabt hatte. Andererseits wusste sie nicht, was in Yukis Verhaltensmustern dessen persönliche Eigenart und was typisch für japanische Männer im Allgemeinen oder speziell für Yakuza gewesen war.
Welche Möglichkeiten blieben ihr, wenn Onishi sie jetzt festhielt, schlug, das ganze Zuhälterprogramm abrief: Erst hatte er Sex mit ihr gehabt, als wären sie ein frisch verliebtes Paar, dann begannen die Demütigungen, am Ende fände sie sich in einem der als Stripclubs getarnten Bordelle der Nekodoshi-gumi wieder und müsste die kindischen Fantasien in ihrer sexuellen Entwicklung zurückgebliebener Angestellter befriedigen.
So oder so hatte sie, wenn sie noch länger zögerte, den richtigen Zeitpunkt für eine entschlossene Handlung verpasst. In ihrer Brust dehnte sich Schrecken aus. Sie sah ein Bild von Yukis toten Augen, das Loch in seinem Kopf, spürte wieder den Kloß im Hals, riss sich zusammen, drehte sich um und ging Richtung Tür: »Ich schaue mal, was ich finde. McDonald’s gibt es hier bestimmt auch, und ich kann ja auf die Sachen zeigen, dann wissen sie schon, was ich will.«
Onishi schüttelte den Kopf, drückte die halb gerauchte Zigarette in den Aschenbecher. Sie sah, dass er sie nicht mit Gewalt daran hindern würde, die Wohnung zu verlassen, gab ihrem Gesicht trotzdem einen zornigen Ausdruck, fuhr sich mit beiden Daumen durch die Augenwinkel, als wollte sie Reste von Schlaf herausreiben.
»Es ist wahrscheinlich ein Fehler, dass ich deinem Willen nachgebe«, sagte er.
Draußen schlug ihnen feuchtwarme Luft entgegen. Die Gebäude erinnerten im Stil an deutsche Nachkriegsstädte, der Hauptunterschied waren die japanischen Schriftzeichen und unzählige kleine Strommasten, wie es sie selbst in Boppard schon lange nicht mehr gab. Alles wurde von einem Kabelnetz überzogen. Direkt hinter dem Haus, in dem sich die Wohnung befand, führte die Hochtrasse einer Schnellstraße vorbei, die für Nikola vom Balkon aus nicht zu sehen gewesen war. Als Onishi sie in die Wohnung gebracht hatte, war es dunkel gewesen, alles hatte fremd und aufregend gewirkt. Jetzt war sie zum ersten Mal bei Tag hier unten und erkannte die Gegend kaum wieder, auch wenn ihr bereits von oben alles wahnsinnig provinziell und spießig erschienen war.
Eine niedrige Hecke trennte den Gehweg von der Fahrbahn, zwei Fahrräder, die an Hollandmodelle erinnerten, und ein grauer Roller standen vor dem Eingang eines Büros.
»Rechts«, sagte Onishi, und dann »Spazieren« mit einem betont langen »a« und einem noch längeren »i«.
»Was essen!«
Sie gingen an einem Laden namens Century 21 vorbei, dessen Fassade im gleichen Gelb-Schwarz leuchtete wie die Filialen der Deutschen Post – offenbar ein Maklerbüro: In den Fenstern hingen DIN-A4-Blätter mit Fotos von Häusern und Apartments. Drei Frauen hinter weißem Mundschutz kamen ihnen entgegen. Auch wenn Nikola wusste, dass es in Japan üblich war, beim geringsten Gefühl des Unwohlseins diese Masken anzulegen, fühlte sie sich einen Moment bedroht.
»Es ist nichts im Umlauf zur Zeit, SARS, Schweinegrippe oder so was?«, fragte sie.
»Ich habe dir gesagt, dass wir am besten in der Wohnung bleiben.«
»Sehr witzig.«
»Sollen wir umdrehen, bevor es zu spät ist?«
»Jetzt sag ernsthaft.«
Onishi zog sie zur Seite: »Du solltest nicht auf der Fahrradspur gehen, auch wenn dir bestimmt alle ausweichen. Das Wichtigste ist es, den reibungslosen Ablauf nicht zu stören und kein Aufsehen zu erregen. Soweit das in deinem Fall möglich ist.«
Neben dem Maklerbüro befand sich ein Restaurant, wo es, den Bildern im Schaufenster zufolge, Suppen oder Eintöpfe gab. Über dem nächsten Geschäft stand in lateinischen Buchstaben Weiß auf Blau Suntory Coffee Boss, dazu das stilisierte Gesicht eines Mannes mit Pfeife im Mund, der an Tommy Lee Jones erinnerte. Auch wenn sie feststellte, dass es sich nicht um einen amerikanischen Coffeeshop, sondern um einen winzigen Laden handelte, in dem aromatisierte Koffeinmixturen in Dosen verkauft wurden, beruhigte es sie, einen Schriftzug lesen zu können.
»So etwas zum Sitzen und mit heißem Kaffee aus Tassen oder Bechern würde mir völlig reichen. Von mir aus Starbucks, wenn es nichts Japanisches in der Art gibt.«
Onishi nickte.
Nikola kannte diese Art Nervosität, die sich eher in Überkontrolliertheit als in Hektik zeigte, von Yuki und fragte sich, ob Onishis Unruhe ausschließlich mit ihr zu tun hatte oder ob er ihr Dinge verschwieg, damit sie sich keine Sorgen machte.
»Wollten deine deutsch-japanischen Freunde mich eigentlich nicht kennenlernen beziehungsweise nicht wissen, was es mit mir auf sich hat?«
»Nein.«
»Aber dieser Friedemann ahnt doch sicher, dass du zur Yakuza gehörst.«
Onishi zuckte mit den Schultern und steckte sich die nächste Zigarette an.