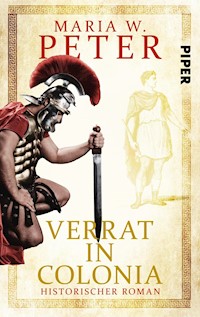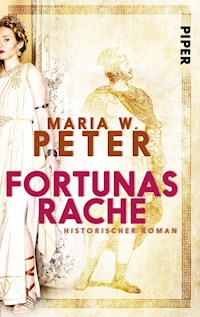6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei grausame Morde, der Fluch des Goldes und der verschollene Tempelschatz von Jerusalem - der dritte Teil der Krimireihe rund um die römische Sklavin Invita 260 n. Chr.: Von düsteren Erinnerungen geplagt, kehrt die Sklavin Invita in ihre Heimatstadt, Divodurum an der Mosel, zurück. Als dort kurz nacheinander zwei junge Frauen ermordet aufgefunden werden, deuten alle Anzeichen auf schwarze Magie hin. Ausgerechnet der jüdische Schmuckhändler Salomo, Invitas Vertrauter aus Kindertagen, wird verdächtigt die grausamen Verbrechen begangen zu haben. Bei dem Versuch, die Unschuld ihres Freundes zu beweisen, stößt sie auf dunkle Machenschaften, einen uralten Fluch und einen verloren geglaubten Tempelschatz, dessen Spuren von Jerusalem bis hierher in die Stadt zu führen scheinen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de/ebook-gewinnspiel
Weitere Informationen zu den Romanen, Hintergründen und Schauplätzen finden Sie auch auf meinen Autorenseiten im Internet: www.mariawpeter.de bzw. www.facebook.com/mariawpeter.
Für Fragen, Anregungen und Feedback stehe ich auch gerne unter [email protected] zur Verfügung. Ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören.
ISBN 978-3-492-98357-0
Die »Invita«-Reihe ist ursprünglich bei Bastei Lübbe erschienen.
© der Originalausgabe: Bastei Lübbe AG, Köln 2008
© dieser Ausgabe: Piper Fahrenheit, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2017
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Kartenzeichnung von Helmut W. Pesch
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: lynea,Nik Merkulov,Innochka/shutterstock.com und Soare Cecilia Corina_shutterstock
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Cover & Impressum
WIDMUNG
KARTE DIVODORUM
GRABSTELE DER IUNIA CURMILLA
ZITAT
KAPITEL I
KAPITEL II
KAPITEL III
KAPITEL IV
KAPITEL V
KAPITEL VI
KAPITEL VII
KAPITEL VIII
KAPITEL IX
KAPITEL X
KAPITEL XI
KAPITEL XII
KAPITEL XIII
KAPITEL XIV
KAPITEL XV
KAPITEL XVI
KAPITEL XVII
KAPITEL XVIII
KAPITEL XIX
KAPITEL XX
KAPITEL XXI
KAPITEL XXII
KAPITEL XXIII
KAPITEL XXIV
KAPITEL XXV
KAPITEL XXVI
KAPITEL XXVII
KAPITEL XXVIII
KAPITEL XXIX
KAPITEL XXX
NACHWORT
GLOSSAR
DANKSAGUNG
ANMERKUNG
Für Caterina Iacono-Ziebert zur Erinnerung an die gemeinsame Studienzeit in Metz,
für meine Cousine Christine Demange und die langen französischen Sommer unserer Kindheit
und für meine Großmutter, die mir die alten Geschichten erzählt hat.
Wozu nicht treibst du der Sterblichen Herzen, verfluchte Gier nach Gold!
Vergil, Aeneis
KAPITEL I
Kann man so etwas je vergessen?
Vergessen, wie es sich anfühlt, von groben Händen gepackt, mit rauen Stricken gebunden und vor den Herrn geschleppt zu werden? Starr vor Angst, welche Strafe diesmal zu erwarten ist.
Den Schmerz, wenn dein Arm auf den Rücken gedreht wird und sich fleischige Finger auf deinen Mund pressen, um zu verhindern, dass du schreist, während sie dich die Treppe hinabstoßen und in einen dunklen, stinkenden Verschlag werfen, wo die Ratten auf dich warten?
Vielleicht. Irgendwann.
Doch niemals werde ich den Tag vergessen, als ich, noch vor dem Morgengrauen aus dem Schlaf gerissen, an Händen und Füßen angekettet, mit der Peitsche hinaus auf den Hof getrieben und in einen Wagen gestoßen wurde, der mich fortschaffen sollte. Fort von allem, was ich kannte und mir vertraut war. Ohne zu wissen, wie mir geschah.
Weggerissen und verkauft. Den Fluss hinab. Ins Ungewisse.
»Ist alles in Ordnung mit dir?« Eine leise Stimme riss mich ins Hier und Jetzt zurück. Besorgt blickten mich ein Paar heller Augen an. »Du bist seit einer Weile so still.«
Meine Erinnerungen verdrängend, zwang ich mich zu einem Lächeln. »Es ist nichts, Herrin. Wahrscheinlich nur die Hitze … Doch kann es jetzt nicht mehr lange dauern, bis wir da sind.«
Seit einigen Tagen befand ich mich mit dem Zug des römischen Statthalters – des Legatus Augusti pro Praetore – auf dem Weg von Treveris nach Divodurum, wo dieser Gericht zu halten gedachte, um dessen Tochter Marcella als persönliche Zofe und Schreiberin zur Hand zu gehen.
Fast ohne Unterbrechung waren wir auf den staubbedeckten, in der Sonnenglut flimmernden Straßen unterwegs. Dabei waren wir immer wieder auf Gruppen von Flüchtlingen getroffen, die, ein paar Habseligkeiten mit sich schleppend, ihre Landgüter und abgelegenen Gehöfte vor dem Ansturm germanischer Barbaren verlassen hatten und nun Schutz in den umliegenden Städten und befestigten Siedlungen suchten. Mit hoffnungsvollen Augen hatten sie dem Tross des Statthalters hinterhergeblickt, als hegten sie die Erwartung, der mächtigste Mann der Provinz könne sie vor einem schrecklichen Schicksal bewahren.
Von den Hängen des Schiefergebirges um Treveris waren wir weiter flussaufwärts gezogen, wo das Land flacher, die Ebenen breiter wurden. Zwischen den Auen und Wäldern erblickten wir gelegentlich verbrannte Gehöfte und verlassene Häuser, wie eine stumme Warnung, nicht so töricht zu sein, die Gefahr von jenseits des Rheines und Limes zu unterschätzen.
Endlich waren die Dächer von Divodurum vor uns aufgetaucht. Die Erleichterung war bei dem gesamten Tross, der den Statthalter auf seinem Weg begleitete, zu spüren gewesen.
In mir jedoch erweckte der Anblick bedrückende Empfindungen, als würden die mir so vertrauten Gebäude den Schmerz der Vergangenheit wiederaufleben lassen. Denn dies war die Stadt, aus der ich vor einigen Monaten gefesselt hinausgeschleift worden war. Und nun kehrte ich wieder dorthin zurück, offiziell, um die Tochter des Statthalters zu begleiten, in Wahrheit jedoch, um nach Spuren meiner Herkunft zu forschen.
Das ungute Gefühl steigerte sich zur Angst, als der Wagen rumpelnd über eine Brücke fuhr.
Wäre es nicht besser, die Vergangenheit ruhen zu lassen? Irgendetwas sagte mir, dass ich in dieser Stadt so manches erfahren könnte, was mir nicht gefallen würde. Oder waren es nur die quälenden Erinnerungen, die dieses seltsame Ziehen hinter meinen Schläfen verursachten?
Ein Schatten fiel auf mein Gesicht, als der Wagen durch das Stadttor rollte.
Bekannte Gerüche schlugen mir entgegen – Gerüche meiner Kindheit! Gemächlich folgten wir der breiten Hauptstraße, bis wir auf dem Forum angekommen waren, wo sonst keine Wagen passieren durften. Angeregt ließ ich meinen Blick umherschweifen, wo sich um diese Tageszeit Hunderte von Menschen drängten, gafften, lamentierten oder ihren Geschäften nachgingen.
Wie bekannt mir das alles noch war!
In den neun Monaten meiner Abwesenheit schien sich die Stadt kaum verändert zu haben.
Neun Monate, in denen ich mich anfangs mehr schlecht als recht im Statthalterpalast zu Treveris eingelebt hatte. Eine ereignisreiche Zeit, die mich beinahe das Leben gekostet hätte, in der es mir jedoch gelungen war, von einer Latrinenreinigerin zur Vertrauten Marcellas, der Tochter des Statthalters, aufzusteigen. Daher saß ich nun als deren Begleiterin in dem vornehmen Reisewagen, konnte mir den Schmutz der Straßen vom Leib halten und durch das große Fenster den Menschenauflauf betrachten, der sich bei der Ankunft des obersten Herrn der Provinz auf den Straßen und Plätzen gebildet hatte. Nur mühsam und mit Hilfe der mit Rutenbündel bewaffneten Liktoren war überhaupt ein Durchkommen möglich.
Von draußen drangen die vertrauten Worte des mediomatrischen Keltisch an meine Ohren. Sie klangen weich und ein wenig schleppend im Vergleich zu dem viel härter gesprochenen Treverisch, das ich in den letzten Monaten neben dem allgegenwärtigen Latein oder Griechisch der Reichen und Gebildeten zu hören bekommen hatte.
Ungewollt stiegen heimatliche Gefühle in mir auf. Hier war ich aufgewachsen, inmitten dieser Mauern hatte ich die wohl ersten siebzehn Jahre meines Lebens verbracht, seit mich ein geschäftstüchtiger Sklavenhändler als Säugling an einen vornehmen mediomatrischen Beamten verkauft hatte. Zuvor soll mich irgendeine gute Seele oder ein gerissener Pfennigfuchser, der ein lukratives Geschäft erkannte, wenn er es sah, irgendwo bei Treveris aus dem Straßengraben gezogen haben, in den mich meine Mutter, wer immer sie auch sein mochte, zum Sterben ausgesetzt hatte.
Der Lärm der Menschenmenge draußen schwoll zu einem Dröhnen an. Unter vereinzelte Jubelrufe mischte sich ein anderer, hässlicherer Ton. Irritiert lehnte ich mich aus dem Fenster und blickte nach vorne, an die Spitze des Zuges. Unmittelbar hinter den voranschreitenden Liktoren ritt der Statthalter auf einem prächtigen Schimmel, und das erhabene Purpur seines Umhangs leuchtete im hellen Licht des Junimorgens.
Doch die Menschen ringsum waren alles andere als festlich gestimmt. Vereinzelt hob jemand die Hand, um zu winken, doch waren es meist Kinder und Halbwüchsige am Straßenrand.
Die Erwachsenen schien das ganze Treiben eher zu beunruhigen. Hier und da sah ich in apathische, sogar feindselige Gesichter. Die Menschen waren nicht zusammengekommen, um die Ankunft des Statthalters zu feiern; sie waren einfach da, und es waren viel zu viele. Über dem ganzen Forum lag eine Stimmung, die jeden Augenblick in Aufruhr Umschlägen konnte.
Ruckartig hielt der Reisewagen an und ließ mich nach vorne kippen. Noch bevor ich mich wieder aufrappeln und vergewissern konnte, dass der Herrin Marcella nichts geschehen war, drangen aufgeregte Schreie an mein Ohr.
Alarmiert sprang ich auf und beugte mich erneut aus dem Fenster, konnte wegen des Menschenauflaufs aber nichts erkennen. Als es nach längerer Zeit noch immer nicht weiterging, wandte ich mich an Marcella.
»Soll ich nachsehen, was da los ist, Herrin?« Die Ungeduld, endlich die Stadt zu betreten, in der ich aufgewachsen war, ließ mein Herz schneller schlagen.
»Ich bitte dich darum!«, erwiderte sie mit einem wissenden Lächeln. Sie kannte meine Neugierde.
Im nächsten Augenblick hatte ich auch schon die Tür des Wagens aufgestoßen und stand draußen im Gewühl.
Der Junitag war schwülwarm, und es war abzusehen, dass es mit steigender Sonne noch heißer werden würde.
»Halt! Bleib stehen!« Eine empörte Stimme drang an mein Ohr. »Haltet sie auf! Fangt die Diebin!«
Sofort spannten sich meine Muskeln fluchtbereit, mein Pulsschlag verstärkte sich – bis mir schließlich bewusst wurde, dass nicht ich gemeint sein konnte.
Mein Blick ging in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war, und ich sah eine Halbwüchsige, die wieselflink über den Marktplatz huschte und jede sich bietende Lücke ausnutzte, um einem fülligen, kurzatmig keuchenden Kerl, der ihr aus Leibeskräften hinterherschrie, zu entkommen. Sie hielt etwas unter den Arm geklemmt, das auf die Entfernung nicht richtig zu erkennen war.
Schnell schlug sie zwei weitere Haken, dann war sie in der Menge verschwunden.
Schnaufend blieb der Händler stehen. Sein feistes Gesicht hatte mittlerweile eine dunkelrote Farbe angenommen, seine Brust hob sich mit ungesunden Pfeiftönen auf und ab. »Du dreckiges Ding! Eines Tages krieg ich dich, und dann kannst du …«
Erst jetzt schien er zu bemerken, dass er mit seiner Verfolgungsjagd den gesamten Zug des Statthalters aufgehalten hatte und die Liktoren nicht die Diebin, sondern ihn mit unwirschem Gesicht betrachteten.
Hastig wischte er sich den Schweiß aus seinem granatapfelroten Gesicht, verneigte sich ungelenk, behindert durch seine Leibesfülle, und bemühte sich, den peinlichen Vorfall zu überspielen. Aufgeregt fuchtelte er mit den Armen in der Luft, während er den Liktoren einen Wortschwall entgegenstieß. Von meiner Position auf der anderen Seite der Straße aus verstand ich nicht viel, doch etwas wie »Lumpengesindel«, »Überfall« und »zur Rechenschaft ziehen« konnte ich beinahe von seinem Lippen ablesen. Wollte er etwa die Männer des Statthalters davon überzeugen, ausgerechnet der oberste Herr der Provinz müsse in der Stadt für Ordnung sorgen? Als würde sich der Legatus mit kleinen Diebereien abgeben. Dafür gab es schließlich die städtischen Beamten.
»Ich glaube nicht, was ich hier sehe!«
Eine melodische Stimme riss mich aus meiner Betrachtung. Unter dem vagen Eindruck, diese zu kennen, wandte ich mich um. Unwillkürlich machte ich einen halben Schritt zurück, als ich in das fein geschnittene Gesicht eines jungen Mannes von etwa Mitte zwanzig blickte. Glänzendes schwarzes Haar. Gerade kurz genug geschnitten, um dem römischen Gefühl für Anstand und Schicklichkeit zu entsprechen, fiel es in Wellen um das bronzefarbene Gesicht. Ein Paar Augen, so dunkel, dass sie mich an die Farbe von gerösteten Kastanien erinnerten, sahen mich belustigt an. Doch es war der kurze, gepflegte Bart, der mich dazu zwang, zweimal hinzuschauen, um zu erkennen, wer vor mir stand.
»Salomo!« Einem Reflex folgend strich ich mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht und zupfte meine Tunika glatt, die von der langen Reise in dem heißen Wagen sicherlich längst zerknittert war. Erst jetzt besann ich mich wieder meiner Position und fügte hinzu: »Herr.«
»Dann habe ich mich also nicht getäuscht.« In den dunklen Augen leuchtete etwas wie wohlwollender Spott auf. »Warst du, als wir uns das letzte Mal begegnet sind, nicht ungefähr so hoch?« Er bückte sich und maß mit der Handfläche einige Handbreit vom Boden ab. »Und hast ein Riesengezeter veranstaltet, weil eure Köchin dich gerade dabei erwischt hatte, wie du ein Stück Kuchen aus der Küche gestohlen hast?«
»Es war kein Kuchen, Herr!« Ohne es verhindern zu können, stieg mir bei der Erinnerung daran flammende Hitze ins Gesicht. »Und das war auch nicht das letzte Mal, dass ich dich gesehen habe …«
Dann unterbrach ich mich und versuchte, meine Gedanken zu ordnen, damit ich nicht noch mehr sinnloses Zeug von mir gab.
»Ach nein? Dann vielleicht ein Honigplätzchen oder einen Haferkeks?«
Es war eine Komödie von Plautus gewesen, die ich mir heimlich aus der Bibliothek meines damaligen Herrn ausgeborgt hatte. Doch das sagte ich nicht, obgleich mir das Kribbeln in meinem Gesicht deutlich machte, dass ich bis zu den Haarwurzeln errötet war.
Die Welt rings um uns schien zum Stillstand gekommen zu sein. Selbst das allgegenwärtige Murren der Menge war in den Hintergrund getreten. »Du bist wieder in der Stadt, Herr?«, sagte ich schließlich, weil mir nichts Besseres einfiel.
»Ja.« Ein warmes Lächeln glitt über seine Züge. »Seit Ende November. In den letzten Jahren bin ich viel gereist. Nun habe ich hier in Divodurum einen Laden eröffnet, um Juwelen und Schmuck zu verkaufen.«
Unwillkürlich tastete meine Hand nach dem silbernen Amulett in Form einer Mondsichel, das ich unter dem Stoff des Gewandes verborgen auf meiner Haut trug. Es war der einzige Schmuck den ich je besessen hatte, das Einzige auf der Welt, das mir gehörte – und sogar das war, streng genommen, Eigentum meines Herrn, so wie ich selbst und alles, was ich auf dem Leib trug.
»Es scheint dir gut zu gehen«, meinte ich und ließ meinen Blick über das sorgfältig geschnittene Gewand aus teurem dunkelblauem Stoff schweifen.
Ich kannte Salomo seit meiner Kindheit. Er war nur wenige Jahre älter als ich und der Sohn des jüdischen Arztes Isaac, der die Familie meines früheren Herrn behandelte. Häufig hatte er seinen Vater bei den Krankenbesuchen begleitet. Zumindest bis es an der Zeit für ihn war, sich seine eigene Existenz aufzubauen. Seither hatte ich ihn einige Jahre nicht mehr gesehen, doch offensichtlich war er nicht in die Fußstapfen seines Vaters getreten.
Ein Schmuckhändler.
In diesem Augenblick brach hinter mir lautes Geschrei los, und ich sah, dass die Liktoren wohl ihre Geduld mit dem geschwätzigen Dicken verloren hatten und ihn mit Schlägen ihrer Rutenbündel von der Straße trieben. Als ich mich wieder Salomo zuwandte, musterte dieser mich forschend. »Du scheinst es auch zu etwas gebracht zu haben.« Überrascht kniff er die Augen zusammen. »Seit wann gehörst du dem Statthalter?«
Noch immer hatte ich mich nicht daran gewöhnt, aufgrund meiner taubenblauen Tunika schon von Weitem als dem Hause des mächtigsten Mannes der Provinz zugehörig erkannt zu werden – offenbar selbst in Divodurum. »Das ist eine lange Geschichte. Ich …«
Aus den Augenwinkeln heraus bemerkte ich, dass sich der Zug wieder in Bewegung gesetzt hatte und ich mich beeilen sollte, um zurück in Marcellas Wagen zu gelangen und nicht im Gewühl der Stadt verloren zu gehen.
»Bitte verzeih, Herr, ich muss weiter. Wahrscheinlich vermisst mich die Herrin schon.«
Ohne Salomo die Gelegenheit zu geben, etwas zu erwidern, wandte ich mich um und eilte zurück zum Tross, der sich glücklicherweise noch immer in gemächlichem Schritttempo durch die überfüllten Straßen schob.
Mit einer gemurmelten Entschuldigung gegenüber den Wachleuten öffnete ich die Tür und kletterte ins Innere. Als ich noch einmal aus dem Fenster zurückblickte, um nach Salomo Ausschau zu halten, war er irgendwo in der Menschenmenge verschwunden.
»Nun, was gab es?«
Einen Moment lang blickte ich Marcella verständnislos an. War mir meine Verwirrung über das Wiedersehen mit einem alten Bekannten so deutlich anzusehen? Dann erinnerte ich mich, dass ich die Ursache des Lärms hatte in Erfahrung bringen sollen, und beeilte mich, ihr von dem aufgebrachten Mann und der Diebin zu berichten.
»Und wie hat die Wache meines Vaters auf die Störung reagiert?«
Entschlossen schob ich alle persönlichen Gedanken beiseite und besann mich auf meine Pflicht. »Sie haben sich zurückgehalten, Herrin. Die Stimmung hier in der Stadt ist … nicht gut«, endete ich lahm.
»Das habe ich auch schon bemerkt«, sagte Marcella nachdenklich.
Während der Wagen langsam seinen Weg fortsetzte, fragte ich mich ein weiteres Mal, was mich an diesem Ort noch alles erwarten würde.
Der Empfang vor dem Amtssitz des Statthalters gestaltete sich wesentlich respektvoller als der in der Stadt. Am Hauptportal standen alle Hausdiener bereit, dazu einige persönliche Wachleute und Benefiziarier, zum Dienst in der Stadt abkommandierte Legionäre, von denen ich nicht sagen konnte, ob sie unserem Reisezug vorausgeschickt worden waren oder einen dauerhaften Posten in Divodurum innehatten.
Ein angespanntes Raunen war zu vernehmen, als sich der Tross näherte. Mit einer schwungvollen Bewegung glitt der Statthalter vom Pferd. Sein purpurner Umhang blitzte in der Morgensonne auf.
Die Schritte seiner weichen Stiefel waren auf dem gepflasterten Steinboden kaum vernehmbar. Aufrecht und gerade blieb er einen Augenblick stehen, um seine Untergebenen zu inspizieren oder um diesen Gelegenheit zu geben, ihn, den Herrn über Leben und Tod in der Provinz, in Augenschein zu nehmen.
Wie auf ein Zeichen hin kamen die Liktoren herbei und umgaben ihn spalierartig. Schließlich trat der Vilicus des Hauses vor und verneigte sich ehrerbietig, um seinen Herrn willkommen zu heißen. Doch aufgrund der allgegenwärtigen Unruhe war ich nicht in der Lage, auch nur ein einziges seiner Worte zu verstehen.
Der Statthalter lächelte, ergriff den Arm seines Verwalters mit beiden Händen und schritt dann auf das Hauptportal der Residenz zu.
Ein lauter Schrei zerriss das angespannte Gemurmel. Ein Körper drängte sich durch die Menschenmenge, stieß einen der vollkommen überraschten Liktoren beiseite und warf sich dem Legatus zu Füßen.
»Ich bitte dich um Gnade, Herr!« Es klang wie ein Aufschrei, verzweifelt, gepresst, kaum verständlich.
Erst jetzt sah ich, dass es sich bei der auf der Erde zusammengekauerten Person um eine Frau handelte, deren leicht ergrautes offenes Haar ihren Kopf und den fast bis zur Erde geneigten Oberkörper wie ein Schleier bedeckte. Sie war barfuß, ihr schäbiges Gewand war an mehreren Stellen notdürftig geflickt. Am ganzen Körper zitternd, streckte sie in der Geste des Bittstellers ihre Hände aus, um den Fuß des Statthalters zu umklammern.
Dieser schien noch immer zu überrascht zu sein, um angemessen zu reagieren. Doch jetzt kam endlich Leben in einen der Liktoren. Er bückte sich und riss die flehende Frau mit einem groben Ruck vom Statthalter weg auf die Füße.
»Du musst mich anhören, Herr!« Die Stimme überschlug sich. »Hab Erbarmen mit meinem Mann! Er ist unschuldig! Er hat nie etwas Böses getan!«
Nun schienen sich auch die anderen Liktoren ihrer Pflicht zu entsinnen. Ein weiterer kam hinzu und packte die Frau, die sich verzweifelt wand und sich dem Legatus erneut vor die Füße zu werfen versuchte. »Gnade, Herr … Ich bitte dich. Gnade …«
Ihre Stimme war nur noch ein Flüstern, Tränen liefen über ihr schmutziges Gesicht. Wie eine leblose Puppe hing sie in den Armen der Wächter, als der Statthalter mit zusammengekniffenen Augen auf sie zutrat.
»Wer ist diese Frau?«, fragte er schließlich mit befehlsgewohnter Stimme, der nicht anzuhören war, ob er über die ungebührliche Unterbrechung seines Empfangs verärgert war.
Hastig trat einer seiner Männer vor. »Verzeih, Herr, diese Frau … wir wussten nicht, was sie vorhatte. Wir glaubten, sie gehöre zu denen, die gekommen sind, dich zu begrüßen. Wir hätten nicht gedacht …« Er unterbrach sich und schien sich wieder an die eigentliche Frage zu erinnern, die ihm gestellt worden war, trat vor und hob das Gesicht der Frau an, die, noch immer im Griff der beiden Wachen, aussah, als würde sie sofort zu Boden sinken, wenn einer von ihnen sie losließe. »Keine Ahnung, wer das ist.« Fragend blickte er zum Statthalter auf. »Sollen wir sie festnehmen und verhören lassen?«
Der Legatus schüttelte den Kopf. »Schafft sie fort!«
Dann sah ich nur noch, wie die Wachleute die verzweifelte Frau wegzerrten.
»Du wirst es bereuen …«, hörte ich eine kehlige Stimme und vermutete, dass sie aus dem Munde der Frau kam. »Ein Fluch liegt über dir und deinem Haus! In dieser Stadt bist du in Gefahr, auch wenn du es nicht wahrhaben willst …«
Die Worte verklangen, als die Wächter mit der Fremden in der Menge verschwanden, und eine betretene Stille blieb zurück.
Unbeeindruckt blickte der Statthalter wieder auf und setzte seinen Weg ins Haus fort, als wäre nichts geschehen.
Langsam, wenn auch ein wenig verhaltener als zuvor, setzten wieder vereinzelte Jubelrufe ein, während ich aus dem Wagen kletterte, um Marcella hinauszuhelfen.
Das war also meine Rückkehr nach Divodurum, in meine alte Heimat, falls man es so bezeichnen konnte. Das beklemmende Gefühl der Vorahnung wurde stärker und legte sich wie ein schweres Gewicht auf meine Brust, als ich der Herrin die Stufen zum Eingangsportal hinauf folgte.
Die feierliche Stimmung war zerplatzt wie ein Holzscheit im Feuer, obgleich das gesamte Zeremoniell der Begrüßung in strenger Würde durchgeführt wurde.
Ich konnte nicht sagen, ob sich der Statthalter von einem Zwischenfall wie diesem in irgendeiner Weise beeinträchtigen ließ oder ob er das Gerede von Flüchen lediglich für den Versuch einer verzweifelten Frau hielt, ihren Mann zu retten. Weder seiner Haltung noch seiner Miene war auch nur das Geringste anzumerken, als er im Haus Mantel und Paraderüstung ablegte, sich Gesicht und Hände über einer Bronzeschale wusch, die ihm ein Sklave hinhielt, und dann mit ruhiger Stimme dem Hausverwalter Anweisungen für die kommenden Tage gab.
Stumm stand ich in der Ecke, das Bündel mit Marcellas privaten Besitztümern an mich gepresst, während meine Augen auf den Statthalter geheftet blieben, bis er mit seinem Sekretär in einer Türöffnung verschwand.
Im allgemeinen Gewimmel der Bediensteten schenkte mir niemand Beachtung. Erst als Marcella ihren blassgelben Mantel löste und von den Schultern gleiten ließ, kam ich wieder zur Besinnung, nahm schnell das Kleidungsstück entgegen und folgte ihr durch hohe, leuchtend bemalte Flure. Eine korpulente Magd, deren strohblonde Haare in festen Flechten um ein rundliches Gesicht gesteckt waren, eilte unter aufgeregtem Geschnatter vor ihr her, um der jungen Herrin den Weg zu ihrem Gemach zu weisen.
Mit einer schwerfälligen Verbeugung öffnete sie die Tür, und wir traten ein.
Helles Licht fiel durch das geöffnete Fenster und ließ einen großzügig geschnittenen Raum erkennen, in dessen Wandbemalung rote und grüne Farbtöne dominierten und dessen Fußboden mit roten und dunklen Marmorplatten ausgelegt war. Ein Bett mit Metallverzierungen auf gedrechselten Beinen, mehrere Truhen, zwei Korbsessel und zwei dreifüßige Tischchen mit runder Platte vervollständigten die Ausstattung.
Auf einem der Tische stand eine Silberkaraffe, dazu ein dünnwandiger Becher aus grünem Glas. Auf dem zweiten befand sich eine Waschschüssel aus Bronze mit dem dazugehörigen Krug, sodass die Herrin sich gleich nach ihrer Ankunft frisch machen konnte.
Mit freundlichen Worten entließ Marcella die Magd und blickte sich um.
Wir waren allein. Endlich zu Hause.
Zu Hause?
Ein Frösteln überkam mich. Nie hätte ich erwartet, die Stadt, in der ich aufgewachsen war, in einer solch bedrohlichen Lage wiederzusehen. Auch gleich bei unserer Ankunft zu erfahren, dass über dem Haus, zu dem ich gehörte, ein Fluch lastete, war nicht gerade dazu angetan, sich hier besonders willkommen zu fühlen.
Dabei glaubte ich im Grunde nicht an Flüche. Das waren Hirngespinste, ein Aberglaube für einfache Gemüter. Aber dennoch …
»Du kannst die Sachen jetzt ablegen.« Marcellas Worte rissen mich aus meinen Überlegungen in die Wirklichkeit zurück.
Ich fühlte das warme Licht des Vormittags auf meiner Haut, die kühle Brise, die durch das offene Fenster hereinwehte und die stickige Wärme linderte.
»Natürlich, Herrin.« Ungeschickt stellte ich das Bündel ab, das ich noch immer in Händen hielt, faltete den Mantel sorgfältig zusammen und legte ihn über die Lehne eines der Korbsessel.
»Sicher angekommen, Gott sei gepriesen.« Marcella lächelte. »Schlaf wäre nun genau das Richtige, aber leider …«
Nichts in ihrem Verhalten deutete daraufhin, dass sie verängstigt war, verstört von dem Fluch oder den laut ausgestoßenen Drohungen.
»Leider bleibt dafür keine Zeit.« Aufseufzend schüttelte sie das schwarze Haar und strich eine glänzende Strähne aus dem Gesicht.
Ich rührte mich nicht.
»Was hast du?« Marcella hielt in ihrer Bewegung inne und sah mich an.«
Verlegen wich ich ihrem Blick aus und begann die Kisten, die irgendein dienstbarer Geist in ihrem Zimmer deponiert hatte, auszupacken und die Kleidungsstücke aufzuschütteln.
»He!« Vorsichtig berührte Marcella meine Schulter, sodass ich mich mit zu Boden gerichtetem Blick herumdrehte. »Mach dir nicht so viele Gedanken, Invita.«
Verwirrt hob ich die Augen.
»Wer kann schon durch all seine Sorge etwas ändern?« Mit einer eleganten Bewegung beugte sie sich hinunter, um sich die Schuhe zu lösen, sodass ich ihr hastig zu Hilfe eilte. »Und die Macht der Menschen ist weit begrenzter, als sie glauben.«
Unwillkürlich dachte ich an Ketten, Peitschen, Sklavenaufseher und an die Macht, die diesen dadurch gegeben war. Doch ich schwieg und stellte Marcellas leichte Reisestiefel aus hellem Ziegenleder in eine Ecke.
»Aber dieser Fluch, Herrin …«, begann ich schließlich.
»Verwünschungen und Flüche sind Ausdruck ohnmächtiger Verzweiflung«, sagte sie leise. »Nichts weiter als der aus Hoffnungslosigkeit geborene Hass, der letztlich denjenigen, von dem er ausgeht, tötet, von innen heraus auffrisst. Ich werde für diese arme Frau beten. Und vielleicht kann man ihr irgendwie helfen.« Marcella begann sich die Nadeln einzeln aus dem schwarzen Haar zu ziehen, das langsam, Strähne für Strähne über ihre Schultern glitt. »Jeder Tag hat seine eigene Sorge, und die heutige heißt Aelius Misenus.«
Ein beinahe spöttisches Lächeln huschte über ihr Gesicht, und ich erinnerte mich daran, diesen Namen schon einmal gehört zu haben.
»Ein Sevir Augustalis der Stadt. Er hat die Bitte geäußert, meinen Vater persönlich zum Gastmahl des Duumvirs zu begleiten. Und als Stellvertreter des Kaisers hat mein Vater kaum eine Möglichkeit, die Einladung eines Kaiserpriesters auszuschlagen. Und natürlich ist dabei meine Anwesenheit erwünscht.«
Ich nickte knapp. »Sicher.«
»Und Dinge, die man nicht ändern kann …«
»… muss man eben geschehen lassen«, vollendete ich philosophisch. »Heißt das, du möchtest ein Bad nehmen, Herrin?«
»Sehr gerne. Bitte begleite mich doch. Es war eine lange Fahrt.«
Skeptisch blickte ich an mir hinunter. Mein taubenblaues, bis zum Boden reichendes Gewand war staubbedeckt und zerknittert, und nicht nur die Herrin konnte ein Bad gebrauchen.
Zumindest der Schmutz der Reise würde sich dadurch abwaschen lassen. Wie sich das mit dem Fluch einer verzweifelten Frau verhielt, würden die nächsten Tage zeigen.
KAPITEL II
Ich hatte vergessen, wie schwül es in Divodurum sein konnte.
Obgleich die Stadt nur wenige Tagesreisen südlich von Treveris lag, war es hier gleich um einiges wärmer, und schon jetzt, zu Beginn des Sommers, erschien mir die Hitze beinahe unerträglich.
Die meist aus Sandstein errichteten Gebäude der Stadt leuchteten golden oder weiß verputzt in der Sonne und bildeten einen starken Kontrast zu dem flammenden Rot der Fensterumrandungen und Häusersockel. Abschüssige Straßen speicherten die Sonnenstrahlen und warfen deren Hitze zurück. Nur die kühle Luft nahe den gewundenen Flussarmen, welche die gesamte Stadt durchzogen, schaffte ein wenig Linderung.
In ihrem nachtblauen Gewand und mit den aufgesteckten Haaren, von denen sich vereinzelte schwarze Strähnen lose um ihr helles Gesicht kringelten, sah Marcella aus wie die fleischgewordene Göttin der Nacht – Luna, Selene oder wie auch immer man sie nennen mochte –, die vom Himmel zu den Sterblichen herabgestiegen war.
Dieser Gedanke löste ein starkes Gefühl der Trauer in mir aus und verleitete mich dazu, für einen unbesonnenen Augenblick in die Vergangenheit zu schweifen.
Kurz nachdem ich nach Treveris verschenkt worden war, hatte ich die Bekanntschaft einer Frau gemacht, die sich Selena nannte. Damals hatte ich geglaubt, in ihr meine unbekannte Mutter gefunden zu haben, die mich als Säugling ausgesetzt hatte. Auch wenn viele Hinweise meine Vermutung zu bestätigen schienen, dass es sich bei Selena wirklich um meine Mutter handelte, hatte sie mich in der Stunde der Not doch erneut meinem Schicksal überlassen.
Von ihr stammte das Silberamulett in Form einer Mondsichel, das sie mir bei unserer letzten, unerwarteten Begegnung geschenkt hatte. Ich war mir selbst nicht im Klaren, warum ich es seitdem immer trug. Vielleicht, um mich an die Hoffnung zu erinnern, die sie in mir geweckt hatte, und als Zeichen des nie versiegenden Wunsches, endlich zu wissen, was es mit meiner Herkunft auf sich hatte.
Ein wenig fahrig wischte ich mir mit dem Handrücken die Schweißperlen weg, die sich auf meiner Stirn gebildet hatten. Vielleicht würde ich ja heute Abend Gelegenheit finden, mich ein wenig umzuhören und so etwas in Erfahrung zu bringen – über mich selbst, die Stadt und den Fluch, der mir nicht aus dem Kopf ging.
Dabei konnte die gängige Praxis, die Sklaven, die zur Begleitung der Gäste gekommen waren, in der Gesindeküche zu bewirten, von Nutzen sein. Niemand wusste über Klatsch und verborgene Geschehnisse besser Bescheid als diese, da sie überall in der Stadt zu tun hatten und ihre Herrschaft auf Schritt und Tritt begleiteten.
Doch war mir klar, dass es nach so langer Zeit ziemlich schwierig sein würde, jemanden zu finden, der wirklich noch etwas über meine Herkunft sagen konnte.
Mit einem flauen Gefühl im Magen nahm ich wahr, wie unser Wagen langsamer wurde und schließlich vor einem Haus zu stehen kam, dessen weiß getünchte Wände und dunkelrot umrandete Fenster in warmes Abendlicht getaucht waren.
Kurz tauschte ich einen Blick mit Marcella. Ich wusste, dass sie derartige Gastmähler verabscheute. Wie um sie zu trösten, reichte ich ihr die Hand und half ihr beim Aussteigen, während rasch ein Sklave herbeigeeilt kam, der die eisenbeschlagene Tür des Wagens offen hielt.
Tief atmete ich die noch warme Abendluft ein. Wir befanden uns im südöstlichen Teil der Stadt, unweit der Saal, wo einige reiche Beamte und Würdenträger ihre prächtigen Häuser hatten. Im Westen färbte sich die Sonne langsam rötlich, doch es war Sommer, und es würde noch eine Weile dauern, ehe sie sich zum Horizont senkte.
Wie eine Königin schritt Marcella neben ihrem Vater durch das große Hauptportal. Die mit Purpur und Gold besetzte Toga des Statthalters bauschte sich leicht bei jeder Bewegung, während die Menschen, Beamte wie Sklaven, ehrfurchtsvoll beiseitetraten und einen Gang bildeten, damit er passieren konnte.
Am Rande nahm ich wahr, dass ein Zeremonienmeister vortrat, den Legatus und seine Tochter mit Rosen bekränzte und ihnen eine Schüssel zum Händewaschen reichte.
Dann näherte sich mir schon die Vilica des Hauses, um mich in die Gesindeküche zu bringen.
Einen Moment lang zögerte ich, suchte den Blick meiner Herrin, die zu einer Liege geführt wurde. Das prächtige, in hellen Beige- und Naturtönen gehaltene Mosaik zeigte in geometrisch angeordneten Feldern Gladiatoren in voller Ausrüstung, deren Waffen und schweißbedeckte Körper detailgetreu wiedergegeben waren.
Nur ungern ließ ich Marcella allein in die Höhle des Löwen gehen. Machtkämpfe und Eitelkeiten war sie nicht gewohnt, und ich war besorgt, wie sie diesen Abend überstehen sollte. Denn es war abzusehen, dass die meisten der Gäste die Anwesenheit des höchsten Beamten der Provinz schamlos für ihr gesellschaftliches Vorankommen ausnutzen und auch seiner Tochter keinen Augenblick Frieden gönnen würden.
Marcellas Augen gaben mir ein Zeichen. Geh nur, ich komme zurecht.
Mit einem immer noch unguten Gefühl im Bauch, folgte ich dann der Vilica durch den mit einer gewölbten Kuppeldecke ausstaffierten Flur hinab zur Gesindeküche.
Der Geruch von Rosen und teuren Duftölen lag schwer in der schwülen Luft. Erschöpft von der Reise gingen meine Gedanken zu Flavus, von dem ich zum ersten Mal seit langer Zeit getrennt war, und plötzlich überkam mich eine solche Traurigkeit, dass ich nur mit Mühe die Tränen zurückhalten konnte, um nicht hier, in meiner alten Heimatstadt, inmitten der marmorgeschmückten Villa eines reichen Emporkömmlings, loszuschluchzen.
Solange ich denken konnte, war ich allein gewesen. Bereits als Säugling zur Sklaverei bestimmt, war ich in die Abhängigkeit der Familie des Cornelius Felix, eines mediomatrischen Beamten, gekommen. Dieser hatte sich wohl erhofft, mich zu einer willigen und gehorsamen Magd für den eigenen Haushalt heranziehen zu können. Aber diese Hoffnung war schon sehr früh an meinem Trotz und meiner Eigenwilligkeit gescheitert. Ihre offensichtliche Enttäuschung darüber vergalt mir die Herrschaft mit Schlägen und Bestrafungen.
Als ich alt genug war, um eine verantwortliche Aufgabe zu erhalten, hatte man mich zunächst damit betraut, den ungezogenen Sohn des Hauses zu den Unterrichtsstunden zu begleiten. Und später dann, der verwöhnten Tochter beim Ankleiden zur Hand zu gehen, wofür ich allerdings nur wenig Geschick an den Tag legte.
So waren die Jahre vergangen, und ich kann nicht behaupten, dass sich eine wie auch immer geartete Zuneigung zwischen der Familie und mir entwickelt hätte. Schließlich entschloss sich mein Herr dazu, mich an den Statthalter zu verschenken, weshalb ich dann im Spätherbst des vergangenen Jahres aus allem, was ich bis dahin kannte, herausgerissen wurde, um eine der vielen Küchensklaven des Legatus in dessen Stadthaus zu Treveris zu werden.
Den Unwägbarkeiten der Göttin Fortuna war es zu verdanken, dass sich dort jedoch mein Schicksal wendete. Ich kam in den Dienst seiner Tochter Marcella, die wohl die erste Herrin war, welche mich wie ein Mensch behandelte und nicht wie ein willenloses Werkzeug – und das, obgleich sie Anhängerin jenes verbotenen Kultes der Christen war, die vom Kaiser selbst zu den Staatsfeinden gerechnet wurden und denen man nachsagte, in der Verborgenheit seltsame Rituale zu zelebrieren.
Neben der gehobenen Stellung als Dienerin der jungen Herrin wurde ich nach einigen Verwicklungen auch noch dem alemannischen Sklaven Flavus als Partnerin zugewiesen, der es nach anfänglichem Misstrauen schaffte, all das zu erringen, von dem ich bis zu jenem Zeitpunkt noch nicht einmal wusste, dass ich es besaß: mein Vertrauen und meine Liebe. Obgleich ich mich zu Beginn vehement gegen diese erzwungene Beziehung gewehrt hatte, erschien es mir jetzt unmöglich, auch nur ein paar Tage ohne seine Gesellschaft zu verbringen.
Von den Nächten ganz zu schweigen.
Zu meinem Leidwesen hatte Flavus in Treveris Zurückbleiben müssen, um im Stadthaus des Legatus seiner Arbeit nachzugehen, da die Abwesenheit des Hausherrn dazu genutzt wurde, um das Hypocaustum, die Fußbodenheizung, für die Flavus zuständig war, einer gründlichen Wartung zu unterziehen.
Marcella war meine Niedergeschlagenheit wegen der Trennung nicht verborgen geblieben, und sie hatte mir versprochen, sich dafür einzusetzen, dass Flavus nachkommen dürfe, sobald die Arbeiten abgeschlossen seien.
Aber bis dahin …
Vielleicht konnte ich das ungewohnte Gefühl der Einsamkeit vertreiben, wenn ich in der Gesindeküche durch gutes Essen, Wein und den neuesten Tratsch auf andere Gedanken gebracht würde.
Vorsichtig glitt mein Blick über die Anwesenden, um zu sehen, ob ich irgendeinen kannte. Wenn ich allerdings jemanden aus dem Hause der Cornelier zu Gesicht bekommen hätte, ich wäre zu einer Marmorstatue erstarrt. Doch dann sagte ich mir, dass die Familie und das Gesinde mittlerweile längst in Rom weilen mussten, wie Cornelius Felix es seinerzeit geplant hatte. Denn das war mit ein Grund gewesen, mich an den Statthalter zu verschenken, weil jedes zusätzliche hungrige Maul die Kosten für den Umzug in die Höhe getrieben hätte.
Ohne Flavus an meiner Seite fühlte ich mich inmitten des Menschengedränges verloren. Ich musste mich dazu zwingen, einen freien Platz an einem der Tische zu suchen und mir einen Becher mit Wasser gemischten Weins einzuschenken. Lustlos nippte ich daran, doch er schmeckte gut und half mir allmählich dabei, die düsteren Gedanken zu vertreiben, die wie dunkle Fledermäuse über meinem Kopf hingen.
Ich begann damit, mich genauer umzusehen. Mehrere schwere Holztische standen im Raum, gedeckt mit einer Auswahl köstlich aussehender Speisen, die schon in mundgerechte Stücke zerteilt waren.
An jedem der Tische saßen mindestens sechs oder sieben Personen, ihrer Kleidung nach, alle Sklaven der eingeladenen Gäste. Zwar entdeckte ich kein bekanntes Gesicht, doch auf dem Platz mir gegenüber saß eine zierliche Gestalt, die sofort meine Aufmerksamkeit fesselte.
Es war ein Mädchen von geradezu nymphenhafter Schönheit, das vielleicht fünfzehn Jahre alt sein mochte, im höchsten Fall ebenso alt wie ich. Goldblonde Locken umflossen ein helles, herzförmiges Gesicht mit zarten Wangenknochen. Große, unschuldig blaue Augen mit langen Wimpern und anmutig geschwungene Lippen ließen die Schöne zugleich mädchenhaft und sinnlich wirken. Obgleich ihr Körper zerbrechlich wirkte, zeigte er vielversprechende Rundungen an den richtigen Stellen auf. Den sorgfältig gepflegten Händen war anzusehen, dass sie keiner harten Arbeit nachzugehen brauchte.
Verstohlen gingen die Blicke der meisten Anwesenden immer wieder zu ihr hin – die der Männer mit unterdrücktem Verlangen, die der Frauen mit nur schwer verhohlenem Neid. Das Objekt der Bewunderung schien davon jedoch nichts zu bemerken und bediente sich reichlich an der Schüssel mit in Würfel geschnittenem Schafskäse. Allerdings kam es mir vor, als würde sie öfter zu mir herübersehen, wobei sich jedes Mal der Blick ihrer Augen verdunkelte und sie in ihrer Bewegung innehielt.
Nachdem sie schließlich ihr Mahl beendet hatte, tupfte sie sich ihren Mund mit einem Tuch ab und schaute mich unverwandt an.
Von so viel Aufmerksamkeit unangenehm berührt, steckte ich meine Nase ein wenig tiefer in den Becher und versuchte so zu tun, als bemerkte ich sie gar nicht.
Über den Rand des Gefäßes hinweg nahm ich jedoch wahr, wie sie sich zu mir vorbeugte, und ihre Hand flüchtig meinen Unterarm berührte.
»Du bist aus dem Hause des Statthalters?« Ihr rauer, leicht fremdländischer Akzent deutete darauf hin, dass sie nicht aus Divodurum stammte.
Unbehaglich zupfte ich an meiner blassblauen Tunika. »Hm …« Anscheinend war es mir nicht vergönnt, ungestört meinen trüben Gedanken nachzuhängen. Denn mit meiner Kleidung stach ich auch hier aus der Menge heraus, als hätte ich ein Schild umhängen: Eigentum des Legatus.
Ohne dem Mädchen einen weiteren Blick zu gönnen, schob ich mir eine überbackene Eierhälfte in den Mund und fragte mich, ob in diesem Hause das Essen für das Gesinde immer so üppig ausfiel oder ob dies nur dem besonderen Anlass heute zu verdanken war.
Die blonde Schönheit schien von meiner Zurückweisung zunächst einmal hinreichend verschreckt worden zu sein und Abstand davon zu nehmen, das Gespräch weiter zu vertiefen. Doch plötzlich hielt sie erneut in ihrer Bewegung inne, blickte sich kurz um, als wolle sie sichergehen, dass keiner der Anwesenden zu ihr herüberschaute, und beugte sich wieder zu mir hin.
»Ich muss dem Statthalter etwas mitteilen«, flüsterte sie hastig und so leise, dass ich sie kaum verstand.
»Du willst was?«, entfuhr es mir mit wesentlich größerer Lautstärke, sodass die Schöne erschrocken zusammenzuckte und zwei der Anwesenden abrupt ihr Gespräch unterbrachen und den Kopf in unsere Richtung wandten.
»Nicht so laut, bitte!«, wisperte sie ängstlich, nachdem sie sicher war, dass keiner mehr zuhörte. »Ich muss unbedingt den Statthalter sprechen.«
Noch immer wollte ich meinen Ohren nicht trauen. Litt das blauäugige Mäuschen vielleicht unter Größenwahn? Wie konnte sie sich zu der Idee versteigen, dass der mächtigste Mann der Provinz ausgerechnet mit ihr sprechen würde? Ein Mann, der in dieser vom Krieg gebeutelten Zeit unter enormem Druck stand: Intrigen erschütterten das Imperium, die Barbaren überrannten den Limes – da hatte er wahrhaftig andere Sorgen. Es sei denn … Nein! Sie war doch wohl nicht eine der Frauen, die es darauf abgesehen hatten, bei jeder sich bietenden Gelegenheit ein Schäferstündchen mit einflussreichen Männern zu verbringen? So etwas konnte sie sich vielleicht vom Publikumsliebling der Gladiatoren oder Wagenlenker erhoffen. Unter Umständen würde sich auch noch ein städtischer Decurio auf ihre Reize einlassen, denn schlecht sah sie ja wahrhaftig nicht aus mit ihrem Schmollmund und den großen blauen Augen. Aber der Statthalter …
»Vergiss es, Mädchen«, sagte ich nur und biss ein Stück von einem Brötchen ab. »Der Legatus hat kein Interesse an einer wie …«
»Ich muss ihn warnen, er ist in Gefahr!«
Um ein Haar wäre mir der Bissen im Halse stecken geblieben, und ich bekam einen Hustenanfall, der erneut die Blicke aller Anwesenden auf uns zog.
Nachdem ich mich gefangen hatte und die anderen ihre Gespräche wieder aufnahmen, fragte ich leise: »Was hast du gesagt?«
»Der Statthalter ist in Gefahr!« Ihr zartes Gesicht nahm eine rosa Färbung an.
»In welcher Gefahr?«, gab ich schließlich ebenfalls flüsternd zurück, unsicher, ob ich diese Kassandrarufe ernst nehmen oder als schlechten Scherz abtun sollte.
»Das muss ich ihm persönlich sagen.« Fast flehentlich hatte sie meinen Arm ergriffen. »Wenn du deinem Herrn einen Dienst erweisen willst, dann hilf mir, zu ihm zu gelangen. Bitte!«
Immer noch wie vor den Kopf gestoßen, blickte ich sie an. Tausend Gedanken wirbelten mir durch den Kopf, und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. War das Ganze nur der Versuch einer verhätschelten Sklavin, sich wichtig zu machen und so die Aufmerksamkeit des obersten Herrn der Provinz zu erlangen? Dann wäre ich schön dumm, ein solches Vorhaben zu unterstützen und mir Ärger einzuhandeln. Andererseits, wenn es stimmte, was sie sagte, und der Statthalter tatsächlich in Gefahr schwebte? War es dann nicht sogar meine Pflicht, ihn zu warnen?
Unschlüssig blickte ich sie an. Ihre großen Augen drückten ernsthafte Besorgnis, fast schon Panik aus. »Nun ja …«, meinte ich schließlich zögernd. »Wenn du die Wahrheit sprichst, werde ich sehen, was ich machen kann.« Krampfhaft überlegte ich, wie ich das bewerkstelligen könnte, ohne selbst allzu dumm dazustehen, wenn sich die Warnungen lediglich als heiße Luft entpuppen sollten. »Vielleicht könnte ich mit seiner Tochter sprechen … Aber du kannst mir wirklich nicht sagen, um was es geht?«
»Nein!« Die Sklavin war aufgestanden. »Zu seiner eigenen Sicherheit und zu deiner.« Hastig blickte sie sich um, ergriff unter der Tischplatte meine Hand und drückte mir etwas hinein. »Es bleibt keine Zeit mehr zu warten. Das hier ist für ihn.«
»Was ist …?«
»Psst!«, unterbrach sie mich leise, aber scharf. »Versteck es unter deinem Gewand und stelle sicher, dass er es erhält!« Sie stand auf. Ihre großen Augen glitten hektisch durch den Raum. »Ich gehe jetzt besser, bevor …«
Den Rest des Satzes konnte ich nicht mehr verstehen, denn noch bevor sie zu Ende gesprochen hatte, war sie herumgewirbelt und aus dem Raum geeilt.
Wie vom Donner gerührt saß ich da, meine linke Hand unter dem Tisch noch immer um den seltsamen Gegenstand geballt, mit der rechten den Rest des Brötchen haltend.
Missmutig legte ich es wieder auf meinen Teller zurück und schob ihn beiseite. Von einem Augenblick auf den anderen war mir der Appetit vergangen.
KAPITEL III
Gewohnheitsgemäß erwachte ich kurz vor dem Morgengrauen.
Noch im Halbschlaf tastete meine Hand nach rechts, in Erwartung, Flavus’ warmen Körper neben mir zu spüren. Doch ich griff ins Leere, und mit dem jähen Gefühl der Enttäuschung kehrte ich vollständig in die Gegenwart zurück.
Ein wenig schlaftrunken rieb ich mir die Augen, setzte mich auf und drehte meinen Kopf dann zu dem kleinen, grün verglasten Fenster, hinter dem sich blass das erste Licht des anbrechenden Morgens zeigte.
Vorsichtig stand ich auf, schlich auf Zehenspitzen zum Fenster, öffnete es einen winzigen Spalt und blickte nach draußen in den Garten. Über den Fassaden der Villa zeichnete sich ein orangefarbener Lichtstreifen ab.
Mein Blick ging zu Marcella, die noch immer schlief. Ihr helles Gesicht wirkte entspannt, ihre schwarz glänzenden Haare breiteten sich wie ein kostbarer Schleier auf ihrem Kopfkissen aus.
Als ich sie vor einigen Monaten, bei meiner Ankunft im Hause des Statthalters, kennengelernt hatte, schien sie von einer seltsamen Krankheit befallen zu sein, die sie dazu zwang, einen Großteil des Tages das Bett zu hüten. Erst seit sie sich ihrem Vater gegenüber zu ihrem seltsamen neuen Glauben der Christen bekannte, war eine unübersehbare Veränderung mit ihr vorgegangen.
Mehr als einmal hatte sie mich vor der Willkür und Peitsche des Sklavenaufsehers Celsus bewahrt und schließlich in ihren persönlichen Dienst aufgenommen. Obgleich ich mir nicht erklären konnte, weshalb, überkam mich in diesem Moment das Gefühl der Dankbarkeit gegenüber meiner Herrin mit einer solchen Heftigkeit, dass ich mir wünschte, es gäbe irgendetwas, womit ich ihr diese Güte vergelten könnte.
Es gab nicht viel, was ich in meiner Position Marcella bieten konnte, aber ich wusste, dass ihr materielle Güter nicht wichtig waren. Und vielleicht wäre da doch etwas …
Lautlos schlüpfte ich in mein Gewand, band den Gürtel um meine Taille und zog rasch die Sandalen an, bevor ich auf leisen Sohlen den Raum verließ, nicht ohne einen letzten Blick auf meine schlafende Herrin zu werfen.
Der Duft von frisch gebackenem Brot, Getreidebrei und gewürztem Käse strömte schon durch die Flure, als ich mich der Küche näherte. Vorsichtig steckte ich den Kopf hinein und sah eine weißhaarige Köchin über die Feuerstelle gebeugt stehen und missmutig in einem Topf rühren. So früh ließ sich keiner der anderen Haussklaven in der Küche blicken.
Unbemerkt eilte ich weiter zum Hauptportal, das zur Straße hinausführte.
Zwei schläfrige Wachposten standen davor und ließen mich mit einem Gähnen passieren, als ich ihnen sagte, ich sei für die Herrin unterwegs. Wenn diese auch nichts davon wusste, so war es doch nicht wirklich gelogen.
Wieder überkam mich das seltsame Gefühl der Vertrautheit, als ich durch die morgendlichen Straßen der Stadt ging, die langsam zu neuem Leben erwachte. Händler öffneten laut polternd ihre Läden, aus den Bäckereien duftete es verführerisch, dazu erklang von überall der weiche Tonfall des mediomatrischen Dialektes.
Mein Ziel lag im Norden der Stadt, ein wenig abseits des Forums, in der Nähe der riesigen Jupitersäule, die fast bis zum Himmel ragte und auf deren Spitze der berittene Göttervater gerade einen aufständischen Barbaren zu Tode trampelte.
Ich beschleunigte meine Schritte, ließ den Isistempel hinter mir und lief entlang der Thermen, über das Forum, vorbei an der Basilica und Kurie, in der an Werktagen die Beamten und Ratsherren, die sogenannten Decurionen, tagten. Schließlich überquerte ich den Decumanus und bog dann in eine kleine Seitengasse ein, wo einfache Häuser mit schlicht verputzten Fronten die Straße säumten. Vor einem unscheinbaren Bäckerladen, neben dessen hölzerner Tür in schon verwitterten roten Buchstaben der Name des Besitzers auf die ehemals weißgetünchte Fassade gepinselt war, blieb ich stehen. Hier gab es die besten Brote und Backwaren der ganzen Stadt.
In den vergangenen Monaten hatte sich hier kaum etwas verändert. Noch immer sah man um diese Zeit die gleichen müden Gesichter der wenigen Kunden, meist einfache Handwerker und Sklaven. Nur dass ich nicht mehr dazugehörte, zu dieser Stadt mit ihren Hügeln, den in leuchtenden Farben bemalten Statuen, ihren Tempeln und Theatern und den Brücken, die sich über die gegabelten Flussarme von Mosel und Saal erhoben, welche die Stadt wie ein Netz durchzogen.
Die teils neugierigen, teils misstrauischen Blicke ignorierend, trat ich ein. Auch hierzulande schien man auf den ersten Blick zu erkennen, dass ich aus dem Hause des Statthalters kam, und machte mir bereitwillig Platz. Und ich konnte nicht verhindern, dass der Gedanke ein ungutes Gefühl in mir wachrief, das sich nicht abschütteln ließ.
Wahrscheinlich fragten sich die Umstehenden gerade, wieso eine Sklavin des Legatus ausgerechnet hier Brötchen einkaufte. Denn obwohl ich schon früher des Öfteren hier gewesen war, erkannte mich niemand. Hatte ich mich so verändert, oder war es nur meine blassblaue Tunika, die sie davon abhielt, mir ins Gesicht zu blicken?
Rasch kramte ich die wenigen Messingasse hervor, die ich besaß.
Mit einem bedauernden Blick auf das, was eigentlich als Grundstock meines Freikaufs gedacht war, zählte ich einige davon ab und verlangte drei Honigbrötchen, ließ zwei davon einpacken und mir das dritte mitgeben. Noch bevor ich den Bäckerladen verließ, vergrub ich meine Zähne, in das knusprig-weiche, nach Butter und Honig duftende Gebäck und hätte bei dem vertrauten Geschmack beinahe geweint.
Ja, der Weg hatte sich gelohnt!
Der Duft des Brötchens mischte sich mit dem Gefühl der Vorfreude, während ich durch die heller werdenden Gassen zurück zur Statthalterresidenz eilte.
Allmählich belebte sich die Stadt, immer mehr Läden wurden geöffnet; in ein, zwei Stunden würde kein Durchkommen mehr sein. Divodurum war überfüllt; bereits jetzt war es deutlich zu spüren. Viele der Anwohner hatten offenbar Verwandte oder Bekannte aus der Provinz bei sich aufgenommen. Aus den mehrgeschossigen Mietshäusern drangen Kindergeplärr und die zornigen Stimmen Erwachsener. Mehr als einmal musste ich dem Strahl eines Nachttopfes ausweichen, der auf das Pflaster ausgeleert wurde.
Selbst in den Häuserecken und Tornischen sah man hier und da Gestalten sich regen, Flüchtlinge, die kein Geld für einen Schlafplatz in einer der Herbergen und keine Angehörige in der Stadt hatten und die dort mit Sack und Pack kampierten. Einige Bettler hatten schon Stellung bezogen und blickten die Passanten flehend oder taxierend an.
Angesichts der sich füllenden Straßen wählte ich einen Umweg und verdrückte mich in eine Seitengasse, während ich versuchte, mich daran zu erinnern, wie ich als Kind hier entlanggelaufen war, neugierig, wieselflink, jedoch immer mit der Angst vor der Strafe, die mich erwarten würde, sollte einer der Herrschaft mein unerlaubtes Verschwinden bemerken. Und doch hatte ich es nicht lassen können, mich immer wieder nach draußen zu schleichen, das geschäftige Treiben auszukosten und mit großen hungrigen Augen vor dem Laden eines Librarius stehen zu bleiben. Auch wenn ich mich nie getraute einzutreten, geschweige denn eine der wertvollen Schriftrollen anzusehen, die dort von Kopisten vervielfältigt und etikettiert wurden, bevor sie einen Platz in den Verkaufsräumen fanden.
Schon damals war mein Hunger nach dem geschriebenen Wort so groß, dass ich, sobald ich des Lesens mächtig war, nie lange dem Drang widerstehen konnte, mir hin und wieder eine Schriftrolle aus der Bibliothek meines Herrn auszuborgen. Eine Tatsache, die anfangs noch nicht einmal aufgefallen war, da niemand in der Familie sich zur schönen Literatur oder gar zur Philosophie hingezogen fühlte.
Selbst Primus, der Sohn des Hauses, auf dem die gesamte Hoffnung der Familie ruhte, war nur mit größter Strenge und unermüdlichem Zureden seiner Mutter Fulvia dazu zu bewegen gewesen, regelmäßig seine Unterrichtsstunden zu besuchen. Ich erinnerte mich genau an das ständige Gezeter, die Unaufmerksamkeit des jungen Herrn und die herben Worte des Grammaticus. Denn mir war die undankbare Aufgabe zugefallen, ihn zu dem verhassten Unterricht begleiten, seine Unterlagen tragen und dann stundenlang stumm in der Ecke stehen und warten zu müssen, bis die Lektionen vorbei waren.
Das einzig Vorteilhafte an dieser bisweilen unerträglichen Situation lag darin, dass ich auf diese Art in den Bannkreis der Philosophie und Literatur hineingezogen und der Hunger nach Wissen in mir geweckt wurde. Allerdings bedeutete das für jemanden in meiner Position nicht unbedingt etwas Gutes. Und als sie durch Zufall dahinterkamen, dass ich mich aus ihrer kostspieligen Schriftensammlung bediente, waren sie alles andere als erfreut darüber. Meine unerlaubten Ausleihen aus der Bibliothek des Herrn hatten mir mehr Prügel und einsame Nächte im dunklen Keller des Hauses beschert als alle meine anderen Vergehen zusammen. Mochte die Familie des Cornelius Felix auch noch so wenig von höherer Bildung beleckt sein, sie verstand es, Dinge zu wahren, die ihr gehörten. Und so knauserig sie auch anderen gegenüber mit Geld waren, so großzügig waren sie im Gebrauch von Rute und Peitsche.
Ein plötzliches Stolpern riss mich aus den unangenehmen Gedanken. Gerade noch gelang es mir, mich im letzten Moment abzufangen, ehe ich mitsamt meiner kostbaren Brötchen auf das dreckige Pflaster stürzte. Verwundert blickte ich zu Boden, um festzustellen, woran sich mein Fuß gestoßen hatte.
Am Rande der Gasse lag ein seltsam zusammengesunkenes Etwas. Es war mit einer dunklen Decke verhüllt und so dicht an eine Häuserwand geschoben, dass ich es beim Vorbeigehen nicht gleich gesehen hatte.
Merkwürdig. Zwar war es üblich, dass Bewohner der angrenzenden Häuser hin und wieder ihren Müll aus dem Fenster oder auf die Straße kippten, doch konnte ich mir nicht denken, was das für Abfälle sein sollten, die jemand in einem derart mächtigen Haufen vor der Haustür stapelte und dazu noch unter einer wollenen Decke verbarg.
Mit misstrauisch gerunzelter Stirn bückte ich mich zu dem Bündel hinunter.
Goldene Strähnen quollen unter dem dicken Stoff hervor. Erschrocken wich ich einen Schritt zurück.
Welche arme heimatlose Seele – ein Flüchtling vielleicht – hatte hier wohl die Nacht verbracht? Erstaunlich war nur, dass die Person durch meinen Zusammenstoß nicht aufgewacht war oder sich zumindest bewegt hatte. Noch immer lag sie genauso reglos da wie zuvor.
Ich stutzte und beugte mich mit zusammengekniffenen Augen erneut über das Bündel. Eine zierliche, selbst unter der Decke noch zerbrechlich wirkende Figur, ein nackter, schmaler Fuß ragte hervor.
Ich wusste, ich sollte spätestens jetzt nach Hause gehen. Den kleinen eigenmächtigen Ausflug würde man mir sicher verzeihen. Wenn ich mich jedoch in fremde Angelegenheiten einmischte und meine Zeit mit Lumpengesindel und Bettlern auf der Straße vergeudete, dann würde ich mir größeren Ärger einhandeln.
Und trotzdem, ich konnte nicht einfach Vorbeigehen und jemanden am Straßenrand liegen lassen, der vielleicht Hilfe benötigte. Noch immer rührte sie sich nicht, auch musste ihr Atem sehr schwach sein, denn durch den Stoff der Decke hindurch war keine Bewegung zu erkennen.
Hatte sich die Herrin Marcella nicht äußerst großmütig gegenüber den Benachteiligten der Gesellschaft gezeigt, ja, geradezu besorgt am Schicksal der schwächer Gestellten? Dieser Gedanke gab den Ausschlag. Beherzt trat ich auf die Schlafende zu, während ich überlegte, ob ihr vielleicht ein Stück der süßen Brötchen helfen konnte, wieder zu Kräften zu kommen.
»Geht es dir nicht gut?«, fragte ich leise, einen unruhigen Blick um mich werfend, um zu sehen, ob mich einer der Passanten bei meinem Tun beobachtete.
Keine Antwort.
»Kann ich etwas für dich tun?« Ein wenig forscher tippte ich die Gestalt dort an, wo ich unter dem Stoff die Schulter vermutete.
Wieder keine Reaktion.
»He, so sag doch etwas!« Diesmal rüttelte ich ein wenig heftiger. Der Körper fühlte sich unnatürlich starr an. Starr und kalt.
Noch einmal kurz über die Schulter schauend, packte ich die Frau an der rechten Seite und drehte sie vorsichtig herum. Ihr steifer Körper schien sich zu widersetzen, doch dann rollte sie auf den Rücken, die Decke glitt ihr vom Gesicht, und wie vom Blitz getroffen fuhr ich auf und taumelte zurück.
Es war das Mädchen von gestern Abend!
Blut rauschte mir in den Ohren, mein Herz hatte einen kurzen Moment zu schlagen aufgehört und begann dann wie ein Trommelwirbel zu pochen.
Wie von einem Zauber gebannt stand ich da und blickte bewegungslos auf das Gesicht hinab, dessen Lockenpracht mir am Tag zuvor Bewunderung und Neid abgerungen hatte.
Noch immer war das Gesicht milchig weiß, doch hatte sich ein unnatürlicher fahler Ton unter die Reinheit der Blässe gemischt. Ihre blauen Augen waren geschlossen, ihre Züge wie festgefroren, nicht einmal eine Wimper zuckte.
In der vergangenen Nacht hatte sie vor Sinnlichkeit gesprüht, und nun lag sie reglos zu meinen Füßen.
Auf der rechten Seite des gespenstisch weißen Gesichts zog sich vom Ohr bis hinab zum Hals ein dunkler Streifen. Es kostete mich einiges an Überwindung, um mich nach vorn zu beugen und diesen näher zu betrachten. Etwa einen Finger breit und bräunlich, wirkte er wie ein Fremdkörper auf den ebenmäßigen Zügen.
Blut!
Ein breites Rinnsal aus getrocknetem Blut.
Bevor ich wusste, was ich tat, war ich neben dem Mädchen auf die Knie gegangen und strich ihm vorsichtig die Haare aus dem Gesicht, um zu sehen, woher das Blut kam.
Ein schwerer Duft schlug mir entgegen, der sich in den Falten der Decke verfangen hatte, ein schwüler Geruch wie von Weihrauch mit einem Hauch von Rosen.
Dann sah ich es.
Einen Schrei unterdrückend fuhr ich zurück. An der rechten Schläfe, beinahe vollständig von der Lockenpracht verborgen, klaffte eine tiefe, schwarz verkrustete Wunde. Von ihr hinab verlief das getrocknete Rinnsal, dessen letzter Ausläufer auf dem Gesicht zu erkennen war.
Galle stieg mir in die Kehle. Ein Zittern hatte sich meines Körpers bemächtigt, und einen Augenblick lang musste ich die Augen schließen, um nicht das Bewusstsein zu verlieren.
Langsam, ganz langsam drang die Erkenntnis zu mir durch: das blasse Gesicht, die Starre des Körpers, die Wunde am Kopf. In meiner Verzweiflung fiel mir nichts anderes ein, als mit den Fingerspitzen nach der Schlagader am marmorweißen Hals des Mädchens zu tasten. Doch das Ergebnis war wie erwartet.
Sie war tot. Ermordet!