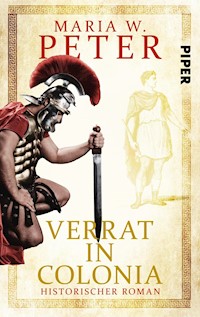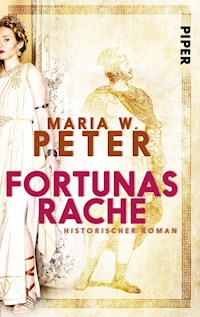6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Invita, die Sklavin des römischen Statthalters zu Trier, steckt erneut in Schwierigkeiten – nicht nur, dass sie dem alemannischen Kriegsgefangenen Flavus als Geliebte versprochen wurde, jetzt versucht sie auch noch, den Mord an einem hochrangigen römischen Beamten aufzuklären. Auf dem Nachhauseweg von einem rauschenden Fest wurde der Mann heimtückisch ermordet. Ein Schuldiger ist schnell gefunden: der Sklave Hyacinthus, welcher ihn begleitete und wie durch ein Wunder unversehrt blieb. Nach altem Recht sollen nun alle Sklaven des Haushaltes hingerichtet werden. Invita stellt Nachforschungen an und findet sich schon bald in einem Geflecht aus Lügen und Intrigen wieder …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-98356-3
Juni 2017
Die »Invita«-Reihe ist ursprünglich bei Bastei Lübbe erschienen.
© der Originalausgabe: Bastei Lübbe AG, Köln 2008
© dieser Ausgabe: Piper Fahrenheit, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2017
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Kartenzeichnung von Helmut W. Pesch
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: lynea,Nik Merkulov,Innochka/shutterstock.com und Soare Cecilia Corina_shutterstock
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Für
Christian Laes,
(Leuven, Belgien)
und
Nancy Llewellyn
(Wyoming, USA)
In Memoriam
Dr. Caelestis Eichenseer
Die Richtschnur des Nutzens ist dieselbe
wie die der Ehrenhaftigkeit.
Wer das nicht einsieht, dem ist kein Betrug,
keine Untat fremd.
Cicero
KAPITEL I
Ab Urbe Condita 1012 (260 n. Chr.)
Der Duft von Weihrauch zog durch das Haus. In jede Ritze, in jeden Winkel kroch der geheiligte Odem, der die Wünsche der Sterblichen hinauf zu den Göttern tragen sollte und gleichzeitig versprach, das Haus von üblen Geistern und Schatten zu reinigen.
Nun weiß ich natürlich nicht, wie wirksam diese reinigende Kraft ist, wenn sich ihr Duft mit dem Geruch von Wein und opulenten Speisen mischt. Im statthalterlichen Triclinium, in dem die heiligen Rauchschwaden aus Kohlebecken emporstiegen, waren alle höheren Beamten und was sonst in Stadt und Civitas Rang und Namen hatte versammelt, um den Geburtstag meines Herrn, des Statthalters der Provinz Gallia Belgica, zu begehen. Schon jetzt hatten sie dem Wein ganz kräftig zugesprochen und lagen mit geröteten Wangen und feuchten Augen auf ihren Speiseliegen.
Eigentlich hatte ich bei dem Fest nichts zu suchen, da ich nicht zur Bedienung eingeteilt war. Celsus, der Sklavenaufseher, hatte mir sogar strengstens untersagt, meine Nasenspitze bei den Gästen zu zeigen, doch erlaubte ich mir die Freiheit, diesen Befehl ein wenig weiter auszulegen, während ich darum betete, Celsus möge sich in seiner Kammer einen Rausch antrinken, statt ausgerechnet über mich zu stolpern.
Hinter dem Vorhang, der den Flur vom Triclinium trennte, war ich den Blicken der hohen Herren und ihrer Gattinnen entzogen und hatte dennoch eine ungetrübte Sicht auf das ganze Geschehen. Von meinem Versteck aus sah ich, wie sich die meisten Gäste großzügig von den üppig auf Tischen angerichteten und in mundgerechte Stücke geschnittenen Speisen bedienten.
An mir vorbei wurden immer weitere Tabletts hineingeschleppt, bis zum Biegen beladen mit erlesenen Köstlichkeiten aus den entlegensten Winkeln des Imperiums, die zum Teil auf ausgeklügelten Wegen auf dem Tisch des mächtigsten Mannes von Treveris gelandet waren. Neben einer Unzahl von getrockneten Früchten und mit exotischen Gewürzen angerichteten Gemüsespezialitäten wie syrischem Rettich und ägyptischem Porree verströmten auch exquisite Fleischgerichte wie frisch angebratener Flamingo und in Honig gebackener Siebenschläfer ihren verführerischen Duft. Auf filigran verzierten Silberplatten glitzerten frische Austern, die in Eis gepackt mit Eilkurieren von der gallischen Atlantikküste herbeigebracht worden waren, mit dem in schweren Silberbechern servierten Wein um die Wette. Beinahe bescheiden nahmen sich daneben die Pfauenzungen aus, mit deren Gegenwert sich so mancher Sklave seine Freilassung hätte erkaufen können.
Geschäftig liefen Bedienstete zwischen den Speiseliegen und Tischen umher, um den Braten zu zerkleinern, Wein nachzuschenken und den Gästen Schalen mit frischem Wasser und trockene Tücher zu bringen, mit denen sie sich nach jedem Gang die Hände waschen konnten.
Ein aufkeimendes Hungergefühl unterdrückend, ließ ich meinen Blick über die Liegen schweifen, um zu sehen, wer eine Einladung ins Erste Haus der Stadt erhalten hatte. Ich lebte noch nicht lange genug in Treveris – die meiste Zeit meines Lebens hatte ich im mediomatrischen Divodurum verbracht –, um alle Honoratioren und Würdenträger zu kennen. Von den meisten hatte ich wohl schon den Namen gehört, doch nur die wenigsten von ihnen zu Gesicht bekommen.
Zu den Personen, die ich erkannte, zählten Gaius Baetius Quigo und Decimus Sempronius Meritus, die beiden amtierenden Duumviri, die mit ihren Frauen einen Platz in der Nähe des Statthalters innehatten, so wie es ihrem Rang gebührte. Dabei wusste ich von Gesprächen, dass es in letzter Zeit häufiger zu Spannungen zwischen den höchsten der städtischen Beamten und dem Statthalter gekommen war. Ich hatte keine Ahnung, um was es sich dabei handelte, doch vermutete ich, dass es um Bedeutenderes ging als um Baumaßnahmen, öffentliche Spiele und die damit verbundenen Kosten.
Seit vor einigen Monaten germanische Barbarenstämme den Limes überrannt hatten und immer wieder plündernd und mordend über Gehöfte, Ansiedlungen und Städte herfielen, befanden sich die gesamten Nordprovinzen im Ausnahmezustand. Tagtäglich kamen – zusammen mit einem Strom von Flüchtlingen – neue Schreckensmeldungen über Metzeleien und Brandschatzungen in die Stadt. Da Kaiser Valerian mit seinen Legionen im Osten kämpfte, oblag es seinem Sohn und Mitregenten Gallienus, sich der einfallenden Horden an Rhein, Donau und in Norditalien zu erwehren. Sein erst sechzehnjähriger Enkel Saloninus residierte derweil in Colonia Agrippinensis, wo er gemeinsam mit Postumus, dem Statthalter von Niedergermanien, die Verteidigung der nördlichen Provinzen sichern sollte.
Schon machten Prophezeiungen vom nahen Weltuntergang die Runde. Wahrsager und Zukunftsdeuter erfreuten sich eines nie gekannten Zustroms, während die wenigen Überlebenden aus den Unglücksgebieten Grauenvolles zu berichten wussten.
»Und ich sage euch, dass wir uns mit aller Macht diesen Barbaren entgegenstellen sollten. In diesem Punkt müssen wir uns einig sein. Der Schutz unserer Bevölkerung muss für alle die oberste Priorität haben!« Diese Worte, die so geschliffen klangen, als kämen sie von einem Redner alter Schule, stammten vom Procurator Marcus Metellus. Er hatte seinen Amtssitz ebenfalls in Treveris und kontrollierte die Finanzverwaltung der Belgica und der beiden germanischen Provinzen. Ähnlich wie der Statthalter war er unmittelbar vom Kaiser eingesetzt und unterstand nur dessen Verfügungsgewalt. Dass er sich dieser Stellung sehr bewusst war, konnte man an dem selbstgerechten Ausdruck seines Gesichts ablesen. Aus irgendeinem Grunde hatte er seine Frau nicht dabei, und so lag er allein inmitten der feuchtfröhlichen Runde und führte das große Wort: »Es wäre nicht das erste Mal, dass besondere Vorkommnisse es geboten erscheinen lassen, Maßnahmen zu ergreifen, die von den Gesetzen des Reiches ursprünglich nicht vorgesehen waren. Doch der Bestand des gesamten westlichen Imperiums steht auf dem Spiel, wenn wir es nicht bald schaffen, diese Alemannen und Franken aufzuhalten.«
»Du redest von Populares, einer Bürgerwehr, nehme ich an. Nun, darüber wurde im Stadtrat bereits gesprochen, und eine winzige Mehrheit der Decurionen teilt in diesem Punkt deine Ansicht.« Marcus Lampenius Ambrosius, einer der amtierenden Aedile, hatte das Wort ergriffen. Ich wusste, dass er erst vor Kurzem seine Frau im Kindbett verloren hatte. Das Schicksal verschont offensichtlich niemanden, auch nicht die Würdenträger. Ich wunderte mich ein wenig, dass er trotzdem auf dieser Festivität erschienen war. »Doch geht es nicht nur darum, das uralte Gesetz zu missachten, das die Macht der Legionen ausschließlich in der Gewalt des Kaisers und seiner Vertreter wissen will. Man riskiert auch, Söhne vornehmer Bürger an der Grenze aufzureiben.«
»Nun, da ist etwas dran«, mischte sich ein weiterer Gast in das Gespräch ein. Erst jetzt fiel mein Blick auf den Fremden, den ich bisher noch nicht wahrgenommen hatte. Er lag ein wenig abseits, am anderen Ende des Raumes, und trug eine reich dekorierte Militärtunica aus purpurfarbener Seide, dazu Hosen und Stiefel. Seine schwarzen Haare waren kurz geschnitten, die vorstehende Nase ein wenig gebogen. »Eine Bürgermiliz aufzustellen erscheint mir ebenfalls als eine nicht ungefährliche Angelegenheit. Sehr leicht zieht man sich dadurch einerseits den Hass der einflussreichen Familien zu, die ihre gefallenen Söhne beweinen, andererseits wird die Aufmerksamkeit der Feinde durch eine solche Mobilmachung häufig erst geweckt.«
»Wer ist das?« Ohne den Blick von dem Treiben der Gäste abzuwenden, packte ich Foeda am Handgelenk, eine Mitsklavin, die gerade Krüge mit frischem Wein auf den Tischen der Gäste abgestellt hatte und auf dem Weg zurück in die Küche war.
Erschrocken zuckte sie zusammen, lächelte jedoch, als sie mich erkannte.
»Wen meinst du?«, fragte sie leise zurück und achtete darauf, dass wir vom Triclinium aus nicht gesehen werden konnten.
»Den dahinten, in der Ecke. Den Kerl in dem purpurnen Gewand.«
Foedas Blick folgte meiner Hand.
»Ich weiß nicht genau«, meinte sie schließlich. »Soviel ich weiß, ein Reiterpraefect aus Niedergermanien, der die besten Grüße des Statthalters Postumus überbringen soll.«
Noch mehr ehrenvoller Besuch also, schoss es mir durch den Kopf. Es überraschte mich nicht, dass auch die Vertreter der Nachbarprovinzen ihre Aufwartung machten.
»Vor nicht allzu langer Zeit soll er einen wichtigen Sieg gegen eine Gruppe Alemannen errungen haben, die die Grenze überrannt hatten, um die umliegenden Städte zu plündern. Mehr weiß ich nicht, aber jetzt muss ich gehen.«
Rasch hatte sich Foeda meinem Griff entwunden und eilte Richtung Küche, während mein Blick auf dem Gesandten aus der niedergermanischen Provinz hängen blieb. So sah also jemand aus, der in der Lage war, es mit Alemannen aufzunehmen.
»Doch macht ihr euch ohnehin zu viele Sorgen«, fuhr dieser fort. »Der edle Postumus hat die Lage im Griff. Die verbliebene Stärke seiner Legionen und Hilfstruppen reicht völlig aus, die Sicherheit eurer Provinz zu gewährleisten. Stellt euch einfach unter den Schutz seiner Truppen.«
»Damit er seine Macht weiter ausbauen kann?«, mischte sich nun Duumvir Baetius Quigo ein. »Es ist kein Geheimnis, dass seine Machtansprüche schon lange über das Imperium seiner Provinz hinausgehen. Die Verteidigung der Belgica – ha, das ist doch nur ein willkommener Anlass für ihn, auch noch die Nachbarprovinz in seine Abhängigkeit zu bringen!« Sein Blick ging zum Statthalter, als erwarte er von ihm eine Bestätigung, doch dieser blickte nur nachdenklich in die Runde.
»Ich dulde nicht, dass auf meinem Fest Gäste beleidigt werden, Baetius«, meinte er schließlich, ohne jedoch die Stimme zu erheben. »Also halte dich mit derartigen Unterstellungen besser zurück.«
»Man erlaube mir die Frage«, nahm nun Sempronius, der zweite Duumvir, das Wort auf, »jetzt, da Kaiser Valerian von den Sassaniden gefangen genommen wurde, wer wird in der Lage sein, dieses Machtvakuum zu füllen. Oder«, er räusperte sich kurz, »zumindest so lange, bis sein Sohn Gallienus das Lösegeld an deren König Schapur bereitgestellt hat.«
Kaiser Valerian, gefangen? Gefangener eines persischen Barbarenkönigs? Tausend Gedanken wirbelten durch meinen Kopf. Wann war es in der Geschichte des römischen Weltreiches je vorgekommen, dass ein Feldherr, noch dazu ein Kaiser, von den Gegnern des Imperiums in die Sklaverei verschleppt worden war?
Während ich immer noch ein wenig fassungslos von meinem Versteck aus das Treiben der Gäste beobachtete, breitete sich in mir die Erkenntnis aus, dass mit den Barbareneinfällen im Norden und den Perserkriegen im Süden vielleicht etwas über Rom hereinbrach, das nicht mehr aufzuhalten war und dazu führen konnte, das Leben, wie es mir vertraut war, von Grund auf zu verändern.
»Natürlich wird alles Erdenkliche getan, um den erhabenen Kaiser zu befreien«, versuchte der Praefect abzuwiegeln, »während Gallienus und Postumus gleichzeitig alles tun werden, um die nördlichen Grenzen zu sichern.« Seine Stimme strahlte eine solche Selbstsicherheit und Ruhe aus, dass niemand zu widersprechen wagte. Zumindest schien das Gespräch plötzlich beendet zu sein, sodass man sich anderen Themen zuwandte.
Langsam begann sich auch mein Puls wieder zu beruhigen. Vielleicht war das alles ja nur heiße Luft, nicht mehr als das weinselige Gerede vornehmer Gäste, die sich wichtig machen wollten.
Außerdem hatten wir Sklaven anderes im Sinn, als sich den Kopf mit Dingen zu beschweren, die doch außerhalb des eigenen Einflussbereiches lagen. Denn gleichgültig, wer gerade Kaiser, Statthalter oder auch nur städtischer Beamter war, es änderte nichts an der täglichen Routine. Und die Frage, ob ein Herr sich einem gegenüber gut oder schlecht verhielt, hatte nur in geringem Maße mit dessen politischer Einstellung zu tun.
Mitten in die Runde dieser erlesenen Gäste, deren Stimmung mit fortschreitender Uhrzeit ganz offensichtlich immer gelöster wurde, trat endlich Flavus, ein schweres Silbertablett auf den Händen.
Und er war der eigentliche Grund, weshalb ich hier stand und eine Abreibung riskierte, falls Celsus mich tatsächlich beim Spionieren erwischen sollte. Denn heute Morgen hatte mich der neue Hausverwalter Hermion in sein Büro zitiert und Flavus und mir eine gemeinsame Kammer zugewiesen. Was das zu bedeuten hatte, war unmissverständlich. Bevor der Barbar dann heute Nacht also über mich herfallen würde, wollte ich ihn mir noch mal ungestört ansehen, was mir sicher keiner verdenken kann.
Flavus. Der alemannische Kriegsgefangene, der seit beinahe zwei Monaten als verantwortlicher Sklave für die Fußbodenheizung des Legatus in den weitläufigen Gemäuern des Statthalterpalastes sein Unwesen trieb. Keine Ahnung, wie er im Barbaren-Kauderwelsch wirklich hieß. In all der Zeit, seit er hier im Hause war, hatte er noch nicht die Höflichkeit besessen, mir seinen richtigen Namen mitzuteilen.
Eigentlich war ich vor einiger Zeit schon einmal dazu beordert worden, diesem ungewaschenen Wilden als Bettgenossin zu dienen. Keine ungewöhnliche Praxis, galten Sklaven doch allgemein als unzuverlässig, gerissen und faul, sodass sie nur mit strengster Zucht und gelegentlichen Vergünstigungen bei der Stange gehalten werden konnten.
Doch wo zwei sture Dickköpfe wie Flavus und ich zusammenstoßen, hat selbst die geballte Macht der römischen Herrschaft kein leichtes Spiel. Statt überschüssiges Temperament auszuleben und gleichzeitig für kostenlosen Sklavennachwuchs unseres Herrn zu sorgen, endete schon meine erste Zusammenkunft mit Flavus in einem handfesten Streit, bei dem ich mir geschworen hatte, in Zukunft lieber die Finger von den Männern zu lassen, besonders wenn es sich um einen handelte, der gerade aus den germanischen Wäldern eingeschleppt worden war.
Zugegeben, ganz so schlimm war das Ganze vielleicht nicht. Immerhin hatte Flavus mir sogar das Leben gerettet und dabei selbst erhebliche Blessuren davongetragen. Noch Tage später hatte mich der Anblick seiner Blutergüsse und Schrammen in Schuldgefühle gestürzt, und langsam war in mir der Verdacht gereift, dass Amors Pfeil mich vielleicht doch ein wenig gestreift haben könnte. Zwar ließ das unverschämte Auftreten dieses Kerls immer noch eine Woge der Hitze in mir aufsteigen, doch musste ich mir eingestehen, dass dies nicht mehr nur aus Ärger geschah, sondern möglicherweise noch andere Ursachen hatte. Nach reiflicher Überlegung hatte ich mich schließlich dazu durchgerungen, meinen Stolz herunterzuschlucken und dem Befehl des Vilicus nachzukommen und das Beste draus zu machen.
Doch sobald Flavus sich von seinen Verletzungen und ich mich von meinem Schrecken erholt hatte, war auch unsere Sturheit zurückgekehrt, und keiner von uns hatte je gefragt, ob das beschlossene Arrangement überhaupt noch galt, zumal der damalige Verwalter nicht mehr im Amt war. Und nun hatte der neue Vilicus uns kurzerhand die Entscheidung abgenommen. Heute Nacht würde mir keine Ausrede mehr etwas nützen, und allein dieser Gedanke trieb mir die Hitze ins Gesicht.
Im Halbdunkel des von Öllampen erhellten Raums konnte ich sehen, wie sich unter dem Stoff von Flavus’ Tunica deutlich sein muskulöser Oberkörper abzeichnete. Mein Herz begann zu klopfen, und ich konnte den Blick nicht von ihm wenden.
Langsam näherte er sich den Klinen, auf denen die Speisenden lagen, und seine Augen glitten über die Gesichter der Gäste. Plötzlich zuckte er kurz zusammen. Für einen winzigen Augenblick blieb er stehen und hielt in seiner Bewegung inne, als hätte er etwas gesehen, das ihm nicht gefiel.
Dann gab er sich einen Ruck und trat auf die Honoratioren zu.
Langsam setzte die Musik der Flöten- und Harfenspieler ein. Das Licht der Fackeln und Öllampen flackerte, und der Geruch des Weihrauchs versetze mich in einen leicht rauschähnlichen Zustand.
Von meinem Platz aus beobachtete ich Flavus, der nur wenige Schritte hinter dem Statthalter stand und immer noch das silberne Tablett mit den kunstvoll angerichteten Enten hielt. Seine hellen Augen wirkten abweisend, die Gesichtszüge verschlossen.
»Ich bin erobert, aber nicht besiegt«, hatte er einmal zu mir gesagt, und so wie er da stand, bezweifelte ich seine Worte nicht. Weiterhin blickte ich wie gebannt auf die Gestalt des Mannes, der in dieser Nacht zum ersten Mal das Lager mit mir teilen würde.
»Invita, du dummes Kind, was tust du denn hier!«
Erschrocken fuhr ich herum und glaubte schon Celsus’ Rute zwischen den Rippen zu spüren. Doch statt in die geröteten Schweinsaugen des Aufsehers blickte ich in das füllige Gesicht von Bricia, der Vilica.
»Hat dir Celsus nicht verboten hierherzukommen? Was ist, wenn er dich hier erwischt?« Sie wirkte eher besorgt als verärgert. »Los, verschwinde, leg dich schlafen, oder hol dir in der Küche was zu essen! Ich habe keine Lust, dich noch einmal gesund pflegen zu müssen, nur weil du Celsus wieder Gelegenheit gibst, dich zu bestrafen.«
Was das anging, war ich mit Bricia genau einer Meinung. Seit ich vor einigen Monaten als Geschenk eines Ratsherrn aus Divodurum in dieses Haus gekommen war, hatte sie mich unter ihre voluminösen Fittiche genommen, und wenn immer Celsus sich dazu genötigt gesehen hatte, mich in Ketten zu legen oder zu züchtigen, war sie es gewesen, die sich um mich gekümmert hatte, auch wenn diese Pflege meist mit einer stinkigen Salbe verbunden war, die jeden gesunden Menschen auf zehn Schritte Entfernung in die Flucht geschlagen hätte.
Allein die Erinnerung daran ließ mich schaudern. Bricia war eine kluge Frau, und wo sie recht hatte, hatte sie recht. Es war besser, hier zu verschwinden.
Die Luft roch ohnehin nach Ärger, auch wenn ich nicht sagen konnte, aus welcher Richtung dieser kommen würde.
Ich unterdrückte ein Gähnen, als ich in die Küche ging.
War im großen Triclinium die Luft zum Schneiden, so war es hier unten geradezu atemberaubend stickig. Viele der Gäste hatten ihre Sklaven mitgebracht, damit diese sie nach der Feier durch die dunklen Straßen nach Hause geleiteten.
Missmutig bahnte ich meinen Weg durch die mit Menschen vollgestopfte Küche. Schlimm genug, dass man hier im Hause schon wegen der eigenen Leute, wie der zahlreichen Sklaven, Freigelassenen und Soldaten im Dienste des Legatus, nie seine Ruhe hatte. Nun musste auch noch der Anhang all dieser fremden Gäste die Gesindestube zum Überlaufen bringen. Dazu legten, je nach gesellschaftlicher Stellung des Besitzers, manche von ihnen auch noch ein derart herablassendes Benehmen an den Tag, dass nur die eigene Position als Diener des Statthalters einen davon abhielt, ihnen ins gepuderte Gesicht zu boxen. Von den aufdringlichen Gerüchen angeblich teurer Duftöle gar nicht zu reden.
Mich in mein Schicksal ergebend, sah ich mich nach einem Platz um. Schließlich fand ich einen in der Ecke, quetschte mich durch die Menschenmenge und ließ mich hungrig und entnervt darauffallen.
Das war ja ein Affentheater!
Ich griff nach einem Weinbrötchen und kaute darauf herum.
»Du siehst verärgert aus.« Eine Stimme riss mich aus meinem heiligen Groll.
Unwillig sah ich auf. »Was du nicht sagst!«
»Ist dir das Essen nicht bekommen, oder hast du Probleme, weil du dem Statthalter Wein über die saubere Tunica gegossen hast?«
Die vorlauten Worte kamen von einem jungen Kerl, kaum älter als ich, mit kurzen rabenschwarzen Locken, ebenso dunklen Augen und einem markanten Gesicht mit scharf hervorstehenden Wangenknochen. »Vielleicht solltest du einfach einen Schluck trinken, dann geht es dir gleich besser.«
Bevor ich etwas erwidern konnte, platzierte er einen Becher vor mich hin und quetschte sich neben mich. Es war unmöglich, auch nur einen Fingerbreit zurückzuweichen.
Mit größter Willensanstrengung rang ich mir ein Lächeln ab. Wie schon gesagt, unsere gehobene Stellung als Sklaven des Statthalters …
»Hast du heute Abend keinen Dienst?« Auffordernd blickte er auf den Becher.
Mit unwillig heraufgezogenen Augenbrauen ergriff ich ihn und nahm einen Schluck. Der Wein war kaum verdünnt und stieg mir geradewegs in den Kopf.
Betont gleichgültig zuckte ich mit den Achseln.
»Du kommst doch aus diesem Hause, oder?«
Mit den Fingerspitzen tippte ich auf meine taubenblaue, von marinefarbener Borte umrandete Tunica: »Sieht fast so aus!«
So schnell ließ er sich aber nicht entmutigen: »Ich habe meinen Herrn schon öfter hierher begleitet. Seltsam, dass wir uns noch nie begegnet sind.« Er lächelte. »Ist die Arbeit gut hier?«
Ich nahm noch ein Brötchen und tauchte es kurz in den Wein. »Wahrscheinlich wie überall sonst auch.« Mir war wirklich nicht nach einem Gespräch zumute.
»Übrigens, ich heiße Hyacinthus.«
Nur mit Mühe unterdrückte ich ein spöttisches Lächeln. Doch wer wie ich Invita, die Unwillige, hieß, sollte sich nicht allzu sehr aus dem Fenster lehnen.
»Und wie heißt du?«
Ein Gefühl sagte mir, dass ich nun besser das Feld räumen sollte, doch ich war hungrig und müde und verspürte überhaupt keine Lust dazu, im Flur Celsus über den Weg zu laufen. Also nannte ich ihm meinen Namen.
Das Leben war doch ein Trauerspiel. Dies war also meine erste Nacht in offiziellem Contubernium, meine Hochzeitsnacht sozusagen. Und der Mann, der dazugehörte, servierte Fleischplatten, während ich in einer überfüllten Küche saß und nicht einmal genug Energie aufbrachte, mich den Annäherungsversuchen des Pedisequus, des Begleitsklaven von irgendwem, zu erwehren.
Frustriert nahm ich noch einen Schluck Wein.
Dieser elende Tag schien kein Ende nehmen zu wollen, und ein seltsames Prickeln in meinem Magen sagte mir, dass die darauf folgende Nacht auch nicht gerade eine Zeit reiner Freuden und Wonnen sein würde.
»Ertrage und halte aus!«, murmelte ich bitter.
»Ertränkst du deinen Ärger mit Ovid?« Dumm war der Knabe nicht, denn offensichtlich wusste er, wovon ich sprach. »Es sieht fast so aus, als hättest du Kummer.«
Unwillig blickte ich zu ihm auf.
»Mag sein. Doch selbst wenn dem so wäre, behielte ich diesen lieber für mich!«
Dumpf schaute ich auf meinen Becher, Hyacinthus blickte auf mich, und ein ungutes Gefühl sagte mir, dass der Rest des Raumes auf uns beide starrte.
Völlig entnervt gab ich meinen Widerstand auf.
»Und, woher kommst du?«, fragte ich, um seinen Blick nicht noch länger ertragen zu müssen.
Er lächelte. »Aus dem Hause des Baetius Quigo!«
Also war Hyacinthus der persönliche Sklave eines der beiden amtierenden Bürgermeister.
»Und dein Herr, der Duumvir, vertreibt sich die Zeit mit Ovid, oder weshalb kennst du dich da so blendend aus?« Da ich ohnehin nichts Besseres zu tun hatte, als hier herumzusitzen und zu warten, konnte ich mich genauso gut unterhalten.
»Hin und wieder!« Ein zufriedenes Aufblitzen ging über sein Gesicht. »Wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, Wahlkampf zu betreiben oder seine Anhänger zu bestechen.«
Das war gewagt. Erschrocken zuckte ich zusammen und wäre froh gewesen, einen anderen Platz gefunden zu haben, da ich keine Lust auf Ärger hatte. »Ich glaube, du solltest nicht so viel ausplaudern. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch zu Hause gehandhabt wird, doch kann ich mir nicht vorstellen, dass es der edle Baetius allzu sehr schätzt, wenn sein Pedisequus für ihn die Verhandlungen im Statthalterpalast führt!«
Wieder lächelte er, was ihn für einen Moment überraschend sympathisch erscheinen ließ. »Sei unbesorgt, mein Herr weiß genau, was er an mir hat. Da sieht er gewisse Dinge nicht so eng.«
Gegen meinen Willen musste ich das Lächeln erwidern. »Ich hoffe, du irrst dich da nicht«, meinte ich zweifelnd, »bisweilen reagieren die da oben ganz unberechenbar, wenn ihr guter Name in Gefahr ist.«
»Ach?« Wohlwollender Spott glitt über Hyacinthus’ Gesicht. »Du scheinst aus Erfahrung zu sprechen, oder täusche ich mich da?«
Verschämt grinste ich in meinen Becher. Eins musste ich zugeben, der Junge hatte ein feines Gespür.
»Doch ich muss jetzt gehen!« Langsam stand er auf. »Mein Herr schätzt Gastmähler nicht besonders. Er wird gleich nach mir schicken, damit ich ihn nach Hause geleite.« Einen Moment ergriff er meine Hand und blickte mich an. »Es war schön, dich kennen gelernt zu haben.« Kurz zog er die Hand an seinen Körper, sodass meine Fingerspitzen ihn berührten. »Wer weiß, vielleicht sieht man sich ja wieder.«
»Vielleicht …« Einen Augenblick war ich zu verwirrt, um ihm zu antworten.
Er lachte. »Wenn es das Schicksal so will. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht.«
Wortlos blieb ich stehen und sah ihm nach, wie er den Raum verließ. An die vor mir liegende Nacht hätte er mich besser nicht erinnert.
KAPITEL II
»So viele Muscheln am Strand, so viel Schmerz bietet die Liebe! «, sagte schon Ovid, und der alte Knabe wusste wahrscheinlich selbst nicht, wie recht er damit hatte.
Das war also meine Hochzeitsnacht oder zumindest das, was für einen – im juristischen Sinne gesprochen – belebten Gegenstand wie mich dieser Sache am nächsten kam.
Obgleich oder gerade weil ich die großen Dichter kannte, ihre frivolen Verse auf Liebe, Lust und Leidenschaft, hatte ich wirklich keine allzu großen Erwartungen an die Freuden, die der Gott Amor für die Sterblichen bereithielt, auch wenn ich mich keineswegs zu den Pythagoräern zählte, mit ihrem geradezu krankhaften Abscheu vor körperlichen Freuden.
Allerdings hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich diese erste Nacht alleine verbringen würde, da der Mann, mit dem ich mein Nachtlager teilen sollte, gerade dazu benötigt wurde, protzig angehäufte Platten mit Speisen herumzureichen und sich von weinseligen Gästen begaffen zu lassen.
Doch wusste ich nicht, ob ich über seine Abwesenheit wirklich traurig sein sollte. Mit einem unguten Gefühl erinnerte ich mich an unser letztes Stelldichein und wie handgreiflich es geendet hatte. Aber diesmal waren die Voraussetzungen ganz anders. Diesmal würde es besser gehen.
Nachdenklich schälte ich mich aus dem taubenblauen Gewand und schlüpfte, nur mit der Untertunica bekleidet, unter die Decke. Ein seltsames Gefühl überkam mich. In meinem ganzen Leben hatte ich die Nächte meistens in Gesellschaft anderer verbracht, umgeben von schwatzendem, lärmendem oder schnarchendem Hauspersonal – von den Zeiten im Ergastulum, dem hauseigenen Kerker, einmal abgesehen.
Zum ersten Mal war ich allein, und allerlei Gedanken stürzten auf mich ein, derer ich mich in der Einsamkeit des kleinen, schäbigen Zimmers nicht erwehren konnte.
Der Raum war so winzig, dass man darin Platzangst bekommen konnte. Neben dem einfachen Bett mit geflochtener Matratze befanden sich darin nur zwei wackelige Regale, in denen irgendwelche Werkzeuge gestapelt waren, sodass ich nicht nur Angst haben musste, des Nachts von einem wilden Barbaren, sondern womöglich noch vom rostigen Inventar des Statthalters erschlagen zu werden.
Der Duft des Frühlings drang durch das geöffnete Fenster, und gedämpft konnte ich den Lärm des Gastmahls vernehmen. Es war ungewöhnlich warm für diese Jahreszeit, dennoch zog ich fast schützend die Decke über mich.
Zwar wusste ich nicht, wann Flavus seine Arbeit beenden oder was die Nacht noch bringen würde, aber jemand in meiner Position hatte gelernt, dass er derartige Dinge ohnehin nicht beeinflussen konnte und besser daran tat, nicht allzu viel darüber nachzudenken.
Ob es die Erschöpfung war oder eine Schutzreaktion meiner Seele, kann ich nicht sagen. Trotz meiner Unruhe und des Lärms schlief ich irgendwann ein.
Etwas hatte mich geweckt!
Einen Moment lang war ich so benommen, dass ich nicht einmal wusste, wo ich mich befand. Schlaftrunken tastete ich mit der Hand neben mich, doch da war nichts außer der leeren Hälfte des Bettes und einer Spur von Wärme, als hätte dort bis vor Kurzem noch jemand gelegen.
Von draußen wurden Schritte laut, aufgeregte Stimmen und hektisches Getrappel. Irritiert richtete ich mich auf.
Dann wurde hart an die Tür geschlagen.
»Steht auf! Macht euch raus! Der Vilicus will euch sehen!« Mein benommener Blick ging zu dem winzigen Fenster.
Es war mitten in der Nacht, und nicht einmal ein Schimmer von Morgenröte war zu sehen.
Was war geschehen?
Die Tür wurde aufgerissen, und ein flackernder Lichtschein fiel herein.
»Los, raus, habe ich gesagt!«, brüllte eine Stimme: »Bist du schwerhörig?«
Eilig sprang ich auf und zog mir meine Tunica über. Mit bloßen Füßen tastete ich nach den Sandalen und fuhr mit den Fingern durch meine verhakten Locken.
Dann hastete ich nach draußen, mit hämmerndem Herzen und der Frage, was so Schreckliches geschehen sein konnte, dass alle mitten in der Nacht geweckt werden mussten.
Der Flur lag, nur schwach von hängenden Öllampen beleuchtet, im Halbdunkeln. In jedem Winkel drängten sich die Haussklaven, und das Ganze wirkte auf mich wie ein Szenario aus der Unterwelt.
»Alle mal herhören!«, bellte Celsus, und seiner Stimme war anzumerken, dass sogar er ernsthaft erregt war. »Wir haben Nachricht erhalten aus dem Hause des edlen Duumvir Gaius Baetius Quigo, der am Abend Gast im Hause des Statthalters war…«
Die Müdigkeit steckte mir noch in den Knochen, und mit den Augen suchte ich die Reihe der Sklaven nach Flavus ab.
»Gerade hat uns ein Bote diese empörende Mitteilung überbracht.«
Nur mühsam hielt ich mich auf den Beinen und wäre beinahe im Stehen wieder eingeschlafen. Warum kam dieser Trottel nicht endlich zur Sache?
»soeben haben wir also Nachricht erhalten… dass der edle Baetius… auf dem Heimweg ermordet worden ist!«
Was?
Einen Moment lang glaubte ich, mich verhört zu haben.
Was sagte er da?
»Es geschah auf offener Straße, nicht weit vom statthalterlichen Palast. Eine Übermacht, nehme ich an. Der edle Baetius muss schrecklich zugerichtet sein.«
Ich musste immer noch träumen. Das hier konnte einfach nur ein Albtraum sein. Wahrscheinlich lag ich in dem harten Bett, und die ungewohnte Umgebung rief aberwitzige Fantasien in meinem Geist hervor. Doch sah ich davon ab, mir in den Arm zu kneifen, um diese These zu überprüfen.
»Natürlich wird sich der Statthalter der Sache annehmen. Der Mord ist gleich nach seinem Gastmahl geschehen!«, polterte Celsus weiter. »Also, wenn einer von euch etwas gehört oder gesehen hat, sagt er es mir am besten jetzt gleich.«
Der schwache Schein der Öllampen tauchte den Flur in ein flackerndes Zwielicht. Mehr denn je glaubte ich mich in der Unterwelt gefangen, auch wenn meine Sinne langsam vom Schlaf in das Hier und Jetzt zurückfanden.
Dann entdeckte ich Flavus. Einige Schritte von mir entfernt, stand er fast unmittelbar hinter Celsus. Halb im Schatten, wirkte sein Gesicht wie das einer Statue, unbewegt und undurchschaubar.
Er sah mich nicht an. Mit seiner üblichen unbeteiligten Miene blickte er ins Leere, als würde ihn all das, was um ihn herum geschah, gar nichts angehen.
Ein Schauder, den ich mir nicht erklären konnte, überfiel mich. Wo war Flavus gewesen? Hatte er noch gearbeitet, als das Verbrechen geschah? War er denn irgendwann im Laufe der Nacht überhaupt einmal bei mir gewesen?
Ich wusste es nicht und konnte mich an nichts erinnern.
Plötzlich bemerkte ich etwas und erstarrte: ein dunkler Fleck auf dem Stoff seiner Tunica, oberhalb seiner linken Brust. Vielleicht spielte das flackernde Licht der Öllampen meinen Augen ja einen Streich, doch von meiner Position aus wirkte es wie Blut.
»Gleich morgen wird der Statthalter mit den Vernehmungen beginnen. Zuerst werden alle diejenigen verhört, die damit beauftragt waren, Gäste nach Hause zu geleiten, dann die Sklaven, die das Essen serviert haben, und so weiter. Habt ihr verstanden?«
Nur entfernt nahm ich Celsus’ Worte wahr. In der dünnen Tunica fröstelnd, war ich in Gedanken noch immer bei Flavus. Dieser schien mich endlich zu bemerken. Sein Blick traf mich, und ein Lächeln erschien auf dem Gesicht, das den Anschein erweckte, nichts von dem, was Celsus gerade berichtete, hätte auch nur die geringste Bedeutung für ihn.
Unsicher wich ich seinem Blick aus. Wo hatte er die ganze Zeit über gesteckt? Eine Gänsehaut überlief mich, als ich für einen kurzen Moment den Ausdruck von Genugtuung über seine Züge gleiten sah.
So viel zu meiner Hochzeitsnacht! Zwar hatte ich von Beginn an geahnt, dass diese in einer Katastrophe enden würde, doch musste das Schicksal beträchtliche Einwände gegen diese unstandesgemäße Verbindung haben, wenn es zu einem derart tragischen Zwischenfall kommen musste. Die Schrift verschwamm vor meinen Augen, während ich an einem Schreibpult im Büro des Statthalters stand und einen Brief kopierte. Die einzige Aufgabe, derer man mich wohl für fähig erachtete, seit ich dort als zukünftige Schreiberin für die Tochter des Hauses angelernt werden sollte.
Während ich mich darum bemühte, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, schossen mir die verworrensten Gedanken durch den Kopf. Jemand hatte den edlen Baetius Quigo ermordet, auf dem Heimweg vom Gastmahl. Und noch kurz zuvor hatte ich mit Hyacinthus gesprochen, dessen Aufgabe es war, seinen Herrn sicher nach Hause zu geleiten.
Unwillkürlich kam mir sein feingliedriges Gesicht, sein selbstbewusstes, etwas herausforderndes Auftreten ins Gedächtnis, und ungewollt versetzte es mir einen kleinen Stich, als ich mich fragte, ob er bei diesem Überfall auch ums Leben gekommen war.
Die Tatsache, dass Celsus nichts über Hyacinthus’ Verbleib hatte verlauten lassen, hatte nichts zu bedeuten. Wenn ein so hoher Beamter wie Baetius umgebracht wurde, fragte niemand nach dem Wohlergehen seines Sklaven.
Wieder versuchte ich, mich auf den vor mir liegenden Brief zu konzentrieren und auf der rauen Oberfläche des Papyrus klare, deutlich lesbare Buchstaben zu zeichnen. Im Schreiben war ich etwas ungeübt, so viel musste ich mir eingestehen. Zwar konnte ich schnell und zügig lesen und beherrschte neben dem treverischen und mediomatrischen Keltisch auch fließend das Lateinische und ein wenig das Griechische, dazu noch vereinzelte Brocken verschiedener germanischer Dialekte. Doch hatte meine Arbeit als Küchensklavin mir nur wenig Gelegenheit gegeben, etwas zu Papier zu bringen. Mein bescheidenes Maß an Bildung verdankte ich ohnehin nur der Tatsache, dass ich als Kind den endlosen Unterrichtsstunden des Sohnes meines ersten Herrn beiwohnen musste, da es meine Aufgabe war, dem Erzieher des Hauses zur Hand zu gehen.
Immer wieder schweiften meine Gedanken ab. Der Statthalter hatte sein Versprechen wahr gemacht. Schon seit Stunden zogen sich die Befragungen der Haussklaven hin, insbesondere derer, die damit beauftragt gewesen waren, die Besucher nach Hause zu geleiten. Seit Celsus’ Botschaft, irgendwann in der Nacht, hatte sich niemand im Haus mehr schlafen gelegt, und die Sekretäre im Büro, die natürlich weder mit Gastmählern noch mit nächtlichen Spaziergängen betraut gewesen waren, bemühten sich, den größtmöglichen Eindruck von Normalität zu erwecken und die Korrespondenz des Statthalters so gewissenhaft weiterzuführen, als sei nichts geschehen.
Im Stillen dankte ich dem Unbekannten Gott für Celsus’ Befehl, mich von dem Gastmahl fernzuhalten, und dafür, dass ich mich weitgehend daran gehalten hatte. So konnte ich zumindest diesmal nicht in die Unannehmlichkeiten mit hineingezogen werden, wie es sonst meist der Fall war. Jeder wusste das, und diese Tatsache stimmte mich etwas friedlicher.
»Pelagius!«
Eine Stimme riss mich aus meinen Gedanken. Vorsichtig legte ich den Federhalter beiseite und wandte mich um. In der Tür stand Hermion, der Hausverwalter, und seinem Aussehen nach zu urteilen hatte er in dieser Nacht ebenfalls nicht geschlafen. Wahrscheinlich war er damit beauftragt, die Befragung der Haussklaven zu leiten, eine verantwortungsvolle Aufgabe für jemanden wie ihn, der neu in der Stellung als Verwalter war.
»Der Dominus möchte Julia, der Witwe des Baetius, einen Besuch abstatten. Dazu benötigt er zwei Schreiber, um die Gespräche zu dokumentieren. Wenn du dich also darum kümmern würdest, Pelagius?«
Der Angesprochene, ein schon grau gewordener Freigelassener im Alter von etwa fünfzig Jahren, nickte. Er war der Vorsteher des statthalterlichen Sekretariats und für den gesamten Schriftverkehr verantwortlich.
Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen kam es ihm ziemlich ungelegen, gleich auf zwei seiner Schreibkräfte verzichten zu müssen. Durch die sich häufenden Barbareneinfälle und die daraus resultierenden politischen Unruhen stand mehr Korrespondenz an als üblich; immerhin war der Statthalter für die gesamte Provinz Gallia Belgica zuständig, mit all ihren Gemeinden und Städten. Wenn er nicht gerade reiste, sorgte sein umfassender Austausch von Berichten und Eilmeldungen dafür, dass er stets über die Geschehnisse auf dem Laufenden war und durch seine Order Recht und Gesetz in der Provinz aufrechterhielt. Gerade jetzt konnte Pelagius niemanden in seinem Büro entbehren, wagte aber natürlich nicht, sich einem direkten Befehl des Legatus zu widersetzen.
»Nun gut«, meinte er schließlich. »Dann schicke ich Marcipor und Sedulus.«
»Sedulus ist seit gestern Abend krank.«
Nur am Rande nahm ich wahr, wie Pelagius die Augenbrauen hochzog. »Deshalb ist er also heute Morgen nicht zur Arbeit erschienen. Und ich hatte geglaubt, er sei bei den Verhören.« Etwas ratlos zuckte er mit den Schultern.
»Hat er gestern vielleicht zuviel getrunken?«
»Woher soll ich das wissen?« Unwillig wandte sich Hermion um. »Und wie sieht es mit der da aus?« Mit den Fingern wies er auf mich. »Ist die für deine Arbeit auch unentbehrlich?«
Hermions Miene war anzumerken, dass er keineswegs gedachte, all die meine Vergehen, die er aus den Akten kannte, allzu schnell zu vergessen.
Ich bemühte mich um ein möglichst unbeteiligtes Gesicht, als Pelagius mich ansah.
»Durchaus nicht«, meinte er. »Sie ist ohnehin nur hier, um mit den Grundlagen eines Schreibers vertraut gemacht zu werden. Eigentlich gehört sie der Domina.«
Einen Moment lang entstand ein angespanntes Schweigen. Beide Männer schienen das Für und Wider abzuwägen.
»Der Statthalter kann nicht länger warten. Er möchte sofort aufbrechen. Also, wie sieht’s aus?«
Vor ungläubiger Aufregung schlug mein Herz bis zum Hals. Stumm wagte ich nicht zu hoffen.
»Dann nimm sie mit. Hier steht sie mir doch nur im Weg rum. Aber ob der Statthalter …? Mit einem Mädchen?«
»Ich habe keine Zeit zu verschwenden. Schick mir noch diesen Marcipor vorbei, und versorge vorher beide mit ausreichend Schreibzeug, es wird ein langes Gespräch.«
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, wandte sich Hermion ab und verließ das Büro.
Einen Augenblick lang verdrängte die freudige Überraschung den Schrecken der letzten Nacht. Ich sollte tatsächlich den Statthalter als Schreiberin zu einer Befragung begleiten? Ausgerechnet ich? Mit meiner Vorgeschichte und dazu noch als Frau?
Langsam und vorsichtiger als notwendig packte ich meine Schreibgeräte zusammen. Das war zu viel Glück auf einmal. Meine Erfahrung hatte mir gezeigt, dass es meistens nichts Gutes zu bedeuten hatte, wenn sich das Fatum auf einen Schlag allzu wohlwollend verhielt.
Ich sollte mich nicht täuschen.
Das vornehme Haus des Baetius befand sich in einem teuren Viertel von Treveris, nicht weit von der Porta Martis, dem nördlichen Stadttor, entfernt.
Eine weißgetünchte, beinahe schlicht zu nennende Außenfront, die auf jeglichen Schmuck verzichtete, ließ von der Straße her nur durch die Größe etwas vom Reichtum des Besitzers erahnen. Diese Familie besaß altes Geld. Das war auf den ersten Blick ersichtlich. Der Ausstattung und dem Baustil nach zu urteilen musste es schon vor einigen Generationen gebaut worden sein, als die Stadt sich gerade zur wirtschaftlichen Blüte aufschwang.
Der Empfangsraum war ebenso altmodisch und gediegen wie das Äußere. Ein Mosaikfußboden, auf dem sich zwischen einfachen Flechtbändern Felder unterschiedlicher Art um ein Mosaik mit einer Darstellung des Bacchus gruppierten, der auf einem von Tigern gezogenen Wagen fuhr. In den vier Ovalen der Ecken erkannte ich Frauengestalten, vermutlich eine Allegorie der Jahreszeiten, dazwischen weitere Tierwagen. Die Wandgliederung zeigte über der Sockelzone Malereien herkömmlicher Art, die ein friedliches Hirtenleben zur Schau stellten, wie es dies allenfalls in den Eklogen Vergils gegeben haben mag. Selbst die Kassettendecke war, in schlichtem Weiß gehalten, mit Himmelblau unterlegt.
Ich merkte, dass ich verlegen nach oben starrte, und senkte erschrocken den Blick. Mit feuchten Händen hielt ich Wachstafel und Griffel an mich gepresst und schaute unsicher in die Runde.
Meine Anwesenheit schien den Statthalter etwas zu irritieren. Einzig und allein die Tatsache, dass er den Besuch bei Baetius’ Witwe möglichst schnell hinter sich bringen wollte, hatte ihn davon abgehalten, mich ins Büro zurückzuschicken und jemand anderen anzufordern. Doch würde der gute Pelagius sicher noch etwas zu hören bekommen, was ihm denn eingefallen wäre, ausgerechnet mich zu schicken.
»Die Herrin Julia erwartet dich!« Ehrerbietig verneigte sich der Empfangssklave, um dann dem Statthalter die Tür zu öffnen und ihn in das geräumige Triclinium zu führen.
Bevor jemand die Gelegenheit hatte, mich anzuweisen, ich möge draußen warten, folgte ich Marcipor und dem Statthalter.
Trotz all seiner Pracht, der verschwenderischen Wandbemalungen, der aufwändigen Mosaiken, die mehr gekostet hatten als zwanzig gute Haussklaven, und der hohen lichtdurchfluteten Räume machte das Haus auf mich den Eindruck eines Grabes. Weihrauchduft hing schwer in der Luft, an den Wänden waren nach römischer Sitte Kränze aus Zypressen und Tannen angebracht, um den Toten zu ehren, und die Sklaven huschten stumm und mit gesenktem Kopf durch die Räume. Eine merkwürdige Beklemmung, die ich mir nicht erklären konnte, überfiel mich.
Die Witwe des Baetius war nicht anders als edel zu nennen. Vielleicht vierzig Jahre alt, mit aschfarbenen, von einzelnen silbernen Strähnen durchzogenen Haaren, die sie als Zeichen der Trauer offen trug. Die nachtblaue Seide, aus der sowohl ihre Tunica als auch die Stola angefertigt war, verlieh ihr eine stille Eleganz, gleichzeitig jedoch eine solch unnahbare Kühle, dass der Raum um einiges kälter zu werden schien, wenn man sich ihr näherte.
Während der Statthalter Julia entgegentrat und ihr leise gesprochene Beileidsbekundungen überbrachte, blieb ich mit Marcipor nahe der Tür zurück und beobachtete verstohlen die ganze Szenerie.
Zwischen den Augenlidern hindurch sah ich, wie Julia den Statthalter bat, Platz zu nehmen. Sofort eilte ein vielleicht vierzehnjähriger Sklavenjunge herbei, stellte einen weiteren Silberbecher auf den kleinen, dreifüßigen Tisch und schenkte Wein ein.
»Gibt es irgendetwas, was ich für dich tun kann?« Ohne den Blick von Julia zu nehmen, griff der Legatus nach seinem Becher.
»Sorge dafür, dass der Mörder meines Gatten bestraft wird!«
»Dazu brauche ich deine Hilfe.« Noch immer war die Stimme des Statthalters ruhig und höflich.
»Wie soll diese aussehen?«
»Nun …« Mit einer Handbewegung winkte der Statthalter Marcipor herbei, damit dieser alles protokollierte. Offensichtlich hatte die Befragung begonnen, und es bestand keinerlei Zweifel daran, dass ich bei der ganzen Angelegenheit nicht wirklich benötigt wurde. »Hatte dein Gatte irgendwelche Feinde?«
Durch ein Kopfnicken wies der Legatus Marcipor an, das Gespräch auf seinen Wachstafeln festzuhalten.
»Privat oder politisch?«, gab sie zurück.
»Macht das einen Unterschied?«
Mit emporgezogenen Augenbrauen griff Julia nach ihrem Becher und lehnte sich zurück. »Feinde? Das kann ich mir nicht vorstellen.« Einen Moment zog sie nachdenklich ihre Stirn in Falten. »Mein Mann war sehr … verträglich, muss man wissen. Immer auf Gerechtigkeit und Ausgleich bedacht. Niemand, der durch allzu großen Ehrgeiz auf Ablehnung gestoßen wäre.«
Selbst in meiner Ecke an der Tür war der leichte Anflug von Kritik, der in der Antwort mitschwang, nicht zu überhören.
Ich zwang mich dazu, weiter unbewegt auf meine Sandalenspitzen zu sehen.
»Das glaube ich dir gerne.« Der Statthalter nickte bedächtig. »Doch haben uns die jüngsten Ereignisse gezeigt, dass es zumindest einen geben muss, den sich Baetius Quigo zum Feind gemacht hat.«
Einen Moment lang verfinsterte sich der Ausdruck auf Julias makellosem, wenn auch nicht mehr in der Blüte ihrer Jugend stehenden Gesicht. »Wer sollte das sein?«
»Um das herauszufinden, bin ich hier.«
Als Julia ihn weiterhin stumm betrachtete, fuhr er fort:
»Es ist ein Skandal, dass einer meiner Gäste ermordet worden ist. Sei versichert, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um den Täter ausfindig zu machen und ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen.«
»Vielleicht musst du da nicht allzu weit suchen.«
Ich bemerkte, wie der Statthalter erstaunt aufblickte.
»Natürlich kann ich nicht nachweisen, wer für den Mord an meinem Gatten verantwortlich ist, doch gibt es zumindest einen, der das Verbrechen hätte verhindern können, wenn er es aufrichtig gewollt hätte.«
Das Schweigen hing im Raum, wie eine unausgesprochene Frage.
Schließlich ließ sich Julia dazu herab, unsere offensichtliche Unwissenheit zu erhellen: »Ich rede von Hyacinthus, seinem Leibsklaven.«
Unwillkürlich zuckte ich bei der Erwähnung dieses Namens zusammen. Wieder kam mir sein Gesicht ins Gedächtnis, seine dunklen, spöttischen Augen.
Ungerührt fuhr Julia fort: »Natürlich streitet er es ab, sagt, er sei überwältigt worden, doch …«
Mit einem lauten Krachen flog die Tür auf, die an der anderen Seite des Raumes nach draußen führte. Gerade noch sah ich, wie der Sklavenjunge hastig einen Schritt zurückwich, dann trat ein vielleicht neunzehnjähriger Mann ein, dessen rotgeränderte Toga ihn als Sohn eines Adeligen auswies.
»Kann ich dir helfen, Mutter?« Ohne auf einen der Anwesenden zu achten, durchschritt er den geräumigen Saal und trat hinter Julia, der er selbstsicher die Hand auf die Schulter legte.
»Wie du siehst, haben wir Besuch.« Kurz berührte die Angesprochene die Hand mit den Fingerspitzen. »Der Statthalter erweist uns die Ehre. Er ist hergekommen, um uns seine Hilfe anzubieten.«
Wenn der junge Mann, der allem Anschein nach ein Sohn des Verstorbenen war, über dessen Tod große Trauer oder Bestürzung empfand, so ließ er sich dies zumindest nicht anmerken.
Selbstbewusst nahm er auf der Kline neben seiner Mutter Platz und wies den Sklaven an, ihm ebenfalls Wein einzuschenken.
»Statthalter …« Kurz nickte er dem Legatus zu. »Wie kann ich dir zu Diensten sein?«
»Mein Beileid zu diesem entsetzlichen Vorfall, Publius.« Ohne sich von dem Auftreten beeindrucken zu lassen, nahm der Statthalter das Wort wieder auf. »Ich werde alles mir Mögliche tun, um den Schuldigen zu bestrafen. Ist dir bekannt, ob dein Vater irgendwelche Feinde hatte?«
Reflexartig warf Publius seiner Mutter einen flüchtigen Blick zu. »Nein«, sagte er nach einer Weile. »Weshalb?«
»Das könnte den Kreis der Verdächtigen eingrenzen und uns helfen, Licht in die Sache zu bringen.«
»Es würde schon genügen, wenn dieser Nichtsnutz von Hyacinthus endlich den Mund aufmachen würde.«
Mit ernstem Gesichtsausdruck griff der Statthalter nach seinem Becher. »Du glaubst also auch, dass er mit dem Verbrechen zu tun haben könnte?«
Ein abfälliger Ausdruck erschien auf Publius’ Gesicht. »Wer denn sonst? Er war als Einziger den ganzen Abend bei meinem Vater, kannte seine Gewohnheiten, wusste, welchen Weg er nahm …«
»Welchen Grund sollte er für diesen Mord gehabt haben?«, unterbrach ihn der Statthalter.
Verächtlich zuckte Publius mit den Schultern. »Wie kann ich denn wissen, was sich im Kopf eines Sklaven abspielt? Habgier vermutlich … oder vielleicht Rachsucht.«
»Hatte Hyacinthus denn einen Anlass, sich an deinem Vater zu rächen?«
Wieder glitt Publius’ Blick zu seiner Mutter, und seine Pupillen flackerten unruhig. »Glauben diese Sklaven nicht immer, einen Grund zu haben, unzufrieden zu sein?«
»Zeigte Hyacinthus sich denn unzufrieden?«
»Sagen wir einmal, er glaubte sich in eine Stellung drängen zu können, die ihm nicht zustand«, nahm nun Julia das Wort wieder auf. »Ich denke, mein Mann war etwas zu nachsichtig mit ihm. Dann vergessen manche leicht, wohin sie eigentlich gehören.«
»Wenn ich etwas zu sagen gehabt hätte«, Publius’ blasses Gesicht hatte eine rote Färbung angenommen, »ich hätte ihm derlei schon ausgetrieben …«
»Wie seid ihr mit ihm verfahren?« Die Stimme des Statthalters blieb weiterhin ruhig.
Desinteressiert lehnte sich Julia zurück und wies den Bediensteten an, ihr Wein nachzuschenken. »Ich habe ihn auspeitschen lassen, dafür, dass er meinen Gemahl in seiner Not so schändlich im Stich gelassen hat.« Ihre schmalen, beringten Finger schlossen sich um den Silberbecher, der ihr gereicht wurde.
»Was geschieht weiter?«, fragte der Legatus.
»Nun …« Gleichgültig stellte Julia den Becher auf dem kleinen dreifüßigen Tisch ab. »Selbstverständlich wird Hyacinthus hingerichtet. Er muss bei diesem Mord die Hand mit im Spiel gehabt haben.«
»Doch zuvor lasse ich ihn verhören. Sicher hatte er Komplizen.« Es klang fast so, als würde Publius seiner Mutter das Wort abschneiden. »Nach dem, was geschehen ist, wird die Familie, deren Oberhaupt ich nun bin, keine einzige Nacht mehr ruhig schlafen können. Jeder weiß, dass man sich des Lebens nicht mehr sicher sein kann, wenn ein Sklave erst einmal gewagt hat, Hand an den eigenen Herrn zu legen. Alles Herdenvieh – es wird nicht lange dauern, bis der nächste etwas Ähnliches versucht.« Ein Ausdruck des Abscheus glitt über sein Gesicht. »Deshalb habe ich mich entschlossen, auf altes Recht zurückzugreifen. Sobald Hyacinthus gestanden hat, werden alle Sklaven des Hauses hingerichtet.«
Julia sah ihren Sohn mit einer ausdruckslosen Miene an, der nicht zu entnehmen war, ob sie über dessen Eröffnung schockiert war oder mit einer solchen Maßnahme gerechnet hatte.
»Und nun«, fuhr Publius ungerührt fort, »wirst du meine Mutter entschuldigen müssen, Legatus. Die Bestattung … Es gibt noch einiges für sie zu tun.«
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, stand Julia auf, wandte sich um und verließ den Raum. Der Stoff ihrer dunklen Stola raschelte leise, als er über den Mosaikboden glitt.
KAPITEL III
Das konnte nicht sein!
Ich war wie vor den Kopf geschlagen, fühlte mich wie in einem Albtraum. Der ganze Raum verschwamm vor meinen Augen.
Einen Moment lang lag ein bedrückendes Schweigen über dem Saal, als hätte die Ungeheuerlichkeit dieser Enthüllung sogar den Statthalter der Sprache beraubt.
»Kann ich dir noch einen Becher Wein anbieten?« Es war Publius, der als Erster das Wort ergriff. Seine Stimme klang entspannt, beinahe selbstzufrieden und riss mich aus meiner Betäubung.
»Nein, danke.« Entschieden schüttelte der Statthalter den Kopf. »Doch gibt es gewisse Dinge, die ich mit dir zu besprechen habe.«
»Die da wären?«
»Nun«, vorsichtig stellte der Statthalter seinen Becher ab, »ich würde dir bei der Suche nach dem Mörder deines Vaters gerne meine Unterstützung anbieten.«
Ich sah, wie Publius’ Gesicht sich verhärtete, seine Lippen bildeten einen schmalen Strich. »Wie meine Mutter schon sagte, ist der Mörder bereits gefunden. Bemühe dich also nicht. So wie es aussieht, fällt die ganze Angelegenheit unter die Gerichtsbarkeit des Pater Familias, was bedeutet, ich habe die letzten Dinge zu entscheiden.«
»Damit wären wir bei der zweiten Sache, die ich mit dir zu besprechen habe«, nahm der Statthalter das Wort wieder auf. »Du weißt sicherlich, dass die Hinrichtung so vieler Sklaven einer offiziellen Genehmigung bedarf. Aus diesem Grunde würde ich gerne …«
»Wie ich mit meinem Besitz verfahre, ist einzig und allein meine Angelegenheit!«, unterbrach Publius ihn schroff. »Oder willst du mir da etwa dreinreden?« Es bereitete ihm sichtlich Schwierigkeiten, ein Mindestmaß an Höflichkeit aufrechtzuerhalten. »Du weißt, dass meine Familie verwandtschaftliche Beziehungen bis in die höchsten Kreise Roms hat. Was, denkst du wohl, würde der Kaiser dazu sagen, wenn er erfahren würde, dass sein Legat sich anmaßt, Angehörigen seines Hauses in privaten Angelegenheiten hereinzureden?«
Alarmiert horchte ich auf. Das war gewagt! Nicht nur dass Publius es sich herausnahm, dem obersten Herrn der Provinz die Stirn zu bieten, nun bezeichnete er sich auch noch selbst als Angehöriger des Kaiserhauses und drohte damit indirekt dem Statthalter, sich über seinen Kopf hinweg an Rom zu wenden.
»Rom ist weit, und der Kaiser hat derzeit andere Sorgen, würde ich meinen«, sagte der Statthalter gefährlich leise. »Aber du solltest nicht vergessen, dass ich hier seine Autorität verkörpere und dass jede Auflehnung dagegen als Verrat missdeutet werden könnte. Nicht dass ich dir, verehrter Publius, dergleichen unterstellen möchte.«
Publius erbleichte. Fast fahrig glitt sein Blick zu der Tür, dann machte er eine beiläufige Handbewegung. »Solche Dinge sollten wir lieber alleine bereden. Nicht vor neugierigen Ohren.«
»Mein Sekretär ist nur hier, um sich Notizen zu machen. Du kannst versichert sein, er ist verschwiegen, wie man es von ihm erwartet.«
Einen Moment lang schien Publius zu zögern. Schließlich nickte er. »Ganz wie du wünschst, Legatus. Doch sicher kannst du auf die Anwesenheit von der da« – er wies auf mich – »verzichten. Ich glaube kaum, dass sie dir in dieser Situation von Nutzen sein könnte.« Er lächelte anzüglich. »Fuscus!«, rief er den Sklavenjungen herbei, der den Wein serviert hatte. »Lass uns allein und sieh zu, dass das Mädchen des Statthalters versorgt wird. Und versuche erst gar nicht, dich in der Nähe der Tür herumzutreiben!«
Das blasse Gesicht des Jungen wurde noch einen Ton fahler, als er nickte und sich zum Gehen wandte. Immer noch erschüttert, folgte ich Fuscus nach draußen, widerwillig, da ich wusste, dass mich dies davon ausschloss, mehr über die ganze Geschichte in Erfahrung zu bringen.
»Willst du etwas trinken?«
Bei den unerwarteten Worten zuckte ich zusammen und schaute zu meinem Begleiter, der mit großen Augen auf eine Antwort wartete. Sein Gesichtsausdruck war trostlos und leer. Dennoch besaß er genügend Disziplin, sich der Anordnung gemäß um das leibliche Wohl der Sklavin des Legatus zu kümmern.
»Sicher …« Meine Antwort kam halbherzig. Mir zog die Vorstellung den Magen zusammen, mich in die Gesellschaft von Todgeweihten zu begeben, in die Gesellschaft der Sklaven, die wussten, dass sie – wenn das Schicksal ihnen nicht gnädig war – höchstens noch einige Tage zu leben hatten, bevor man sie für ein Verbrechen hinrichten würde, das sie nicht begangen hatten.
»Komm mit!« Mit einer fahrigen Handbewegung bedeutete er mir, ihm zu folgen, und gemeinsam gingen wir den Flur hinunter zur Küche.
Der übliche Geruch nach Braten, Ruß und Gewürzen schlug mir entgegen, und ich trat, meine Beklemmung überwindend, ein.
An einem schweren Tisch saß eine Alte, die Bohnen schnitt, während an der Feuerstelle eine hagere Mitsklavin in einem großen Topf rührte. Eine hochgewachsene, blonde Frau von Anfang zwanzig, die auf einem Schemel saß und Erbsen pulte, hob nur kurz den Blick, als wir die Küche betraten. Zu ihren Füßen hockte ein etwa vierjähriger Junge, dessen Gesichtszüge mir seltsam vertraut vorkamen.
»Das ist eine Sklavin des Statthalters. Sieh zu, dass sie versorgt wird!« Fuscus’ Stimme schien um Festigkeit bemüht, doch es war deutlich zu spüren, wie sehr er sich jedes Wort einzeln abringen musste.
Misstrauische Blicke wurden auf mich geworfen, dann erhob sich die Alte von dem knarrenden Stuhl, schlurfte zu dem großen Wandregal, nahm daraus einen Becher. Schließlich goss sie mir etwas verdünnten Wein ein, den sie vor mir auf dem Tisch abstellte, und gab mir ein Zeichen, mich ebenfalls zu setzen.
Zögernd griff ich nach dem glasierten Tonbecher und trank einen Schluck, während ich mich verstohlen in der Küche umsah.
Ein gemauerter Herd, zwei steinerne Backöfen. Außer dem Tisch, an dem wir saßen, war noch ein weiterer an die Wand gerückt, darüber Regale, in denen sich das Geschirr stapelte. Von der Decke hingen Gewürze zum Trocknen. Der mit Terrakotta-Fliesen belegte Fußboden war peinlich sauber gehalten.
Die anheimelnde Einrichtung stand im krassen Gegensatz zu der bedrückten Stimmung. Überall auf den Gesichtern derselbe Ausdruck: Hoffnungslosigkeit und Angst.
Schließlich hielt ich das Schweigen nicht länger aus. »Wann wird euer Herr bestattet?«, begann ich, da mir nichts Besseres einfiel.
Die Alte zuckte zusammen und hätte sich beinahe mit dem Messer in die Hand geschnitten. Langsam blickte sie zu mir auf. »In drei Tagen, weshalb fragst du?« Ihre Stimme klang schleppend, und wahrscheinlich war es nur der pflichtschuldige Respekt einer Sklavin des Statthalters gegenüber, der sie überhaupt etwas sagen ließ.
Verunsichert stammelte ich eine halbherzige Erklärung und nahm schnell einen weiteren Schluck.
»Es ist eine schreckliche Sache, nicht wahr?«, warf ich nach einer Weile in den Raum, wobei ich es bewusst offen ließ, ob ich den Tod des Baetius Quigo meinte oder die möglichen Folgen.
Ich sah, wie ein Zittern durch den Körper der Alten ging, erhielt jedoch keine Antwort.
»Warum hat Hyacinthus euren Herrn getötet?«
Die Frau am Herd hielt in ihrer Bewegung inne und wandte mir wie unter Schock ihr bleiches Gesicht zu. Der Alten am Tisch fiel das Messer aus der Hand, und Fuscus starrte mich an, als hätte ich ihm einen Schlag verpasst oder mich vor seinen Augen in ein Fabelwesen verwandelt. Sogar die stille, blonde Frau mit dem kleinen Jungen saß starr aufgerichtet und mit entsetzten Augen da.
Hitze schoss mir ins Gesicht, und schon bereute ich es, diese Frage gestellt zu haben.
Die Alte fing sich als Erste. »Wer hat das gesagt?«
»Ich hörte meinen Herrn mit eurer Herrin darüber sprechen«, gab ich verlegen zur Antwort und wand mich unbehaglich auf meinem Platz. »Ich habe Hyacinthus auf dem Gastmahl meines Herrn, des Statthalters, kennen gelernt; wir haben miteinander gesprochen. Er wirkte gelöst und guter Dinge, nicht wie jemand, der für dieselbe Nacht noch einen Mord geplant hat.«
Das Schweigen wurde unerträglich.
»Ich kann es nicht glauben, dass er zu so etwas fähig wäre. Ich glaube, dass jemand anders den Mord begangen hat.«
»Ein anderer – aber wer?« Die Frage der Alten klang wie ein leiser Aufschrei, und es hatte etwas geradezu Erlösendes, statt der stummen Ergebenheit eine menschliche Reaktion auf die bevorstehende Hinrichtung zu erfahren.
Vorsichtig hob ich die Schultern. »Ich weiß es nicht. Vielleicht einer der Gäste, ein politischer Gegner, ein persönlicher Feind.«
Die starr auf mich gerichteten Augen zeigten mir, dass sie eine derartige Möglichkeit noch nie in Betracht gezogen hatte.
Mehr zu meiner eigenen Klarheit fuhr ich in den Überlegungen fort: »Einen Mord zu begehen, noch dazu an einem derart wichtigen Beamten, dafür braucht es ein Motiv. Einen Grund, der ausreichend genug ist, ein solches Risiko einzugehen.« Immer noch schienen mich alle Blicke zu fixieren.
»In den Tagen vor dem Gastmahl, gab es da irgendetwas, das euch seltsam vorkam? Irgendetwas, das mit dem Tod eures Herrn in Verbindung stehen könnte?«
Die Alte sah mich unverwandt an, während die junge blonde Frau ihre Schüssel mit Erbsen beiseitestellte, aufstand und durch eine Seitentür entschwand. Der kleine Junge blieb verschüchtert zurück. Noch immer schienen sie alle Angst zu haben, mit mir zu reden.
»Der junge Herr, der Sohn des Verstorbenen, sprach davon, dass Hyacinthus es gewohnt sei, sich Dinge herauszunehmen, die ihm nicht zustanden«, nahm ich wieder das Wort auf, in der Hoffnung, etwas zu erfahren, das vielleicht ein wenig Licht in das Dunkel bringen konnte. »Weißt du, was er damit gemeint hat?«
Das Schweigen, das daraufhin entstand, war so groß, dass man eine Nadel hätte fallen hören können. Aus den Augenwinkeln heraus nahm ich wahr, wie Fuscus sich umwandte und die Küche verließ. Dann schien der Bann gebrochen, und die Alte schüttelte stumm den Kopf.
Ich kam einfach nicht weiter!
Bevor ich ins Haus des Statthalters kam, war ich Sklavin bei einem einflussreichen Ratsherrn namens Cornelius Felix in Divodurum gewesen. Zwar waren dessen Frau und Tochter im günstigsten Fall als Drachen zu bezeichnen, die recht freigiebig Ohrfeigen zu verteilen wussten, wenn sie schlecht gelaunt oder unzufrieden waren. Doch noch nie im Leben hatte ich einen Haushalt gesehen, in dem die Sklaven derart verängstigt waren.
Seltsam, dabei hatte Hyacinthus an jenem Abend überhaupt nicht diesen Eindruck erweckt, so keck und vorlaut, wie er sich gegeben hatte. Solche Bemerkungen über meinen Herrn hätte noch nicht einmal ich mir herausgenommen, und ich stand im Rufe, nicht besonders vorsichtig mit meinen Äußerungen zu sein.
»Der Legatus möchte gehen!« Ohne dass ich es gemerkt hatte, war Fuscus zurückgekommen und stand in der Tür, sein Gesicht immer noch blass und ausdruckslos. »Du solltest jetzt besser aufbrechen.«
Noch einmal sah ich mich um. Wie auf ein Stichwort hin hatten alle ihre Arbeit wieder aufgenommen und wichen meinem Blick aus.
Ich unterließ es, noch einen guten Tag zu wünschen, und verließ die Küche.
Die dunkle Kühle des Flures, die bunten Wandbemalungen, deren Faune und Hirtinnen zynisch zu mir herabzustarren schienen, verstärkten das Unbehagen.
Ein leises Geräusch ließ mich zusammenfahren. Vom hinteren Teil des Flurs waren leise Schritte zu hören.
»Du – Mädchen!« Eine raue Stimme ließ mich innehalten. Langsam blieb ich stehen und wandte mich um. Einige Schritte von mir entfernt hinter einer Säule versteckt stand die junge blonde Frau, die ich in der Küche gesehen hatte, und blickte mich an.
Zögernd warf ich einen Blick über die Schulter und machte ein paar Schritte auf sie zu.
»Was ist los?«, flüsterte ich, und vor Angst schlug mir das Herz bis zum Hals.
»Du – in Haus von Statthalter?« Trotz ihres schlechten Lateins klang ihre Stimme fest, wenn auch etwas ängstlich.
Ich nickte. »Ja!«
»Hyacinthus nicht ermorden Dominus. Hyacinthus unschuldig.«
Überrascht blickte ich die Frau an und sah mich verstohlen um, ob uns jemand belauschte.
»Woher weißt du das?«
»Ich wissen.« Beschwörend legte sie mir die Hand auf die Schulter. »Und jetzt wir alle sterben wie Hyacinthus, Frau, Mann, Kind, alle!« Sie machte eine allumfassende Handbewegung, und ihre Augen flackerten erregt.
»Was weißt du von der Sache?« Vor Aufregung drohte meine Stimme zu versagen.
Widmung
Zitat
KAPITEL I
KAPITEL II
KAPITEL III
KAPITEL IV
KAPITEL V
KAPITEL VI
KAPITEL VII
KAPITEL VIII
KAPITEL IX
KAPITEL X
KAPITEL XI
KAPITEL XII
KAPITEL XIII
KAPITEL XIV
KAPITEL XV
KAPITEL XVI
KAPITEL XVII
KAPITEL XVIII
KAPITEL XIX
KAPITEL XX
KAPITEL XXI
KAPITEL XXII
NACHWORT
GLOSSAR
REISE- UND STÖBERTIPPS
DANKSAGUNGEN