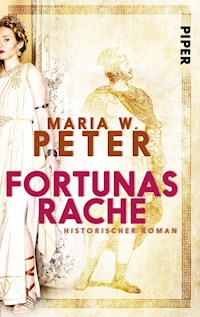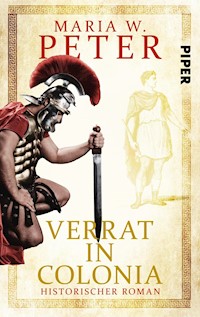
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Spannungsvoll
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein grausamer Mord, eine blutige Belagerung – der Kampf um die Vorherrschaft am Rhein hat begonnen. Invitas neuer Fall von Bestsellerautorin Maria W. Peter »Aber der Mensch denkt, das Schicksal lenkt – und als Sklave weiß man ohnehin nie, was der nächste Tag mit sich bringt.« Das römische Köln und Bonn im 3. Jahrhundert n. Chr.: Während immer wieder Überfälle germanischer Stämme die römische Rheingrenze verunsichern, wird ein hoher Beamter im Bad des Praetoriums ermordet aufgefunden. Sogleich fällt der Verdacht auf den germanischen Kriegsgefangenen Flavus. Da ihm Folter und Hinrichtung drohen, versucht seine Geliebte Invita, Sklavin des Statthalters, den wahren Schuldigen zu finden. Dabei gerät sie in einen Strudel von Verrat und Verschwörung, welcher die gesamte germanische Provinz in den Abgrund zu reißen droht... »Verrat in Colonia« ist der vierte Fall der Sklavin Invita. Die Bände sind in sich abgeschlossen und unabhängig voneinander lesbar. »Ein Besuch in der Römerzeit der sich lohnt.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Ein weiterer spannender Fall um die Sklavin Invita mit einer verzwickten Mörderjagd und politischen Ränken.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Eine wunderbare Hintergrundrecherche sowie eine fesselnde Geschichte machen diesen Roman wieder einmal zu einem Hochgenuss! Absolute Leseempfehlung – diese Serie ist unvergleichlich!!!« ((Leserstimme auf Netgalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Verrat in Colonia« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2021
© Kartenzeichnung von Helmut W. Pesch
© für das Foto des römischen Praetoriums zu Köln: Stadt Köln/Archäologische Zone, Chr. Kohnen
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Karte
Model Praetorium
Zitat
KAPITEL I
KAPITEL II
KAPITEL III
KAPITEL IV
KAPITEL V
Für Katharina
Niemand in der ganzen Welt übertrifft die Germanen an Treue.
nach Publius Cornelius Tacitus
KAPITEL I
In Germania inferiore, ad castra Bonnensia,anno MXII ab urbe condita, aestate
(Niedergermanien, in der Nähe des Legionslagers Bonn,Sommer 260 n. Chr.)
Ein Schlag riss mich aus dem Dämmerzustand und warf mich auf die Knie. Scharf durchzuckte mich ein Schmerz, als ich versuchte, den Sturz abzufangen und mir dabei Hände und Unterarme an der Wand des Reisewagens aufschürfte.
Ehe ich mich aufrichten konnte, ließ ein heftiger Stoß mich ein weiteres Mal zusammenfahren. Der Holzboden unter mir schien zu zerbersten. Bretter splitterten, Männer schrien, Stahl traf klirrend auf Stahl.
Brandgeruch stieg mir in die Nase, und hustend drückte ich mir den Stoff meines Gewandes auf den Mund. Die Erkenntnis schlug über mir zusammen wie eine donnernde Woge.
Ein Überfall!
Bei dem Versuch, aufzustehen, bekam ich etwas Weiches zu fassen: den Saum von Marcellas Gewand, ihre Füße … und diese Berührung half mir, wieder in die Realität zurückzukehren.
»Domina!« Meine Stimme wurde fast vollständig vom Lärm des Kampfes geschluckt. »Herrin, geht es dir gut?« Meine Panik unterdrückend tastete ich mich in der Dunkelheit weiter. »Ist alles in Ordnung mit dir?«
Kühle Finger umfassten mein Handgelenk, ein leichter Ruck ließ mich wieder auf die Beine kommen.
»Mir ist nichts geschehen.« Marcellas Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, doch unendlich beruhigend. »Bist du verletzt?«
»Nein.« Ein schmerzhaftes Pochen bewies, dass meine Antwort nur zum Teil der Wahrheit entsprach.
Wieder ein Krachen, trampelnde Hufe und flackerndes Feuer, das als goldener Schatten durch den Vorhang schimmerte, der das Fenster bedeckte. Fackeln! Oder hatten sie bereits einige unserer Wagen in Brand gesteckt?
Sie? Wer auch immer es war, der uns hier angriff, uns, den Tross des Finanzprocurators.
Hastig riss ich den Vorhang beiseite und starrte nach draußen. Was ich dort sah, musste ein Albtraum sein, die Ausgeburt meiner wilden Fantasie.
Mit allen Kräften setzten sich die Legionäre, die uns begleiteten, gegen die Gestalten zur Wehr, die mit Fackeln, Äxten, langen Schwertern und seltsamen, runden Schilden ausgestattet waren. Einige von ihnen zu Pferde, andere kämpften zu Fuß. Doch alle stießen sie ein ohrenbetäubendes Geschrei aus, das mich bis ins Mark erschütterte.
Unablässig fiel der Regen. Donner grollte von jenseits des Rheins, Blitze tauchten die Szenerie in grelles Licht.
Nach Atem ringend wich ich zurück, ohne jedoch das blutige Gemetzel aus den Augen zu lassen. Die Barbaren schleuderten Fackeln in unsere Richtung. Einer der Wagen stand bereits in Flammen. Der Wind trieb den scharfen Rauch in unsere Richtung.
Plötzlich erstarrte ich vor Entsetzen. Von der Seite her kam einer der Angreifer auf uns zu. Lange, vom Regen durchweichte Haare hingen ihm ins bärtige Gesicht. In der rechten Hand hielt er ein Schwert, in der linken eine Fackel.
Er will uns ausräuchern!
Todesangst ergriff vollständig von mir Besitz. Wir würden elend sterben, die Herrin und ich. Ohne nachzudenken, packte ich Marcella bei den Händen, riss sie nach oben und stieß die Tür auf.
»Wir müssen hier raus, Domina, schnell. Es ist unsere einzige Chance.«
Ein erneuter Stoß gegen den Wagen ließ mich das Gleichgewicht verlieren. Bevor ich Gelegenheit hatte, mich irgendwo festzuhalten, kippte ich nach vorne. Krachend schlug ich auf der Holztreppe auf und fiel weiter hinab, auf die aufgeweichte Erde.
Eine Gestalt beugte sich über mich. Schreiend wich ich zurück. Erst als ich aufsah, erkannte ich, wer da über mir stand: Flavus, der alemannische Kriegsgefangene des Statthalters, mein Gefährte. Sein Gesicht war vor Zorn verzerrt, seine Augen spiegelten ungläubiges Entsetzen wider.
»Was tust du hier draußen? Bist du verrückt?« Schnell hatte er mich gepackt und hochgerissen. »Du scherst dich zurück in den Wagen, verriegelst die Tür und kommst nicht noch einmal auf den Gedanken, auch nur den Kopf nach draußen zu strecken. Hast du gehört?«
Seine Worte waren im Lärm des Kampfes kaum zu verstehen, doch sein Körper, seine Miene, jede Bewegung drückten Zorn aus. Zorn und etwas anderes, was ich noch selten bei ihm gesehen hatte. Furcht?
Furcht um mich.
Heißes, flackerndes Licht blendete mich.
»Flavus, pass auf!«
Der Barbar mit der Fackel hatte uns erreicht. Schon holte er aus, als wollte er nicht nur unseren Wagen in Brand setzen, sondern zuvor noch Flavus’ Schädel zerschmettern.
»Da! Hinter dir!«
Behände wie ein Raubtier fuhr Flavus herum, schlug dem Angreifer mit einem einzigen Hieb die Klinge aus der Hand. Zornschnaubend stieß der Fremde die Fackel in Flavus’ Richtung. Dieser wich zurück und hatte plötzlich ein Messer in der Hand. Drohend umkreiste er damit den Gegner, der das lodernde Holz wie eine Waffe vor sich hielt. Dann griffen beide gleichzeitig an, schossen aufeinander zu und gingen gemeinsam zu Boden. Die Fackel rollte über die aufgerissene Erde, brannte zischend weiter.
Panik kochte in mir hoch. Das Ende der Welt schien mit Blitz, Donner und Waffengedröhn hereinzubrechen. Hilflos musste ich zusehen, wie beide in einem erbitterten Kampf miteinander rangen.
Erneut ließ mich ein Krachen herumfahren. Einer der Barbaren stand hinter mir. Der Stahl seines Schwertes blitzte im Schein der brennenden Wagen auf. Panisch flog mein Blick zu Flavus, der sich noch immer in tödlicher Umklammerung auf der Erde wälzte.
Taumelnd rappelte ich mich auf, versuchte rückwärts zum Wagen zu entkommen. Doch bevor ich die Chance hatte, mich auch nur ein paar Fuß weit zu bewegen, wurde ich ein weiteres Mal zu Boden gestoßen.
Einen Moment lang lag ich keuchend auf dem Rücken, unfähig, mich zu rühren. Dann wurde ich gepackt und nach oben gerissen. Eine Hand drückte mir die Luft ab, die Klinge lag auf meiner Halsbeuge.
Fest presste sich ein Körper an meinen. Vor Angst wie betäubt sah ich zum Wagen und erkannte in einem aufflammenden Blitz die Herrin Marcella, die dort in der Tür stand.
Voller Wucht schleuderte mich der Barbar zu ihr hinüber. Schwindel erfasste mich, als ich mit dumpfem Knall an der Holzwand des Gefährts aufschlug und ein heftiger Schmerz durch mein Handgelenk fuhr. Einen Augenblick glaubte ich, es sei gebrochen, doch ehe ich weiter darüber nachdenken konnte, tauchte ein dritter Angreifer auf, riss Marcella heraus und drehte ihr die Arme auf den Rücken.
Eine Faust grub sich in den Kragen meiner Tunica, ein Schlag traf mein Gesicht so fest, dass mein Kopf zur Seite flog und sich der metallische Geschmack von Blut in meinem Mund ausbreitete.
Plötzlich schienen sie von überall her zu kommen. Getrampel, Geklirre, verzweifeltes Brüllen. Keuchender Atem, zuckende Leiber. Eine Hand umfasste meinen Hals. Ich glaubte zu ersticken, war unfähig zu schreien, gelähmt vor Schmerz und willenloser Panik. Mit einem kreischenden Geräusch riss der Stoff meiner Tunica, und ich wusste, es war vorbei.
Dann aber schimmerte das glänzende Metall eines Brustpanzers durch die schwarzen Schatten meines Gesichtsfelds, dunkelroter Stoff, ein kurzes Schwert, das massiv und schwer in einer behaarten Hand lag.
fantasierte ich bereits? Traum und Wirklichkeit schienen ineinander zu verschwimmen, als sich die Nebelfetzen vor meinen Augen verdichteten, und ich glaubte, der Erde entgegenzufallen.
Ein gebellter Befehl und der Griff, der mich gepackt hielt, lockerte sich. Metall traf splitternd auf Holz. Dann prallte mit dumpfem Geräusch ein menschlicher Körper auf den schlammigen Boden.
Vorsichtig schob jemand seine Hand unter meine Armbeuge. Ich blinzelte.
»Mädchen? Mädchen, geht es dir gut?«
Irgendjemand sprach eine mir verständliche Sprache, zwei kräftige Arme stützten mich, schoben mich voran.
Dann von weiter entfernt: »Domina, kann ich dir helfen?«
Marcella? War sie in Sicherheit?
Schwer atmend richtete ich mich auf, noch immer den stützenden Griff in meinem Rücken. Mein Blick klärte sich.
Marcella stand vor der Treppe des Wagens. Jemand reichte ihr die Hand und half ihr hinauf. Ich erkannte einen Kettenpanzer und einen matt schimmernden Legionärshelm.
Ungläubige Erleichterung ließ mich beinahe in die Knie gehen. Ein römischer Soldat?
Schwankend wandte ich mich um und begriff erst jetzt, dass die Arme, die mich von hinten festhielten, ebenfalls einem unserer Männer gehörten. Mit einem Ruck hob dieser mich durch die Wagentür ins Innere, wo ich in einen der Sitze sank und den Kopf an die Wand lehnte.
»Geht es dir gut?« Es war Marcellas Stimme.
Ein Stöhnen unterdrückend wandte ich mich ihr zu.
»Ja«, murmelte ich schwach. »Und dir? Bist du verletzt, Herrin?« Angewidert spuckte ich süßliches Blut aus und versuchte das Flimmern vor meinen Augen zu vertreiben.
»Nein, mir ist nichts geschehen. Nur der Schrecken …«
Das Pochen in meinem Handgelenk schwoll mit jedem Herzschlag an. Ein klebriges Gefühl machte sich am Unterarm bemerkbar, wo aus einer lang gezogenen Wunde warmes Blut sickerte.
»Wirklich, Herrin? Dieser Fremde, hat er …?« Ein Zittern überfiel meinen Körper, und ich umschlang meine Knie mit den Armen.
»Alles in Ordnung hier?« Eine unbekannte Stimme, warm, weich und tief, riss mich aus meiner Apathie. Hitze und Licht einer Fackel fielen ins Innere des Wagens. Ich blickte auf. Durch die Türöffnung sah ich im unruhigen Flackern eine große Gestalt auf einem Pferd, das nervös tänzelte, als würde der Geruch von Feuer und menschlichem Blut es beunruhigen.
Schwankend richtete ich mich wieder auf; der anerzogene Impuls, in Anwesenheit von Höhergestellten nicht zu sitzen. Mit klammen Fingern krallte ich mich an der Tür des Wagens fest, während Marcella sich vorsichtig an mir vorbei nach draußen schob und ihren Gruß abstattete.
Ein Blick hinaus ließ mich Genaueres erkennen: Flankiert von zwei Soldaten, von denen einer ein Schwert, der andere eine Fackel in der Hand hielt, saß ein junger Mann hoch aufgerichtet auf einem Pferd. Sein Gewand war nass vom Regen, den Helm musste er im Kampf verloren haben. Schwere schwarze Locken fielen ihm in die Stirn, umrahmten ein Gesicht mit hervorspringenden Wangenknochen, leicht bronzefarbener Haut und dunklen Augen, die im schwachen Licht nur undeutlich zu erkennen waren.
Die linke Hand hielt die Zügel, seine rechte umfasste ein Schwert. Fast bis zum Heft war es mit schwärzlich schimmerndem Blut getränkt, dessen Anblick Übelkeit in mir aufkeimen ließ.
»Irgendwelche Verluste bei euch?« Forschend sah er sich um. Sein Blick glitt kurz über mich hinweg, blieb dann an dem Wagen hängen, begutachtete Räder und Achse und nickte schließlich befriedigt. »Fortuna war mit euch. Andere Abteilungen hat es weit schlimmer getroffen. Gut, dass wir noch rechtzeitig zu euch gestoßen sind. Das hat die fränkischen Hunde in die Flucht getrieben … Wenn auch nicht ohne Beute.«
Marcella ging nicht auf den letzten Punkt ein. »Ihr kommt vom Lager Bonna? Die zugesagte Verstärkung?«
Der Angesprochene nickte kurz. »Keine Stunde zu früh, wie es aussieht. Der Finanzprocurator hat gut daran getan, weitere Männer anzufordern, die euch entgegenreiten sollten. Ohne diese Vorsichtsmaßnahme wäre es weit schlimmer ausgegangen. Immer wieder versuchen diese Barbaren, Rhein und Limes zu überwinden, um ins Innere des Imperiums vorzudringen.« Ein grimmiger Ausdruck überzog das gebräunte Gesicht. »Besonders hier im Grenzbereich ist es unsicher.« Achtlos wischte er das Blut von seinem Schwert und schob es in die Scheide. »Aus diesem Grund patrouillieren wir in regelmäßigen Abständen entlang der Fernstraßen …«
Mit einem Schenkeldruck lenkte er sein Pferd näher zu uns heran und betrachtete schließlich Marcella, die seinen Blick gelassen erwiderte.
»Ich freue mich, noch zur rechten Zeit gekommen zu sein. Wie ich sehe, ist dir nichts Ernstes geschehen.«
»Wir sind dir sehr dankbar.« Marcellas Stimme klang ruhig. »Wer weiß, was ohne dein beherztes Eingreifen mit uns geschehen wäre, Centurio …?«
»Mucius Longinus. Ich befehlige diese Einheit.« Knapp nickte er uns zu und wendete dann sein Pferd. Der durchnässte Soldatenmantel lag schwer über seiner Schulter und reichte bis zum Rücken seines Reittieres.
Ein kurzer Blick über die von Fackeln schwach erleuchtete Umgebung ließ nichts Gutes erkennen. Ein zerschlagener Wagen, zwei weitere, die in Flammen standen, dazu tote Pferde und mehrere gekrümmte Schatten, die wie menschliche Körper aussahen.
Mein Magen verkrampfte sich, und ein Würgen unterdrückend schloss ich die Augen, stumm darum betend, dass Flavus nicht unter ihnen war.
Das also war die Provinz Niedergermanien.
KAPITEL II
Die Kammer, die man uns für diese Nacht im Legionslager zugewiesen hatte, war warm und trocken. Mehrere Fackeln erleuchteten den bescheidenen, schlicht möblierten Raum. In zwei Kohlebecken brannten Feuer, und auf einem kleinen Tisch standen bereits ein Krug mit zwei Bechern, dazu Teller und Schüsseln mit Brot, Oliven, Käse und gewürfeltem Speck. Die weiß getünchten Wände wiesen am oberen Rand einfache geometrische Muster in leuchtendem Rot auf.
Man hatte die Herrin und mich im Gebäude des Praefectus Castrorum, des Kommandanten, untergebracht, wohl die beste und sicherste Unterkunft, die das Lager Bonna zu bieten hatte. Kurz ließ Marcella ihren Blick über unser Quartier gleiten, dann nickte sie dem jungen Soldaten zu, der uns hierher geleitet und ihre Holzkiste mit persönlichen Dingen neben der Tür abgestellt hatte. »Danke.«
»Ich hoffe, es ist alles zu deiner Zufriedenheit, Domina. Benötigst du noch irgendetwas?«
»Im Augenblick nicht. Doch mein Mädchen hier«, sie wies auf mich, »ist bei dem Überfall verletzt worden. Ob vielleicht …«
»Ich werde nach dem Lagerarzt schicken. Und wenn du ein Bad wünschst …«
»Nicht mehr heute Abend. Mir genügt eine Schüssel mit warmem Wasser und zwei saubere Tücher.«
»Natürlich.« Mit einem knappen Nicken wandte sich der Legionär um und schloss die Tür hinter sich.
Die Herrin und ich waren allein.
Trotz der Wärme in der Kammer begann ich zu zittern, als die Anspannung von mir abfiel und die Erlebnisse der vergangenen Stunde ungefiltert über mir zusammenschlugen. Unser Tross, der Tross des Procurators, war von einer barbarischen Horde angegriffen und überfallen worden. Bei allen Göttern!
Hart schlugen meine Zähne aufeinander, während ich der Domina aus ihrem Mantel half und diesen auf einer Stuhllehne zum Trocknen auslegte. Schließlich schälte ich mich aus meinem Umhang, an dem noch immer der zwischenzeitlich hart gewordene Schlamm klebte.
Dann eilte ich zu dem kleinen Tisch, goss einen Becher des angewärmten Weines ein, der einen beruhigenden Duft nach Anis und Nelken verströmte. Wortlos reichte ich ihn Marcella, die sich in einem der Sessel niedergelassen hatte. Ihr Gesicht wirkte bleich, um ihre Augen lagen dunkle Schatten, deutliche Spuren des überstandenen Schreckens. Dennoch hob sie mit ruhiger Hand das Getränk an die Lippen.
Seltsam, diese Ruhe und Selbstbeherrschung. Ich selbst war weit davon entfernt.
Dankbar, etwas zu tun zu haben, mit dem ich mich beschäftigen konnte, richtete ich etwas von dem Brot und den Beilagen auf einem der Teller an und schob ihn der Herrin hin. Noch immer bebten meine Hände, als ich erneut zu dem schweren Krug griff und mir selbst einschenkte. Meine Finger waren eisig, und so schloss ich sie fest um den Becher, der langsam die Wärme des gewürzten Weines annahm.
Ich trank in gierigen Schlucken. Doch weder das heiße Getränk noch die darin enthaltenen Gewürze konnten die Kälte vertreiben, die sich in meinem Körper ausgebreitet hatte.
Ich verspürte keinen Hunger, mein Magen war wie zugeschnürt, und so setzte ich mich auf einen Schemel und starrte über meinen Becherrand in das flackernde Licht einer Öllampe.
Bereits seit einiger Zeit wurden die Grenzregionen im Nordosten des Reiches immer wieder Opfer von Überfällen feindlicher Alemannen und Franken, die über Rhein und Limes bis weit ins Landesinnere hereinbrachen und dort Angst und Schrecken verbreiteten.
Vielleicht hatte Kaiser Gallienus genau aus diesem Grunde nach seinem Besuch in der niedergermanischen Hauptstadt Colonia Claudia Ara Agrippinensium seinen Sohn, Erben und Stellvertreter Saloninus zurückgelassen, damit dieser dort in seinem Namen wichtige Entscheidungen treffen konnte. Währenddessen befand sich der niedergermanische Statthalter und Oberbefehlshaber der Truppen, Marcus Cassianus Latinius Postumus, auf einem Feldzug gegen die germanischen Barbaren. Die Colonia und seinen Palast soll er für diesen Zeitraum, so war mir zu Ohren gekommen, in die Obhut des jungen Thronerben übergeben haben, der zumindest vorübergehend die Regierungsgeschäfte übernommen hatte. Eine Provinz ohne Statthalter also, und ein junger Kaisersohn, der in unruhigen Zeiten für Ordnung sorgen musste.
Ein Stöhnen unterdrückend rieb ich mir die Schläfe. Wieso hatte sich Marcella nur auf diese Reise eingelassen? Der Wunsch ihres Vaters, hatte sie nur kryptisch erklärt und etwas von Familienangelegenheiten hinzugefügt. Nun, es mussten ja bedeutsame Familienangelegenheiten sein, wenn der Statthalter der Provinz Gallia Belgica seine einzige Tochter in derart unruhigen Zeiten unter dem Schutz und Geleit des Finanzprocurators von Divodurum nach Niedergermanien reisen ließ. Letzterer hatte den Auftrag, unter militärischer Bewachung die Soldkasse für die niedergermanischen Truppen zu überbringen.
Tatsächlich schien die Reise von Beginn an unter keinem guten Stern zu stehen. Seit unserem Aufbruch von Divodurum Mediomatricorum hatte brütende Hitze wie eine stumme Drohung über unserem Tross gehangen, über den staubigen Straßen, den Männern, Wagen und Pferden. Und schließlich, kurz bevor wir den Rhein erreicht hatten, waren schwarze Wolken aufgezogen, und die angestaute Glut der vergangenen Tage hatte sich in einem heftigen Gewitter entladen.
Dunkelheit, Donner und Regen. Das mochten die Gründe gewesen sein, weswegen der plötzliche Angriff viel zu spät bemerkt worden war. Wir wären aufgerieben worden. Getötet. Verschleppt. Wenn nicht …
Es klopfte. Auf Marcellas Zurufen hin öffnete sich die Tür, und ein weißhaariger Mann mit wettergegerbtem Gesicht kam herein. In der Hand trug er einen Stoffbeutel und eine kleine Holzkiste.
»Sei gegrüßt, Herrin. Mein Name ist Lucius Enebardus, ich bin der Lagerarzt. Man sagte mir, dein Mädchen sei bei dem Überfall verletzt worden.«
»Hab Dank, dass du so schnell gekommen bist. Gibt es große Verluste zu beklagen?« Es war typisch für Marcella, sich um das Wohlergehen anderer zu sorgen.
»Mehrere unserer Männer wurden verwundet, teilweise schwer, ein halbes Dutzend hat es nicht überlebt. Jedoch keine zivilen Opfer. Niemand aus eurem Tross.«
Vor Erleichterung schwindelte es mir. Das bedeutete also, dass Flavus nichts geschehen war, er sich hatte retten können. Stumm sandte ich ein Dankgebet an alle Götter, die mir einfielen, besonders an den Unbekannten Gott.
Flavus lebte!
»Und bei den anderen? Den Angreifern?« Marcellas Worte waren so leise, dass selbst ich sie kaum verstand.
Der Medicus allerdings musterte sie mit einem seltsamen Blick aus zusammengekniffenen Augen. »Ebenfalls Tote und Verletzte. Doch konnten wir keine Gefangenen machen, so dass niemand Genaues zu sagen weiß.«
Nickend wies die Herrin schließlich auf mich. »Bitte.«
»Dann zeig mal her.« Mit einer routinierten Bewegung zog der Medicus mein Handgelenk zu sich heran und begutachtete fachmännisch die blutenden Schürfungen, Blutergüsse und Schnitte an Handflächen und Unterarm. Vor sich hin grummelnd öffnete er seinen Beutel, nahm einen sauberen Lappen heraus, entkorkte ein kleines Behältnis aus Ton und träufelte etwas des darin enthaltenen Öls auf das Tuch. Dann begann er, damit meine Verletzungen zu säubern.
Verbissen presste ich die Kiefer zusammen, während mir die Tränen in die Augen schossen, rührte mich jedoch nicht.
Als er mit der Prozedur fertig war, kramte er erneut in seiner Tasche, entnahm ihr einen kleinen Tontiegel, hob den Deckel und tupfte etwas Salbe auf die gereinigten Wunden. Langsam ließ der Schmerz nach, und ein wenig entspannter sah ich zu, wie er mit sauberen Stoffstreifen meine Hände und Unterarme verband.
Anschließend betastete er meinen linken Knöchel, der seit meinem Sturz noch immer schmerzte und deutlich geschwollen war. »Eine leichte Verstauchung. Du solltest den Fuß eine Weile schonen.«
Ohne mich anzusehen, bandagierte er das Gelenk mit festen Leinenbinden, so dass ich mir allmählich wie eine ägyptische Mumie vorkam und wahrscheinlich ebenso intensiv nach Spezereien roch.
»Das wär’s.« Mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck richtete er sich wieder auf. »Und du bist sicher, Herrin, dass dir nichts fehlt?«, fragte er an Marcella gerichtet.
Sie lächelte. »Ganz sicher. Trotzdem danke.«
»Auch wenn du bei dem Überfall keine äußeren Verletzungen davongetragen hast, so ist dein Geist sicher sehr aufgewühlt. Ich könnte dir einen Trank zubereiten, der dir für diese Nacht Vergessen und ruhige Träume schenkt.«
Mit aufrichtigem Blick hielt Marcella dem seinen stand. »Und würde das etwas helfen? Das Vergangene ungeschehen machen oder morgen die Folgen davon verwischen?«
Der Mund des Arztes bog sich zu einem Lächeln. »Wohl eher nicht.« Ich war sicher, auf seinen Zügen den Anflug von Anerkennung zu lesen. Schnell bückte er sich, um seine Sachen zusammenzupacken. Dann nickte er noch einmal in Marcellas Richtung und verließ den Raum.
Wir waren wieder allein.
Mit routinierten Bewegungen begann Marcella damit, die Nadeln aus ihrem Haar zu ziehen, das sich durch den brutalen Angriff zum Teil aus der Frisur gelöst hatte. Dabei zitterten ihre Hände nicht im Geringsten, nur ihren Augen war anzusehen, dass sie sich sorgte und in ihren Gedanken versunken war.
Auf mich stürmten ebenfalls tausende Fragen ein und mischten sich mit dem noch kurz zuvor Erlebten, den Schreien der Verwundeten und Sterbenden, dem kalten Gefühl der Klinge an meiner Kehle.
Mein Mund war trocken, mein Hals brannte. Fahrig griff ich nach dem Becher, den ich mit zwei tiefen Zügen leerte, während mich das sengende Bedürfnis überkam, Flavus zu sehen, mich zu vergewissern, dass es ihm wirklich gut ging. Doch noch musste ich mich gedulden.
Irgendwann kam der junge Soldat zurück, brachte die Schüssel mit angewärmtem Wasser und die beiden Tücher, die Marcella sich erbeten hatte.
Mit einem kurzen Dank entließ sie ihn wieder, streifte sich dann die schmutzige Tunica vom Körper und wusch sich gründlich. Anschließend überließ sie mir die Schüssel, damit ich mich ebenfalls reinigen konnte.
In Momenten wie diesen war ich zutiefst dankbar für Marcellas Fähigkeit, meinen Wunsch nach Schweigen zu respektieren, nicht von mir zu verlangen, dass ich sie unterhielt oder ihr die Zeit vertrieb.
Vielleicht würde ich ja am nächsten Tag Gelegenheit haben, Flavus zu sprechen und ihn nach seiner Einschätzung der Lage zu fragen. Waren die Angreifer seine Leute gewesen? Der Gedanke ließ mich erschaudern.
Doch war ich in dieser Nacht keiner klaren Überlegung mehr fähig, und als Marcella sich hinlegte, kroch ich in das andere Bett und wickelte mich in eine kratzige Wolldecke.
Trotz der grässlichen Bilder in meinem Kopf überfiel mich eine bleierne Müdigkeit. Nur noch schwach spürte ich das Pochen meiner Verletzungen. Dann war ich eingeschlafen.
*
Ein lautes Geräusch riss mich aus dem Schlaf. Einen Moment benötigte ich, um wieder ins Hier und Jetzt zurückzukehren und zu erkennen, dass es sich um eine Posaune handelte, die mit ihrem Dröhnen das gesamte Lager weckte.
Schlaftrunken setzte ich mich in meiner Pritsche auf und stellte blinzelnd fest, dass erst ein grauer Lichtschein durch die kleinen Fenster des Raumes schimmerte. Das Feuer in den Kohlebecken war verglüht, nur der leichte Geruch von kaltem Rauch hing in der Luft.
Mein Blick glitt zu Marcella, die sich ebenfalls zu regen begann. Das offene, lange Haar bedeckte ihren Körper wie ein schwarzer Mantel.
Kurze Zeit später brach ein allgemeiner Tumult aus. Türen wurden aufgerissen und wieder zugeschlagen, genagelte Stiefel trampelten über den Boden, und von allen Seiten wurden laute Befehle gebrüllt.
Rasch warf ich die Decke zurück und sprang aus dem Bett. Ein wenig zu hastig, wie mir ein rasender Schmerz in meinem verletzten Knöchel klarmachte. Einen Fluch unterdrückend humpelte ich zu dem kleinen Tischchen, goss etwas Wasser in die Schüssel und benetzte mir das Gesicht, während ich überlegte, wo Flavus wohl die Nacht verbracht hatte. Vermutlich irgendwo bei den Tross- und Pferdeknechten.
Genau wie ich selbst war Flavus Sklave des Statthalters der Gallia Belgica. Vor einigen Monaten war er als Kriegsgefangener in dessen Stadthaus nach Treveris gebracht worden und arbeitete seither meist im Praefurnium, dem Heizraum. Mehr als Strafe denn als Belohnung war ich ihm zu Beginn des Frühlings als Gefährtin zugewiesen worden.
Vollkommen gegen meinen Willen, wie es zu betonen gilt. Hatte ich mir doch vom Leben etwas Besseres erhofft, als einem ungewaschenen alemannischen Kriegsgefangenen das Bett zu wärmen. Seither war jedoch viel geschehen, und spätestens, nachdem er mir bei einer meiner Dummheiten das Leben gerettet hatte, konnte ich meine Gefühle für ihn nicht mehr leugnen.
Gefühle, die auf Gegenseitigkeit beruhten, wohlgemerkt. Eine winzige Insel von Glück und Geborgenheit inmitten dieser verstörenden, friedlosen Welt.
Aber der Mensch denkt, das Schicksal lenkt – und als Sklave weiß man ohnehin nie, was der nächste Tag mit sich bringt. So kam es, dass ich einen weiteren meiner Fehltritte dadurch büßen musste, dass mir der Hausverwalter jeden Umgang mit Flavus untersagte. Eine übliche Strafe, um allzu aufmüpfige Sklaven zur Raison zu bringen. Und ich wusste, wenn ich das Verbot übertrat, riskierte ich damit, dass Flavus in die Steinbrüche verkauft würde.
Lediglich der Tatsache, dass meine Herrin Marcella sich Flavus als ihre persönliche Leibwache von ihrem Vater erbeten hatte, war es zu verdanken, dass er uns nun auf unserer Reise in die Colonia Agrippina begleitete. Eine kluge Bitte, auf die der belgische Statthalter gerne eingegangen war, nicht zuletzt aufgrund der verworrenen Situation, welche derzeit im gesamten Imperium herrschte. Selbst die römischen Kaiser hielten sich bereits seit Jahrhunderten oft germanische Leibwachen, und sicher beruhigte es meinen Herrn zu wissen, dass seine Tochter auf einer Reise, die so dicht an die Grenzen des Reiches führte, unter zusätzlichem Schutz stand.
»Guten Morgen, Domina.«
Marcella hatte sich aufgesetzt und sah zu mir herüber. Ich beeilte mich, ihr beim Ankleiden behilflich zu sein und die Haare aufzustecken. Eine Arbeit, bei der ich zugegebenermaßen recht wenig Geschick an den Tag legte, was Marcella jedoch noch nie beanstandet hatte.
Noch bevor ich die letzte Haarnadel festgesteckt hatte, wurde an die Tür geklopft. Die Herrin hieß einzutreten, und sogleich schob sich das Gesicht des jungen Soldaten herein, der uns schon bei der Ankunft versorgte hatte.
In Händen hielt er ein Tablett mit Brötchen, Moretum und eine kleine Tonschüssel, in der goldener Honig schimmerte. Der Duft, der dem Krug entströmte, offenbarte, dass es sich um angewärmtes Mulsum handeln musste, einen ebenfalls mit Honig versetzten Würzwein.
Rasch räumte ich das Geschirr des Vorabends zusammen und schaffte auf dem Tisch Platz für das Frühstück, das der Soldat dort abstellte.
»Wenn du anschließend ein Bad nehmen möchtest, Domina«, fragend blieb er stehen, »die Baderäume stehen dir jederzeit zur Verfügung.«
»Das wird nicht nötig sein.«
Eine andere Antwort hatte ich nicht erwartet. Marcella besuchte nur ungern die öffentlichen Bäder. Da war ein Legionslager nicht gerade der richtige Ort, eine Ausnahme zu machen.
»Wie du möchtest.« Mit einem knappen Nicken wandte er sich zum Gehen. »Solltest du noch etwas benötigen, kannst du dein Mädchen schicken. Ich empfehle mich.«
Kaum hatte der junge Legionär den Raum verlassen, wies Marcella mich an, mich zu ihr zu setzen und mit ihr das Frühstück zu teilen. Halbherzig griff ich nach einem Brötchen und kaute darauf herum.
Seit den Ereignissen der letzten Monate war zwischen uns – der Tochter des Statthalters und ihrer Sklavin – eine scheue Vertrautheit erwachsen. Ein Gefühl, das ich ebenso genoss, wie es mir zuvor fremd gewesen war.
Dennoch verspürte ich wenig Appetit. Der Überfall der vergangenen Nacht steckte mir noch in den Knochen, und es wollte mir nicht gelingen, das Grauen über das Erlebte zu vergessen.
Wir aßen schweigend, und als wir fertig waren, erhob sich Marcella. »Die Höflichkeit verlangt es, dass ich den Finanzprocurator aufsuche und auch dem Kommandanten des Lagers meinen Dank abstatte sowie die Grüße meines Vaters überbringe.«
»Natürlich, Herrin.«
»Möchtest du mich begleiten, oder gibt es … Dinge, die du zuvor erledigen möchtest?«
Verlegen wich ich ihrem Blick aus. »Wenn du nichts dagegen hättest, Domina, würde ich mich gerne ein wenig im Lager umsehen.«
Marcella lächelte wissend. »Dem steht nichts entgegen. Anschließend kannst du unsere Sachen zusammenpacken. Ich nehme an, wir brechen noch heute wieder auf.« Mit diesen Worten hatte sie die Tür geöffnet und verschwand nach draußen.
Nachdenklich und verunsichert blieb ich zurück.
Die grausamen Ereignisse des Vortages hatten mir überdeutlich gezeigt, wie gefährlich die Lage an den Grenzen der Provinzen war. Unberechenbar und tödlich. Natürlich hatte ich von den Angriffen der Barbaren gehört. Auch hatte ich mit eigenen Augen die Flüchtlingsströme gesehen, die sich von den kleinen Gehöften und Ortschaften in die befestigten Städte ergossen.
Aber all das hatte mich nicht auf das wahre Ausmaß der Gefahr hier an Limes und Rhein vorbereitet, die ich nun zum ersten Mal am eigenen Leib erfahren hatte.
Eilig räumte ich die Reste des Frühstücks zusammen, steckte meine Haare auf und machte mich für einen kurzen Rundgang durch das Lager bereit. Nicht, dass ich mich wirklich wohl dabei fühlte, als Frau allein unter all den Soldaten. Doch als Begleitung des Finanzprocurators und Gäste des Kommandanten würde es niemand wagen, Hand an mich zu legen. Zudem war mein Wunsch, Flavus zu sehen, größer als meine Furcht. Ich schlug den Mantel um mich und trat nach draußen.
KAPITEL III
Das Gewitter der vorherigen Nacht hatte eine deutliche Abkühlung gebracht. Die drückende Hitze der letzten Tage war verflogen, und dumpfe Feuchtigkeit hing in der Luft. Von der regengetränkten Erde stieg feiner Dunst auf und mischte sich mit dem Rauch des Lagers und der Canabae, dem zugehörigen Dorf.
Aus den Augenwinkeln heraus nahm ich eine vertraute Gestalt wahr. Als ich mich umwandte, sah ich, dass Flavus aus einer der Unterkünfte kam, einer lang gestreckten Baracke, wie sie von den einfachen Legionären bewohnt wurde und von denen aufgrund der Truppenverschiebungen gerade viele leer standen. Offensichtlich hatte man nicht nur die Soldaten unseres Trosses, sondern auch die Knechte und Sklaven für die Nacht hier untergebracht.
Wie üblich trug Flavus eine knielange Tunica in einem blassen Taubenblau mit marinefarbener Borte am Saum, die ihn ebenso wie mich auf den ersten Blick als Sklaven des Statthalters der Provinz Gallia Belgica kenntlich machte.
Seine dunkelblonden Haare waren feucht, als käme er vom Bad, und auf Gesicht und Hals schimmerten winzige Wassertropfen im trüben Morgenlicht. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Aufgrund seiner Körpergröße überragte er die meisten der vorbeieilenden Soldaten um Haupteslänge, deutlich zeichneten sich die gut ausgebildeten Muskeln unter dem Leinenstoff seines Gewandes ab. Hitze schoss mir ins Gesicht, während ich beobachtete, wie er zu einem der Brunnen ging, einen mit Eisenringen beschlagenen Holzeimer mit Wasser füllte und sich damit wieder auf den Weg zurück zur Unterkunft machte.
Dann entdeckte er mich und hielt im Gehen inne. Sein Mund bog sich zu einem Lächeln, ohne Hast stellte er den Eimer neben sich ab und kam auf mich zu. Einige Schritte vor mir blieb er stehen.
»Wie geht es dir?« Sein Blick fiel auf die weißen Verbände, die meinen rechten Ellbogen und Unterarm bedeckten, die verkrusteten Abschürfungen auf der Innenseite meiner Handflächen, doch er berührte mich nicht.
Noch immer galt das Verbot, dass wir uns nicht sehen durften.
»Danke. Marcella und ich wurden gut versorgt. Und du?«
»Ich habe keinen Grund, mich zu beklagen, man kümmert sich hier vorbildlich um das Eigentum des Statthalters der Nachbarprovinz.« In seiner Stimme lag ein Hauch Ironie. Flavus war ein Krieger gewesen, bevor er von den Römern verschleppt, gebrandmarkt und versklavt worden war. Und ich, die ich selbst die Freiheit nie kennengelernt hatte, konnte nur ahnen, was es für ihn bedeutete, von den Soldaten seiner einstigen Feinde als unfreier Knecht behandelt zu werden, der noch weniger Rechte besaß als der niederste Rekrut, kaum mehr als eines der Pferde in den Stallungen. Selbst wenn er im Dienste einer der mächtigsten Männer nördlich der Alpen stand und gerade dessen Tochter als ihr persönlicher Leibwächter begleitete.
»Flavus, dieser Überfall gestern Nacht …« Noch immer erschauerte ich bei dem Gedanken an das Feuer, die Schreie der Sterbenden, den Anblick aufgeschlitzter menschlicher Leiber.
Ein Schatten glitt über sein Gesicht. »Den Göttern sei Dank, dass dir nichts geschehen ist.«
»Weißt du, wer das gewesen sein könnte? Ein Angriff auf offener Straße, gegen einen bewaffneten Tross mit fast zweihundert Soldaten?«
Seine Augen verengten sich. »Das Imperium ist nicht so uneinnehmbar, wie viele glauben.«
»Kanntest du die … die Angreifer?« Mein Atem setzte in der Erwartung seiner Antwort einen Zug lang aus.
Er wandte sich ab. »Nein.«
Erleichterung durchfloss mich. Flavus würde mich nicht belügen. Das verbot ihm schon seine Ehre. Dennoch wusste ich, dass es Dinge gab, über die er nicht offen sprach. Kämpfe, Verschwörungen, Überfälle – ich kannte nicht viel von dieser Welt jenseits des Rheins, die so plötzlich über die Grenzen des Imperiums hereingebrochen war, und es gab Fragen, die ich Flavus nicht zu stellen wagte.
Es war ein schmaler Grat, auf dem unsere Bindung verlief. Einerseits fühlte ich mich seiner unverbrüchlichen Treue sicher, zugleich wusste ich aber, dass auch er zu diesen Stämmen gehörte, die derzeit plündernd, brandschatzend und mordend über Dörfer und Gehöfte im Herzen des römischen Gebietes herfielen.
»Was denkst du, wird der Procurator als nächstes tun?«, fragte ich schließlich, um unser Gespräch in eine unverfänglichere Richtung zu leiten. »Er hat große Verluste erlitten, an Männern und …«
»… an Gold«, vollendete Flavus meinen Satz. »Die Soldkasse.«
Überrascht blickte ich auf. »Was sagst du da?«
»Die Angreifer haben einen Großteil des Staatsschatzes erbeutet, der eigentlich für die Löhnung der Soldaten in Bonna und Vetera bestimmt war. Ich habe gehört, wie einige der Männer darüber gesprochen haben.«
Plötzlich hatte ich das Gefühl, einen erneuten Schlag in die Magengrube erhalten zu haben, und der Zauber des neu erwachten Morgens verdüsterte sich. Ich verstand nicht so viel von Politik, um die gesamte Tragweite des Verlustes zu begreifen. Doch selbst jemandem wie mir, deren Lebensinhalt darin bestand, für das Wohl der statthalterlichen Familie zu sorgen, Kleider auszubürsten und gelegentlich aus verstaubten Schriftrollen vorzulesen, war nicht entgangen, dass es um die wirtschaftliche Situation des Imperiums schlecht bestellt war. Nicht nur, dass schon seit längerer Zeit eine herbe Inflation wütete und sich der Wert des Geldes noch schneller verminderte als der Silbergehalt der Münzen, die jedes Jahr mehr mit Kupfer gestreckt wurden. Auch die an allen Grenzen des Imperiums aufflackernden Kriegsherde schwächten das Reich zusätzlich. Die grausamen Raubzüge der hereinbrechenden Barbaren hatten über große Gebiete Gehöfte und Felder verwüstet und viele Menschen heimatlos gemacht, die als Flüchtlinge, hungernd, bettelnd oder stehlend in den größeren Städten Zuflucht und Obdach suchten.
Unmengen an Vorräten, Wertgegenständen, Silber und Schmuck fielen immer wieder den germanischen Plünderern in die Hände. Trotz des beherzten Eingreifens der Rheinflotte und der Limestruppen gelang es ihnen nicht selten, beträchtliche Teile der Beute aus dem Imperium herauszuschaffen. Viele der in vollem Korn stehenden Getreidefelder wurden bei diesen Angriffen dem Erdboden gleichgemacht oder in Brand gesetzt. Zum wohl ersten Mal seit Errichtung der Nordprovinzen vor beinahe dreihundert Jahren drohte die Versorgung der Bevölkerung und der in der Nähe der Grenze stationierten Einheiten ernsthaft zusammenzubrechen.
Dass die Kaiser sich nur noch auf die Macht und Loyalität ihrer eigenen Truppen stützen konnten, war längst kein Geheimnis mehr. Doch auch deren Treue währte nur so lange, wie sie bezahlt wurden, in barer Münze und mit den üblichen Vergünstigungen.
Wenn es stimmte, dass die Hälfte des Soldes geraubt worden war, dann waren die Folgen für die Soldaten, das Land und die umliegende Bevölkerung kaum ausdenkbar.
»Du wirkst erschüttert.« Dem Spott in Flavus’ Worten gelang es nicht, die darin enthaltene Sorge zu verbergen.
Auch er hatte seine Heimat verloren. Seine Sippe wurde von Verrätern in den eigenen Reihen hintergangen und an die Römer ausgeliefert, sein Vater und der Rest seiner Familie getötet. Lediglich die Frau seines Bruders und deren Sohn hatten das Massaker überlebt, wenn auch nur, um ebenfalls in die Sklaverei verkauft zu werden.
Ich wusste nicht, ob es für Flavus überhaupt ein Zuhause gäbe, in das er zurückkehren könnte, sollte er eines Tages wirklich seine Freiheit wiedererlangen.
»Das ist das Ende«, murmelte ich, »von diesem Verlust wird man sich nicht so leicht erholen.«
»Seit wann gibst du dich so schnell geschlagen?« Er war einen Schritt nähergetreten, sodass sich unsere Fingerspitzen fast berührten. Aber nur fast. »Noch ist nicht alles verloren, und ich bin sicher, der Procurator und der Kommandant brüten da drinnen bei einigen Bechern Würzwein schon einen Plan aus, wie die Situation noch zu retten ist.«
Skeptisch hob ich die Schultern. »Da wird ihnen der Kopf aber ganz schön rauchen, so bar ihrer Mittel. Ein Kommandant mit deutlich geschrumpfter Armee und ein Finanzprocurator mit abhanden gekommenen Schatztruhen.«
»Eine kluge Entscheidung, gerade diesen Tross anzugreifen, den größten Geldtransport zwischen den nördlichen Provinzen.« Mit dem Unterarm schob sich Flavus eine feuchte Strähne aus der Stirn. »Wer auch immer dahintersteckt, für ihn hat sich die Beute gelohnt.«
»Fragt sich nur …« Von einem Augenblick auf den anderen war ein schrecklicher Verdacht in mir aufgestiegen. »Woher konnten die Angreifer überhaupt wissen, dass just an diesem Tag ein solches Vermögen von Treveris in die Colonia Agrippina gebracht werden sollte? Und woher kannten sie die genaue Route? Das kann doch nicht alles nur Zufall gewesen sein! Sie müssen uns aufgelauert haben.«
Flavus’ Gesichtsausdruck nach zu urteilen war ihm gerade derselbe Gedanke gekommen. Seine Kiefermuskeln verhärteten sich, sein Blick wurde kalt. »Verrat?«
Ich schluckte, während ich versuchte, meine Gedanken zu ordnen. »Sieht ganz danach aus. Oder …«, flüsterte ich heiser, »hast du eine andere Erklärung dafür?«
Flavus’ Augen verengten sich, angespannt dachte er nach. »Es ist nicht vollkommen auszuschließen, dass es sich um einen Zufall handelte. Überall dringen die Krieger über die Grenzen. Daher wäre es durchaus möglich, dass dieser Zusammenstoß sich einfach so ergeben hat.«
»Ausgerechnet an dieser Stelle? In sicherer Entfernung von der nächsten Siedlung, Stadt oder auch nur einem Wachturm? Noch dazu in einem Gelände, wo der Weg hügelig, die Straßen so schlecht passierbar sind, dass die Soldaten ihre Formation aufbrechen mussten.«
Ein grimmiges Lächeln breitete sich auf Flavus’ Gesicht aus. »Keine Taktik, die den Römern völlig unbekannt ist. Vielleicht …«
»Findest du das etwa gut?«, entfuhr es mir heftiger als beabsichtigt. »Wir wurden auf offener Straße angegriffen, ausgeraubt und massakriert. Viele Männer sind tot, auf beiden Seiten. Und ich …« Wie zur Verdeutlichung meiner Worte hielt ich ihm meinen verletzten Arm hin, durch dessen Leinenbinden bereits Spuren der Salbe gesickert waren. »Ist es das, was du willst? Bist du stolz auf deine … deine Stammesbrüder, dass ihnen ein solches Glanzstück gelungen ist?« Atemlos hielt ich inne. »Auf welcher Seite stehst du?«
Flavus’ scharf geschnittenes Gesicht war blass geworden, die Sehnen an seinem Hals spannten sich an.
»Invita …« Der Klang meines Namens zwang mich, ihn anzuschauen. »Ganz gleich, was passiert, du sollst wissen, dass ich dich niemals verraten werde. Du stehst immer unter meinem Schutz, notfalls gegen meine eigenen Leute …« Den letzten Teil des Satzes stieß er heiser hervor, als könnte er selbst nicht glauben, was er da gerade sagte. »Ich habe dir mein Wort gegeben, weißt du noch? Bis in den Tod …«
Eine Spur von Verletztheit lag auf seinen Zügen, eine Frage, als wolle er wissen, ob ich noch immer an ihm zweifelte. Ein sengendes Schuldgefühl überkam mich, gepaart mit dem Verlangen, ihn zu berühren und ihm zu versichern, dass ich ihm vertraute wie niemandem sonst in dieser aus den Fugen geratenen Welt, mit Ausnahme von Marcella. Doch meine Zunge schien wie gelähmt.
Das Schicksal, diese seltsame Macht, schien einen eigentümlichen Sinn für Ironie zu haben. Mein ganzes Leben lang hatte ich, das Fundstück, die von der eigenen Mutter Verstoßene, mich nach einem Menschen gesehnt, zu dem ich wirklich gehörte. Und gerade, als ich nach all der Zeit der Ablehnung und des Misstrauens erkannte, dass ausgerechnet der Fremde von jenseits des Rheins, der mir aufgezwungen worden war, der Mensch war, auf den ich gewartet hatte, wurde mir der Umgang mit ihm verboten.
Nun standen wir hier, inmitten eines Legionslagers in Alarmbereitschaft, an der nordöstlichen Grenze des Reiches, zwischen schnaubenden Pferden und grimmigen Legionären, und waren uns so nah, dass wir uns berühren konnten. Dieser Barbar und ich.
Gegen meinen Willen überschwemmte mich eine Welle von Dankbarkeit und Liebe, dass es mir schwer fiel, den gebotenen Abstand zu ihm einzuhalten.
Doch befanden wir uns hier nicht mehr im Herrschaftsbereich des Statthalters der Belgica. Die ungerechten Verbote und Anordnungen seines Hausverwalters galten hier nicht, und wenn wir erst in Colonia wären, im Palast des Statthalters Postumus mit seinen langen Gängen und ausladenden Flügeln, den schmalen Gassen und dem geschäftigen Hafen der Stadt … Sicher würden sich dort Möglichkeiten für unbeobachtete Zusammenkünfte finden.
Und dieser Gedanke gab mir genügend Kraft, den Kopf zu heben und Flavus anzuschauen. Einige Herzschläge lang schien er durch mich hindurchzusehen. Sein verhangener Blick ging über die Ausdehnung des Legionslagers hinaus, in die Gebiete jenseits des Rheins, die Wildnis und Barbarei, in seine Heimat. Dann jedoch trafen sich unsere Augen, und der Ausdruck in seinen veränderte sich.
»Sei vorsichtig! Hier stimmt etwas nicht. Ich rieche es, wenn Verrat in der Luft liegt, und in dieser Provinz stinkt es ganz gewaltig.«
»Das muss von den Pferdeställen herkommen.« Mit gespielter Abscheu rümpfte ich die Nase. »Ist mir auch schon aufgefallen. Einfach grässlich, diese Biester. Überall lassen sie ihre Äpfel fallen.«
Ein spöttischer Funke blitzte in Flavus’ Augen auf, dann straffte er die Schultern. »Ich muss jetzt gehen, aber verlass dich drauf. Ich bin immer in deiner Nähe.«
Damit wandte er sich ab und bückte sich nach dem Eimer. Im Vorbeigehen streifte seine Hand meinen Unterarm, seine Finger glitten in meine. Doch nur für einen Moment, direkt löste er sie und war mit wenigen Schritten verschwunden.
Die Hitze, die plötzlich in mir aufstieg, ließ mich schwindeln, meine Haut prickelte, und ich wusste, dass dies nicht von der blassen Sonne herrührte, die nun endgültig durch die Wolken gebrochen war und den dunstigen Nebel vertrieb.
Mein Herz hämmerte, als ich mich auf den Weg machte, Marcella zu suchen.
Nur noch eine Tagesreise, dann hätten wir die Colonia erreicht, und dort würde ich eine Gelegenheit finden, mit Flavus allein zu sein.
Einen Moment dachte ich an seine Warnung, den Verdacht, dass hier Verrat im Spiel sei, und eine schleichende Unruhe befiel mich wie ein Schatten, der sich unerwartet aus der Dunkelheit herausschälte.
Doch mit einem Kopfschütteln streifte ich ihn ab.
Darüber wollte ich jetzt nicht nachgrübeln. Jeder Tag hatte seine eigene Sorge. Und im Augenblick wollte ich nur schnell Marcella finden, zusammenpacken und dann weiterreisen.
Colonia Claudia Ara Agrippinensium …
Mit diesem Bild vor Augen ging ich geradewegs auf das prächtige Gebäude des Kommandanten zu.
KAPITEL IV
»Ich denke, damit wäre alles geklärt.«
Während ich auf einen Wink von Marcella in den Raum schlüpfte, sah ich, wie der Finanzprocurator, in dessen Begleitung wir uns befanden, gerade seinen Becher abstellte und sich erhob.
Ein hochgewachsener, etwa fünfzigjähriger Mann in pflaumenblauer, silberdurchwirkter Tunica, den ich für den Kommandanten des Lagers hielt, stand ebenfalls auf. »Ich bedauere zutiefst, dass etwas Derartiges geschehen musste. Die Verluste sind herb.«
»In jeder Hinsicht.« Der Procurator nickte. »Wir verdanken es nur dem Eingreifen deiner Männer, dass wir nicht noch mehr Tote zu beklagen haben und sich zumindest die Hälfte der Soldkasse noch in unserem Besitz befindet.«
»Ich freue mich, dass ich dir helfen konnte.«
»Hab Dank für die Gastfreundschaft.«
»Das war doch das Mindeste. Die Verletzten werden bis zu ihrer vollständigen Genesung in unserem Valetudinarium gepflegt, ich werde sie dir nachschicken, sobald sie wieder stark genug für die Reise sind.«
Wortlos umfasste der Procurator kurz die Unterarme seines Gegenübers, eine stumme Geste des Dankes. Dann wandte er sich zum Gehen.
»Da ist noch etwas …« Die Worte des Kommandanten ließen den anderen in seiner Bewegung innehalten. »Die Reise so dicht an der Grenze ist nicht ungefährlich, wie du selbst erfahren musstest. Zudem hat Postumus weitere Truppen für seine Feldzüge angefordert. Daher«, fuhr er nach einer kurzen Pause fort, »werde ich mir erlauben, hundert Mann zusätzlich zu deiner persönlichen Sicherheit abzustellen. Sie werden deinen Tross bis zur Ankunft in der Colonia begleiten und von dort aus zu Postumus’ Truppen stoßen.«
Der Gesichtsausdruck des Procurators ließ keine Reaktion erkennen.
»Während der Reise unterstehen die Männer dem Befehl des Centurios Mucius Longinus. Sicher erinnerst du dich an ihn.«
Wie auf ein Stichwort öffnete sich eine Tür auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes, und der Erwähnte trat ein. Zum ersten Mal sah ich ihn bei Tageslicht, und auch wenn es bei Sklaven schlecht angesehen war, jemanden anzustarren, war es doch schwer, den Blick von ihm abzuwenden. Zwar war er nicht überdurchschnittlich groß, doch etwas an seiner Gestalt zog zwangsläufig die Aufmerksamkeit auf sich.
Und er war jung. Selbst seine wettergegerbten Züge, die von langen Märschen und blutigen Kämpfen zeugten, konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass er kaum dreißig Jahre zählen mochte. Ein geringes Alter für jemanden, dem ein solch wichtiger Posten übertragen worden war. Zweifelsohne hatte er sich in seiner bisherigen Laufbahn sehr verdient gemacht.
Er salutierte vor dem Kommandanten und dem Procurator. Dann entbot er Marcella seinen Gruß und schließlich einer vierten Person, die ich bisher noch nicht bewusst wahrgenommen hatte: Stolz aufgerichtet, mit herablassenden, aristokratischen Zügen stand ein Mann neben dem Procurator und musterte den Centurio nur kühl.
Ich kannte ihn. Er war etwa auf der Höhe, in der die Saar in die Mosel mündet, mit seinem Gefolge zu unserem Tross gestoßen, hatte uns den gesamten restlichen Weg begleitet und sich jeden Abend mit dem Finanzprocurator unterhalten.
Aber auch zuvor hatte ich ihn schon einige Male zu Gesicht bekommen, zu Hause in Treveris. Er war häufiger auf Gastmählern meines Herrn zugegen gewesen. Ein wichtiger Ratsherr mit guten Verbindungen zum Kaiserhaus. Vicus … Victor … Im Geist ging ich die unterschiedlichen Namen durch. Richtig, nun erinnerte ich mich. Marcus Piavonius Victorinus.
Ein bedeutender Mann also und zugleich Erbe großer Ländereien außerhalb der Stadt, wenn ich mich richtig entsann. Nur … weshalb begleitete er den Procurator auf einer solchen Mission?
»Ich nehme an, dir ist bereits mitgeteilt worden«, ergriff der Centurio das Wort, »dass meine Männer dir sicheres Geleit auf dem Weg in die Colonia geben werden.«
Der Procurator räusperte sich. »Dem ist so.« Anscheinend war er ohne Rücksprache vor vollendete Tatsachen gestellt worden.
»Gut.« Der Centurio nickte zufrieden. »Dann sollten wir bald aufbrechen, um noch vor Einbruch der Nacht unser Ziel zu erreichen.« Sein Blick glitt durch den Raum und blieb für den Bruchteil eines Atemzuges an Marcella hängen, bevor er sich abwandte und hinausging.
*
Der restliche Weg in die Colonia Agrippina erschien mir endlos. Dunkel und bedrohlich hingen schwere Wolken am Himmel. Die Erde war vom Regen aufgeweicht und schlammig, die Luft stickig und feuchtigkeitsschwanger.
Noch immer beschäftigten mich die Erinnerungen an den vergangenen Tag, während meine Verletzungen unter dem Verband, den der Lagerarzt vor unserem Aufbruch noch einmal erneuert hatte, dumpf pochten.
Eine unbestimmte Spannung schien über dem gesamten Tross zu liegen, trotz der Verstärkung durch die zusätzlichen Legionäre aus Bonna.
Scheinbar endlos schlängelte sich der Rhein durch die immer flacher werdende Landschaft, so breit, dass das gegenüberliegende Ufer weit entfernt wirkte, wie eine andere Welt. Eine Welt der Finsternis, des Krieges und der Barbarei. Eine Welt, die jeden Tag bedrohlich näher zu rücken und das Imperium zu überrollen drohte.
Marcella war wohl in stummer Zwiesprache mit ihrem Gott versunken. In einer Sphäre, die mir ebenso fremd erschien wie das gegenüberliegende Ufer des Flusses, in die ich ihr nicht folgen konnte und die doch so stark zu sein schien, dass sie die Wirklichkeit mit all ihren Gefahren und Schrecken nicht zu erschüttern vermochte.
Hin und wieder sprach sie mich an, erkundigte sich nach meinen Verletzungen, vergewisserte sich, dass es mir gut ging.
Ein weiterer Trost auf dieser seltsam unwirklichen Reise war es, Flavus vorne auf dem Kutschbock zu wissen.
Immer wieder musste ich an unser Gespräch denken, den beunruhigenden Verdacht. Wenn bei dem Überfall wirklich Verrat im Spiel, ein Kollaborateur aus unseren eigenen Reihen beteiligt war, dann schwebten wir alle in größerer Gefahr als bisher angenommen.
Allerdings hatte ich dafür keinerlei Beweise, nichts als die Mutmaßung und ein vages Gefühl, dass beim gestrigen Überfall die Barbaren nicht allein agiert hatten. Einige Male war ich versucht gewesen, Marcella auf meinen Verdacht anzusprechen. Doch wirkte diese so friedlich und in sich gekehrt, dass mich dieser Anblick die grässlichen Ereignisse der vergangenen Nacht vergessen ließ und zumindest zeitweise in ein Gefühl von Sicherheit hüllte, welches ich nicht mit unausgegorenen Vermutungen zerstören wollte.
Instinktiv ging meine Hand zu dem schweren Silberamulett in Form einer Mondsichel, welches ich an einem Lederband um meinen Hals trug und dass mich unter den Schutz der Mondgöttin stellen sollte. Zwar konnte ich dem Wirrwarr der unzähligen römischen, griechischen und anderen, in den verschiedenen Provinzen einheimischen Gottheiten nicht unbedingt etwas abgewinnen und wandte mich in meinen Gebeten lieber dem abstrakten Gott der Philosophen zu, welchen ich im Stillen den Unbekannten Gott nannte. Dennoch hatte dieses Amulett eine besondere Bedeutung für mich. Es gehörte zu den wenigen Dingen, die ich besaß, soweit eine Sklavin so etwas wie persönlichen Besitz ihr Eigen nennen konnte.
Und es war das Geschenk einer Frau, der ich vor nicht allzu langer Zeit begegnet war, und in der ich meine Mutter zu erkennen geglaubt hatte. Die Frau, die mich als Säugling im Straßengraben ausgesetzt hatte, wo mich entweder streunende Hunde, der Hungertod oder Sklavenhändler finden würden. In meinem Fall war es Letzteres. Meinem anschließenden Verkauf nach Divodurum Mediomatricorum verdankte ich eine recht unglückliche Kindheit als Magd in einem mediomatrischen Beamtenhaushalt. Eine Zeit, in der mir meine Aufsässigkeit und Wissbegier mehr Prügel eingebracht hatte als den meisten anderen in meiner Position und in der mich die Frage, weshalb mich meine eigene Mutter hatte loswerden wollen, aufs Heftigste umtrieb. Schließlich wurde ich an den Statthalter der Gallia Belgica, den Legatus Augusti pro praetore, verschenkt, Marcellas Vater, und lebte fortan in dessen Palast in Treveris.
Den seltsamen Verstrickungen des Fatums, des Schicksals, war es zuzuschreiben, dass ich in dieser Stadt einer Frau begegnen sollte, die sich Selena nannte. Eine Kräuterkundige, die diverse Tinkturen und Heiltränke verkaufte und zu der ich von Beginn an eine seltsame Verbindung spürte. Im Laufe der Zeit hatte sich mein Verdacht verdichtet, Selena könnte wirklich meine Mutter sein, die ich nie kennengelernt hatte. Doch im Moment großer Gefahr hatte sie mich ein weiteres Mal meinem Schicksal überlassen, zweimal sogar, wenn ich genau darüber nachdachte. Bei unserer letzten Begegnung hatte sie mir diesen Anhänger, das Symbol ihrer Schutzgöttin Luna oder auch Selene, wie sie die Griechen nannten, mitgegeben, verbunden mit einem Segenswunsch.
Und so versprach mir der Anblick des Amuletts stets aufs Neue Schmerz und Trost zugleich, eine bittersüße Erinnerung, die mich daran gemahnte, dass ich mehr war, mehr sein konnte als ein Fundstück, ein sprechendes Werkzeug, ein belebter Besitz, der nach Belieben verkauft oder verschenkt werden konnte. Und die meine Suche nach meiner Herkunft weiter am Leben hielt.
Meine Verletzungen pochten, der unverdünnte Wein, den ich zur Stärkung und Linderung getrunken hatte, machte mich schläfrig, dazu die schwüle, von Feuchtigkeit getränkte Sommerhitze, das Schaukeln des Wagens auf nicht enden wollenden Straßen … Irgendwann fielen mir die Augen zu, und ich versank in einer Welt von Nebel und Schatten, in der sich Bilder von blitzenden Schwertern und brennenden Häusern mit dem Geruch von verbranntem Fleisch mischten.
Dennoch erwachte ich nicht, bis sich schließlich die Nacht über Niedergermanien senkte, wir endlich das südliche Tor der Colonia Agrippina erreichten und langsam weiter ins Herz der Stadt rollten.
KAPITEL V
Mit einem Ruck kam der Wagen zum Stehen. Erschrocken fuhr ich zusammen, die Muskeln angespannt wie in Erwartung des Lärms und der Schreie eines erneuten Barbarenüberfalls.
Doch alles blieb ruhig. Eilige Schritte, respektvoll gemurmelte Worte und das Licht von Fackeln drangen durch die Fenster des Wagens zu uns herein. Schließlich wurde der Schlag geöffnet, und der behelmte Kopf eines Praetorianers oder Benefiziariers, der anscheinend zum Wachtdienst des niedergermanischen Statthalters abkommandiert war, schob sich herein.
»Dem edlen Saloninus Caesar, Sohn des erhabenen Gallienus Augustus, ist es eine besondere Ehre, die Domina Marcella, Tochter des Statthalters der Gallia Belgica, in seinem Palast als Gast begrüßen zu dürfen.«
Marcella nickte, ohne sich zu rühren.
Ich jedoch blinzelte. Sein Palast?
»Leider ist er im Augenblick verhindert, weshalb er seine Grüße nicht selbst überbringen kann. Wenn du es erlaubst, Herrin, werde ich mich daher um deine Sachen kümmern und dich und dein …«, sein Blick fiel auf mich, »dein Mädchen zu deinen Gemächern führen.«
Einen Moment lang zögerte Marcella. Auch ich wagte es nicht, eine unbedachte Bewegung zu machen. Soldaten des Kaisersohnes, ein persönliches Geleit? Entsprach das nur der gebührenden Höflichkeit gegenüber der Gesandtschaft des Procurators und Statthalters oder war es ein Versuch, uns unter Kontrolle zu halten?
»Domina?« Auf die erneute Anrede des Soldaten hin nickte Marcella und ergriff die Hand des jungen Mannes, der ihr die Stufen des Wagens hinabhalf. Eilig folgte ich ihr.
Auch Flavus war bereits vom Kutschbock gestiegen und wartete mit ausdrucksloser Miene neben dem Gefährt. Sein Blick streifte mich kurz, und ich las die unausgesprochene Warnung darin ebenso wie sein Versprechen, mich nicht aus den Augen zu lassen.
Zwei Sklaven halfen dem Finanzprocurator aus dessen Reisewagen, der unmittelbar vor unserem zum Stehen gekommen war. Von der langen Fahrt war seine Toga zerknittert, dennoch strahlte er die ruhige Autorität eines römischen Würdenträgers aus. »Ich werde mich nun hier verabschieden, Domina«, wandte er sich an meine Herrin.
Marcella nickte. »Ich bedauere, dass du es vorgezogen hast, nicht mit uns im Praetorium zu wohnen.«
Sacht wiegte der Procurator den Kopf. »Ich bedauere diese Entscheidung ebenfalls, doch habe ich gesellschaftliche Verpflichtungen meinem alten Freund, dem hiesigen Quaestor Decius Aurelius Celer gegenüber, den dein Vater ebenfalls sehr schätzt.«
Erneut nickte Marcella. »Ja, eine alte Freundschaft aus besseren Zeiten.«
»Sein Sohn Nonius müsste etwa in deinem Alter sein, und wenn ich deinen Vater recht verstanden habe, sähe er es gern, wenn du diese Verbindung durch eine, ähm, Freundschaft zu Nonius Aurelius Celer weiter festigen würdest.«
Trotz der Dunkelheit, die nur durch das flackernde Licht der Fackeln erhellt war, sah ich, wie Marcella errötete. »Das sähe er gerne, in der Tat.« Sie schien es vorzuziehen, das Thema nicht weiter zu vertiefen. Mir jedoch stockte bei der plötzlichen Erkenntnis der Atem. Das war also der Grund, weshalb der Statthalter seiner Tochter diese Reise gestattet hatte. Dass sie endlich ihre »Flausen« hinter sich ließe, besonders die Kontakte zu der verbotenen Sekte der Christen, und sich stattdessen einen Mann suchte, wie es einer Frau ihres hohen Standes und ihres Alters gebührte? Am besten noch den Sohn eines Freundes der Familie?
Wieso hatte sie mir gegenüber nie etwas davon erwähnt? Wer war dieser Aurelius Celer, der sogar das Vertrauen meines Herrn besaß?
»Noch eine Sache, Domina«, hakte der Procurator nach. »Der Großteil der Soldaten, die uns hierher begleitet haben, werden gleich morgen wieder aufbrechen und zu Postumus’ Truppen stoßen, um diese zu verstärken. Bei dem Überfall wurde einiges an Wagen und Material beschädigt. Dein Sklave hier …«, mit dem Kopf wies er auf Flavus, »scheint ein kräftiger Bursche zu sein und nicht ungeschickt, wie man gestern sehen konnte. Wenn du ihn für zwei Tage entbehren könntest, damit er hier mit anpackt, alles schnellstmöglich wieder in Ordnung zu bringen?«
Nein! In hilflosem Zorn biss ich mir auf die Lippen. Flavus entbehren? Gerade jetzt, wo wir endlich wieder Gelegenheit hätten, uns zu sehen, miteinander allein zu sein? Etwas, worauf wir so lange gewartet hatten? Ich spürte, wie meine Hände sich zu Fäusten ballten, und das Gefühl der Rechtlosigkeit, nicht über das eigene Leben verfügen zu dürfen, übermächtig wurde.
Kurz ging Marcellas Blick zu mir herüber, und ich sah, wie sehr ihr dieses Ansinnen missfiel, aber auch, dass sie wusste, wann es notwendig war, sich zu fügen. »Höchst ungern, Procurator«, gab sie schließlich zurück, »dieser Sklave ist mein Leibwächter, und ich vertraue ihm. Doch wenn es unabdingbar ist …«
»Ich bin sicher, dass es dir im Statthalterpalast an nichts fehlen wird, und du dort keine Leibwache benötigst. Ich jedoch wüsste seine Hilfe sehr zu schätzen.« Mit einer Hand gab der Procurator ein Zeichen, Flavus zu seinen Männern zu schicken. »Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Nur zwei Tage, Domina. Du erweist uns damit einen großen Dienst.«
»Nun denn …« Mit einem Nicken stimmte Marcella zu, und ich spürte, wie das Gefühl von Wut sich mit dem der Enttäuschung mischte, als ich dem Procurator nachblickte, der sich an seine Soldaten wandte. Er hatte nun die Pflicht, sich um den verbliebenen Rest der Soldkasse zu kümmern und dafür zu sorgen, dass dieser sicher untergebracht wurde.
Ohne dass ich es bemerkt hatte, war der Centurio Mucius Longinus zu uns herangetreten. Das Licht der Fackeln spiegelte sich lebendig in seinen schwarzen Augen. Sein ernster Blick war auf Marcella gerichtet. »Bitte erlaube mir, dich zu deinen Gemächern zu begleiten, Herrin, und mich zu vergewissern, dass du gut untergebracht bist.«
»Das ist überaus freundlich von dir. Hab vielen Dank.« Marcella nickte knapp.
»Es ist meine Aufgabe, dich sicher an das Ziel deiner Reise zu bringen, und noch ist diese Aufgabe nicht erfüllt.« Mit diesen Worten wandte er sich um und befahl den Bediensteten, unser Gepäck nachzubringen.
Mein Blick flog zu Flavus, der gerade von einem der Soldaten Anweisung erhielt, ihm zu folgen. Seine Augen suchten mich, und ich las den gleichen Zorn darin, den ich auch selbst empfand. Zugleich schenkte er mir ein schiefes Lächeln, eine stumme Botschaft, die mich ein wenig aufmunterte. Wir finden einen Weg, wollte er sagen, nur Geduld. Dann wandte er sich ab und folgte den Soldaten des Procurators.
Plötzlich spürte ich, wie erschöpft ich war. Unzählige Eindrücke stürmten auf mich ein. Das Gewimmel so vieler Menschen. Soldaten und Sklaven. Das Schnauben der erschöpften Pferde, ihr Schweiß, ihre Ausdünstungen. Der helle Schein der Fackeln, deren Rauch die Augen tränen ließ. Der schale Geruch, der vom Rhein hergeweht wurde.
Dunkel und bedrohlich erhob sich das Praetorium, die Residenz des Statthalters, vor uns, mehr eine Festung denn ein Palast. Ich musste den Kopf in den Nacken legen, um es in seiner ganzen Größe sehen zu können. Über seinen Dächern funkelten die ersten Sterne durch die aufgerissene Wolkendecke.
Ich beschleunigte meine Schritte, während ich hinter Marcella und dem Centurio das riesige Eingangsportal passierte, das mich wie das Maul eines Raubtieres verschluckte.
Der innere Flur war ebenfalls von Fackeln und Öllampen erleuchtet, so dass ich die farbenprächtigen Wandbemalungen erkennen konnte, die, von den zuckenden Flammen angestrahlt, beinahe lebendig wirkten.
Gedämpft vernahm ich die flüsternden Stimmen der Hausdiener, die uns begrüßten und das Gepäck hereinbrachten, die genagelten Stiefel der Praetorianer, die respektvoll zur Seite traten, den Stab des Finanzprocurators und die Tochter des Statthalters umsäumten.
Nur am Rande bemerkte ich, wie nach einigen Schritten die Männer des Procurators abzweigten und uns nur noch wenige Palastwachen begleiteten. Lediglich der Centurio Longinus wich nicht von unserer Seite, und ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit durchströmte mich, ähnlich wie ich es empfunden hatte, als er uns aus der Gewalt der fränkischen Angreifer gerettet hatte.
Seltsame Blicke, murmelnde Stimmen. Auch wenn ich nicht wusste, woher dieses Gefühl kam, hatte ich den Eindruck, von unsichtbaren Augen beobachtet zu werden. Vorhänge, die Eingänge vom Flur abtrennten, schienen sich wie von selbst zu bewegen, und fast lautlos schlossen sich Türen hinter uns.
Das Hämmern meines Herzens kam mir fast so laut vor wie meine Schritte auf dem kalten, rötlichen Marmorfußboden. Meine Augen suchten Marcella, doch wenn sie diese seltsame Stimmung ebenfalls wahrgenommen hatte, ließ sie sich nichts davon anmerken. Höflich wechselte sie einige Worte mit dem jungen Centurio, der neben ihr her schritt.
Je weiter wir kamen, desto deutlicher wurde ein Geräusch, ein seltsames Scharren, ein ersticktes Wimmern. Fragend sah ich Marcella an, doch der Centurio, seine Männer und die Kammerdiener, die uns begleiteten, schritten weiter voran.
Das Wimmern wurde lauter, unterbrochen von dumpfen Schlägen. Eine ungute Ahnung kroch meine Wirbelsäule hinauf, während wir in einen Seitenflur einbogen, wo sich wohl die Gästezimmer befanden.
Dann blieb ich so plötzlich stehen, dass einer der Palastwachen beinahe über mich gestolpert wäre: Ein hagerer, hochgeschossener Mann in einem bodenlangen weißen Gewand, wahrscheinlich der Hausverwalter, hatte eine junge, blonde Sklavin in etwa meinem Alter gepackt. Mit der einen Hand hielt er sie fest, während er ihr mit der anderen eine Tracht Prügel verabreichte, sodass die Schläge seines Ledergürtels im hohen Flur widerhallten. Eine Woge von Mitleid überkam mich, war ich in meinem Leben doch schon so oft selbst gezüchtigt worden.
Ehe ich wusste, was geschah, war der Centurio vorgetreten, hatte sein Schwert gezogen und stieß mit der flachen Klinge den Verwalter von der Sklavin weg, die, aus dessen Griff befreit, mit einem unterdrückten Aufschluchzen zu Boden sank.