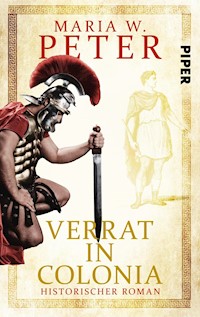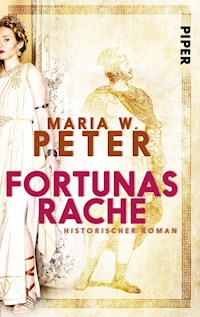
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Folgen Sie Sklavin Invita ins römische Trier. Historische Spannung von HOMER-Preisträgerin 2018 Maria W. Peter Seit sie denken kann, ist Invita eine Sklavin, doch durch einen Winkelzug des Schicksals, beherrscht sie die Kunst des Lesens und Schreibens, auch sonst scheut sie sich nicht, ihre Meinung zu sagen. Nun arbeitet sie im Haus des Statthalters zu Trier, wo sie ihr Temperament und Eigensinn immer wieder in Schwierigkeiten bringen. Kein Wunder also, dass Invita sofort verdächtigt wird, als einer der Sklaven spurlos verschwindet – da muss die junge Frau doch ihre Finger im Spiel haben! Um ihrer Strafe zu entgehen, beginnt Invita, selbst Nachforschungen anzustellen und stößt schon bald auf ein unerwartetes Geheimnis …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-98355-6
Mai 2017
Die »Invita«-Reihe ist ursprünglich bei Bastei Lübbe erschienen.
© der Originalausgabe: Bastei Lübbe AG, Köln 2007
© dieser Ausgabe: Piper Fahrenheit, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2017
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Kartenzeichnung von Helmut W. Pesch
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: lynea,Nik Merkulov,Innochka / shutterstock.com und burnel1_shutterstock
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Widmung
Für
Charity Goodwin
St. Louis, Missouri
Zitat
Zum Edlen macht uns nicht ein Ahnensaal
voll rauchgeschwärzter Familienbilder.
Kein Vorfahr hat sich für unseren Ruhm abgemüht,
und was vor uns war, gehört uns nicht.
Allein die Gesinnung macht den Edlen aus,
sie allein kann sich aus jeder Lebenslage
über das Schicksal erheben.
Seneca
KAPITEL I
Ab Urbe Condita 1012 (260 n. Chr.)
Alle einschlägigen Philosophen sind sich in dem Punkt einig, dass das Fatum, unser aller Schicksal, manche Menschen dazu auserkoren hat, meist auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen, während andere dazu bestimmt sind, immer wieder in wichtigen Dingen zu versagen.
Natürlich kann ich nicht nachweisen, ob diese Aussage tatsächlich auf alle Menschen zutrifft. Wenn ich mich jedoch selbst betrachte, könnte da durchaus was dran sein. Mein Fatum zumindest scheint sich gerade wieder bemüßigt zu fühlen, mich daran zu erinnern, unter welchem Stern ich gemeinhin stehe und dass ich meist selbst ganz kräftig an diesem zweifelhaften Glück geschmiedet habe.
Und bisweilen trifft mich diese Erkenntnis wie ein Blitz aus heiterem Himmel.
»Dacht ich’s mir doch!«
Bevor ich die Bedeutung dieser Worte verstehen konnte, packte mich eine Hand am Arm und riss mich herum.
Die Zähne zusammenbeißend blickte ich in das bullige Gesicht des Aufsehers Celsus, das vor Freude oder Trunksucht gerötet war. Ich versuchte mich loszureißen, doch sein Griff hielt mich fest wie eine Eisenklammer.
»Elende kleine Diebin!« Sein Atem roch unangenehm, und seine wässrigen, geröteten Augen durchbohrten mich.
Verkrampft hielt ich den Atem an. Ein warnendes Ziehen kroch meine Wirbelsäule hinauf. Die große Bibliothek, fast bis zur Decke mit Regalen vollgestopft, in denen sich sorgfältig etikettierte Schriftrollen stapelten, wurde von der blassen Sonne durchflutet. Staubkörner tanzten im schräg hereinfallenden Licht. Ich hatte noch immer den Wischlappen in der Hand.
Mit seiner grobschlächtigen Pranke packte Celsus meinen anderen Arm und bog mein Handgelenk herum, bis die Knochen knackten und ich den Lappen fallen ließ.
Glaubte er etwa, der sei auch gestohlen?
»Au!« Schmerzhaft wand ich mich unter seinem Griff. »Lass mich los! Ich mache hier sauber. Siehst du das nicht?«
Sein herablassendes Grinsen traf mich wie ein Schlag. »Das könnte dir so passen. Ausgerechnet du!« Seine großporige Nase kam näher. »So, so? Also die Made im Speck!«
Ich weiß nicht, wie er es fertigbringt, gleichzeitig so selbstzufrieden und so bedrohlich zu klingen.
Wütend versuchte ich mich loszureißen, doch er hielt mich mit eisernem Griff fest. Am nächsten Tag würde ich überall, wo er mit seinen dicken Fingern zugedrückt hatte, blaue Flecken haben.
»Was hast du hier gesucht, eh?« Er packte mich an den Schultern und schüttelte mich, als sei ich selbst ein Putzlappen. »Du kannst mir nichts vormachen, ich hab’s genau gesehen!«
Mein Kopf schlug hart gegen das Regal. Eine Schriftrolle fiel aus meiner Tunica und landete direkt vor seinen Füßen.
»Aha!«, meinte er.
Leugnen war zwecklos, so viel zumindest war jetzt sicher.
Mit einem beinahe triumphierenden Gesichtsausdruck bückte er sich, hob das Corpus Delicti auf und hielt es mir direkt vor die Nase.
»Und was ist das?«
Wenn du lesen könntest, wüsstest du’s, schoss es mir durch den Kopf.
»Senecas Briefe!«, presste ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Sein Griff begann allmählich richtig wehzutun.
»Aha, und wer hat dir erlaubt, fremde Post zu lesen?« Hohlkopf! Trotz meiner bescheidenen Lage hätte ich beinahe gelacht und ihn darüber aufgeklärt, dass der alte Seneca keinesfalls der Brieffreund des Dominus sein konnte.
Ich schwieg. War wahrscheinlich besser so.
»Du hast also wirklich gar nichts dazugelernt? In all den Monaten!« Abfällig blies er mir seinen Atem ins Gesicht. Die ganze Situation wurde langsam ungemütlich. »Und weshalb? Ist das, was dieser Senoca deinem Herrn mitzuteilen hat, etwa zwanzig Rutenstreiche wert, he?«
»Seneca!«, brachte ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Dumm wie Bohnenstroh, aber Aufseher!
»Was hast du dir dabei gedacht?« Sein Gesicht wurde noch eine Spur roter. Es musste ihn furchtbar beunruhigen, gewisse Dinge einfach nicht verstehen zu können.
»Na? Was denn?«
Gar nichts hatte ich dabei gedacht. Es hätte auch niemand einen Schaden davongetragen, wenn er nicht überall seine aufgequollene Nase reinstecken müsste.
»Dann komm mal mit!«
Wie ein wertloses Beutestück packte er mich an meiner Tunica und stieß mich vor sich her. Etwas in meinem Hinterkopf sagte mir, dass ich mich mal wieder selbst in diese Lage manövriert hatte. Zornig brachte ich diese Stimmen zum Schweigen, während ich versuchte, nicht die Kellertreppe hinunterzustürzen. Celsus’ Griff hielt mich fest. Vor einer schweren Eichentür blieb er stehen. Wichtigtuerisch klapperte er mit dem Schlüsselbund und sperrte schließlich auf.
Das Ergastulum! Oder wie auch immer man hierzulande die Bestrafungszelle für Sklaven nennen mochte. Die Luft war zum Schneiden. Ein allzu bekannter Geruch schlug mir entgegen. Unwillkürlich versteifte ich mich, und ein Anflug von Panik flackerte in mir auf.
Celsus stieß mich nach vorne. Unsanft landete ich auf dem Boden, verbiss mir aber den Schmerz. Ich presste auch noch meine Zähne zusammen, als er mit seinen Wurstfingern an den in die Wand eingelassenen Ketten herumfingerte und sie an meinen Handgelenken befestigte. Das war vollkommen überflüssig! Von hier konnte man nicht fliehen. Das wusste ich aus Erfahrung.
»Hier kannst du dich schon einmal in Geduld üben und beten, dass der Vilicus nicht auch noch die zwanzig Hiebe für angemessen hält!«
Böse starrte ich ihn an, rührte mich aber nicht. Manchmal soll Schweigen ja Gold sein.
Er wirkte geradezu erfreut, als er sich aufrichtete und zur Tür ging. »Oh! Arma virumque cano …«
Von Waffen will ich singen und dem Mann … Das war wohl der einzige Vers, den dieser Holzkopf kannte.
Mit einem lauten Krachen fiel die Tür ins Schloss.
Er hätte sich nicht über Vergils Aeneis lustig machen dürfen, der Trottel.
Von mir aus über Catull oder Ovid mit ihren kitschigen Liebesgedichten, doch nicht über Vergil! Vergil ist ein Dichter, der sich nicht mit verlogenen Seichtigkeiten abgibt. In seiner Aeneis schreibt er über eine verlorene Heimat, die Suche nach Familie und Identität. Und das ist etwas, über das man nicht scherzen sollte.
Davon könnte ich selbst ein Lied singen, obwohl ich nicht einmal behaupten kann, dass ich nach Heimat oder Familie suchte. Ich besitze weder das eine noch das andere. Deshalb vermisse ich beides wohl mehr als jeder andere, für den dies alles eine Selbstverständlichkeit bedeutet.
Natürlich gehöre ich im rechtlichen Sinne zur Familia meines Herrn, des Legatus, wie der Statthalter hierzulande heißt. Seit etwa vier Monaten bin ich nun Teil seines Hauses, des Ersten Hauses der Stadt, wie es so stolz heißt. Aber offenbar weiß hier niemand so recht, wohin man mich stecken soll.
Sicher, ich kann lesen, schreiben und eigenständig denken. Neben Latein spreche ich natürlich fließend den belgisch-keltischen Dialekt der Gegend, wenn auch mit einem Akzent, dem meine in Divodurum Mediomatricorum verbrachte Kindheit deutlich anzuhören ist. Außerdem verstehe ich sogar ganz leidlich Griechisch und habe zudem eine Menge germanischer Schimpfwörter von ein paar Stallburschen aufgeschnappt.
Aufgrund meiner Bildung hätte ich es hier im Haus durchaus zu etwas bringen können. Doch mit meinem schlechten Ruf war das nicht möglich. Ich möchte gar nicht wissen, welche Charaktermängel man sich über mich bereits notiert hatte. »Vorlaut, unzuverlässig, verlogen« und, um all dem die Krone aufzusetzen, »musste öfter wegen Diebstahls bestraft werden«.
Dabei stehle ich nicht wirklich. Ich gehöre nicht zu den Sklaven, die es sich zur Gewohnheit gemacht haben, die besten Teile aus der Küche mitgehen zu lassen, um damit ihren persönlichen Speiseplan aufzustocken, auch auf die Gefahr hin, dass ein anderer den Verlust ausbaden muss. Auch habe ich noch nie irgendwelche Wertgegenstände wie Schmuck oder Tafelsilber eingesteckt.
Meine Schwäche sind nun einmal die alten Dichter und – was noch verführerischer ist – die großen Philosophen mit ihren Reden über Würde und Größe der Seele. Ich glaube, ohne diese Körnchen geistiger Nahrung wäre ich schon längst verrückt geworden. Und um an die philosophischen Werke ranzukommen, muss ich mir eben hin und wieder ein paar Schriftrollen ausborgen, mich in der geringen Freizeit dann in irgendeine Ecke verdrücken und sie in aller Ruhe studieren.
Dabei hatte ich sie jedes Mal wieder zurückgebracht; zumindest, wenn das irgendwie gefahrlos möglich war.
Doch all diese Kapriolen hatten meinem vorherigen Herrn wohl genügt, um mich aus dem Haus haben zu wollen. Missmutig hatte er mein Treiben eine Zeitlang beobachtet und schließlich versucht, mich bei der nächstbesten Gelegenheit loszuwerden. Er war ein angesehener Vertreter des Stadtrates in Divodurum, bevor er, einem höheren Ruf folgend, nach Rom umsiedelte, um dort in der Karriereleiter weiter aufzusteigen. Bei dieser Gelegenheit hatte er alles zurückgelassen, was ihm lästig war oder unliebsame Erinnerungen weckte.
Ich gehörte offenbar auch dazu. Um genau zu sein, war ich Teil des Unterpfandes für die politische Karriere seines Sohnes gewesen. Dieser war ein Tagedieb und Tunichtgut, dessen ganzer Ehrgeiz offenbar darin bestanden hatte, den Namen seines Vaters mit seinen Betrügereien zu besudeln. Statt ihn wie jeden Normalsterblichen dafür die Härte des Gesetzes spüren zu lassen, ließ sein Vater, mein damaliger Herr, beim Statthalter der Gallia Belgica seine Beziehungen spielen. Als kleine Aufmerksamkeit und um seiner Bitte, in diesem speziellen Fall doch ein Auge zuzudrücken, den entsprechenden Nachdruck zu verleihen, ließ er vor seiner endgültigen Abreise nach Rom neben teurem Silbergeschirr und Schmuck aus nordischem Bernstein auch noch eine junge Sklavin – nämlich mich – gut verschnürt als großzügiges Geschenk überreichen. Was dazu führte, dass der Sohn nun in der Finanzverwaltung sitzt, ich mich hingegen zwischen Karottenschalen und Getreidespelzen in der Küche des Statthalters wiederfand, der erst seit kurzem seinen Amtssitz in der Colonia Augusta Treverorum hatte, der Hauptstadt der Treverer, kurz auch Treveris genannt.
Im Grunde konnte mir das nur recht sein. Wenn die Gerüchte stimmen, stamme ich sogar aus dieser Stadt. So genau kann das niemand sagen. Alles, was ich weiß, ist, dass ich als Säugling von einem mitfühlenden Wesen im Straßengraben aufgegabelt und an einen reichen Beamten in Divodurum verscherbelt wurde, der noch Wert darauf legte, die hauseigenen Sklaven von Kindesbeinen an selbst heranzuziehen. Das hatte mich davor bewahrt, streunenden Hunden zum Opfer zu fallen, und meinem Finder ein paar Silberdenare und gleichzeitig die Erkenntnis eingebracht, dass die Göttin Justitia Taten der Barmherzigkeit zuweilen in barer Münze vergilt.
Dabei gibt es genügend Möglichkeiten, ehrenhaft in die Sklaverei zu gelangen. Entweder gerät man als aufrecht besiegter Kriegsgefangener in die Knechtschaft, oder man wird als so genannter Verna in den Haushalt geboren, was einen durchaus angesehenen Status darstellt und zumeist eine gehobene Stellung mit sich bringt.
Von allen Möglichkeiten hat mir das Fatum, Fortuna oder wie man hierzulande die Schicksalsgewalt auch nennen mag, ausgerechnet die unerfreulichste ausgewählt. Wie ein überflüssiges Gepäckstück an der nächsten Straßenecke entsorgt zu werden bedeutet wohl kaum einen guten Start ins Leben.
Ich hätte meine Mutter gern gekannt. Wenn ich allein bin, kommt mir häufig die Frage in den Sinn, was für ein Mensch sie gewesen sein mag, dass sie es fertigbrachte, mich einfach so auf der Straße auszusetzen. Meist versuche ich, nicht daran zu denken. Wer kann sich in meiner Lage den Luxus des Selbstmitleids schon erlauben? Aber an manchen Tagen kann ich einfach nichts dagegen tun. Vielleicht hatte sie gar keine andere Wahl gehabt, als mich wegzugeben. Aber jedes Mal, wenn ich daran denke, brennt diese Vorstellung wie eine offene Wunde.
Am schlimmsten ist jedoch der Gedanke, dass vielleicht ich selbst – und nicht irgendwelche mysteriösen Umstände – der Grund dafür gewesen war, weshalb meine Mutter mich loswerden wollte. Ob vielleicht irgendetwas an mir so abstoßend wirkte, dass selbst die eigene Mutter mich nicht bei sich haben wollte?
Doch was könnte das gewesen sein?
Gut, vielleicht bin ich keine blendende Schönheit. Meine Haare, die ich, seit ich in diesem Hause bin, jeden Morgen in einem Knoten zu bändigen versuche, haben mehr die Farbe von Rost als von Kupfer und stehen in drahtigen Locken von meinem Kopf ab. Meine Nase ist voller Sommersprossen, was mir irgendwie den Ausdruck von Aufsässigkeit gibt. Ich weiß nicht, wie viele Leute darüber schon gespottet haben. Aber zumindest daran kann ich wirklich nichts ändern.
Leider besitze ich jedoch ein ausgeprägtes Talent dafür, mich immer wieder in Schwierigkeiten zu bringen, was mir wohl auch meinen Namen eingebracht hat. Andere Sklaven heißen Modestus, Sedulus oder Dedicatus, der Bescheidene, der Fleißige oder der Ergebene. Mich hatte man schon als Kind Invita genannt, die Widerwillige, was wohl beschämend war, aber immer noch besser als manch andere Ausdrücke, mit denen ich bisweilen tituliert wurde, wobei Inventa – Fundstück – das Einzige war, was mich wirklich verletzte.
Dabei bin ich alles andere als dumm. Schon immer hatte ich eine gute Auffassungsgabe. Ich lernte schneller lesen als der Sohn des Hauses, dessen endlosen Unterrichtsstunden ich nur deshalb beiwohnen durfte, weil ich bereits als kleines Mädchen dem Erzieher des Hauses zur Hand gehen musste. Heute noch kenne ich ganze Passagen mancher Werke auswendig. Das hilft über trockene Zeiten hinweg oder vertreibt die Furien im Kopf, wenn sie mir einreden wollen, ich hätte mich ein weiteres Mal in die Nesseln gesetzt.
So wie gerade jetzt wieder.
Es war nicht das erste Mal, dass ich im Ergastulum festsaß. Und wie ich mich kannte, wohl auch nicht das letzte Mal. Es sei denn, der Statthalter entschloss sich dazu, mich gleich wieder auf dem Sklavenmarkt zu verkaufen, um mich endgültig loszuwerden.
Allein die Vorstellung, wohin es mich dann verschlagen könnte, sollte mich eigentlich dazu bringen, beim »Entleihen« von Schriftrollen etwas mehr Zurückhaltung zu üben. Zwar nehme ich mir dies immer wieder vor, wenn aber Literatur und Weisheit locken, werde ich meist doch wieder schwach.
»Weg mit den Büchern, lass dich von ihnen nicht einfangen; da liegt deine Bestimmung nicht«, sagte schon unser verehrter Philosophenkaiser Marc Aurel. Und der musste schließlich wissen, wovon er sprach.
Missmutig saß ich in der Dunkelheit und dachte nach. Vielleicht war es wirklich besser, mich in der nächsten Zeit ruhig zu verhalten.
Ich war nicht übertrieben ehrgeizig, doch konnte es nicht schaden, die eigene Stellung im Hause aufzuwerten. Ständig verdreckte Küchenböden und Latrinen zu schrubben war nicht gerade das, was ich mir auf lange Sicht vom Leben erhoffte.
In der Zelle wurde es kühl und ungemütlich. Außerdem bekam ich allmählich Hunger.
Das war ein Anlass, mir selbst gegenüber Besserung zu geloben und mir vorzunehmen, jetzt gleich damit anzufangen. Zwar heißt es, das Schicksal sei für jegliche Widrigkeit unseres Lebens verantwortlich, doch hegen sogar manche Philosophen den Verdacht, bisweilen könnte unser eigenes Verhalten auch eine kleine Rolle spielen. »Dein Charakter ist dein Schicksal«, sagte schon Heraklit, und so manches Mal, wenn ich Prügel bezogen hatte, war es ausgerechnet dieser Satz, der mir schmerzhaft in den Sinn kam.
Da ich also nicht mein Schicksal, sondern lediglich mich selbst ändern konnte, setzte ich mein umgänglichstes Gesicht auf und fasste mich in Ergebenheit, damit Celsus, der mich hoffentlich in nächster Zeit wieder rauslassen würde, auch sehen konnte, dass er es mit einer Geläuterten zu tun hatte.
Diesmal dauerte es drei volle Tage, bis der Mistkerl mich aus dem Ergastulum entließ. Und nur ein einziges Mal in der ganzen Zeit hatte er mir etwas zu essen gebracht, mit einem so beglückten Grinsen auf dem Gesicht, dass es mir ziemlich schwerfiel, meine Vorsätze wahr zu machen und ihm keine patzige Antwort zu geben. Wahrscheinlich war es jedoch nur die Angst vor den angedrohten Schlägen, die mich schweigen ließ. Ich wusste, wie er die Peitsche führte, und war dankbar, nun doch nicht in diesen zweifelhaften Genuss gekommen zu sein.
Selbst ich weiß eben bisweilen, wann es besser ist, den Mund zu halten.
Celsus’ Stimmung schien immer noch ausgezeichnet zu sein, als er mich schließlich laut pfeifend von meinen Ketten befreite, wobei er nicht gerade große Feinfühligkeit an den Tag legte. Empört schrie ich auf und biss mir noch gerade rechtzeitig auf die Lippen, um nichts Unüberlegtes zu sagen.
Helles Morgenlicht blendete mich. Einen Fluch unterdrückend rieb ich mir die schmerzenden Handgelenke, während ich hungrig in die Küche humpelte. Der Geruch von frisch gebackenem Brot und dampfender Getreidegrütze ließ meinen Magen rebellieren. Ich hatte seit Ewigkeiten nichts mehr gegessen.
Unter dem scharfen Blick zweier Wäscherinnen, die sich in der Küche zum Tratschen versammelt hatten, steckte ich mir ein paar Honigplätzchen in den Mund und spülte schnell mit einem Becher Wasser nach. Wer weiß, wann ich das nächste Mal etwas bekommen würde.
»Huch, Invita, dein Geruch verrät, wo du gerade herkommst!«
Wütend starrte ich Parvula an, eine hellhäutige Küchenmagd, die gerade dabei war, ein braun gefiedertes Huhn zu rupfen, wobei die Federn durch die ganze Küche stoben.
»Manche Dinge lassen sich eben nicht vermeiden!«, gab ich bissig zurück und nahm noch ein Stück trockenes Brot, auf dem ich wütend herumkaute.
Doch wo sie recht hatte, hatte sie recht. Nach Tagen im Ergastulum konnte ich unmöglich besonders gepflegt wirken.
Kurz entschlossen steckte ich meinen Kopf in einen Bottich mit einigermaßen frischem Wasser, das später zum Putzen der Böden dienen sollte. So gut es ging, wusch ich Haare, Gesicht und Hals und schrubbte mir danach noch schnell über Arme und Beine. Mit einem nicht gerade sauberen Lappen rieb ich mich trocken und schüttelte die tropfnassen Locken. Zum Schluss klopfte ich meine Tunica aus und strich sie notdürftig glatt. Das musste fürs Erste genügen.
»Glaubst du, das reicht?« Parvula legte das kahl gerupfte Huhn beiseite und packte ein neues.
Statt einer Antwort grinste ich nur zurück und nahm noch ein Stück Brot.
Das kalte Wasser hatte mich so weit aufgemuntert, dass ich wieder klar denken konnte und imstande war, mir zu überlegen, wie ich meine guten Vorsätze am besten in die Tat umsetzen konnte. Gestärkt und erfrischt ging ich nach draußen in den Hof.
Die Frühlingsluft war kristallklar. Der Morgen schien wie geschaffen für einen Neuanfang. Gut gelaunt atmete ich durch, als ich das durchdringende Geräusch von Schlägen auf Holz hörte.
Ich blickte auf. Ein paar Schritte von mir entfernt war gerade ein junger Kerl dabei, das Holz für das Hypocaustum, die Fußbodenheizung, in gleichmäßige Scheite zu hacken. Er war mit ein paar Kniehosen, einer kurzen hemdähnlichen Tunica und knöchelhohen Stiefeln bekleidet.
Zweierlei erkannte ich sofort: Er war neu hier, und er würde Probleme machen.
Dabei kann ich nicht einmal behaupten, über eine besonders gute Menschenkenntnis zu verfügen, doch manche Dinge sind einfach offensichtlich. Immerhin trug er Fußfesseln, und seine honigfarbenen Haare waren kurz geschnitten, wobei man dem Ergebnis ansehen konnte, dass diese Prozedur nicht ohne Widerstand durchgeführt worden war.
Beeindruckt blieb ich stehen.
»Guten Morgen!«, sagte ich und versuchte mit den Fingern notdürftig die nassen, ineinander verhakten Locken zu entwirren.
Der Flegel blickte nicht einmal auf. Wortlos und verbissen hackte er weiter auf die Holzscheite ein, als hätte er jeden einzelnen davon zu seinem persönlichen Feind erklärt.
Er wollte also nicht mit mir reden. Verächtlich schüttelte ich den Kopf. Das würden wir ja sehen.
»Guten Morgen, habe ich gesagt!« Diesmal versuchte ich es in der geschliffensten Version des Belgischen und unterdrückte meinen mediomatrischen Akzent, in der Hoffnung, er könnte mich vielleicht dann verstehen.
Einen kurzen Augenblick sah er hoch. »Salve!« Dann schlug er wieder auf die unschuldigen Holzscheite ein.
Oh, der Gute sprach also doch Latein! Es klang zwar wie zwei aufeinander reibende Steine, doch hoffnungslos dumm war er offensichtlich nicht.
Einen Moment lang blickte ich ihn schweigend an und versuchte, ihn einzuschätzen. Bei dem Treiben, das im Haus von Politikern herrscht, hatte ich gelernt, mir schnell ein Bild von Fremden zu machen, doch irgendwie wurde ich aus seinem Typ nicht schlau.
Die Neugier in mir war erwacht. Eine Charaktereigenschaft, die mich bisher fast immer in Schwierigkeiten gebracht hatte.
Er war groß, nicht schlecht gebaut und schien an körperliche Arbeit gewöhnt zu sein. Doch irgendetwas an ihm war anders als beispielsweise bei den selbstverliebten Ringkämpfern oder protzigen Gladiatoren, die sich mit aufgeblähten Muskeln ihrem Publikum präsentieren. Er wirkte nicht massig, eher ausdauernd, starrköpfig und zäh.
Deswegen war er wohl auch in Ketten.
Ich beschloss, ihn nicht so einfach davonkommen zu lassen. Sich mit der Herrschaft anzulegen war eine Sache, doch Leute des eigenen Standes dermaßen abzufertigen gehörte sich einfach nicht.
»Was hat dich denn hereingeschneit?«
Er warf mir einen abschätzigen Blick zu, blieb mir jedoch eine Antwort schuldig.
»Willst du nicht reden oder hast du einfach keine Worte?« Vielleicht war sein lateinischer Wortschatz doch beschränkter, als es den Anschein hatte. Unbeeindruckt hieb er weiter auf das Holz ein. Allmählich wurde ich wütend.
»Ich glaube, so machst du dir hier nicht viele Freunde!« Stirnrunzelnd stemmte ich die Hände in die Taille. »Glaub mir’s, Junge. Und wie du aussiehst, kannst du gut welche gebrauchen.«
Jeder brauchte welche. Ich wusste am besten, wovon ich sprach.
Einen Moment lang traf mich sein Blick, ein spöttisches Aufblitzen seiner Augen.
Ich werde nie erfahren, ob meine Predigt ihn tatsächlich dazu gebracht hätte, mit mir etwas gepflegtere Konversation zu treiben, denn im selben Moment kam Celsus aus der Küche gestapft.
Sein Gesicht war immer noch gerötet, und seine Nase wirkte großporiger als sonst. Es sah aus, als hätte er die letzten Tage ausgiebig die Tatsache begossen, mich wieder hinter Schloss und Riegel gebracht zu haben.
Ohne mich eines Blickes zu würdigen, ging er direkt auf den Neuen zu. Wahrscheinlich würde er zur Abwechslung ihm eine Standpauke über Arbeit und Disziplin im Hause des Legatus halten. Bitte schön!
Ich hielt es für klüger, das Feld zu räumen, bevor Celsus noch auf den Gedanken kam, ich wirkte nach seiner Disziplinierung womöglich nicht zerknirscht genug. Dabei kann ich einigermaßen schauspielern, wenn es sein muss. Doch nicht selten verraten mich meine Augen, und man soll das Schicksal nicht unnötig herausfordern.
Ich verließ den Hof mit dem leichten Triumph, dass zumindest in nächster Zeit Celsus jemand anderen haben würde, mit dem er fertig werden musste. Ein Faktum, das seine Aufmerksamkeit von mir ablenken würde.
Wirklich, der Tag fing gar nicht so schlecht an!
Ich hatte mich zu früh gefreut. An diesem Tag sollte mir keine Ruhe vergönnt sein. Nachdem ich knapp Celsus’ ungemütlicher Präsenz entkommen war, entschloss ich mich, meine guten Vorsätze wahr zu machen und direkt an die Arbeit zu gehen, die durch meine Verbannung ins Ergastulum ein so plötzliches Ende gefunden hatte.
Mit energisch vorgerecktem Kinn machte ich mich auf den Weg zu einem kleinen Nebenraum der Küche, in dem die wichtigen Gerätschaften des Haushalts aufbewahrt wurden. Schnell würde ich mir Lappen und Bürste schnappen und weiter den Boden der Bibliothek polieren. Diesmal jedoch, ohne die Schriftrollen auch nur eines Blickes zu würdigen.
Noch bevor ich die grob beschlagene Holztür öffnen konnte, hörte ich Stimmen. Einen Moment hielt ich inne. Wer war so verrückt, freiwillig in der Abstellkammer herumzulungern? Seltsam rhythmische Worte drangen an mein Ohr, in einer Sprache, die ich nicht verstand. Ich zögerte. Das leise Ab- und Anschwellen des Flüsterns schien mir fast eine Warnung zu sein, lieber nicht einzutreten und das zu stören, was sich gerade hinter der verschlossenen Tür abspielte.
Doch mir blieb keine Wahl. Was auch immer dahinter lauerte, konnte unmöglich nur halb so schlimm sein wie das, was mich erwartete, wenn Celsus mich beim Nichtstun erwischte.
Kurz entschlossen riss ich die Tür auf.
Mitten in der Bewegung hielt ich inne und starrte auf das Bild, das sich mir bot.
Auf dem Fußboden kniete Foeda, mit dem Rücken zur Tür, das Gesicht dem kleinen Fenster zugewandt, durch das ein morgendlicher Lichtstrahl fiel. Aufgeschreckt durch mein Erscheinen fuhr sie zusammen, zögerte einen Moment und bückte sich dann, um einen hölzernen Eimer hinter einem Mauervorsprung hervorzuziehen. Danach wandte sie sich langsam zu mir um, und ich konnte sehen, dass ihre hellen Augen feucht schimmerten.
»Salve«, murmelte ich schnell, da mir gerade nichts Besseres einfiel.
»Salve!« Ihr Blick flackerte und schien dem meinen ausweichen zu wollen, doch dann sah sie mir direkt in die Augen, und ihre Züge wurden weich. »War es schlimm?«
Verärgert schüttelte ich den Kopf. Offensichtlich wusste mittlerweile schon jeder von meiner unfreiwilligen Auszeit. Ich verspürte nicht die geringste Lust, darüber zu reden.
Allerdings gehörte Foeda nicht zu denen, die sich darüber freuten, mich den Zornesausbrüchen des Aufsehers ausgeliefert zu sehen. Im Gegenteil, sie blickte mich so mitleidig an, dass ich es fast als unerträglich empfand. Typisch Foeda.
Sie war ein zierliches Ding, klein, blass und unauffällig. Meistens ging sie still und zuverlässig ihrer Arbeit nach, sprach selten ein Wort, und wenn, dann meist, um schlichtend in irgendwelche Streitereien einzugreifen. Was also hatte sie heimlich hier in der Abstellkammer zu suchen, und mit wem hatte sie gerade geredet?
Möglichst unauffällig ließ ich meinen Blick durch den kleinen Raum schweifen, doch ich konnte niemanden entdecken. Seltsam, ich hatte sie ganz sicher sprechen hören.
»Invita …«
Erschrocken fuhr ich herum.
Direkt hinter mir, in der Türöffnung, stand Modestus.
Ich konnte nicht sagen, ob er gerade hereingekommen war oder sich die ganze Zeit schon hier im Raum aufgehalten hatte.
Misstrauisch blickte ich ihn an. »Was tust du hier?«
Modestus war der Bote des Statthalters und der Letzte, den ich in dieser Umgebung erwartet hätte. Stirnrunzelnd wanderte mein Blick von ihm zu Foeda und wieder zurück. Sollten sich hier Dinge abspielen, von denen ich nichts wusste?
»Gut, dass ich dich treffe, Invita!«
Erst jetzt bemerkte ich, dass sein etwas pausbäckiges Gesicht angespannt war und die sonst gutmütig dreinblickenden Augen nervös flackerten.
Immer noch wusste ich nicht, was ich von der Situation zu halten hatte. Es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder war er mir hierher gefolgt, oder ich hatte ihn und Foeda gerade gestört, bei was auch immer.
Diese hatte jedoch schon wortlos ihren Eimer ergriffen und machte Anstalten, wieder an die Arbeit zu gehen. Ohne Modestus auch nur anzusehen, trat sie an ihm vorbei und verließ den Raum.
Nachdenklich sah ich ihr hinterher.
»War es sehr schlimm, diesmal?« Modestus’ Stimme riss mich aus meinen Gedanken.
»Was soll schlimm gewesen sein?«
»Na …«, Modestus suchte nach Worten, »im Ergastulum.« Schamesröte schoss mir ins Gesicht. Den Nächsten, der mich das fragte, würde ich mit eigenen Händen erwürgen!
»Zumindest lebe ich noch«, gab ich zurück. Aus den Augenwinkeln heraus sah ich, dass das rundliche Gesicht von Modestus einen Farbton blasser wurde.
»Hat Celsus dich … ich meine, hat er …?«
Verärgert blieb ich stehen. »Er hat mich an den Füßen aufgehängt und mir die Haut vom Leib gerissen!«, fauchte ich böse. »Ist es das, was du hören wolltest?«
Modestus’ Gesicht war nun vollkommen weiß geworden. Sein Blick flackerte, und am Hals sah man ganz deutlich seinen Puls schlagen.
»Was ist los mit dir?«, knurrte ich, immer noch nicht bereit, ihm sein Eindringen in derart peinliche Angelegenheiten zu vergeben. »Hast du ein Gespenst gesehen?«
Abwesend starrte er an mir vorbei. »Celsus hat dich …«, stammelte er entgeistert, »und das nur wegen einer Schriftrolle, oh …« Von einem Augenblick auf den anderen schien Modestus völlig in sich zusammenzusacken, die Schultern hingen herab, und sein Kopf war ihm beinahe auf die Brust gesunken.
Erstaunt über diese Reaktion, versuchte ich meine Übertreibung zu relativieren: »Hör mal, wenn das wirklich stimmen würde, wäre ich dann noch in der Lage, hier vor dir zu stehen?«
Keine Antwort.
Augenblicklich verflog meine Wut. »Warum fragst du mich das alles?« Sanft griff ich seine Schultern, was ihn beinahe schmerzhaft zusammenzucken ließ, als hätte ich meinen Finger in eine Wunde gelegt.
»Es geht um …« Die letzten Worte murmelte er so leise, dass ich ihn kaum verstehen konnte.
»Um was?«
»Um Diodoros’ Ring.«
Einen Moment blickte ich Modestus völlig entgeistert an. Nur allzu gut erinnerte ich mich an das Drama, das der Hausverwalter Diodoros vor einigen Tagen veranstaltet hatte, als er seinen wertvollen Siegelring vermisste. Diesen protzigen Klunker hatte ihm der Statthalter vor einigen Jahren für besondere Verdienste geschenkt. Natürlich wurde gleich von Diebstahl gesprochen, obwohl ich es für wesentlich wahrscheinlicher hielt, dass Diodoros ihn, etwa beim Besuch der Thermen, verlegt oder verloren hatte. Da ich mich ausnahmsweise jedoch eines absolut reinen Gewissens rühmen konnte, hatte ich der ganzen Geschichte keine besondere Bedeutung beigemessen.
»Was ist mit dem Ring? Wurde er in der Zwischenzeit gefunden?«
Stumm schüttelte Modestus den Kopf.
»Was geht das dich denn an?«, meinte ich achselzuckend. »Soll der alte Griesgram doch ohne seinen Klunker auskommen. Er hält es doch ohnehin mit der Stoa.«
»Darum geht es nicht.« Umständlich kramte er in den Falten seines Gewandes und streckte mir schließlich seine Hand hin, in der etwas hell aufblitzte.
»Du hast den Ring?«, brachte ich schließlich hervor und starrte ungläubig auf seine Handfläche, auf der das gesuchte Schmuckstück lag. »Wie – wie konntest du so etwas nur tun?«
Ich war wirklich fassungslos. Ausgerechnet Modestus! Er war ein Musterknabe, geradezu vorbildlich sowohl der Herrschaft als auch dem Gesinde gegenüber. Nicht einmal im Traum wäre mir der Gedanke gekommen, jemand wie er könnte mit dem Verschwinden des wertvollen Kleinods irgendetwas zu tun haben.
»Ich hab ihn nicht gestohlen!« Seine sonst so ruhige Stimme klang gepresst. »Der Ring lag auf der Erde, und da ich in Eile war, steckte ich ihn zur Sicherheit erst einmal ein. Noch am selben Abend wollte ich ihn Diodoros zurückbringen, doch in der Zwischenzeit hatte er schon das ganze Haus alarmiert, und dann …«
»Dann hast du dich nicht mehr getraut!«, beendete ich den Satz.
Er nickte. Stumm, beinahe hoffnungsvoll waren seine Augen auf mich gerichtet, als ob meine reichhaltigen Erfahrungen auf diesem Gebiet es mir erlauben würden, seine Situation besser zu verstehen.
Das taten sie zwar, sagten mir jedoch auch, dass der Karren ganz schön im Dreck steckte.
»Da hilft alles nichts. Du musst ihn zurückbringen!«
Mittlerweile war Modestus’ Gesicht so weiß, dass es selbst neben der Toga eines Beamtenanwärters nicht auffallen würde.
»Das kann ich nicht«, flüsterte er entsetzt.
Modestus war ein Feigling, das war mir klar, doch seine Angst war in diesem Fall nicht ganz unberechtigt.
Eine Weile schwieg er, dann sagte er leise. »Aber wenn der Ring nicht wieder auftaucht, wird vielleicht ein Unschuldiger des Diebstahls bezichtigt.«
Ein mulmiges Gefühl sagte mir, dass ich da die besten Aussichten hätte, in Verdacht zu geraten.
Er schien einen inneren Kampf mit sich auszutragen. »Also gut«, meinte er schließlich. »Abends sucht Diodoros meist den Dominus in dessen Büro auf, um mit ihm die Geschäfte des Tages zu besprechen. Vielleicht wäre das die passende Gelegenheit, den Ring in Diodoros’ Zimmer in eine Ecke zu legen …« Modestus sah beinahe schon wieder erleichtert aus. »Meinst du, das könnte gehen?«
Fast mitleidig grinste ich ihn an. »Sicher – solange du dich nicht dabei erwischen lässt!«
Zwar hatte ich nicht den Eindruck, dass meine Worte ihn sonderlich beruhigten. Doch einen ehrlichen Knochen wie Modestus konnte ich einfach nicht belügen. Außerdem fehlte mir die Zeit für längere Gespräche. Nach meinem letzten Fehltritt würde Celsus ein noch wachsameres Auge auf mich haben, und ich hatte schon genügend Zeit vertrödelt.
Immer noch nachdenklich sah Modestus mir nach, als ich meine Bürste schnappte und mich auf den Weg in die Bibliothek machte.
Wahrscheinlich war ich zu sehr mit meinen guten Vorsätzen beschäftigt, um zu spüren, dass sich das Fatum gerade dazu anschickte, einen dunklen Schatten auf das Erste Haus der Stadt zu werfen.
Umständlich rutschte ich auf den Knien herum, während ich mit der nassen Bürste den Boden schrubbte. So viel zu meinem Beitrag für den Frühjahrsputz. Meine Hände waren schon aufgeweicht, und selbst Ovids Verse konnten mich an diesem Morgen in keine bessere Stimmung versetzen, egal wie hartnäckig ich sie auch im Kopf rezitierte.
Dafür lavierte ich mich nun angestrengt um zwei aufgeregt schnatternde Stubenmädchen herum, die sich ausgerechnet die Küche ausgesucht hatten, um den neuesten Hausklatsch breitzutreten, und mir mit stoischer Ruhe in den Füßen herumstanden.
»Hast du schon den Neuen zu Gesicht bekommen?« Durch das Schrubben der Bürste hörte ich einen Hauch von Empörung in der Stimme von Rapida. Sie war für die Zimmer des Legatus zuständig und trug den Stolz auf diese Stellung mit sichtlicher Genugtuung zur Schau.
Ich wusste gleich, von wem sie sprachen.
»Nein!« Neugierig trippelte die andere auf ihren zierlichen Füßen. Secura kümmerte sich um den Blumenschmuck im Haus, was ihr die Möglichkeit verschaffte, überall herumzuschnüffeln und ihre Nase in Angelegenheiten zu stecken, die sie nichts angingen.
»Ich habe gehört, er sei ein Kriegsgefangener, einer von diesen Barbaren, diesen Alemannen!«
»So jemanden überhaupt ins Haus zu lassen, nenne ich geradezu leichtsinnig.« Von meiner Position aus sah ich, wie Rapidas Fußspitzen nervös zu zucken begannen. »Das ist ja gerade wie das Trojanische Pferd.«
Da hatte ja jemand tatsächlich einen Hauch von Bildung!
»Also, ich sage dir, ich werde keine Nacht ruhig schlafen, solange ich weiß, dass dieser Wilde mit uns unter einem Dach haust!«
Als würde sich ausgerechnet an der irgendjemand vergehen wollen!
Energisch schrubbte ich weiter und zog stückchenweise den Wassereimer hinter mir her, während ich um die Füße der beiden Frauen herumzuputzen versuchte. Keine von ihnen machte auch nur einen Schritt zur Seite.
Ich hasste diese Gänse von Stubenmädchen. Können nicht lesen und schreiben, bilden sich aber wer weiß was drauf ein, bei der Herrschaft rumschwirren zu dürfen.
»Ach, du dummes Ding, pass doch auf!«, kreischte die eine erschrocken auf. In meinem Übereifer hatte ich ihr etwas Wasser über die Füße gegossen.
»Du siehst doch, dass ich hier putze! Du hättest ja einen Schritt zur Seite gehen können!«, konterte ich verärgert. Wer sich in Gefahr begibt …
»Was erlaubst du dir!« Ihr helles Gesicht lief vor Wut rot an. »Ich lass mich doch nicht von jemandem wie dir herumkommandieren. Wenn es nach mir gegangen wäre, wärst du nicht so schnell wieder rausgekommen!«
Immer noch aufgebracht schnaubte sie weiter: »Was kann man denn auch anderes erwarten von einem Fundstück!«
Der Schmerz explodierte in mir wie ein Holzscheit im Frühlingsfeuer. Ich spürte, wie ich blass wurde. »Geh einfach weg«, sagte ich leise und zwang mich dazu, ruhig zu klingen. Ich würde ihr nicht auch noch die Genugtuung geben, ihr zu zeigen, wie sehr sie mich getroffen hatte.
»Was gibt es denn hier schon wieder?« Das war Bricia, die Vilica, die Vorsteherin der Hausdiener. Mit roten Flecken auf ihrem pausbäckigen Gesicht kam sie angeschlurft. Sie keuchte etwas. In ihrer Fülligkeit schien sie jeder Schritt anzustrengen. Ihre grauen Haare waren aufgesteckt, die kräftigen Hände hielten einen Besenstiel gepackt.
»Ach nichts!« Naserümpfend drehte sich Rapida um. Mit Bricia wollte sie sich dann doch nicht anlegen. »Wir suchen uns einen angenehmeren Platz aus.«
Schmollend zog sie ihre Freundin mit sich.
Dumme Gänse!
Ich fühlte mich immer noch getroffen.
Bricia blieb vor mir stehen. Mit zusammengekniffenen Lippen stand ich auf und rieb mir schnell die nassen Hände an meiner Tunica ab. Sie war ohnehin schon schmutzig.
»Und?«, fragte sie mit ihrer tiefen Stimme. »War’s schlimm diesmal?«
Sie war eine der wenigen, die sich um mich sorgten, besonders, wenn ich wieder einmal das Ergastulum genossen hatte. Energisch schüttelte ich den Kopf. »Nicht wirklich.«
»Lass mich mal sehen!«, befahl sie knapp. Bevor ich etwas erwidern konnte, zog sie mich zu sich heran und suchte mich fachmännisch nach Verletzungen ab. »Du hast recht«, brummte sie schließlich. »Nichts Schlimmes!«
Kritisch betrachtete sie den violett gefärbten Bluterguss auf meinem Handgelenk, an dem die Fessel angebracht gewesen war. »Dafür kann ich dir etwas Salbe bringen. Tut’s weh?«
»Ach, das ist nicht nötig.« Schnell zog ich meine Hand weg. Nicht wieder eines dieser klebrigen Wundermittel, die schon auf weite Entfernung ranzig rochen. Da konnte ich mir ja gleich ein Schild um den Hals hängen: Mich hat es wieder erwischt!
Ich zwang mir ein Lächeln ab. »Wird schon wieder.«
»Na ja«, grummelte sie, »wie du meinst.« Mit einem Kopfschütteln schlurfte sie davon.
Es tat wirklich nicht weh, nicht mehr richtig jedenfalls. Das dumpfe Pochen kam von dem, was diese dämliche Gans von sich gegeben hatte. Das hatte gesessen, und ich war nicht in der Verfassung, es nur als blödes Gerede abzutun.
Und gegen solche Schmerzen war kein Kraut gewachsen, genauso wenig wie gegen Dummheit.
Die Sonne war bereits untergegangen, als ich endlich mit meiner Arbeit fertig war. Jeder einzelne Teller war gespült und die Küche dermaßen geschrubbt, dass in keinem Winkel auch nur noch ein Staubkorn zu sehen war. Mit runzelig aufgeweichten Fingern stellte ich den Besen in die Ecke und wischte mir mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn, wobei ich wohl recht großzügig Ruß und Asche auf meinem Gesicht verteilte. Doch Eitelkeiten stellten derzeit mein geringstes Problem dar.
Im Hause war es still. Außer mir schien ohnehin kaum noch jemand wach zu sein.
Dumpf pochten die Blutergüsse an meinen Handgelenken, als ich die Tür zur Küche öffnete und mit einer Öllampe leise auf den dämmrigen Flur trat. Das schwach flackernde Licht schien die Figuren der Wandmalereien zu gespenstischem Leben zu erwecken.
Am Abend war es wieder kälter geworden, und die Segnungen der Fußbodenheizung waren, selbst im Hause des Statthalters, auf die Räume der Herrschaft beschränkt, weshalb ein Großteil des Gebäudes wenig angenehme Temperaturen aufwies. Fröstelnd eilte ich durch den dunklen Flur und spürte, wie die Kälte des Steinbodens durch meine dünnen Sohlen drang.
Das Geräusch leiser Schritte ließ mich zusammenzucken. Ich drehte mich um. Niemand war zu sehen, doch für einen Moment schien ein Schatten über die Wand zu huschen.
Seltsam! Unwillkürlich überkam mich eine Gänsehaut. Ich glaubte nicht an Gespenster, nicht an Geister oder Dämonen. An manchen Tagen wusste ich überhaupt nicht, ob ich an irgendetwas oder irgendwen glaubte, und zog es vor, mich auf die Weisungen der stoischen Philosophie zu verlassen, da konnte ich auf keinen Fall falsch liegen. Hin und wieder allerdings erlaubte ich es mir, ein Gebet an den Unbekannten Gott zu schicken, auch auf die Gefahr hin, dass er nicht zuhörte oder die Bitten einer wie mir schlicht und ergreifend nicht zur Kenntnis nehmen wollte.
Es ist der einzige Gott, den ich anrufe. Nicht, dass ich ernsthaft an der Existenz der Götter zweifeln würde – Jupiter, Minerva und wie sie alle heißen. Allerdings sind diese, wenn auch vielleicht nicht Geschöpfe der menschlichen Fantasie, so doch zumindest selbst Produkte eines letzten Urgrundes, der alle Dinge, Götter wie Menschen, Raum und Zeit, hervorgebracht hat und den einige Philosophen als Theós bezeichnen.
Natürlich glaube ich, dass es einen solchen Urgrund geben muss. Da jedoch niemand etwas Genaues darüber weiß und er dadurch allen unbekannt ist, nenne ich ihn lieber den Unbekannten Gott, obgleich ich weiß, dass dieser Titel eigentlich einem der olympischen Götter zugedacht ist, der sich womöglich bisher den Menschen nicht offenbart hat. Eine derartige Vorsichtsmaßnahme halte ich jedoch für ziemlich überflüssig. Jeder, der die Olympischen kennt, weiß, dass sie es nicht unterlassen können, sich unter die Menschen zu mischen und kräftig an deren Geschick zu rütteln. Es erschiene mir unwahrscheinlich – um nicht zu sagen absurd –, wenn sich auch nur einer von ihnen so vornehm zurückgehalten hätte, dass sein Name bisher verborgen geblieben wäre und er so auf Tempelkult und Opfergaben der Sterblichen verzichten müsste.
Erneut hörte ich trappelnde Schritte, dann einen unterdrückten Aufschrei. Eine Tür schlug zu, danach war wieder alles still.
Auch wenn ich keinerlei Angriffe aus der jenseitigen Welt fürchtete, so hatte ich jedoch Respekt vor Mächten aus dem Diesseits, besonders wenn diese mit den Vollmachten eines Oberaufsehers ausgestattet waren, der es gar nicht schätzte, wenn Angehörige des Gesindes noch so spät nachts durch das Haus huschten.
Ich beschloss, mich schleunigst aus dem Staub zu machen. Nach den beiden Nächten im Ergastulum taten mir alle Knochen weh, und ich sehnte mich danach, wieder auf einer weichen Unterlage zu schlafen.
Noch bevor ich meine guten Vorsätze in die Tat umsetzen konnte, knarrte nur wenige Schritte von mir eine Tür. Stimmengeflüster war zu vernehmen.
Einer Eingebung folgend drückte ich mich an die Wand und verbot mir zu atmen.
»Sicher doch, Herr, gewiss!« Die Stimme zitterte ein wenig und flüsterte so leise, dass ich nicht heraushören konnte, wer da gerade sprach. »Du kannst dich auf mich verlassen!«
Neugierig reckte ich den Hals, ohne jedoch von meiner Position an der Wand zu weichen.
»Das hoffe ich für dich!«, kam die Antwort. Einen Moment lang herrschte eisiges Schweigen, dann fiel erneut die Tür ins Schloss.
Es war eindeutig Zeit für mich, zu verschwinden. Eilig löste ich mich von der Wand und wollte mich gerade auf den Weg machen, um endlich in Morpheus’ Armen zu versinken, als ich beinahe mit Modestus zusammengestoßen wäre. Bei meinem Anblick fuhr er entsetzt zusammen und wurde kreidebleich. Toll! Nun wusste ich wenigstens, dass ich an meinem Aussehen doch noch etwas arbeiten sollte.
»Invita!«, stieß er hervor, und seiner Stimme war nicht zu entnehmen, ob er erschrocken oder erleichtert war, ausgerechnet mich unter den Schichten von Dreck und Ruß zu erkennen.
»Modestus …«, gab ich zurück und widerstand dem Drang, mit dem Ärmel der Tunica über mein Gesicht zu wischen.
Sein Blick flackerte. »Ich habe dich nicht gesehen.« Das hatte ich bemerkt.
»Was tust du um diese Zeit hier?«, fragte ich, immer noch verärgert darüber, dass mein Aussehen ihn so offensichtlich abzuschrecken schien.
»Nichts Besonderes.« Sein Blick wich meinem aus.
»Hast du den Ring zurückgebracht?«
Einen Moment hielt er inne. »Den was?« Immer noch waren seine Pupillen ganz eindeutig auf etwas anderes fixiert, vielleicht auf eine flackernde Motte, die irgendwo hinter mir herumschwirren mochte. Zumindest erweckte es diesen Eindruck, denn nach wie vor gelang es ihm nicht, mir direkt in die Augen zu blicken.
Ungläubig stemmte ich die Arme in die Hüften. »Diodoros’ Ring. Du erinnerst dich, den Ring unseres Hausverwalters, den du so äußerst unüberlegt in deine Tasche gesteckt hast. «
Wieder erfolgte zunächst keine Reaktion, dann fuhr Modestus zusammen, als würde er erst jetzt wieder in die Realität zurückfinden. »Ach ja, der Ring …« Fahrig nestelte er an dem kleinen Lederbeutel, den er als Bote des Statthalters stets an seinem Gürtel trug, und zog schließlich etwas massig Goldenes daraus hervor, das im Schein der Öllampe blass aufblitzte.
»Du hast ihn immer noch!«, entfuhr es mir entsetzt. »Aber ich dachte, du wolltest …«
Ich unterbrach mich, als ich Modestus’ Gesichtsausdruck wahrnahm, der nun so aussah, als sei er tatsächlich einem Gespenst begegnet.
»Du hast ihn nicht zurückgegeben!«
»Hab ich vergessen!«, murmelte er abwesend. »Morgen, gleich morgen werde ich es tun!«
»Wie kannst du so etwas vergessen? Weißt du nicht, was passiert, wenn man das Ding bei dir findet?« Mein Herz hämmerte zum Zerspringen. Ich dachte an all die Prügel, die ich allein dafür eingesteckt hatte, dass ich mir ein paar herumliegende Schriftrollen ausgeborgt hatte, kein Vergleich zu einem dermaßen wertvollen Stück.
»Aber ich habe den Ring doch nicht gestohlen!« Modestus’ Stimme klang plötzlich ungewohnt heftig: »Ich habe ihn gefunden und hatte noch keine Gelegenheit, ihn zurückzubringen!« Vor Aufregung zitternd ließ er das schwere Schmuckstück wieder in den Beutel gleiten. »Und nun lass mich gehen. Ich habe morgen noch vor Sonnenaufgang einen Botengang für Diodoros zu erledigen! Gute Nacht.«
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, eilte er von dannen. Seltsam. Immer noch die Öllampe vor mich haltend, blickte ich ihm nach. Was war nur los mit ihm? Normalerweise war er eher schüchtern, still und von einer geradezu unerträglichen Gutmütigkeit, die dazu führte, dass selbst Mitsklaven diese hin und wieder auszunutzen versuchten. Was hatte es mit diesem Ring auf sich, dass er Modestus in schiere Panik versetzte und dieser sonst so musterhafte Sklave sogar davor zurückschreckte, das Ding zurückzugeben?
Es sollte mir egal sein. Die Tatsache, gerade erst aus dem Ergastulum gekommen zu sein, brachte mich zu der Entscheidung, dass es hin und wieder besser war, mich in gewisse Dinge einmal nicht einzumischen.
Andererseits …
Ich entschloss mich, Modestus am nächsten Tag darauf anzusprechen.
Irgendjemand wollte mich loswerden!
Aus den Füßen haben, besser gesagt.