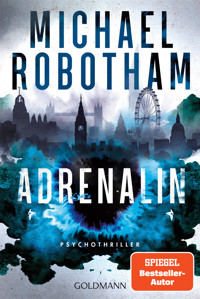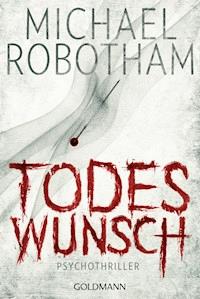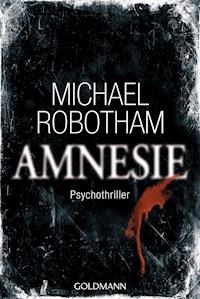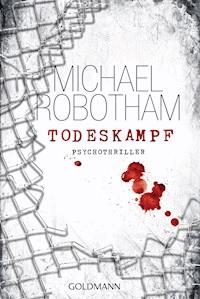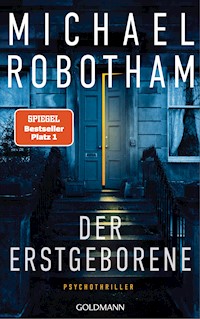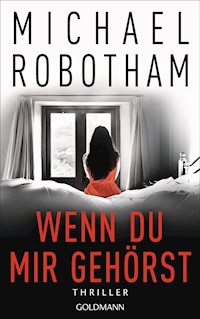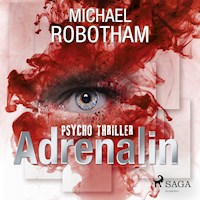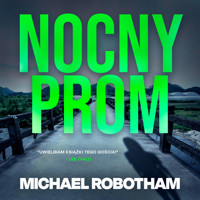9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Joe O'Loughlin und Vincent Ruiz
- Sprache: Deutsch
"Michael Robothams Thrillerreihe um den an Parkinson erkrankten Psychotherapeuten Joe O'Loughlin ist ultraspannend." Sebastian Fitzek
Ein abgelegenes Bauernhaus in Somerset: Zwei Frauen, Mutter und Tochter, werden Opfer eines brutalen nächtlichen Doppelmordes. Da die Ermittlungen der Polizei ins Leere laufen, bittet Chief Superintendent Ronnie Cray den erfahrenen Psychologen Joe O’Loughlin um Hilfe. Es gibt gleich mehrere Tatverdächtige, vom betrogenen Exmann bis hin zu einem der zahlreichen Liebhaber. Doch als eine weitere Leiche auftaucht – mit einem blutigen „A“ auf der Stirn –, mehren sich die Anzeichen, dass ein gestörter und äußerst gefährlicher Serientäter sein Unwesen treibt. Jemand, der auf einem Rachefeldzug für längst vergangenes Unrecht ist. Und der vor nichts und niemandem haltmacht, auch nicht vor O’Loughlins Familie ...
Der zehnte Band der Erfolgsserie um den Psychologen Joe O'Loughlin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Joe O’Loughlin ist völlig überrascht, als seine Exfrau Julianne ihn fragt, ob er nicht den Sommer zusammen mit ihr und ihren Töchtern verbringen will. Könnte das die Versöhnung sein, nach der er sich schon so lange sehnt? Gerade als er zugesagt hat, bekommt er einen Anruf von Chief Superintendent Ronnie Cray, die dringend seine Hilfe als Profiler benötigt. Es geht um einen Doppelmord in Clevedon, bei dem eine Mutter und ihre Tochter in einem alten Bauernhaus ermordet wurden. Joe zögert. Doch als Cray ihm von seinem unfähigen Vorgänger erzählt, der sich auf O’Loughlin als Mentor bezieht, fühlt er sich verpflichtet. Sein ehemaliger Student Milo Coleman hatte schon immer eine Vorliebe für den großen Auftritt. Weil er der Presse Details zum Tathergang und zum Tatort verriet, brachte er den Fall praktisch zum Erliegen. Zwei Wochen sind inzwischen seit dem Doppelmord vergangen, und in der Öffentlichkeit macht sich Unruhe breit. O’Loughlin stürzt sich zusammen mit dem ehemaligen Polizisten Vincent Ruiz in die Ermittlungen und beschäftigt sich schon bald mit mehreren Verdächtigen. Doch dann geschieht ein weiterer Mord an einer Frau. Wie schon bei dem jüngeren Opfer aus Clevedon, wurden auch ihre Hände in Bleiche getunkt, um Spuren zu entfernen, und auch sie wurde durch Unterbrechen der Blutzufuhr zum Gehirn getötet. Allerdings gibt es ein Detail, das anders ist. Dem Opfer wurde der Buchstabe »A« auf der Stirn eingeritzt. O’Loughlin weiß jetzt, wonach er suchen muss: nach einem Täter, der skrupellos ist und gleichzeitig eine perfide Mission verfolgt. Was er nicht weiß: Der Täter ist ihm schon näher, als ihm lieb ist …
Weitere Informationen zu Michael Robotham sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Michael Robotham
Der Schlafmacher
Psychothriller
Ins Deutsche übertragen von Kristian Lutze
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Close Your Eyes« bei Sphere, einem Imprint der Little, Brown Book Group, London.
Copyright © Bookwrite Pty 2015Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016by Wilhelm Goldmann Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbHUmschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, MünchenUmschlagmotiv: FinePic®, MünchenSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-16658-8V004 www.goldmann-verlag.de
Für alle Opfer häuslicher Gewalt – mögen wir niemals die Augen davor verschließen.
Meine Mutter starb mit ihrem Kopf im Schoß eines anderen Mannes. Der Wagen prallte frontal mit einem Milchlaster zusammen, der daraufhin in eine Eiche krachte, sodass Eicheln auf die Karosserie prasselten wie Hagelkörner. Mr Shearer verlor ein Anhängsel. Ich verlor meine Mutter. Das Schicksal schlägt meistens dann zu, wenn man es am wenigsten erwartet.
Der Wagen war ein knallroter Fiesta, den meine Mutter ihren »kleinen sexy Flitzer« nannte. Sie hatte ihn gebraucht gekauft und in einer Hinterhofwerkstatt, die mein Vater kannte, umlackieren lassen. Ich habe sie an dem Tag wegfahren sehen. Ich stand am Fenster im ersten Stock, als sie rückwärts aus der Einfahrt setzte, am Haus der Tinklers vorbeifuhr, an Mrs Evans, die im Garten ihre Rosen beschnitt, und an dem Haus an der Straßenecke, in dem Millicent Jackson mit ihren zwölf Katzen wohnte. Erst später wurde mir klar, dass sich in diesem Moment meine Welt auflöste. Es war, als hätte meine Mutter einen losen Faden zu fassen bekommen, der sich, je weiter sie sich von mir entfernte, immer weiter aufribbelte wie ein billiger Pullover, erst Ärmel, dann Schulter, Vorder- und Rückseite, bis ich nackt am Fenster stand.
Meine Tante Kate erzählte mir, was passiert war – nicht die ganze Geschichte natürlich – niemand erzählt einem Neunjährigen, dass seine Mutter mit einem Penis im Mund gestorben ist. Solche Details werden gern ausgelassen, so wie man über unglaubwürdige Passagen in einem schlechten Film hinweggeht oder der Frage ausweicht, wie es der Weihnachtsmann schafft, sich in einer Nacht durch so viele enge Kamine zu zwängen. Alle in meiner Schule wussten vor mir Bescheid (über meine Mutter, nicht über den Weihnachtsmann). Einige der älteren Jungen konnten es kaum erwarten, mir die ganze Wahrheit auf die Nase zu binden, während die Mädchen hinter vorgehaltener Hand kicherten.
Mein Vater sagte nichts, nicht an jenem Tag, als es passierte, und auch nicht an dem darauf oder irgendeinem der folgenden. Stattdessen saß er in seinem Sessel und formte mit den Lippen stumm Worte, als würde er einen unbeendeten Streit fortführen. Eines Tages fragte ich ihn, ob Mum im Himmel sei.
»Nein.«
»Wo ist sie denn?«
»Sie schmort in der Hölle.«
»Aber in die Hölle kommen nur böse Menschen.«
»Das hat sie verdient.«
Ich hatte immer vermutet, dass Mr Shearer ebenfalls zur Hölle gefahren wäre, später jedoch entdeckt, dass er den Unfall überlebt hat. Ich weiß nicht, ob man sein Glied wieder angenäht hat. Ich nehme nicht an, dass man es mit meiner Mutter eingeäschert hat. Vielleicht hat man ihm eine Prothese angefertigt – einen bionischen Penis –, obwohl das klingt wie aus einem billigen Porno.
Solcherart sind die Details, die mir geblieben sind, nachdem die meisten meiner Kindheitserinnerungen verschwunden sind wie verschüttetes Wasser, das an der Luft trocknet. Der letzte Tag meiner Mutter hat sich mir ins Bewusstsein gebrannt wie ein alter Amateurfilm in Schwarzweiß, der in Endlosschleife hinter meinen geschlossenen Lidern flackert. Ich habe diese Szenen im Gedächtnis bewahrt, weil so wenig von meiner Mutter übrig geblieben ist, nachdem mein Vater sie aus seinem und meinem Leben getilgt hatte.
Diese Splitter meiner Kindheit – manche real, andere frei erfunden – sind für mich so greifbar und konkret wie die Welt, durch die ich jetzt gehe, so fest wie die Bäume und so kühl wie die Meeresbrise. Ich stehe am Rand eines Hügels und blicke auf die Kirchtürme der Stadt, die vor dem dunkler werdenden Himmel schimmern. Die dünnen Wolkenfetzen erinnern an Kreidespuren. Jenseits der Dächer, hinter den Landzungen, Steinstränden und Sandsteinklippen kann ich die ferne Küste ausmachen. Sie ist mit Felsbrocken übersät, die aussehen wie vom Wetter gemeißelte und geglättete Skulpturen.
Ich gehe in der Regel eher langsam. Ich lasse mir Zeit, bleibe stehen, nehme einzelne Dinge in mich auf. Die Schafe. Kühe. Vögel. Pferde. Ich mache ihre Geräusche nach. Schafe sind so passive, apathische Geschöpfe, nicht wahr? Ihre Augen sind dumm – anders als die von Hunden oder Pferden. Schafe sind bloß formlose Wollknäuel, blind gehorsam und ahnungslos wie flauschige Lemminge.
Der Fußweg erreicht eine hinter Bäumen verborgene Biegung. Dies ist ein guter Platz zum Warten. Ich setze mich hin, lehne mich an einen Baumstamm und nehme einen Apfel und ein Messer aus meiner Tasche.
»Möchtest du ein Stück?«, frage ich. »Nicht? Wie du willst. Dann lauf weiter.«
Warten macht mir nichts aus. Geduld bedeutet nicht, dass nichts passieren wird – es geht um das richtige Timing. Wir warten darauf, geboren zu werden, warten darauf, erwachsen zu werden, und dann warten wir, alt zu werden … An manchen, an den meisten Tagen kehre ich enttäuscht, aber nicht unglücklich heim. Es wird andere Gelegenheiten geben. Ich habe die Geduld eines Anglers. Die Geduld von Hiob. Ich weiß alles über diesen Heiligen, wie Satan Hiobs Familie und sein Vieh vernichtet und ihn über Nacht von einem reichen Mann zu einem kinderlosen Bettler gemacht hat, doch Hiob weigerte sich, Gott für sein Leiden zu verfluchen.
Die Brise streicht durch die Äste des Baumes, und ich kann das Salz und das Seegras riechen, das auf dem Kiesstrand trocknet. Eine kräftigere Böe weht Blätter gegen meine Beine, und irgendwo gurrt monoton eine Taube. Dann bellt ein Hund und löst eine Unterhaltung mit anderen Hunden aus, die hin und her kläffen, neckisch oder prahlend.
Ich stehe auf und lege die Maske an. Ich schiebe die Hand in die Hose und umfasse meinen Hodensack. Mein Penis fühlt sich nie so an, als wäre er meiner. Er sieht unpassend aus wie ein seltsamer Wurm, der nicht weiß, ob er Schwanz oder Talisman sein will.
Ich lehne mich wieder an den Baum und halte den Weg im Blick. Dies ist die richtige Stelle. Hier will ich sein. Sie wird bald kommen, wenn nicht heute, dann vielleicht morgen.
Mein Vater hat gerne geangelt. Er hatte so wenig Geduld für die meisten Dinge im Leben, doch er konnte stundenlang damit zubringen, auf die Spitze seiner Rute oder den auf dem Wasser tanzenden Schwimmer zu starren und vor sich hin zu summen.
»Thou shall have a fishy on a little dishy,
thou shall have a fishy when the boat comes in.«
1
»Sie dürfen nicht auf dem Rasen liegen.«
»Verzeihung?«
»Sie sind auf dem Rasen.«
Eine Gestalt steht über mir und verdeckt die Sonne. Ich kann nur ihre Umrisse erkennen, bis sie den Kopf bewegt, und dann bin ich geblendet.
»Ich habe kein Schild gesehen«, sage ich und schirme meine Augen ab. Meine Hand schimmert an den Rändern rosafarben.
»Das hat irgendjemand geklaut«, sagt der College-Pförtner, der eine Melone, einen Blazer und die obligatorische Krawatte seines Colleges trägt. Er ist Mitte sechzig mit grauem Haar, das ordentlich gestutzt ist bis auf seine Augenbrauen, die aussehen wie Raupenzwillinge, die sich über seine Stirn jagen.
»Ich hätte nicht gedacht, dass Oxford unter Kleinkriminalität leidet«, sage ich.
»Jugendlicher Übermut würde ich eher sagen«, meint der Pförtner. »Ein paar von den Studenten sind verflucht clever, wenn Sie meine Wortwahl entschuldigen, Sir.«
Er bietet mir eine Hand an und hilft mir auf. Wie bei einem Zaubertrick zieht er eine Fusselrolle aus der Tasche, streicht über Schultern und Rücken meines Hemdes und entfernt die Grashalme. Er hält mir mein Sakko hin. Ich komme mir vor wie Bertie Wooster, der von seinem Butler Jeeves angekleidet wird.
»Waren Sie Student hier in Oxford?«
»Nein, ich habe in London studiert.«
Der Pförtner nickt. »Ich in Durham. Mehr ein Gefängnis mit Freigang als eine höhere Lehranstalt.«
Die Vorstellung, dass dieser Mann jemals studiert hat, fällt mir schwer. Nein, das stimmt nicht. Ich kann ihn als herrschsüchtigen Aufsichtsschüler an einem unbedeutenden Internat in Hertfordshire in den 1960ern vor mir sehen, wo er einen bedauerlichen Spitznamen wie Fishy Rowe oder Crappy Cox hatte.
»Warum darf man nicht auf dem Rasen liegen?«, frage ich. »Es ist ein herrlicher Tag – die Sonne scheint, die Vögel singen.«
»Tradition«, sagt er, als ob das alles erklären würde. »Das Betreten, das Liegen und das Tanzen auf dem Rasen ist verboten.«
»Sonst bröckelt das Empire.«
»Dafür ist es ein bisschen spät«, räumt er ein. »Sind Sie sicher, dass wir uns noch nie begegnet sind, Sir? Ich kann mir Gesichter ziemlich gut merken.«
»Absolut.«
Er schnippt triumphierend mit den Fingern. »Sie sind der Psychologe. Ich habe Sie in den Nachrichten gesehen.« Er schwenkt einen Finger. »Professor Joseph O’Loughlin, stimmt’s? Sie haben geholfen, dieses vermisste Mädchen zu finden. Wie hieß sie noch? Sagen Sie es mir nicht. Es liegt mir auf … der Zun… Piper, das ist es. Piper Hadley.« Er strahlt mich an, als wollte er zu seinem Geistesblitz beglückwünscht werden. »Was führt Sie hierher? Werden Sie Vorlesungen halten?«
»Nein.«
Ich blicke über den Rasen zu dem Gebäude, wo bunte Fahnen über den Eingängen flattern und Luftballons aus dem Fenster hängen. Der Tag der offenen Tür ist in vollem Gange, Studenten stehen hinter Tischen und kleinen Ständen und verteilen Prospekte an potenzielle Erstsemestler, in denen verschiedene Seminare, Clubs und Aktivitäten beworben werden. Es gibt eine Real Ale Society, eine Rock Music Society und eine C. S. Lewis Society; und die Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer/Questioning Society – ein Happen für jede Neigung.
»Meine Tochter wollte sich die Uni ansehen«, sage ich. »Sie und ihre Mutter sind drinnen.«
»Ausgezeichnet«, sagt der Pförtner. »Was will sie denn studieren?«
»Keine Ahnung.«
Er runzelt die Stirn, und seine Augenbrauen senken und verbeugen sich über seinen Augen.
»Ich glaube, sie hat sich noch nicht entschieden«, füge ich hinzu, bemüht, wie ein informiertes Elternteil zu klingen.
Diesen Moment wählt mein Körper, um zu versteifen, sodass ich in einer klassischen James-Bond-Hocke erwischt werde, ohne die Pistole natürlich, das Gesicht starr, der Körper in der Bewegung eingefroren, als würde ich Stopptanzen spielen.
»Alles in Ordnung?«, fragt der Pförtner, als ich mich zuckend wieder zu bewegen beginne. »Sie sind plötzlich ganz steif und unheimlich geworden.«
»Ich habe Parkinson.«
»Das ist bitter, ich habe Gicht«, sagt er, als ob die beiden Leiden irgendwie vergleichbar wären. »Mein Arzt meint, ich trinke zu viel, und meine Augen sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Ich habe Schwierigkeiten, ein Kneipenschild von einem Hausbrand zu unterscheiden.«
Zwei ausgelassene Teenager jagen sich gegenseitig über den Rasen. Der Pförtner ruft ihnen zu, sie sollen aufhören. Er tippt an seine Melone und wünscht mir alles Gute, bevor er mit pendelnden Armen die Verfolgung der jungen Leute aufnimmt, als würde er einen flotten Marsch auf dem Exerzierplatz hinlegen.
Die Mittagstour des Colleges geht zu Ende. Ich halte unter der Menge der Menschen, die aus den Türen strömen und über die Wege laufen, Ausschau nach Charlie und Julianne. Ich hoffe, ich habe sie nicht verpasst.
Das sind sie! Charlie plaudert mit einem Studenten – einem Jungen, der auf irgendetwas hinter ihrer Schulter zeigt und ihre Nummer in sein Handy tippt. Ein anderer Junge beugt sich zu ihm und flüstert ihm etwas ins Ohr. Sie checken meine Tochter ab.
»Sie ist noch nicht mal im ersten Semester«, murmele ich.
Julianne nimmt Prospekte von einem Tisch. Sie trägt eine weiße Leinenhose, eine Seidenbluse, in ihrem Haar steckt eine rote Sonnenbrille. Sie sieht nicht so viel anders aus als bei unserer ersten Begegnung vor dreißig Jahren – ein bisschen kräftiger mit breiteren Hüften, sportlicher, aber zugleich kurviger. Groß. Dunkelhaarig. Getrennt lebende Ehefrauen sollten nicht so gut aussehen. Sie sollten unattraktiv und geschlechtslos sein, mit einem fetten Bauch und Hängebrüsten. Ich bin nicht sexistisch. Exmänner sollten genauso sein – übergewichtig mit schütterem Haar, leicht verwahrlost …
Charlie hat sich für ein weites Kleid und Doc Martens entschieden, eine wenig überraschende Kombination. Mutter und Tochter sind beinahe gleich groß mit den gleichen vollen Lippen, dichten Wimpern und einem in der Stirnmitte spitz zusammenlaufenden Haaransatz. Meine Tochter hat das neugierigere Gesicht und neigt zu Sarkasmus und gelegentlichem Fluchen, womit ich leben kann, solange es nicht in Beisein von Emma, ihrer jüngeren Schwester, passiert.
In elf Wochen wird Charlie ihr Zuhause verlassen, um zu studieren. In letzter Zeit habe ich mich bei dem Wunsch ertappt, dass sie ihre Abi-Prüfung vergeigt hat und wiederholen muss. Ich weiß, das ist ein schrecklicher Wunsch für einen Vater, obwohl ich den Verdacht habe, dass ich nicht der Erste bin, dem es so ergeht.
Charlie entdeckt mich und winkt. Sie trottet los wie ein reinrassiger Hund bei einer Hundeshow. Seine halbwüchsige Tochter mit einem Hund zu vergleichen gehört sich eigentlich nicht, doch Charlie verfügt auch über viele andere lobenswerte Eigenschaften eines Hundes wie Treue, Intelligenz und traurige braune Augen.
Julianne hakt sich bei mir unter. Sie wippt beim Gehen leicht auf den Zehen wie eine Balletttänzerin. Das hat sie schon immer getan.
»Und was hast du gemacht?«
»Mich mit den Einheimischen unterhalten.«
»War das ein College-Pförtner?«
»Ja.«
»Wie schön, dass du dich so rasch anfreundest.«
»So ein Typ bin ich halt.«
»Normalerweise beurteilst du Menschen eher, als dich mit ihnen anzufreunden.«
»Was soll das heißen?«
»Du bist wie ein Mechaniker, der kein Auto angucken kann, ohne sich zu fragen, was es unter der Haube hat.«
Julianne lächelt, und ich staune, wie sie es schafft, Kritik wie ein Kompliment klingen zu lassen. Ich war zweiundzwanzig Jahre mit dieser Frau verheiratet, und wir sind seit sechs Jahren getrennt. Nicht geschieden. Es heißt, die Hoffnung würde ewig sprudeln, doch ich spüre, dass ich in diesem speziellen Fall einen trockenen Brunnen gegraben habe.
»Und was denkst du?«, frage ich Charlie.
»Es ist wie Hogwarts für Erwachsene«, erwidert sie. »Sie tragen sogar Roben zum Abendessen.«
»Was ist mit dem Sprechenden Hut und schwebenden Kerzen?«
Sie verdreht die Augen.
Ich weiß nicht, was überholter ist – Harry Potter oder meine Witze.
»Unten am Fluss spielt eine Band«, sagt Charlie. »Kann ich da hingehen?«
»Willst du nicht etwas zu Mittag essen?«
»Ich hab keinen Hunger.«
»Wir sollten über die Colleges reden.«
»Vielleicht später.«
»Irgendwelche neuen Ideen, was du vielleicht studieren möchtest?«
»Keine einzige.«
Sie neckt mich. Behält ihre Pläne für sich. Ich werde es als Letzter erfahren, falls nicht väterlicher Rat oder Geld gebraucht wird, worauf ich unvermittelt zum Quell aller Weisheit und Herr der Brieftasche werden würde.
»Wo sollen wir uns treffen?«, fragt Julianne.
»Ich ruf dich an«, antwortet Charlie und hält mir ihre offene Hand hin. Ich tue so, als würde ich woanders hingucken. Sie macht eine lockende Geste mit den Fingern. Ich zücke meine Brieftasche, und bevor ich die Scheine zählen kann, hat sie mir einen Zwanziger aus den Fingern gezupft und mich auf die Wange geküsst. »Danke, Daddy.«
Sie wendet sich Julianne zu. »Hast du ihn gefragt?«, flüstert sie.
»Pst.«
»Hast du mich was gefragt?«
»Ist nicht so wichtig.«
Offensichtlich führen sie irgendwas im Schilde. Charlie war schon den ganzen Tag besonders aufmerksam, hat meine Hand gefasst – die linke natürlich – und ist neben mir gegangen.
Was verschweigen sie mir?
Als ich den Blick von Julianne wende, ist Charlie schon weg, ihr Kleid bauscht sich im Wind, und sie drückt es mit den Händen nach unten.
Es ist fast Mittagszeit. Ich muss etwas essen, oder meine Medikamente spielen verrückt – und dann fange ich an zu zucken wie Miley Cyrus.
»Wohin möchtest du gehen?«, frage ich.
»In irgendein Pub«, sagte Julianne, als wäre das selbstverständlich. Wir gehen durch den steinernen Torbogen und biegen vor der St. Aldate’s Church ab. Die Bürgersteige sind mit Eltern, potenziellen Studenten, Touristen und Leuten, die Einkaufstüten in der Hand tragen, bevölkert. Chinesische und japanische Reisegruppen in identischen T-Shirts folgen knallbunten Schirmen.
»Möchte Charlie wirklich in Oxford studieren?«, frage ich.
»Vielleicht wird sie gar nicht angenommen«, erwidert Julianne.
»Es kommt einem alles ziemlich Wiedersehen mit Brideshead-mäßig vor, oder? Manchmal frage ich mich, ob es nicht eher ein Themenpark als eine Universität ist. Was will sie studieren?«
»Mir erzählt sie es auch nicht.«
»Das verstößt doch bestimmt gegen irgendwelche Vorschriften. Rasen betreten verboten! Keine Geheimnisse vor den Eltern!«
»Irgendwann wird sie es uns sagen.«
Trotz meiner Bedenken über Charlies Auszug zu Hause gefällt mir die Vorstellung, dass sie auf die Uni gehen wird. Ich beneide sie um die neuen Freundschaften, die sie schließen wird, und um die frischen Ideen, die sie hören wird, die Diskussionen und Debatten, den subventionierten Alkohol, die Partys, die Bands und das Gefühl, frisch verliebt zu sein.
Als wir uns der Kreuzung nähern, höre ich einen Aufruhr. Ein Protestmarsch kreuzt auf der High Street. Leute skandieren Parolen und schwenken Plakate. Die anderen Fußgänger sind an der Straßenecke von mehreren Polizisten gestoppt worden. Irgendjemand schlägt eine Snare-Drum, daneben spielt ein Mädchen Yankee Doodle Dandy auf einer Flöte. Ein Junge mit pinken Haarsträhnen drückt mir ein Flugblatt in die Hand.
»Wogegen protestieren sie?«, fragt Julianne.
»Starbucks.«
»Weil sie schlechten Kaffee verkaufen?«
»Weil sie in Großbritannien keine Steuern zahlen.«
Ein Stück die Straße hinunter sehe ich das Starbucks-Logo. Eins der Plakate schwebt wippend an uns vorbei. Darauf steht: »Too little, too latte.«
»Wir haben damals gegen Apartheid demonstriert.«
»Es war eine andere Welt.«
Der Marsch zieht weiter. Es ist ein harmlos aussehender Haufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von ihnen das Parlament in die Luft sprengen oder die Karren zum Schafott ziehen würde. Die meisten sind wahrscheinlich Erben von Familienvermögen oder Titeln. In dreißig Jahren werden sie das Land regieren. Gott stehe uns bei!
Julianne entscheidet sich für ein Pub am Flussufer. Blumenampeln hängen davor, und auf der Terrasse stehen Tische mit Blick aufs Wasser. Paare schippern mit Stechkähnen über den Fluss, navigieren zwischen den herabhängenden Ästen einer Weide und der stärkeren Strömung an der Innenseite einer Biegung. Ein verirrter Luftballon gleitet über die sich kräuselnde Wasseroberfläche und bleibt im Schilf hängen.
Nachdem ich eine gemischte Vorspeisenplatte für uns beide bestellt habe, hole ich an der Bar ein großes Glas Wein für Julianne und eine Limonade für mich. Wir stoßen an und machen Smalltalk, entspannt und natürlich. Seit unserer Trennung haben wir stets weiter miteinander kommuniziert, zwei Mal in der Woche telefoniert, um über die Mädchen zu sprechen. Julianne ist immer heiter und fröhlich – glücklicher, seitdem sie nicht mehr mit mir zusammen ist.
Für eine Ex ist sie ziemlich nett. Vielleicht wäre es leichter, wenn sie ein Drache oder eine giftige Xanthippe wäre. Ich hätte meine Ehe hinter mir lassen und jemand anderen finden können. Stattdessen klammere ich mich an die Vergangenheit und hoffe ewig auf eine zweite Chance oder Nachspielzeit. Ich würde auch bis zum Elfmeterschießen durchhalten, wenn es unentschieden bleibt.
»Bist du sicher, dass Charlie einen Plan hat?«, frage ich.
»Hattest du mit achtzehn einen Plan?«
»Ich wollte mit jeder Menge Mädchen schlafen.«
»Und? Hat das geklappt?«
»Super sogar, bis du gekommen bist.«
»Sollte ich mich dafür entschuldigen, dich eingeengt zu haben?«
»Du hast mir die Trefferquote versaut.«
»Du bist doch damals nie zum Schuss gekommen. Ein echter Chancentod würde ich mal sagen.«
»Ich hab es immerhin geschafft, dich auf die Matte zu legen.«
»Jetzt bringst du die Sportarten durcheinander.«
»Nein, ich bin ein Allroundtalent.«
Sie winkt lachend ab. Es fühlt sich gut an, sie zum Lachen zu bringen. Ich habe Julianne an der London University kennengelernt. Ich hatte bereits drei Jahre Medizin hinter mir, obwohl ich beim Anblick von Blut sofort in Ohnmacht falle, Julianne studierte Sprachen im ersten Semester. Ich wechselte zu Psychologie – zum großen Widerwillen meines Vaters. Er hatte erwartet, dass ich als Chirurg eine seit vier Generationen bestehende Familientradition fortsetzen würde. Es heißt, eine Kette reißt immer am schwächsten Glied.
Unser Essen kommt. Julianne löffelt Hummus auf ein Stück knuspriges Brot und kaut nachdenklich. »Triffst du dich mit jemandem?«, fragt sie. Sie klingt nervös.
»Eigentlich nicht, und du?«
Sie schüttelt den Kopf.
»Was ist mit diesem Anwalt? Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern.«
»Kannst du doch.«
Sie hat recht. Marcus Bryant. Gut aussehend, erfolgreich, schmerzhaft edel – ein Verehrer wie aus dem Bilderbuch, wenn es so etwas gibt. Ich habe einmal den Fehler gemacht, ihn zu googeln, bin jedoch nicht über seine vierjährige Tätigkeit beim Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag und seine ehrenamtliche Arbeit für Todeskandidaten in texanischen Gefängnissen hinausgekommen.
Es folgt ein weiteres langes Schweigen. Julianne ergreift als Erste wieder das Wort. »Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich, glaube ich, nicht so früh heiraten.«
»Warum?«
»Ich wünschte, ich wäre mehr gereist.«
»Ich habe dich nicht davon abgehalten.«
»Ich kritisiere dich auch gar nicht, Joe«, sagt sie. »Ich stelle nur etwas fest.«
»Was hättest du sonst noch gerne getan – mehr Liebhaber gehabt?«
»Das wäre nett gewesen.«
Ich versuche, mit ihr zu lachen, doch mir ist überhaupt nicht danach.
Sie streckt die Hand über den Tisch. »Oh, jetzt habe ich dich verletzt. Sei nicht beleidigt. Du warst toll im Bett.«
»Ich bin nicht traurig. Das sind die Medikamente.«
Sie lächelt, ohne mir zu glauben. »Es muss doch auch irgendwas geben, was du gern anders gemacht hättest.«
»Nein.«
»Wirklich nicht?«
»Vielleicht eine Sache.«
»Was?«
»Ich hätte nicht mit Elisa schlafen sollen.«
Das Geständnis erzeugt ein plötzliches Vakuum, Julianne zieht ihre Hand zurück und wendet sich ab. Ihr Blick schweift über den Fluss zu einem Bootshaus am anderen Ufer. Für einen winzigen Moment scheinen ihre Augen feucht zu werden, doch als sie mich wieder ansieht, ist der Schimmer verschwunden.
An dem Tag vor fast zehn Jahren, als man bei mir Parkinson diagnostizierte, ging ich nicht direkt nach Hause. Ich kaufte keinen roten Ferrari, buchte keine Kreuzfahrt um die Welt und erstellte keine Liste von Dingen, die ich vor meinem Tod noch machen wollte. Ich kaufte auch keine Kiste Glenfiddich und verkroch mich für einen Monat im Bett. Stattdessen schlief ich mit einer Frau, die nicht meine Frau war. Es war ein dummer, dummer, dummer Fehler, den ich mir seither zu erklären versuche, doch meine Rechtfertigungen reichen nicht an den Schaden heran, den ich damit angerichtet habe.
Manchmal kann ein einziges willkürliches, törichtes Ereignis ein Leben verändern – eine zufällige Begegnung, ein Unfall oder ein Moment des Wahnsinns. Doch häufiger geschieht es allmählich, wie eine auflaufende Flut, so langsam, dass wir es nicht bemerken. Die Parkinson-Diagnose hat mein Leben verändert. Sie war nie ein Todesurteil, doch die Krankheit hat mich schrittweise Kräfte gekostet.
»Tut mir leid, dass ich nachgebohrt habe«, sagt Julianne und spielt mit dem Stiel ihres Weinglases.
»Das darfst du.«
»Warum?«
»Ich nehme an, formal sind wir noch verheiratet.«
Sie nippt an ihrem Wein. Wieder schweigen wir.
»Und was hast du für Pläne für den Sommer?«, fragt sie. »Machst du einen schönen Urlaub?«
»Das habe ich noch nicht entschieden. Vielleicht einen günstigen Last-Minute-Trip nach Florida. Palmen. Mädchen mit Schmollmund. Bikinis. Körper, bei denen der Schönheitschirurg nachgeholfen hat.«
»Du hasst den Strand.«
»Salsa. Mambo. Kubanische Zigarren.«
»Du rauchst nicht, und du kannst nicht tanzen.«
»Jetzt hast du mir den Spaß verdorben.«
Julianne beugt sich vor und legt ihre Ellbogen auf den Tisch. »Ich muss dich etwas Wichtiges fragen.«
»Okay.«
»Vielleicht hätte ich dich früher fragen sollen. Ich habe lange darüber nachgedacht – irgendwie habe ich ein bisschen Angst davor, was du sagen wirst.«
Jetzt ist es so weit! Sie will die Scheidung. Kein Herumschleichen auf Zehenspitzen und Reden um den heißen Brei mehr. Vielleicht heiratet sie Marcus und geht mit ihm nach Amerika. Oder sie hat beschlossen, die Gemälde ihres Vaters zu verkaufen und eine Weltreise zu machen.
»Joe?«
»Hä?«
»Hast du mir zugehört?«
»Tut mir leid.«
»Ich habe dir eine Geschichte erzählt.«
»Du weißt, dass ich Geschichten liebe.«
Ihr finsterer Blick warnt mich, die Sache ernst zu nehmen.
»Hast du das von der alten Frau in Glasgow gelesen, die acht Jahre tot in ihrem Haus gelegen hat? Niemand hat sie besucht. Niemand hat Alarm geschlagen. Ihr wurden das Gas und der Strom abgestellt. Fenster wurden bei einem Sturm eingeschlagen. Post stapelte sich drinnen im Flur. Aber niemand ist gekommen. Man hat ihr Skelett neben ihrem Bett gefunden. Vermutlich ist sie gefallen und hat sich die Hüfte gebrochen. Möglicherweise hat sie noch Tage gelebt und um Hilfe gerufen, doch niemand hat sie gehört. Und jetzt streitet ihre Familie sich um das Haus. Jeder will etwas von dem Geld abhaben. Da fragt man sich doch …«
»Was?«
»Wie schrecklich es sein muss, alleine zu sterben.«
»Wir sterben alle allein«, sage ich und bedauere es sofort, weil es zu schnoddrig und abschätzig klingt. Nun ist es an mir, die Hand auszustrecken und ihre zu fassen. Sie hebt die Fingerspitzen, und unsere Finger verschränken sich. »Wir sind nicht verantwortlich für die Fehler anderer. Sagst du mir das nicht immer?«
Sie nickt.
»Du bist ein guter Vater, Joe.«
»Danke.«
»Du bist zu nachgiebig gegenüber den Mädchen.«
»Irgendjemand muss der gute Bulle sein.«
»Ich meine es ernst.«
»Ich auch.«
»Du bist ein guter Mann.«
So war ich immer schon. Auch vor sechs Jahren, als du mich verlassen hast.
Ist das die Einleitung zu irgendeiner Entschuldigung?, frage ich mich. Vielleicht will sie mir eine weitere Chance geben. Ein Schweißtropfen rinnt von meinem Haaransatz im Nacken am Rückgrat herunter bis ins Kreuz.
»Ich weiß, wir können die Zeit nicht zurückdrehen«, sagt Julianne, »und wir können unsere Fehler nicht wiedergutmachen …«
»Du machst mir langsam Angst …«
»Es ist nichts Dramatisches«, erwidert sie wieder ernst. »Ich wollte dich fragen, ob du den Sommer mit uns verbringen möchtest?«
»Verzeihung?«
»Emma und Charlie haben sich bereit erklärt, ein Zimmer zu teilen, sodass du ein Zimmer für dich haben würdest.«
»In dem Häuschen?«
»Du hast gesagt, du wolltest ein paar Wochen frei nehmen. Du könntest nach London pendeln, wenn du arbeiten musst. Die Mädchen würden dich wirklich gern öfter sehen.«
»Du möchtest, dass ich wieder einziehe … als Gast.«
»Du bist kein Gast. Du bist ihr Vater.«
»Und du und ich …?«
Sie legt den Kopf leicht zur Seite. »Deute nicht zu viel hinein, Joe. Ich dachte einfach, es wäre nett, wenn wir den Sommer zusammen verbringen.« Sie zieht ihre Hand zurück und wendet den Blick ab. Atmet aus und wieder tief ein. »Ich weiß, dass das ziemlich kurzfristig kommt. Du musst nicht Ja sagen.«
»Nein.«
»Oh.«
»Nein, ich meine, ich weiß, dass es keinen Druck gibt. Es klingt perfekt, wirklich … es ist bloß …«
»Was?«
»Ich schätze, ich habe Angst, wenn ich zu viel Zeit mit den Mädchen verbringe, wird es mir schwerfallen, mich wieder zu verabschieden.«
Sie nickt.
»Und ich könnte mich wieder in dich verlieben.«
»Beherrsch dich.«
Das Schweigen dehnt sich unbehaglich. Ein junges Paar an einem Nachbartisch lacht laut. Die Stimme des Mädchens klingt süß und glücklich. Ich atme tief ein und halte die Luft an. Julianne tut offenbar das Gleiche.
Gar nichts zu sagen wäre das falsche Zeichen. Ich bin ihr eine Erklärung schuldig oder muss ihr zumindest auf halbem Weg entgegenkommen. Sie hat mir eine Rettungsleine zugeworfen. Ich sollte sie mit beiden Händen packen, doch ich bin mir nicht sicher, ob sie irgendwo angebunden ist.
»Du musst dich auch nicht gleich entscheiden«, sagt sie entschuldigend. Verletzt.
»Nein, ich glaube, ich komme.«
Noch während ich das sage, höre ich in meinem Kopf einen leisen Warnton, so als hätte ich den Sicherheitsgurt nicht angelegt oder den Schlüssel in der Zündung stecken lassen. Es ist kein toller Plan. Das Ganze hat garantiert ein Nachspiel. Es endet in Tränen.
Juliannes Lippen verziehen sich zu einem breiten Lächeln, ihre Zähne blitzen dabei, und in ihren Augenwinkeln bilden sich kleine Fältchen. Wir essen weiter, doch die Unterhaltung ist nicht mehr so ungezwungen wie vorher.
Charlie ruft an und verabredet sich mit uns. Sie ist ganz in der Nähe. Vor dem Pub kramt Julianne in ihrer weichen Schultertasche nach ihren Autoschlüsseln.
»Du verstehst, dass es nur für den Sommer ist?«
»Natürlich.«
»Ich möchte nicht, dass du dir Hoffnungen machst.«
»Nur so viel, wie du mir erlaubst.«
Julianne wendet sich, als würde sie ein Geheimnis aus ihrer Tasche ziehen, doch sie hat nichts in der Hand, als sie sich wieder umdreht. »Und wann möchtest du kommen?«
»Wie wär’s mit dem Wochenende?«
»Ausgezeichnet«, antwortet sie. »Ich nehme an, du brauchst keine Wegbeschreibung.«
»Nein, brauche ich nicht.«
Sie zögert. »Ist alles in Ordnung, Joe?«
»Ja.«
»Es gibt vieles, worüber wir nicht geredet haben.«
»Stimmt.«
»Vielleicht machen wir das dann.«
Sie beugt sich vor, um mich zu küssen. Ich bin versucht, auf ihren Mund zu zielen, doch sie hält mir die Wange hin, und ich muss mich mit ihrem frischen Seifenduft und dem Gewicht ihres Kopfes zufriedengeben, den sie für einen Moment auf meine Schulter legt.
Fass dir ein Herz, sage ich mir, als sie ihre Sonnenbrille aufsetzt.
Mein Handy vibriert. Ich ziehe es aus der Tasche und blicke auf das Display. Veronica Cray. Ich stecke das Handy wieder weg.
»Du solltest rangehen«, sagt Julianne.
»Das kann warten.«
Mein Handy vibriert wieder. Derselbe Anrufer. Es sind bestimmt keine guten Nachrichten. Das sind sie nie, wenn sie von der Leiterin des Dezernats für Kapitalverbrechen kommen. Sie wird nicht anrufen, um mir zu sagen, dass ich ein Vermögen geerbt, eine Systemwette beim Pferderennen gewonnen oder den Friedensnobelpreis verliehen bekommen habe.
Julianne beobachtet mich. Wartet. Ich lächele entschuldigend, hebe einen Finger und forme stumm die Worte »eine Minute«.
»Chief Superintendent.«
»Professor.«
»Kann ich Sie zurückrufen?«
»Nein.«
»Ich bin bloß gerade ...«
»Beschäftigt, ja, ich weiß, ich auch. Mehr als ein einbeiniger Stepptänzer, und Sie rufen mich nicht zurück. Das tun Sie nie, weil Sie denken, dass ich etwas von Ihnen will. Aber überlegen Sie mal für einen Moment, dass dies auch ein privater Anruf sein könnte. Ich könnte als Freundin anrufen. Vielleicht möchte ich bloß ein bisschen mit Ihnen plaudern.«
»Rufen Sie denn als Freundin an?«
»Selbstverständlich.«
»Und Sie wollen nur ein bisschen plaudern?«
»Unbedingt, aber da uns die Themen ausgegangen sind, möchte ich, dass Sie sich für mich etwas ansehen.«
»Ich mache kein Profiling mehr.«
»Sie sollen auch nicht als Profiler tätig werden. Ich möchte nur Ihre Meinung hören.«
»Über ein Verbrechen?«
»Ja.«
»Einen Mord?«
»Einen Doppelmord.«
Ich warte und sehe sie vor mir, rund wie ein Fass, mit stacheligen kurzen Haaren und einem Faible für Männerschuhe. Sie schreibt ihren Nachnamen mit »C«, nicht mit »K«, weil sie nicht will, dass die Leute denken, sie wäre mit den psychopathischen Zwillingsbrüdern verwandt, die in den Siebzigern das Londoner East End terrorisiert haben.
Ich kenne Ronnie Cray seit beinahe sieben Jahren, seit sie mir zugesehen hat, wie ich am Straßenrand gekotzt habe, nachdem eine nackte Frau von der Clifton Suspension Bridge in den Tod gesprungen war. Ich sollte sie davon abhalten. Ich hatte versagt. Die nachfolgenden Ereignisse haben mich meine Ehe gekostet. Ronnie Cray hat diese Ermittlung geleitet. Ich glaube, sie macht sich Vorwürfe, meine Familie nicht genug geschützt zu haben, doch es war niemandes Schuld außer meiner. Seitdem hat sie den Kontakt gehalten, mich manchmal in einem Fall um Rat gefragt oder Details fallen lassen wie Brotkrumen in der Hoffnung, dass ich der Spur folgen würde. Mittlerweile ist sie tatsächlich so etwas wie eine Freundin, obwohl ich mir nie ganz sicher bin, wann ich jemanden eine Freundin oder einen Freund nennen soll. Ich habe so wenige.
»Suchen Sie sich einen anderen Psychologen«, wehre ich die Bitte ab.
»Das habe ich schon. Er nennt sich ›Der Mindhunter‹. Preist seine Dienste an. Sie müssen von ihm gehört haben.«
»Nein.«
»Das ist seltsam. Er sagt, Sie hätten ihm alles beigebracht, was er weiß.«
»Was?!«
»Er hat sogar Ihren Namen als Referenz angegeben.«
Ich zögere. Julianne und Charlie wollen sich verabschieden.
»Wo wollen wir uns treffen?«
»Ich nenne Ihnen die Adresse.«
2
Die Straßen des West Country sind verstopft mit Wohnwagen und Touristenbussen, die sich angestaut haben wie Baumstämme in einem überfluteten Fluss. Ich wünschte, ich hätte mich nicht von Cray überreden lassen. Sie hat mir einen Köder vor die Nase gehalten, den Haken versenkt und mich eingeholt wie eine fette Forelle.
Jemand hat meinen Namen benutzt, um Türen zu öffnen und das Vertrauen der Polizei zu gewinnen. Womöglich ein Scharlatan oder ruhmsüchtig oder sensationshungrig. Ich verachte Psychologen, die an Tatorten herumstolzieren, in Fernsehsendungen dozieren und vom Leid anderer Menschen profitieren. Oder sie schreiben Bücher über bestimmte Mordfälle, in denen sie das Wie und Warum erklären – was rückblickend immer leicht ist. Ich verstehe nicht, wie jemand Freude daran haben kann. Es geht nicht um ein Denkrätsel oder um ein Gesellschaftsspiel. Jemand ist tot, geschändet oder verschwunden. Er oder sie hatte Familie und Freunde, war Teil einer Gemeinschaft.
Mein linker Arm zuckt in meinem Schoß. Ich packe das Lenkrad und kämpfe gegen die Versuchung an umzukehren. In ein paar Stunden könnte ich in London sein. Ich könnte einen Koffer packen und früher bei Julianne einziehen. Meine Begeisterung demonstrieren.
Am Stadtrand von Portishead halte ich an und frage in einem Pub namens The Albion nach dem Weg. Die schwere, breite Tür leistet Widerstand, und ich muss mich mit meinem ganzen Gewicht daranhängen, um sie aufzuziehen. An der Milchglasscheibe klebt ein Zettel.
Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe
HABEN SIE ETWAS GESEHEN?
Am Samstag, dem 6. Juni, gegen Mitternacht wurden Elizabeth Crowe und ihre Tochter Harper in ihrem Bauernhaus in der Nähe von Clevedon getötet.
Waren Sie zwischen Samstag 22 Uhr und dem frühen Sonntagmorgen in der Nähe der Windy Hill Farm unterwegs?
Ist Ihnen eine Person aufgefallen, die sich verdächtig verhalten hat?
Hinweise unter der Nummer: 0800-555111
Der Wirt ist ein rundlicher, kurzarmiger Bob-Hoskins-Typ mit vom Alkohol geröteten Wangen und einer Boxernase. Das Lokal ist fast leer, und er liest eine Zeitung, die zwischen seinen Ellbogen auf dem Tresen liegt. »Kundschaft«, ruft er. Eine Frau kommt aus dem Keller, ihr kupferfarbenes Haar ist hochgesteckt, einzelne Strähnen kleben in ihrem Nacken.
»Was darf ich Ihnen bringen, Schätzchen?«
»Ich suche die Windy Hill Farm.«
Ihr Lächeln verblasst. »Sind Sie Reporter?«
»Nein.«
»Wie ein Bulle sehen Sie auch nicht aus«, stellt der Wirt fest und faltet den Daily Mirror. »Vielleicht bloß ein Gaffer. Wir hatten sie alle hier. Trauertouris, Amateurdetektive, True-Crime-Spinner …«
»So jemand bin ich nicht«, sage ich.
»Vielleicht will er das Haus kaufen«, sagt die Frau.
Der Mann lacht höhnisch. »Ich würde keine einzige Nacht darin verbringen.«
»Seit wann bist du denn so zimperlich?«
Ich habe einen Streit ausgelöst, über dem sie mich offenbar vergessen haben. Ich räuspere mich. »Die Windy Hill Farm?«
Sie halten kurz inne und streiten dann gleich weiter, diesmal über den Weg. Sie sagt, es seien zwei Meilen, er meint drei.
»Halten Sie nach den Blumen Ausschau«, sagt sie schließlich. »Sie können sie gar nicht übersehen.«
Ich fahre weiter, folge der Küstenstraße über sanfte Hügel und flache Talsohlen, vorbei an weiß gestrichenen Häuschen, Farmen und Viehhöfen. Verkümmerte Bäume klammern sich an Kuppen, arthritisch gebeugt, als würden sie sich in Erwartung kommender Stürme niederkauern.
Der Haufen aus Blumen und Plüschtieren ist mittlerweile so hoch wie der Zaun. Es gibt Karten, Kerzen und handgemalte Schilder. Auf einem steht: Gerechtigkeit für Elizabeth und Harper. Zwischen den Torpfosten ist Absperrband der Polizei gespannt und von vorherigen Fahrzeugen durchgerissen worden. Die Reste flattern blass und ausgefranst wie eine zurückgelassene Partydekoration.
Ich biege von der Straße ab und fahre über einen Weiderost und einen Pfad entlang, der auf beiden Seiten von einer zwei Meter hohen Hecke gesäumt ist. Ich sehe nichts, bis ich um die nächste Ecke komme und ein zweistöckiges weiß getünchtes Bauernhaus in meinem Blickfeld auftaucht, das sich dicht an den Hügelkamm schmiegt, geschützt vor den heftigsten Böen des Windes.
Neben dem Tor vor dem Haus parkt ein Zivilfahrzeug der Polizei. Ronnie Cray steigt auf der Beifahrerseite aus, dreht ihren Hals von einer auf die andere Seite und zieht ihre Hose hoch. Aus irgendeinem Grund hat ihr gefärbtes stacheliges Haar nie dieselbe Farbe wie ihre Augenbrauen, sodass es immer so aussieht, als trüge sie eine Perücke. Bei Cray weiß ich nie, ob ich sie umarmen oder ihr auf die Schulter klopfen soll. Sie streckt die Hand aus, ergreift meine Faust und zieht mich in eine Umarmung, die so kurz ist, dass es auch ein Aufeinanderprallen unserer Brüste sein könnte.
Sie ist in Begleitung eines weiteren bekannten Gesichts, Colin Abbott, besser bekannt als »Monk«, ein schwarzer Londoner, der einen Kopf größer ist als seine Chefin. Monk ist seit unserer letzten Begegnung befördert worden – er ist jetzt Detective Inspector –, und seine festen Locken werden langsam grau. Sie kleben an seinem Schädel wie Eisenspäne an einem Magneten.
»Wie geht’s den Jungen?«, frage ich. Er hat drei davon.
»Gut«, sagte er und zermalmt meine Hand mit seinem Händedruck. »Der Älteste reicht mir schon bis hier.« Monk berührt seine Schulter.
»Melden Sie ihn beim Basketball an.«
»Ich vermute, was seine Hand-Augen-Koordination betrifft, kommt er eher nach seiner Mutter.«
Andere Höflichkeiten werden ausgetauscht. Cray wird ungeduldig. »Der Nachmittagstee ist vorbei, Ladys, Sie können später weitertratschen.«
»Also, wer hat meinen Namen als Referenz benutzt?«, frage ich.
»Emilio Coleman.«
»Nie gehört.«
»Ende zwanzig, attraktiv, selbstverliebt. Er sagt, er hätte bei Ihnen studiert.«
Ich überlege. Emilio Coleman? Emilio? Ich habe an der University Bath einmal die Masterarbeit eines älteren Studenten namens Milo betreut. Das war vor vier oder fünf Jahren. Milo war intelligent, aber faul. Er nutzte seine Fähigkeiten mehr dazu, junge Bachelor-Studentinnen ins Bett zu kriegen, als seine Prüfungen zu bestehen. Ich weiß noch, dass er mir als erstes Thema für seine Abschlussarbeit eine Studie darüber vorgeschlagen hat, ob Frauen bei lauter Musik und übermäßigem Alkoholgenuss eher bereit sind, nach dem ersten Date Sex zu haben.
»Er ist also einer von Ihren früheren Studenten«, sagt Cray, und es hört sich so an, als wäre ich persönlich verantwortlich für den Mann.
»Was hat er getan?«, frage ich.
»Mr Coleman hat der vorherigen Ermittlungskommission seine Dienste angeboten und dabei Ihren Namen als Referenz genannt. Er durfte Zeugenaussagen lesen und Tatortfotos ansehen. Danach ist er direkt zur Presse marschiert.«
Mich beschleicht ein ungutes Gefühl. »Und dort hat er Details ausgeplaudert, die der Öffentlichkeit mit Absicht vorenthalten worden waren – die genaue Position der Leiche, die Art der Verletzungen, das Zeichen, das an der Wand war. Potenzielle Verdächtige brauchen jetzt nur noch zu behaupten, sie hätten in der Zeitung über den Fall gelesen. Außerdem wird es für uns schwieriger, die Zeitverschwender und falschen Geständnisse herauszufiltern.« Sie senkt die Stimme. »Das kommt davon, wenn Sie mich nicht zurückrufen, Professor. Dann schlägt die große Stunde der Dilettanten.«
»Das ist ja wohl kaum meine Schuld.«
»Na ja, also, Sie haben diesen Clown unterrichtet.«
»Ich habe ihn ein oder zwei Mal pro Semester gesehen.«
»Ich bin nicht hier, um mit Ihnen zu streiten. Ich möchte, dass Sie es besser machen.«
»Wie?«
»Schauen Sie sich den Fall kritisch an. Gehen Sie noch einmal alle Zeugenaussagen und Ermittlungsakten durch. Sagen Sie uns, was wir übersehen haben.«
»Gibt es Verdächtige?«
»Zu viele«, knurrt sie. »Die Leute hier glauben, wir hätten es vermasselt. Die Nerven liegen allmählich blank. Heute Abend gibt es eine öffentliche Versammlung. Ich möchte, dass Sie dabei sind.«
»Warum ich?«
»Sagen wir so: Es wäre ein Zeichen der Freundschaft.«
»Das ist aber nicht meine Definition von Freundschaft.«
Cray rollt die Schultern nach hinten und lächelt mich mit blitzenden Augen an. »So ist das nun mal mit uns, Professor. Wir können unterschiedlicher Meinung sein, ohne dass es unsere tiefe und bleibende Freundschaft beeinträchtigt. Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Tatort.«
3
Detectives haben eine Art zu reden, die Informationen zu Stichpunkten zusammendampft und auf viele Präpositionen verzichtet; mündliche Steno gewissermaßen, die Kollegen instinktiv verstehen. Darauf greift Cray nun zurück.
»Zwei Opfer, Mutter und Tochter, Elizabeth und Harper Crowe, dreiundvierzig und siebzehn beziehungsweise achtzehn ...«
»Beziehungsweise?«
»Harper hatte an dem Sonntag Geburtstag. Wir wissen nicht, ob sie vor oder nach Mitternacht gestorben ist.«
Ein Windstoß erfasst die Bäume und macht mich unruhig. Ich betrachte das Farmhaus, 17. Jahrhundert, denkmalgeschützt, Sprossenfenster und Blumenkästen. Es steht auf sechseinhalb Hektar Land mit einem Obsthain, einem ummauerten Garten, einem alten Getreidespeicher, Ställen, Melkschuppen und einem Hühnerstall.
»Sieht aus wie eine Bed-and-Breakfast-Pension.«
»Komisch, dass Sie das sagen«, erwidert Cray und streicht sich über den Kopf. »Vor drei Monaten hat Elizabeth Crowe offiziell einen Antrag dafür gestellt. Sie wollte eine B-&-B-Pension hier einrichten. Der Gutachter von der Stadtverwaltung hat ihr eine Liste mit Dingen gegeben, die noch gemacht werden mussten – Einbau von Feuerschutztüren, Notbeleuchtung, neue Badezimmer und vernünftige Beschilderung. Im letzten Monat hatte sie alle möglichen Handwerker im Haus.«
»Wie hat sie das finanziert?«
»Mit einem Bankkredit und dem Geld aus ihrer Scheidungsvereinbarung.«
Mir fällt die zersplitterte Holzfüllung der Haustür auf. Jemand hat ein Loch hineingeschlagen, das groß genug ist, um hindurchzugreifen und die Tür zu entriegeln. Cray öffnet das Vorhängeschloss mit einem Schlüssel. Die Tür geht nach innen auf. Bis zum Ende des Flurs sind Lattenroste wie Trittsteine ausgelegt. Ich blicke auf meine Schuhe.
»Machen Sie sich keine Sorgen«, sagt Cray, als hätte sie meine Gedanken gelesen. »Die Spurensicherung hat das Haus schon zwei Mal auf den Kopf gestellt.« Wir treten ein. Mein Blick fällt auf einen fleckigen Spiegel in einem vergoldeten Rahmen und eine Sammlung von Spazierstöcken in einem Schirmständer.
»Die Leichen wurden am Sonntag, den 7. Juni, um 7.33 Uhr entdeckt. Harper war oben, Elizabeth im Wohnzimmer.«
»Wer hat sie gefunden?«
»Ein Nachbar, Tommy Garrett, lebt bei seiner Großmutter. Ihnen gehört die Farm direkt hinter den Bäumen dort.«
»Was hat er hier gemacht?«, frage ich.
»Sagt, er hätte die Alarmanlage gehört, als er angefangen hat, die Kühe zu melken. Doreen hat ihn erst seine Pflichten erledigen lassen, bevor er hierherkommen durfte. Er ist über den Zaun gesprungen und zunächst zur Hintertür gegangen. Dann ist er ums Haus herumgelaufen und hat die aufgebrochene Tür gesehen. Drinnen hat er dann Mrs Crowe gefunden.«
»Ist er auch nach oben gegangen?«
»Er sagt Nein. Als die ersten Beamten eintrafen, hat er gewütet, geschrien und gegen den Zaun getreten.«
»Ist er tatverdächtig?«
»Nummer eins auf der Liste.« Cray blickt zu Monk. »Wie würden Sie Tommy Garrett beschreiben?«
»Langsam«, lautet die Antwort, »obwohl er seine Geschichte ruck, zuck an die Boulevardblätter verkauft hatte.«
»Das war wahrscheinlich seine Großmutter«, sagt Cray, »aber ich würde den Jungen trotzdem nicht unterschätzen.«
Ich blicke auf ein Rechteck aus sandfarbenem Sonnenlicht auf den ausgetretenen Bodendielen. »Sie sagten, Elizabeth war geschieden.«
»Vor acht Monaten«, erwidert Cray.
»Und ihr Ex?«
»Dominic Crowe ist ein Bauunternehmer aus der Gegend. Sie waren vierundzwanzig Jahre verheiratet. Vor etwa zehn Jahren hat Crowe mit seinem besten Freund Jeremy Egan eine Bauträgerfirma gegründet, doch Dominic musste seine Anteile während der Finanzkrise verkaufen. Elizabeth hat sie aufgekauft. Sie hatte Geld von ihrer Familie. Sie bestand darauf, dass ihr die Firma überschrieben wird. Dann hat sie sich scheiden lassen und ihm auch noch den Rest genommen.«
»Das muss ihn ziemlich verbittert haben.«
»Er ist unser Hauptverdächtiger Nummer zwei«, sagt Monk.
Ich blicke den Flur hinunter und sehe, dass er sich zu einer Küche öffnet. Zur Linken liegt ein Esszimmer mit poliertem Mahagonitisch und passenden Stühlen. Auf dem Kaminsims stehen gerahmte Fotos und die Bronzestatue eines Fuchses. An den Wänden hängen Aquarelle, Landschaften und Küstenszenen.
Cray gibt mir zwei Fotos. Das erste zeigt eine attraktive Blondine mittleren Alters mit knapp schulterlangem Haar. Sie hat ein leicht schräges Lächeln und blaue Augen unter dünn gezupften Brauen. Das zweite Bild zeigt ihre Tochter Harper, deren Augen eher grau als blau sind und deren dunkleres Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden ist. Sie ist hübsch und sportlich, ihr Lächeln entblößt eine schmale Lücke zwischen den Vorderzähnen.
»Harper wurde oben im Bett gefunden, erstickt, höchstwahrscheinlich mit einem Kissen. Keine Anzeichen von sexueller Gewalt. Praktisch keine Kampfspuren. Die Mutter wurde hier gefunden.«
Ich trete in das Wohnzimmer zur Rechten. Die Atmosphäre schlägt plötzlich um, als hätte jemand eine Tür oder ein Fenster geöffnet und damit den Luftdruck oder die Temperatur verändert. Mein Blick wird von einem verschmierten rötlichen Symbol über dem Kamin angezogen – ein fünfzackiger Stern in einem Kreis, dessen untere Ränder aus dem Putz zu sickern scheinen, als würde die Wand bluten.
Bestimmte Zeichen lösen eine instinktive Reaktion aus – Gedanken, bevor wir etwas denken. Das Pentagramm ist eines von ihnen. Es gilt als heidnisches Symbol und reicht weiter zurück als bis zum antiken Mesopotamien. Über die Jahrtausende war es Zeichen der Freimaurer, königliches Wappen, Schutz gegen das Böse, Insignium königlicher Abstammung und ein christliches Symbol, das die fünf Wunden Christi darstellt. Ich weiß nicht, wofür es in diesem Kontext steht – für etwas Verdrehtes und Schändliches, eine Visitenkarte oder eine Absichtserklärung.
Im übrigen Zimmer sind die Möbel nach hinten gerückt worden. Das Sofa steht an der Wand, die beiden Sessel links und rechts neben dem Fenster. Kerzen sind aufgestellt worden, und auf einem Beistelltisch liegt eine aufgeschlagene Bibel. Die Seiten sind mit Fingerabdruckpulver übersät.
»Darf ich mal?«, unterbricht Cray meine Gedanken und schlägt ein Album mit Tatortfotos auf.
Trotz der Spuren an der Wand bin ich nicht auf die Wucht der Bilder vorbereitet. Auf den ersten Blick sehen sie aus wie Szenenbilder eines B-Horrorfilms aus Hollywood, bei dem eimerweise Blut verschüttet wurde. Auf dem Boden ist die Leiche einer Frau zu erkennen, ihre Arme und Beine sind gespreizt, ihre Hände bittend nach oben gewandt. Ihr halbnackter Körper ist völlig verstümmelt. Gemetzelt. Geschändet.
Es ist nicht das erste Mal, dass ich einen Toten sehe. Ich habe Obduktionen beigewohnt, Unfallopfer und die Überreste von Kindern in Augenschein nehmen müssen, doch nichts kann einen auf einen derartigen Anblick vorbereiten – auf das schiere Grauen, die Trauer, den Unglauben, die Verwirrung und die Wut, die einen in dem Moment überkommt; auf die sinnlose Brutalität und die kranke Demonstration von Macht.
»Sie hatte sechsunddreißig Stichwunden«, sagt Cray, »die meisten wurden ihr nach dem Tod zugefügt. Wie Sie sehen, hat er sich auf ihre Genitalien konzentriert.«
Ein weiteres Foto zeigt das Gesicht des Opfers. Ihre Augen sind offen, doch in ihrem Blick liegt kein Schmerz oder Entsetzen. Ich hoffe, sie ist schnell gestorben. Ich hoffe, sie hat nicht gelitten.
»Ich glaube nicht, dass ich Ihnen helfen kann«, flüstere ich.
»Warum nicht?«
»Ich bin klinischer Psychologe. Sie brauchen jemanden, der auf solche Fälle spezialisiert ist. Rufen Sie in Broadmoor oder Rampton an.« Ich wende mich ab, um den Flur hinunterzugehen. Mich drängt es an die frische Luft.
»Ich möchte niemand anderen«, sagt Cray mittlerweile leicht gereizt. »Glauben Sie mir, Professor, ich will Ihnen dieses Szenario eigentlich nicht zumuten. Ich begreife es nämlich genauso wenig wie Sie, wie jemand so etwas tun kann. Es übersteigt schlicht mein Vorstellungsvermögen. Aber ich weiß noch, wie Sie den Fall damals angegangen sind. Ich habe gesehen, wie Sie ein Verbrechen rekonstruiert haben. Sie können Gedanken lesen …«
»Ich kann nicht Gedanken lesen.«
»Dann eben Motive, Reize, Impulse, wie immer Sie es bezeichnen wollen – ich brauche Ihre Hilfe.«
Ich antworte nicht. Ich finde keine Worte. Cray wartet. Sie sieht viel älter aus als bei unserer letzten Begegnung. Erschöpfung hat die Tränensäcke unter ihren Augen anschwellen lassen und tiefe Furchen in ihre Stirn gegraben.
Jede Faser meines Körpers schreit mich an, dass ich gehen soll. Einfach weitergehen. In den Wagen steigen. Heute war ein guter Tag für mich. Julianne hat mich gebeten, nach Hause zu kommen. Sie würde es hassen, dass ich überhaupt hier bin. Sie wird mir Vorwürfe machen. Aber unbewusst sammele ich schon Details und male mir aus, wie es sich zugetragen haben könnte.
Ich nehme Cray die Fotos ab, stelle mich vor den Kamin, halte sie einzeln hoch, nehme die Position des Fotografen ein, blicke wie durch seine Linse und versuche, jene Nacht zu rekonstruieren. Elizabeth war bis auf einen dünnen Bademantel nackt. Auf der Vorderseite sind Urinflecken. Wie kann das sein? Die erste Stichwunde hat die Halsschlagader durchtrennt. Blut ist aus der Arterie auf den Sessel neben ihrem Kopf gespritzt. Sie hat die Kontrolle über ihre Blase verloren. Er hat sie sanft hingelegt und ist dann Amok gelaufen.
Das ist es, was ich tue – ich betrachte den Tatort, stelle mir vor, was geschehen ist, spiele es in meinem Kopf nach und erkenne die psychologischen Marker, die jeden Aspekt menschlichen Verhaltens steuern. Ich habe in meiner Praxis viele verstörende Dinge gehört und gesehen. Ich habe Traurige, Einsame, Getrennte, Wütende, Ängstliche, Eifersüchtige, Todessehnsüchtige und Mordlustige behandelt. Ich habe die Tiefen menschlichen Elends ausgelotet, doch ich weiß, dass es immer noch eine weitere Schicht gibt, dunkler und gefährlicher.
»Hat man Blutspuren in einem der Badezimmer gefunden?«, frage ich.
»In der Waschküche«, sagt Cray.
»Und oben?«
»Nein.«
»Fingerabdrücke?«
»Achtundvierzig Voll- oder Teilabdrücke – die meisten von Mitgliedern der Familie. Weitere Blutstropfen wurden direkt hinter der Haustür gefunden, neben einem verschmierten Fußabdruck.«
Ich gehe durch den Flur in die Küche. Neben dem Spülbecken trocknen zwei Tassen und ein einzelnes Weinglas. Über dem Wasserhahn hängen Gummihandschuhe. Der Aga-Herd ist kalt.
Cray redet immer noch. »Die Spurensicherung hat Faserspuren im Teppich sichergestellt, im Bett ihrer Tochter Spermaflecken. Die DNA entspricht der ihres Freundes. Auf dem Vordersitz des Wagens der Mutter wurden ebenfalls zahlreiche Spermaflecken gefunden. Wir haben die DNA-Proben mit unserer Datei abgeglichen. Bisher ergebnislos.«
»Hat sich die Mutter regelmäßig mit jemandem getroffen?«
»Nicht nur mit einem«, sagt Cray und verzieht leicht das Gesicht.
»Das heißt?«
»Wissen Sie, was Dogging ist, Professor?«
»Ich habe davon gehört, doch ich lasse mich gerne von Ihnen aufklären.«
Cray schlägt den Blick nieder, das Thema ist ihr unangenehm. »Manche Leute macht es an, sexuelle Handlungen an halb öffentlichen Orten im Freien zu praktizieren. Es gibt eine ganze Subkultur – Teilnahmeregeln, Etikette, Websites …«
»Und Elizabeth Crowe stand auf so was?«
»Das nehmen wir an. Immerhin ein Zeuge hat ausgesagt, sie an einem einschlägigen Treffpunkt bei einem Sexualakt beobachtet zu haben, und wir haben die Spermaflecken in ihrem Wagen.«
»Das heißt, ihr Mörder könnte sie dort getroffen oder beobachtet haben?«
»Ja.«
»Das macht die Sache nicht leichter.«
»Sagen Sie bloß.«
Cray geht die Stunden vor den Morden durch. Elizabeth hatte ihrer Schwester erzählt, sie wolle abends daheim bleiben, doch das Signal ihres Handys beweist, dass sie das Haus um kurz nach halb neun verlassen hat.
»Wir haben ihre Bewegungen bis zu den Clevedon Court Woods an der Tickenham Road verfolgt. Es ist ein bekannter Parkplatz-Sex-Treff. Abgelegen. Privat.«
»Hat irgendjemand sie dort gesehen?«
»Wir haben ein mobiles Einsatzzentrum eingerichtet und mit Autofahrern gesprochen, doch die Nachricht hat sich ziemlich schnell verbreitet. Bislang hat sich niemand gemeldet.«
»Kann es sein, dass sie mit jemandem verabredet war?«
»In ihren SMS, Anruflisten und E-Mails haben wir nichts gefunden, aber vielleicht hatte sie es schon früher vereinbart.« Cray reibt sich die von Schlafmangel verquollenen Augen. »Es gibt etwas, was das Ganze noch verkompliziert. Wir wissen, dass Mrs Crowe vor sechs Monaten Mitglied einer Online-Dating-Agentur geworden ist. Es ist zu zwei Treffen gekommen – beide mit Männern aus der Gegend.«
»Hatte sie Sex mit ihnen?«
»Zunächst haben beide es bestritten. Einer ist verheiratet. Seine Spermaspuren wurden in Elizabeths Wagen sichergestellt. Der andere ist Witwer. Er hatte in einer Wohnung in Bristol Sex mit ihr. Der Witwer hat für die Mordnacht ein Alibi. Den verheirateten Mann haben wir noch auf dem Radar.«
Ein tropfender Wasserhahn macht ein ploppendes Geräusch, als würde jemand eine einzelne Harfensaite zupfen. Ich stehe am Spülbecken, die Arme fest um den Körper geschlungen. Cray berührt meine Schulter. Ich zucke zusammen. Sie entschuldigt sich. Mein Herz hüpft, als hinge es an einem Gummiband.
Draußen werden die Schatten länger, und die Bäume zeichnen sich scharf vor dem Hügelkamm ab. Etwas erregt meine Aufmerksamkeit – eine Bewegung in der Nähe der Ställe. Eine rotschwarz getigerte Katze schnuppert an den Mülltonnen.
»Hatten sie Haustiere?«, frage ich.
»Eine Katze«, sagt Monk. »Sie ist verschwunden.«
»Ich glaube, sie ist gerade nach Hause gekommen.«
Er tritt durch die Hintertür in den Garten. Ich beobachte, wie er in die Hocke geht, das Kätzchen leise ruft und die Hand ausstreckt. Die Katze mustert ihn argwöhnisch. Er bewegt sich auf sie zu. Mit einem Schwanzschlag ist sie in den hohen Gräsern verschwunden, die den gewölbten Bauch eines Dieseltanks streifen.
»Sie muss am Verhungern sein«, sagt er, kehrt in die Küche zurück und öffnet die Schränke. Er findet eine Dose Katzenfutter und sucht einen Dosenöffner. Cray möchte weitermachen.
»Es gibt einen Adoptivsohn – Elliot – sechsundzwanzig, wohnt in Bristol. Er ist wegen Drogenkonsums aktenkundig, zwei kleinere Vorstrafen. Er kam mit acht als Pflegekind in die Familie und wurde später adoptiert. Man hatte Elizabeth erklärt, sie könne keine Kinder bekommen, doch dann hat es im dritten Anlauf doch noch mit einer künstlichen Befruchtung geklappt.«
»Hat Elliot ein Alibi?«
»Er behauptet, die Nacht mit einer Stripperin in Bristol verbracht zu haben, kann sich jedoch weder an ihren Namen noch an die Adresse erinnern.«
»Wie passend.«
»Genau.«
»Wie hat er sich mit seiner Mutter verstanden?«
»Elliot hat bei der Scheidung zu seinem Vater gehalten. Er hat nicht mehr mit Elizabeth geredet. Das hat ihn allerdings nicht daran gehindert, seine Hand nach ihrem Geld auszustrecken.«
»Erbt er das Haus?«
»Soweit wir wissen.«
Ich gieße mir ein Glas Wasser ein. Meine linke Hand zittert, als ich es an die Lippen führe. Ich wische Tropfen von der Brust meines Hemds.
»Also dieser Tommy Garrett, der Nachbar, hat die Leichen gefunden. Gibt es abgesehen von der Tatsache, dass er am Tatort angetroffen wurde, noch einen Grund, ihn zu verdächtigen?«
»Der Junge hat diverse Arbeiten auf der Farm erledigt – Rasen gemäht, Brennholz gehackt. Vor etwa einem halben Jahr hat Mrs Crowe sich offiziell beschwert, dass jemand Unterwäsche von ihrer Leine gestohlen hat. Sie beschuldigte Tommy, konnte es jedoch nicht beweisen. Die örtliche Polizei hat ihm einen kleinen Vortrag gehalten, damit schien die Sache erledigt.«
»Hat er einen Schlüssel?«
»Nein.«
»Und was ist mit seinem Alibi?«
»Er sagt, er hätte bis spät Fernsehen geguckt.«
»Kann das irgendjemand bestätigen?«
»Seine Großmutter will kein böses Wort über ihn hören.«
Cray ist nun bereit, mir Harpers Zimmer zu zeigen. Auf dem oberen Absatz der schmalen Treppe wenden wir und folgen einem Flur, der sich über die gesamte Länge des Hauses erstreckt. Zu beiden Seiten gehen Zimmer ab, einige mit angrenzendem Bad, nackte Gerippe, die halbfertig auf Fliesen und Armaturen warten. Auf dem Boden liegen Planen, darauf Werkzeuge und Mörtelsäcke, die der Rückkehr der Handwerker harren.
In einem Raum steht ein Einzelbett unter dem Schrägdach. Es ist ein typisches Teenagerzimmer, unaufgeräumt, überhäuft und eigenwillig. Kleider hängen über den Heizkörpern und quellen aus Schubladen und Flechtkörben. Ein BH baumelt an der Türklinke. Schmutzige Sachen sind neben dem Wäschekorb gelandet. An den Wänden kleben Fotos, Poster, Wimpel und Fahnen. Es erinnert mich an Charlies Zimmer, nur dass auf ihren Postern Hipster mit Vollbärten und verweichlichte Jungs mit feinen Gesichtszügen abgebildet sind.
»Sie lag auf dem Bett«, sagt Cray. »Praktisch unberührt.«
»Waren die Jalousien hoch oder heruntergelassen?«
»Unten.«
Ich ziehe an der Kordel, der Stoff faltet sich nach oben zusammen und gibt den Blick auf das Fenster frei, das einen Spalt offen steht. Die Fensterbank ist mit Plüschtieren, Nippes, bemalten Kieselsteinen, Kristallen und einer Schneekugel des Eiffelturms dekoriert. Ich bemerke ein kleines viereckiges Loch in einer Ecke des Fensters.
»Es wurde von außen eingeworfen«, sagt Cray. »Wir haben vor dem Haus eine Glasscherbe auf dem Boden gefunden.«
Ich schiebe das Fenster auf und blicke hinaus. Die Dachziegel aus Schiefer sind mit getrocknetem Moos überzogen. Bis zum Boden sind es etwa sieben Meter. Vermutlich hätte sich jemand an einem Fallrohr hinauf- und wieder hinunterhangeln können, aber das Loch in der Scheibe ist zu niedrig, um die Fensterverriegelung zu erreichen.
Das Zimmer ist unordentlich, doch nichts wurde verschoben oder umgestoßen.
Ich betrachte die Skizzen und ungerahmten Aquarelle.
»Wer hat die gemalt?«
»Harper«, sagt Cray. »Sie wollte Kunst studieren.«
Auf einem Hängeregal über Harpers Schreibtisch stehen Bücher über Malerei und Fotografie, an die schräge Decke über ihrem Bett sind zahlreiche Polaroids gepinnt. Der ganze Retrolook muss ihr gefallen haben – die Verwendung von Film statt einer digitalen Spiegelreflex. Vielleicht mochte sie das Geräusch, wenn die Kamera die Bilder ausspuckt, oder sie hat gerne zugesehen, wie die Chemikalien auf weißem Papier Bilder formen.
»Haben Sie ihre Kamera gefunden?«, frage ich und lasse den Blick über die Regale schweifen.
Cray steht noch immer in der Tür. »Sie lag auf dem Rücksitz ihres Autos.«
Ich überquere den Flur und betrete Elizabeths Schlafzimmer, ein antiker gusseiserner Bettrahmen trägt eine Matratze, die in der Mitte leicht durchhängt, als ob darauf noch immer eine unsichtbare Leiche liegen würde. Die Laken sind abgezogen. Kriminaltechniker werden sie auf Fasern, Flecken und Hautpartikel untersucht haben.
Durch einen begehbaren Kleiderschrank gelangt man in das angrenzende Bad. Zwischen den Regalen und Stangen streiche ich mit einer Hand über die Kleider und fühle die Stoffe. Größe 42. Markenware. Mode aus den vergangenen zehn Jahren. Diese Kleidung ist sorgfältig gepflegt worden von einer Frau, die es gewohnt war, genug Geld zu haben, und dann feststellen musste, dass es vielleicht doch nicht reicht.
Als ich eine Schublade aufziehe, quillt Unterwäsche heraus: G-Strings und Mieder, zueinander passende Slips und BHs, manche leichter als Luft. Waren das Geschenke, oder hat sie diese Sachen für sich selbst gekauft?
Ich schiebe eine Hand in ihre Manteltaschen und ziehe eine Bonbonverpackung, einen Reinigungsbeleg, Kleingeld, eine halbe Kinokarte, eine Tankquittung und die Visitenkarte einer Klempnerfirma heraus.
Anschließend betrete ich das angrenzende Bad. Der Toilettensitz ist heruntergeklappt. Ein einzelnes Handtuch hängt ordentlich über einer Stange neben dem Duschbad.
Cray wartet im Schlafzimmer. Ich versuche, die Ereignisse zu ordnen. Die Haustür wurde aufgebrochen. Die Alarmanlage wurde ausgelöst. Davon wäre Elizabeth wach geworden. Sie hätte die Polizei alarmiert. Stattdessen hat sie einen Morgenmantel übergezogen und ist nach unten gegangen.
Ich bleibe am Fenster stehen und blicke auf den kleinen rechteckigen Vorgarten, der durch einen Gitterzaun von einem Feld getrennt ist, das sanft zu den Hecken hin abfällt, die die Küstenstraße säumen.
»Waren diese Vorhänge offen?«, frage ich.
»Ja.«
»Was war mit der Nachttischlampe?«
»Sie brannte.«
Im Licht der Lampe liegt ein Buch auf dem Nachttisch: Die Unvollendete von Kate Atkinson. Etwa in der Mitte steckt ein Lesezeichen zwischen den Seiten. Sie wird die Geschichte nicht mehr zu Ende lesen.
Psychologen sehen einen Tatort mit anderen Augen als Ermittler. Handfeste Indizien und Zeugen sind wichtig, wenn man einen bekannten Täter überführen