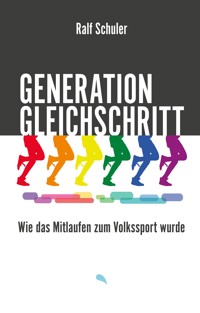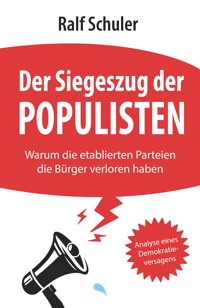
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Populisten gewinnen Wahlen, Populismus ist weltweit auf dem Vormarsch. Ralf Schuler diagnostiziert Demokratieversagen und rät zu volksnahen Problemlösungen. Sie sprechen laut, sie sprechen verständlich – und sie gewinnen Wahlen: Parteien und Politiker, die unter dem unscharfen Begriff «Populisten» einsortiert werden. Sie sind nicht nur in Deutschland, sondern längst weltweit erfolgreich: von Argentinien bis Amerika, von Portugal bis Skandinavien. Ralf Schuler, zehn Jahre lang Leiter der Parlamentsredaktion von BILD und Kanzlerkorrespondent, kennt die deutsche und internationale Politik aus der Nähe und erklärt das Phänomen des Populismus. Seine Diagnose: Demokratieversagen auf verschiedenen Ebenen. Etablierte Parteien liefern nicht, was sie versprechen, sind oft zu langsam und versuchen, im Namen der Demokratie die populistische Konkurrenz mit oftmals undemokratischen Mitteln zu bekämpfen. Doch dadurch machen sie sie nur noch stärker. Die Lösung kann nur sein: einbinden statt ausgrenzen, die Probleme lösen, die Populisten stark machen - und vor allem: mit den Menschen reden statt über sie. Denn Demokratie lebt von unten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der schlaueste Weg, Menschen passiv und gehorsam zu halten, ist, das Spektrum an akzeptabler Meinung streng zu beschränken, aber eine sehr lebhafte Debatte innerhalb dieses Spektrums zu ermöglichen – sogar die kritischeren und die Ansichten der Dissidenten zu fördern. Das gibt den Menschen ein Gefühl, dass es ein freies Denken gibt, während die Voraussetzungen des Systems durch die Grenzen der Diskussion gestärkt werden.
Noam Chomsky, The Common Good
Ralf Schuler
Der Siegeszug der Populisten
Warum die etablierten Parteien die Bürger verloren haben
Analyse eines Demokratieversagens
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://www.dnb.de/ abrufbar.
Der Fontis-Verlag wird von 2021 bis 2024
vom Schweizer Bundesamt für Kultur unterstützt.
© 2024 by Fontis-Verlag Basel
Umschlag: René Graf, Fontis-Verlag
Foto Ralf Schuler S. 302: © Wolf Lux
Satz: Justin Messmer, InnoSet AG, Basel
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
ISBN 978-3-03848-469-1
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorwort von Monika Maron
Prolog
1 · Demokratieversagen
2 · Falsche Abwehr
3 · Der Staat als Beute
4 · Das demokratische Missverständnis
5 · Das Versagen der bürgerlichen Opposition
6 · Das große Medienversagen
7 · Rückkehr zur sozialistischen Planwirtschaft
8 · Was also ist jetzt eigentlich Populismus?
Epilog
Personenregister
Quellen und Anmerkungen
Über den Autor
Vorwort
Ein Vorwort für dieses Buch zu schreiben, fällt mir schwer, weil alles, was mir zum Thema Populismus einfallen könnte, Ralf Schuler darin geschrieben hat, und das sehr viel fundierter und gründlicher, als ein politischer Laie wie ich es könnte.
In seinem Buch beweist Schuler alle Tugenden, die ich an ihm schätze: Er verbindet die aktuellen Geschehnisse mit den großen historischen Linien, präsentiert andere Stimmen, er selbst bleibt bei gebotener Schärfe seiner Kritik immer sachlich, ist nie zynisch oder hämisch, es findet sich kein Gift in seinen Argumenten, sondern das manchmal verzweifelt anmutende Bemühen, zu verstehen, was nicht zu verstehen ist, vor allem aber geht es ihm um Aufklärung.
Ralf Schuler wurde 1965 in Ost-Berlin geboren und hat die ersten 25 Jahre seines Lebens in der DDR verbracht. Auf ein Studium an der Filmhochschule Babelsberg verzichtete er trotz bestandener Aufnahmeprüfung, weil der Preis dafür eine Dienstzeit als Unteroffizier bei der Nationalen Volksarmee gewesen wäre. Und seine Arbeit als Leiter der Parlamentsredaktion bei der BILD-Zeitung kündigte er, als der Vorstand des Hauses Springer beschloß, sich konsequent auf die Seite der LBTQ-Aktivisten zu stellen. «Ich bin nicht bereit, für eine politische Bewegung, welcher Art auch immer, und unter ihrer Flagge zu arbeiten. Das habe ich früher nicht getan und tue ich heute erst recht nicht», erklärte er.
Seine Erfahrungen als Parlamentskorrespondent liefern ihm das Material für seine Analysen der Parteienpolitik mit all dem Taktieren und Verschweigen, den autoritären Allüren vor allem der Grünen, der Kumpanei zwischen Medien und Politik. Und immer wieder schiebt sich in die Analyse der Gegenwart Schulers biografische Erfahrung als Ostdeutscher, der vielleicht empfindlicher reagiert, wenn Freiheitsrechte beschnitten werden, als jemand, dem solche Erfahrungen erspart geblieben sind. Jedem Ostdeutschen muß der Paragraph gegen «staatsfeindliche Hetze» einfallen, wenn Nancy Faeser und ihr Präsident des Verfassungsschutzes ein Delikt wie die «verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates» erfinden, also eine illegitime Verschiebung der Strafbarkeitsgrenze im Kampf gegen rechts, gegen die AfD, gegen den Populismus.
Wenn eine Regierung zwanzig bis dreißig Prozent der Wähler hinter eine Brandmauer verbannt und so vom Kampf um die Regierungsmehrheit ausschließt, stimmt etwas mit dem Demokratieverständnis nicht. Wenn Kritik und Verhöhnung an der Regierung verfassungsrechtlich sanktioniert werden können, als wären die amtierenden Minister die personifizierte Demokratie und ihre Schmähung demzufolge demokratiefeindlich, liegt entweder ein juristisches Mißverständnis vor oder eine bedenkliche Überhöhung der eigenen Person. Auf die Wahl kann die Abwahl folgen, wenn der Souverän es will. Siebzig Prozent der Bevölkerung halten die regierenden Parteien für unfähig oder sogar unwillig, die Probleme des Landes zu lösen, was für die Regierung aber nicht als ein Signal zur Korrektur erkannt wird, sondern als Bedrohung der Demokratie. Und selbst die Abwahl dieser Regierung würde die deutschen Wähler nicht vor dem Personal der einen oder anderen ungeliebten Partei bewahren, denn eine von ihnen würde danach wieder mitregieren, und das Vertrauen in die CDU, die sich bis heute nicht öffentlich zu den Fehlern der Merkel-Zeit bekannt hat, bleibt erschüttert.
Der Populismus erweist sich als letzte Abwehrkraft gegen eine Politik, die den Willen der Mehrheit nicht nur mißachtet, sondern diffamiert und kriminalisiert.
Ralf Schuler untersucht die Mechanismen der Machtausübung und Machtabwehr an konkreten Beispielen nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, Österreich, Frankreich, England, Skandinavien. Sein Fazit: Der Populismus ist das Ergebnis von Demokratieversagen. Es begann in Deutschland 2013 mit der Gründung der AfD, damals eine seriöse konservative Partei, die vor allem eine andere europäische Geldpolitik forderte, aber von Anfang an als illegitimer Feind unter Naziverdacht gestellt wurde. Dieser undemokratische Umgang hat an der Radikalisierung der AfD einen entscheidenden Anteil. Wenn heute «Hass und Hetze» im Netz und im öffentlichen Umgang beklagt und verklagt werden, sollte man fragen, womit das Hassen und Hetzen eigentlich begonnen hat.
Rudolf Augstein hat den Auftrag der Journalisten in seinem berühmten Zitat benannt: «Einer Wahrheit ans Licht zu helfen, …eine Wahrheit, der die etablierten Führer und Meinungsmacher aus Bequemlichkeit und Eigensucht bislang ausgewichen sind – das ist die einzige Möglichkeit für den Journalisten, die Wirklichkeit zu verändern: Er kann sagen, was ist!» Ralf Schuler nennt seine Interviewreihe im Online-Portal NIUS «Fragen, was ist». Er interviewte Politiker wie Wolfgang Kubicki, Wolfgang Bosbach, Ralf Stegner, Sahra Wagenknecht und Arnold Vaatz, er sprach mit Dieter Nuhr, dem Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel und vielen anderen.
Schuler fragt, ohne zu urteilen, er will wissen, nicht bedrängen oder seine Gesprächspartner in verbale Fallen locken. Selbst Ralf Stegner bietet ein anderes Gesicht, als man von ihm aus öffentlichen Auftritten kennt. Auch wenn man seine Meinung danach nicht teilt, versteht man vielleicht besser, warum er sie hat. Daß Schuler vorwiegend konservative Gäste begrüßen darf, läßt vermuten, daß auch er für Grüne und Linke schon zu den Populisten gehört, mit denen man nicht spricht, denn eingeladen zum Gespräch waren sie. Ein Satz des Liberalen Wolfgang Kubicki könnte sie ermutigen: «Wenn ein Auftritt bei Ihnen (Schuler) ausreicht, jemanden zum Rechtsradikalen zu machen, komme ich jede Woche zu Ihnen.»
Jedem, der sich darüber wundert, wie aus ihm plötzlich ein Rechter geworden ist, nachdem er sich sein Leben lang für links, liberal oder konservativ gehalten hat, sei Ralf Schulers Buch über den Populismus empfohlen. Es wird ihn beruhigen.
Monika Maron, Schriftstellerin
Prolog
«Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Populismus.» Als ich diesen berühmten ersten Satz aus dem «Kommunistischen Manifest» von Karl Marx für den Einstieg in mein Buch «Lasst uns Populisten sein» (2019) leicht abgewandelt entlieh, konnte ich nicht ahnen, dass der Aufstieg dieser neuen Bewegung der sogenannten Populisten noch längst nicht zu Ende war und offenbar auch noch lange nicht zu Ende ist. Das Wort «Kommunismus» aus dem «Kommunistischen Manifest» von Marx hatte ich lediglich durch «Populismus» ersetzt, und schon passte die historische Analogie verblüffend auf unsere Tage.
Heute, ein halbes Jahrzehnt nach «Lasst uns Populisten sein», hat sich daran nichts geändert. Im Gegenteil: Die Bewegungen unter dem von außen als negative Konnotation zugewiesenen Titel «Populismus» ist eher noch größer, ja stärker geworden. Das Gespenst lebt nicht nur, es gedeiht geradezu: von der Rassemblement National (ehemals Front National) in Frankreich über Geert Wilders’ Freiheitspartei in Holland, die Schweizerische Volkspartei, die italienische Lega und die regierenden Fratelli d’Italia oder die FPÖ in Österreich und die AfD in Deutschland. Nach gängiger Lesart fallen auch die Regierungsparteien in der Slowakei und Ungarn unter das Rubrum Rechtspopulismus, und der mögliche Wahlsieg von Donald Trump in den USA lässt sich ebenfalls in dieses politische Phänomen einordnen.
Für gewisse Irritationen sorgt allenfalls der neue argentinische Präsident Javier Milei, der häufig als «ultraliberal» oder «Anarchokapitalist» apostrophiert wird, was auch nicht als Kompliment gemeint ist, aber offenbar noch nicht so ganz ins Raster des «Populismus» passt, obwohl der Mann mit dem wirren Haarschopf und seinen impulsiven Auftritten die Populismus-Witterer durchaus zu einigem Argwohn provoziert. Im Wahlkampf schwenkte er beispielsweise eine Kettensäge, um zu zeigen, wie er mit dem morschen argentinischen Staat umspringen werde. Er erwarb sich auch sonst den Ruf eines radikalen Umkremplers, der mit seinem Gebaren jene von vielen vermisste Authentizität darstellte, mit der auch Trump in den USA punktet, wenngleich auf weitaus weniger programmatisch verständliche und berechenbare Weise als Milei.
Mit anderen Worten: Der sogenannte Populismus* ist längst kein Gespenst mehr, das hier und da umgeht, sondern harte politische Realität, mit der man rechnen, leben und Politik machen muss. In diesem Buch blicken wir deshalb auf Jahre zurück, in denen diese Bewegungen immer stärker geworden sind, und wollen die wesentlichsten, die offensichtlichsten Ursachen aufzeigen. Um es ganz klar zu sagen: Die wichtigste und gefährlichste Wurzel jener erstarkenden Parteien und Bewegungen neben den etablierten politischen Strömungen ist ein massives Demokratieversagen – und das gleich auf mehreren Ebenen.
Es ist schon einigermaßen verräterisch und alarmierend zugleich, wenn in freien, demokratischen Gesellschaften gestandene Politiker eine populäre Bewegung geradezu verachten und dies ausgerechnet mit dem Begriff «Populismus» zum Ausdruck bringen. Das Volk (lat. populus) läuft den Falschen nach, soll das heißen, den «Rattenfängern», wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier es vor einiger Zeit ausdrückte. Eine unschöne Metapher, die Bürgern vermeintlich falscher Gesinnung die Rolle als Schadnager zuweist. Das Volk liegt falsch, soll das wohl heißen. Und im Kern: Das Volk stört beim Regieren.
Doch: So soll es auch sein! In funktionierenden Demokratien zumindest. Das Volk kann, darf und muss sogar stören, wenn die Vorstellungen der politischen Akteure sich allzu weit von denen der Menschen entfernt haben und die daraus entstehenden Brüche das Gemeinwesen als Ganzes gefährden. Das ist für Politiker schmerzlich, die ja in der Regel klare Vorstellungen davon haben, worauf die Dinge hinauslaufen sollen, und sich nur ungern bei der Arbeit am politischen Gesamtkunstwerk bremsen oder gar korrigieren lassen.
Selbst in freiheitlichen Gesellschaften ist das Denken in politischen Missionen, wie sie der reale Sozialismus einst auf die Spitze trieb, nicht ganz ausgestorben. Die «Transformation» hin zur Klimaneutralität ist dafür eine interessante Parallele, weil sie das ersetzt, was im klassischen Sozialismus/Kommunismus die «historische Mission der Arbeiterklasse» war: eine Art schicksalhafter Vorwärtsentwicklung der menschlichen Gesellschaft, die – vergleichbar der biologischen Evolution – weder verhandelbar noch aufzuhalten sei. Wer sich dieser Vision entgegenstellt, entlarvt sich augenblicklich als (ewig) gestrig, als Bremser und potenzieller Menschenfeind, dem man im Grunde die Teilnahme am demokratischen Meinungsbildungsprozess verwehren muss, wenn man den Fortbestand der Menschheit nicht gefährden will.
Eine weitere Ursache für die Populisten-Konjunktur, der wir in diesem Buch nachgehen wollen, ist die hier zu Tage tretende Lernunfähigkeit bzw. -unwilligkeit, die zumindest für mich deshalb so verblüffend ist, weil ich mit meinen biografischen Wurzeln im ehedem real existierenden Sozialismus die westlichen Demokratien immer als offene und vor allem lernfähige Systeme gesehen habe. Die Überlegenheit des Westens am Ende des Kalten Krieges war und ist in meinen Augen eine Folge davon, dass beim Wirtschaften der Markt (im Gegensatz zur sozialistischen Planwirtschaft) die Akteure immer wieder zum Abgleich mit der Realität, mit den Wünschen der Kunden und den effizientesten Strategien der Wertschöpfung zwingt (übrigens ausdrücklich inklusive Energieeffizienz und Ressourcenschonung!). Wer effizienter ist, macht mehr Gewinn.
Das Gleiche gilt für die freiheitliche Demokratie, die es den handelnden Akteuren immer wieder dadurch schwer macht, dass der politische «Endverbraucher» seine Wünsche und Stimmungen – sofern es relevante Inhalte und keine kurzfristigen Aufwallungen sind – in die parlamentarische Administration einsteuern kann. Anders als beim «ideologisch wetterfesten» (Karl-Eduard von Schnitzler) DDR-Politbüro steigen und fallen demokratische Parteien damit, dass sie die Unterströmungen im Volk nicht nur erkennen, sondern aufnehmen und möglichst klug umsetzen. Die verfassungsrechtliche Denk- und Handlungsverbotszone sollte in Demokratien nahezu verschwindend klein sein und sich auf jene beschränken, die «aggressiv-kämpferisch» diese demokratische Ordnung überwinden und abschaffen wollen.
Wie wir in der Gegenwart leider sehen, widerstehen aber auch vermeintlich gefestigte Demokratien wie Deutschland mitunter der Versuchung nicht, sich lästige Konkurrenz dadurch vom Leibe schaffen zu wollen, dass man sie kurzerhand in Gänze für «gefährlich», «demokratiefeindlich» und unberührbar erklärt. Damit wird eine auch staatliche Verfolgung möglich, die vom Grundgesetz in weiser Konsequenz aus den Hitler-Jahren ausdrücklich nicht vorgesehen war.
Die Auswirkung von Demokratieversagen und demokratischer Lernunwilligkeit hat viele Facetten, die ich auf den folgenden Seiten gern im Detail und ohne Anspruch auf Vollständigkeit beleuchten möchte. Meine Hoffnung ist es, dass die dargelegten Gründe für den Siegeszug der Populisten das Interesse jener ebenso finden, die sie teilen, wie das Interesse derjenigen, die es anders sehen. Wenn dieses Buch dazu beitragen kann, die Weltsicht der anderen Seite zumindest nachvollziehbarer zu machen, wäre schon viel gewonnen in Zeiten oft unversöhnlicher Debatten.
Ich bitte dabei um Nachsicht, wenn mir hin und wieder (wie auch hier schon) vergleichende Verweise auf meine DDR-Vergangenheit bewusst unterlaufen. Das hat nicht nur damit zu tun, dass die Intensität des Erlebten in einem autoritären und repressiven System besonders prägend ist für einen jungen Menschen, der noch nicht einmal revoluzzerhaft veranlagt war, sondern einfach nur in Ruhe gelassen werden und da nicht mitspielen wollte.
Es ist auch der Tatsache geschuldet, dass gern von anderer Seite vermeintlichen Anfängen gewehrt werden soll, die viel weiter zurückliegen und angeblich in die Zeit vor 1945 zurückführen. In vielen Fällen muss man aber gar nicht so weit in die nicht mehr selbst erlebte Vergangenheit abtauchen, sondern kann sich bei bestürzend zahlreichen freiheitsbeschränkenden und Konformitätsdruck schaffenden Phänomenen Mechanismen vor Augen führen, die eine noch sehr lebendige Generation von Ostdeutschen gut im Gedächtnis hat.
Ausdrücklich nicht gemeint ist damit freilich ein Komplett-Vergleich der Bundesrepublik Deutschland mit der DDR in all ihren Facetten als geschlossenes und gleichschaltendes repressives System. Obwohl es sich eigentlich von selbst versteht und offensichtlich ist, erwähne ich das hier so ausdrücklich, weil es eine beliebte Methode ist, durch bewusstes Missverstehen unerwünschte Debatten zu beenden, und weil – absurd genug – DDR-Vergleiche im Verfassungsschutzbericht 2021 unter der Rubrik «verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates» als Indiz dafür erwähnt werden.
Dort heißt es: «Die staatlichen Schutzmaßnahmen gegen die Coronapandemie und die damit einhergehenden Freiheitseinschränkungen lösten nicht nur eine breite gesellschaftspolitische Debatte und verfassungsrechtlich legitime Proteste aus, sondern dienten in einzelnen Fällen auch als Vorwand und Hebel, um die demokratische und rechtsstaatliche Ordnung als solche zu bekämpfen. Um die in diesem Kontext festzustellenden Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen adäquat bearbeiten zu können, hat das BfV im April 2021 den neuen Phänomenbereich ‹Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates› eingerichtet.»1
Wie dies im Einzelnen aussehen kann, wird so beschrieben: «demokratisch gewählte Repräsentanten des Staates verächtlich machen, staatlichen Institutionen und ihren Vertretern die Legitimität absprechen, (…) zum Ignorieren gerichtlicher Anordnungen und Entscheidungen aufrufen.»
All das ist insofern interessant, als das «Verächtlichmachen» staatlicher Institutionen ganz ausdrücklich ein normales Freiheitsrecht ist, zumindest wenn man Majestätsbeleidigung nicht als rechtsstaatliche Norm betrachtet. Und nach all den Jahren, man kann fast schon sagen, Jahrzehnten, in denen linke Bewegungen sich auf das «Recht auf zivilen Ungehorsam» etwa bei Anti-Castor-Protesten oder anderen Blockade-Aktionen (siehe Klima-Kleber) berufen haben, das «Ignorieren gerichtlicher Anordnungen» als Gefährdung der Verfassungsordnung einzustufen, ist auch eher bedenklich.
Und: «Zum Teil wird die Bundesrepublik Deutschland mit den diktatorischen Regimen des Nationalsozialismus und der DDR gleichgesetzt.» Mit anderen Worten: Auch hier könnte künftig der Verfassungsschutz zuständig sein. Doch ein medialer oder gesellschaftlicher Aufstand gegen diese Ausweitung und Verschiebung des Auftrags für den Inlandsgeheimdienst, der als nachgeordnete Behörde des Bundesinnenministeriums und damit nicht ohne Zustimmung der Bundesinnenministerin agiert, ist weitgehend ausgeblieben.
So wollen wir hier also im Folgenden Spuren und Indizien nachgehen, warum «populistische Bewegungen» trotz aller Anfeindungen und Bekämpfungsversuche nicht verschwinden. Böse Vermutung: weil die Ursachen für ihren Aufstieg nicht verschwunden sind.
* Zum Sprachgebrauch des Wortes «Populismus» und «Populisten»: Wie ich im Kapitel «Was ist eigentlich Populismus?» zeige, ist die Vokabel «Populismus» im parteipolitischen Tagesgeschäft zu einem Kampfbegriff geworden, der zur allgemeinen Abwertung konkurrierender Politik und Politiker verwendet wird und als Gattungsbegriff für eine ganze Parteienfamilie im rechts-bürgerlichen Spektrum geworden ist. Diese Bedeutungsebene mache ich mir ausdrücklich nicht zu eigen und schreibe deshalb der Abwechslung halber von «Populisten», «sogenannten Populisten» etc., um eine gewisse Distanz zur parteitaktischen Instrumentalisierung auszudrücken.
Der eigentliche Ursprung des Populismus liegt in der Beschreibung eines Politikstils, der den Menschen nach dem Munde redet, einfache Lösungen für komplizierte Probleme verspricht und in einem ungesunden Maß auf Beifall vom politischen Publikum aus ist.
Da diese Art von Populismus eine unerlässliche, mehr oder weniger reichliche Zutat jeglicher Politik ist, ist es aus meiner Sicht kein wirkliches Monitum und eine geschmäcklerische Debatte. Politik sollte die Vertretung von Volksinteressen der Bürger sein und enthält deshalb immer auch populistische Akzente, wenn sie populär sein will. Das Gegenteil wäre eine außenweltunempfängliche ideologische Erstarrung und pädagogische Überwindung des Adressaten.
Ich verwende also den Begriff Populismus in dem von seinen Gegnern konnotierten und gebräuchlichen Sinne für die Beschreibung der entsprechenden politischen Bewegungen, ohne mir jedoch die Konnotierung zu eigen zu machen. Und ich würde mich freuen, wenn sich diese – zugegeben, nicht ganz einfache – Logik dem Leser im Laufe der Lektüre immer besser erschließt.
1 · Demokratieversagen
Diese Zeit hat etwas durchaus Gespensterhaftes. Die Leute gehen täglich ihren Geschäften nach, machen Verordnungen und durchbrechen sie, halten Feste ab und tanzen, heiraten und lesen Bücher – aber es ist alles nicht wahr.
Es rumort in der Tiefe, und der Boden schwankt leise. Wohin führt das alles? Wir versuchen, dem gänzlich Neuen mit den alten Mitteln beizukommen. Und werden seiner nicht Herr. Es verfängt alles nicht: Humor nicht, Satire nicht; offener Kampf, Gewalt, Propaganda – die Pfeile fallen matt zu Boden. Wohin führt das alles?
Töricht, die Zerfallssymptome zu leugnen. Eine Welt wankt, und ihr haltet an den alten Vorstellungen fest und wollt euch einreden, sie seien so nötig und natürlich wie die Sonne.
Lange Reden und dicke Bücher schaffen es nicht mehr; ungeduldig steht etwas an dem großen Tor und klopft und klopft. Und es wird ihm wohl eines Tages aufgetan werden müssen.
Das bürgerliche Zeitalter ist dahin. Was jetzt kommt, weiß niemand. Manche ahnen es dumpf und werden verlacht. Was sich da träge gegeneinander schiebt, gereizt sich anknurrt und tobend aufeinander losschlägt: Im tiefsten ist es der unüberbrückbare Gegensatz zwischen Alt und Neu, zwischen dem, was war, und dem, was sein wird.
Es scheint wieder eine der Perioden gekommen zu sein, wo ganz von vorn angefangen werden wird, wo wieder der Mensch auf der Scholle steht und Gräser, Tiere und sich selbst mit grenzenlosem Erstaunen betrachtet.
Wohin treiben wir? Wir lenken schon lange nicht mehr, führen nicht, bestimmen nicht. Ein Lügner, wer’s glaubt.
Es dämmert, und wir wissen nicht, was das ist: eine Abenddämmerung oder eine Morgendämmerung.
Es ist verblüffend, wie der große Kurt Tucholsky vor über einhundert Jahren in einem Essay für die «Weltwoche» (Nr. 11 vom 11. März 1920) das Zeitgefühl unserer Tage traf. «Es rumort in der Tiefe, und der Boden schwankt leise», schrieb Tucholsky und meinte damit freilich ganz andere Erscheinungen als die aktuellen.
Ging es damals um «Bolschewismus und Preußentum, Revolution und Konsistenz», so wandert heute ein Phänomen um die Welt, das im Vergleich zu den in der Rückschau fest konturierten Ideologien am Anfang des 20. Jahrhunderts viel weniger greifbar ist: Sogenannter Populismus sammelt auf, was das zerbröselnde bürgerliche Nachkriegszeitalter liegen lässt. «Die Welt driftet, und niemand weiß, wohin», schrieb der Publizist Gabor Steingart in einem seiner Morning Briefings (12. Februar 2024). Der «moderate Politiker» sei womöglich das Phänomen einer untergehenden Epoche.
Und noch etwas ist bemerkenswert an dem Essay von Tucholsky: Anfang 1920, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, spürte er angesichts von Oktoberrevolution und ersten marschierenden Paramilitär-Horden etwas gären, spürte den Untergang der «Welt von gestern», wie Stefan Zweig sie mehr als zwanzig Jahre später in seinen Erinnerungen beschreibt.2 Ein Untergang, der sich dann tatsächlich erst 25 Jahre nach Tucholskys Essay mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in aller Grausamkeit vollzog und den Beginn der Nachkriegszeit markierte.
Der Rückblick auf diese Abläufe zeigt, welche historischen Zeiträume vergehen können zwischen dem Erkennen der Vorzeichen und dem realen Umbruch. Unglücklicherweise fehlen den jeweiligen Zeitgenossen solcher Veränderungen in der Regel die Fantasie und die Fähigkeit zum Einrechnen des Unerwarteten, Zufälligen, um präzise vorhersagen zu können, wo genau sich der kommende Umschwung entzünden und wie er verlaufen und enden wird.
Betrachten wir also zunächst die wichtigsten und aus meiner Sicht offensichtlichen Ursachen des erstarkenden «Populismus». Dass dieser kein temporäres Phänomen ist und nicht demnächst wieder verschwindet, liegt im Übrigen auf der Hand. Oder glaubt im Ernst jemand, dass die Welt zu einem wie auch immer gearteten «vorpopulistischen» Zustand zurückkehren werde, ganz gleich, wann man diesen zeitlich einordnen möchte? Und: Wirklich gemütlicher, übersichtlicher, beherrschbarer war die Welt weder am Ende des Kalten Krieges noch in den hohen Zeiten des islamistischen Terrors Anfang der 2000er-Jahre – und auch nicht in der schmalen Spanne bis etwa 2020, als es am Rande Russlands (Georgien, Bergkarabach, Krim) bereits kriegerisch rumorte und zwischendurch Finanzkrisen um die Welt gingen.
Die wohl augenscheinlichste Ursache für Unzufriedenheit und Hinwendung vieler Menschen der im weitesten Sinne westlichen Welt (inklusive Schwellenländer wie Argentinien und Brasilien) liegt nach meiner Analyse im Demokratieversagen. Kluge Köpfe mögen einwenden, dass Demokratie eine politische Organisationsform ist, die bestehe und gar nicht versagen könne, weil sie kein handelndes Objekt sei. Versagen könnten allenfalls die sie repräsentierenden Personen.
Das ist zweifellos richtig. Da aber offenbar in vielen Teilen der Welt das Austauschen der politischen Akteure entlang der etablierten Parteilinien und -lager in den Augen vieler Wähler keine ihren Erwartungen gemäße Abhilfe mehr schafft, wenden sie sich neuen Repräsentanten zu. Diese gehen mit der bestehenden Demokratie deutlich robuster um und verfahren oft nach dem Motto: Wenn die Regeln keine pragmatische Lösung zulassen, pfeife ich auf die Regeln. Man kann also durchaus sagen, dass das demokratische Regelwerk unter Druck gerät – wenngleich dies auch oft im Sinne des mehrheitlichen Wählerwillens geschieht, was ja eigentlich wieder demokratisch ist.
Demokratie liefert nicht
Dieses Demokratieversagen hat im Wesentlichen zwei Aspekte. Der erste: Demokratie liefert nicht. Das ist nicht gefühlig, sondern im ganz pragmatischen Sinne gemeint. Wer sich eine effektive Kontrolle der Migration wünscht, bekommt sie nicht. Wer die Sonntagsreden von der überlebenswichtigen Stärke des europäischen Wirtschaftsraumes in der Konkurrenz zu den USA und Asien ernst nimmt, bekommt keinen starken europäischen Wirtschaftsraum. Wer möchte, dass Europa seine geostrategischen und wirtschaftlichen Interessen in der Welt durchsetzen kann, steht einem oft machtlosen Europa gegenüber. Der Kontinent ist nicht einmal in der Lage, militärisches Drohpotenzial aufzubauen (geschweige denn einzusetzen), mit dessen Hilfe man den Ausbruch von Konflikten vorab verhindern oder Aggressoren bestehender Krisenherde zur Eindämmung zwingen könnte. Stattdessen jammern Europäer, dass die USA ihnen womöglich künftig weniger bei der Selbstverteidigung helfen könnten, was schon verbal ein Widerspruch ist, wenn der Wortbestandteil «selbst» ernst gemeint ist.
Für all diese «Lieferengpässe» gibt es gute Begründungen: mangelnde Einigkeit, widerstrebendes Recht in Europa und seinen Ländern, unterschiedliche Interessen, föderalistische Selbstblockaden und Ähnliches.
Doch die Kenntnis der Begründungen macht das Hinnehmen nicht leichter. Selbst beim proklamierten Top-Thema Klimaschutz liefert die Politik vor allem wohlfeile Beschlüsse und steigende Energiepreise, reißt aber trotzdem die selbst gesteckten Ziele. Dass diese Ziele womöglich völlig unrealistisch und im Widerspruch zu einfachen physikalischen Gesetzen stehen, sei hier einmal freundlich beiseitegelassen, obwohl jeder ahnt, dass ein Komplettumbau von Gesellschaft und Wirtschaft schmerzlos und ohne massive Einschnitte nicht zu haben ist.
Politiker aller Parteien sprechen von Digitalisierung, die vorankommen müsse, von Modernisierung maroder Infrastruktur, von dringender Investition in Bildung, Schulen, Hochschulen und Kinderbetreuung, von Kriminalitätsbekämpfung, mehr Wertschätzung im Bereich Gesundheit und Pflege, sicherer Rente und einer wie auch immer gearteten «Zukunftsfähigkeit» des Landes. Erlebt wird von alledem nichts. Im Alltag ist gerade bei diesen Themen keine Besserung zu spüren.
Mit anderen Worten: Das Gemeinwesen, der Staat, die Politik und natürlich dementsprechend die Politiker versagen. Man kann das für zu pauschal und für ungerecht halten, aber die Wahrnehmung ist schlichtweg ein Faktum. Und dass sich Bürger einsichtig nickend die Hinweise auf begrenzte Ressourcen und andere mildernde Umstände der Politik zu eigen machen müssten, wird niemand wirklich verlangen.
In einer repräsentativen Befragung (2008 Teilnehmer) des Meinungsforschungsinstituts Forsa für den Beamtenbund über die Handlungsfähigkeit des Staates aus dem Sommer 2023 heißt es: «So halten (…) aktuell zwei Drittel der Befragten (69 Prozent) den Staat in Bezug auf seine Aufgaben und Probleme für überfordert – insbesondere hinsichtlich der Asyl- und Flüchtlingspolitik, der Schul- und Bildungspolitik und dem Klima- und Umweltschutz. 2022 war zudem der Anteil derer, die eine Abnahme der Leistungsfähigkeit des Staates wahrgenommen hatten, im Vergleich zu den Jahren zuvor gestiegen.»3
Lediglich 27 Prozent der Befragten halten demnach den Staat noch für handlungsfähig. Interessanterweise wird diese Überforderung des Staates von nahezu allen Bevölkerungs- und Wählergruppen wahrgenommen, schreiben die Autoren, mit einer Ausnahme: Lediglich die Anhänger der Grünen sehen den Staat mit knapper Mehrheit noch in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen. Das allgegenwärtige Thema Klimaschutz scheint hier durch häufige Erwähnung zumindest den Anschein umfassenden Bemühens zu erwecken, was von dieser Klientel gewürdigt wird. Andere Themen sind grünen Milieus womöglich weniger wichtig.
Wörtlich heißt es in der Studie: «Wie bereits in den vergangenen Jahren glauben weiterhin nur wenige Befragte (11 Prozent), dass die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes in den letzten Jahren größer geworden sei. Deutlich mehr Befragte (45 Prozent) allerdings glauben, wie bereits im letzten Jahr, die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes sei eher geringer geworden. 35 Prozent sehen keine Veränderung bei der Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes. Dass die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes in den letzten Jahren abgenommen hat, meinen in überdurchschnittlichem Maße die Anhänger der AfD (65 Prozent).»4
Letzteres wirft ein Schlaglicht auf die Wahrnehmung wachsender Lieferschwierigkeiten des Staates – für den der öffentliche Dienst exemplarisch steht – durch jene, die sich vom etablierten Parteienspektrum abgewandt haben. Die Erwartung, in einem funktionierenden Staatswesen zu leben, in dem man Ämter- und Arzttermine einfach bekommt, vernünftige Schulen, Bahnen und Straßen vorfindet und nachts unbehelligt nicht nur Teile der Stadt besuchen kann, tritt hier ganz offensichtlich einer unbefriedigenden Realität gegenüber. Dass die dafür verantwortliche Politik in Bund, Land und Kommunen nach den Regeln demokratischer Wahlen und Teilhabe zustande gekommen ist und womöglich föderale, finanzielle oder juristische Hindernisse effizientes Verwaltungshandeln behindern, muss den Bürger als Finanzier und «Endverbraucher» des demokratischen Staates nicht oder nur am Rande interessieren. Er bewertet das Produkt und ist unzufrieden.
Repräsentanzlücken der Demokratie
Der zweite Aspekt des Demokratieversagens geht noch tiefer an den Kern der «Volksherrschaft» (altgriechisch demos – Volk, kratos – Kraft, Macht, Herrschaft) und betrifft das demokratische Prinzip selbst: die Repräsentanz des Volkswillens durch die jeweilige Regierung und die mit ihr assoziierten Eliten.
«Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss», rief Bayerns stellvertretender Ministerpräsident und Bundeschef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, am 10. Juni 2023 in die johlende und applaudierende Menge von Erding, wo die Kabarettistin Monika Gruber mit einigen Mitstreitern eine Demonstration gegen das Heizungsgesetz der Berliner Bundesregierung organisiert hatte. Der Historiker Andreas Rödder (CDU) bezeichnete diese Demonstration und im Speziellen diesen Satz als einen «ikonischen Moment» und wurde dafür ebenso heftig gescholten wie Aiwanger selbst, der im Landtag gar zum Rücktritt aufgefordert wurde, weil er die Demokratie verächtlich mache, die er selbst an herausgehobener Stelle repräsentiere.
Rödder hat völlig recht: Aiwangers Rede ist ein «ikonischer Moment» – nicht wegen Aiwangers volkstümlicher Invektive («ihr in Berlin habt’s wohl den Arsch offen»), sondern weil er im eher gefühlsgesteuerten Redeschwall genau jenes Empfinden auf den Punkt brachte, hinter dem sich der zweite Aspekt des Demokratieversagens verbirgt: eine beträchtliche Repräsentanzlücke. Diese treibt jene zu den politischen Rändern, die in den zurückliegenden Nachkriegsjahrzehnten mit dem parteipolitischen Angebot entweder zufrieden waren, womöglich wechselnd wählten oder den allgemeinen Politikbetrieb zumindest so gleichmütig über sich ergehen ließen, dass sich keine bruchhaften Veränderungen abzeichneten.
Aiwanger liefert einen Schlüsselsatz für das Verständnis dieses heraufziehenden Neuen, das Tucholsky schon vor einhundert Jahren beschrieb: eine innere Unruhe, ein Nichtzufriedensein mit dem demokratischen Mess- und Regelsystem. Im Kern spricht der demokratisch gewählte und legitimierte Aiwanger aus, was er in seiner Position eigentlich nicht formulieren dürfte, ohne die Verfasstheit zu beschädigen, auf der sein Amt beruht: Er benennt jenes Empfinden vieler Menschen, wonach es einen Unterschied gibt zwischen «formaler Demokratie» mit ihren gesetzlich fixierten Regeln und jener Mitwirkungszusage, die die Wähler damit verbinden (womöglich zu Unrecht) und nicht eingelöst sehen.
Der Konflikt, der sich dahinter verbirgt, lässt sich freilich nicht mit dem Verweis darauf entkräften, dass alle vorgeschriebenen Regeln, Quoren und Stufen etwa von Gesetzgebungsverfahren eingehalten wurden oder dass es nun mal nur alle vier Jahre Wahlen im Bund gebe und man in der Zwischenzeit die legale Gesetzgebungskompetenz zwar nicht klaglos, aber doch ertragen müsse. Ebenso wenig hilft der Einwand, dass auch in einer Demokratie das Volk die Regeln akzeptieren müsse und nicht wie ein bockiges Kind, das beim Brettspiel nicht verlieren kann, den Tisch einfach umwerfen darf, wenn sich die Dinge in eine unwillkommene Richtung entwickeln.
Das ist grundsätzlich richtig, hilft aber nicht weiter, denn das Volk kann selbstverständlich aufbrausend und unwirsch reagieren, weshalb kluge Regenten die Stimmungslage im Land im Blick behalten und sich nicht auf dem formal erteilten Machtmandat ausruhen sollten. Denn anders als beim bockigen Kind hat die von ihren Bürgern gewählte Regierung zwar ein Mandat, aber keinen Erziehungsauftrag. Wenn der klügste Regentenplan den Regierten nicht passt, dürfen sie es kundtun. Das Regierungsmandat bedeutet in einer funktionierenden Demokratie nicht vier Jahre Allmacht, sondern vier Jahre Politik mit Rückbindung, Erklären und Überzeugen. Anders als in der Familie können die bockigen «Kinder» Regierungen abwählen, die sich zu Vormündern aufschwingen. Das macht demokratisches Regieren schwieriger und Rechthaberei im Amt langfristig riskant.
Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) brachte das in einem Leitartikel für die Welt (25. Januar 2024) auf den Punkt: «Die derzeitige Stärke des rechten politischen Randes resultiert vor allem aus der Schwäche der politischen Mitte. Es ist in den vergangenen Jahren eine politische Repräsentationslücke entstanden, weil ‹die› Politik mutmaßlich immer selbstreferenzieller geworden ist.»
Bestimmten politischen Milieus sei es in den zurückliegenden Jahren anscheinend vor allem darum gegangen, Dinge durchzusetzen, die für das Selbstverständnis, das (Über)Leben der eigenen Klientel und den eigenen Machterhalt wichtig und vorrangig waren. «Anders ist nicht zu erklären, dass gesellschaftliche Mehrheiten in großen und kleinen Fragen wie dem Atomausstieg, der Migrationspolitik oder auch beim Selbstbestimmungsgesetz sowie dem Gendern in der Verwaltungssprache keine Rolle spielen. Der mündige Bürger ist als politischer Referenzpunkt offenbar obsolet geworden», so Kubicki weiter.
Besser und deutlicher kann man Demokratieversagen nicht beschreiben. Das ist umso bemerkenswerter, als Kubicki Teil jener Ampel-Regierung ist, die oft genug in genau diesem Stil handelt und argumentiert. So erfrischend diese nicht vom Amt verstellte Klarsicht auch ist, so nachvollziehbar ist es, wenn kritische Bürger es bemängeln, dass Kubicki im Sinne der Koalitionsräson dann doch vielen Vorhaben zustimmt.
Der Schärfe und Treffsicherheit seiner Analyse nimmt das allerdings nichts, wenn er schreibt: «Wer die Abwendung großer Teile der Wählerschaft von der demokratischen Mitte beklagt, der versucht, das eigene Versagen zu kaschieren. Manche politischen Kräfte versuchen dabei sogar noch, sich zugleich selbst als Kämpfer gegen ‹Rechts› zu stilisieren. Denn wer erklärt, mit den ‹Nazis› geht es euch schlecht, der muss irgendwann die Kommunikationsstrategie ändern, wenn die Menschen merken: Es geht ihnen auch so schlecht. Dann wird die ‹richtige Haltung› zur letzten Bastion der politischen Antworten. Man erklärt also sinngemäß: Wir sind besser, weil wir besser sind. Ob das in der Breite überzeugend ist, mag jeder für sich selbst beantworten.»
Das Kuriose ist, dass sich dieser zu den politischen Rändern (vor allem nach rechts) drängende Frust auch in den sechzehn Jahren aufgebaut hat, als man von einer Kanzlerin regiert wurde, die sich durchaus an Stimmungen orientierte und Politik eher unter sich geschehen ließ, statt sie selbst zu gestalten. Angela Merkel (CDU) kämpfte richtigerweise für längere Laufzeiten der Kernkraftwerke und kassierte diesen Beschluss entgegen ihren Überzeugungen gewissermaßen über Nacht, als die (wenig rationale) Supergau-Angst in eine Anti-Atom-Stimmung zu kippen drohte. Merkel führte auch den Mindestlohn gegen ihren eigenen Wirtschaftsflügel ein, redete Geschlechterparität das Wort und ermöglichte die gleichgeschlechtliche Ehe, obwohl sie selbst anschließend aus Überzeugung dagegen stimmte.
So gesehen haben die Deutschen den kritischen Umgang mit Ideologen wie den Grünen, die in der Regierung ihre Projekte im Sinne höherer Menschheitsbeglückung stur durchziehen, schlichtweg verlernt. Die Frage ist am Ende allerdings nicht, ob man sich ein Sensorium für die Stimmung im Land bewahrt hat, sondern ob man mit diesem Sensorium die wirklich prägenden Stimmungen wahrnimmt. Wer auf die falschen Milieus hört und setzt, läuft trotz weltanschaulicher Flexibilität in die Irre.
Doch bei allem Unmut und allen Umfragen, die der Ampel-Regierung in der Beliebtheit ein Allzeit-Tief zuweisen, geht es gar nicht um gewaltsame Umstürze, wilde Barrikaden oder besetzte Rathäuser. Die Deutschen, Amerikaner, Argentinier, Niederländer, Schweden usw. tun nichts anderes, als die Demokratie und die Demokraten beim Wort zu nehmen und Parteien zu wählen, die einen massiven Politikwechsel versprechen. Und auf einmal soll nun auch das falsch sein, beschließen Eliten aus Kultur, Wirtschaft und Politik, die mit der bestehenden Ordnung gut leben und davon profitieren können oder sich mit ihr zumindest weitgehend arrangiert haben. Dieser Misston und dieser Widerspruch teilen sich auch jenen mit, die nicht täglich Nachrichten konsumieren und die Spiegelstriche des Berliner Parlamentsbetriebs intensiv beobachten.
So hat etwa in den ostdeutschen Bundesländern der Umgang mit der AfD und anderen «rechtspopulistischen» Bewegungen einen besonderen Beigeschmack, der mit den Umbrüchen der Wende- und Nach-Wendezeit zusammenhängt. Damals mussten Ostdeutsche in kurzer Zeit nicht nur marktwirtschaftliches Wirtschaften (mit all seinen Härten) lernen, sondern auch einen Crashkurs in Demokratie absolvieren. Diese kommt zwar nicht immer effizienter und schneller zu Entscheidungen, erhebt aber dafür den Anspruch, staatliches Handeln nach rechtsstaatlichen Grundsätzen überprüfbar zu machen und etwa durch Bürgerbeteiligung die sogenannte Zivilgesellschaft (welche gibt es denn sonst noch?) mit einzubeziehen.
Das ging so lange gut, wie sich das bürgerliche Engagement auf kleine Initiativen beschränkte und weder kommunal-noch landes- oder bundespolitisch wirklich einflussreich wurde. Spätestens seit dem Aufkommen der «Pegida»-Demonstrationen in Dresden aber war vom Einbringen «zivilgesellschaftlicher» Impulse in das demokratische Gemeinwesen nicht mehr die Rede. Stattdessen mischten sich deutlich obrigkeitsstaatliche Untertöne in die Debatte. Kanzlerin Angela Merkel etwa forderte in ihrer Neujahrsansprache 2016, «denen nicht zu folgen». Und als der damalige SPD-Chef Sigmar Gabriel einen Versuch unternahm, mit den Demonstranten ins Gespräch zu kommen, wurde er öffentlich schwer unter Beschuss genommen, obwohl das im Grunde die richtige und vernünftige Reaktion eines Demokraten ist.
Mit anderen Worten: In der Wahrnehmung vieler Ostdeutscher erweisen sich die Hohelieder auf die Vorzüge der Demokratie in dem Moment als hohl und heuchlerisch, in dem ein ernsthafter Politikwechsel auch nur in die sichtbare Nähe des Möglichen gerät. Interessanterweise teilen dieses Bild Menschen der unterschiedlichsten Milieus – abgesehen von den Grünen, die es allerdings im Osten auch sehr schwer haben. Der Tenor, dem ich hier immer wieder begegne, lautet: Man hat uns erklärt, Demokratie sei «friedlicher Machtwechsel», und jetzt heißt es: «Aber nicht so, wie ihr das wollt, nicht mit dieser Partei und nicht mit diesen Inhalten. Bitte wählt aus dem bestehenden Menü aus.» Dass eine solche Argumentation nicht besonders überzeugend wirkt, dürfte nachvollziehbar sein.
Noch einmal Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki: «Wenn die AfD in Berlin nur noch plakatieren muss: ‹Jetzt AfD›, dann ist der Protest bereits das Programm.» Es entgeht auch jenen, die nur mäßig politisch interessiert sind, nicht, dass angesichts der hohen Umfragewerte der AfD etliche der sich markig und couragiert ins Zeug werfenden «Demokraten» mit undemokratischen Mitteln unterwegs sind und sich damit selbst widerlegen.
Wenn etwa Regeln für die Parteienfinanzierung oder die Finanzierung der parteinahen Stiftungen so abgefasst werden, dass ausgerechnet eine Partei (die AfD) nicht in den Genuss der ansonsten allen zustehenden Gelder kommt, mag das formal rechtens sein, dem demokratischen Geist folgt es ganz sicher nicht. Ganz zu schweigen von so bizarren Schaustücken wie der Rückabwicklung der Thüringen-Wahl 2020, weil FDP-Mann Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD ins Amt kam. Die Liste ließe sich beliebig verlängern.
Dazu Kubicki: «Wir wären dumm, auf diesem Weg einfach weiterzumachen, anstatt endlich wieder unsere eigentliche demokratische Aufgabe zu erfüllen: zuhören, die unterschiedlichen Interessen abwägen, Lösungen erarbeiten und anbieten – Lösungen, die die übergroße Mehrheit der Menschen zumindest nachvollziehen kann. Der Gipfel der Hilflosigkeit sind allerdings die immer lauter werdenden Rufe nach Parteiverboten und dem Entzug von Grundrechten. Und hier wird es gefährlich, denn manche Demokraten drohen undemokratisch zu überziehen und selbst den Boden der Verfassung zu verlassen.»
Dem ist nichts hinzuzufügen. Wer nach den tieferen Gründen für den Siegeszug der Populisten sucht, bekommt hier Futter. Und auch an dieser Stelle gilt der Satz von Kurt Tucholsky: «Das Volk versteht das meiste falsch; aber es fühlt das meiste richtig.»5 Es ist kein Wunder, wenn sich gerade im Osten eine Art Michael-Kohlhaas-Stimmung breitmacht, aus Trotz und verletztem Rechtsempfinden.
Jene, denen man immer wieder erklärt hat, dass die freiheitliche Demokratie eben gerade kein «System» im realsozialistischen Sinne ist, wo die Obrigkeit zurückschlägt, wenn sie infrage gestellt wird, sondern eine lernende, offene Gesellschaft der Rede und Gegenrede – all jene sehen sich durch solche kaschierten, aber letztlich doch autoritären Akzente ihrer Gegner nun darin bestätigt, dass Demokratie auch nichts anderes sei als ein «Machtinstrument der herrschenden Klasse», wie man es ehedem schon im DDR-Staatsbürgerkundeunterricht gelernt hat.
Es wäre darum eine wesentliche und dringliche Aufgabe der demokratischen Kräfte in Deutschland, dies durch eine geläuterte, gelebte und lebendige Demokratie als Trugschluss zu widerlegen oder – wo nötig – als Fehlentwicklung zu beklagen und sie gemeinsam wieder aufzurichten. Demokratie ist in ihrem Kern ein Wettbewerb der Ideen, ein Ort, wo in der Sache gestritten werden darf und sogar gestritten werden muss, um für komplexe Fragestellungen die bestmöglichen Antworten zu finden und umzusetzen.
Die Nachkriegsordnung der Bundesregierung zerfällt
Dabei steht derzeit mehr auf dem Spiel, als wir womöglich glauben. Es geht darum, ob wir das Erbe der Nachkriegsordnung erhalten oder ob deren Grundlagen dem Zerfall anheimgestellt werden. Das ist kein Griff in die Kiste der ganz großen Schlagworte, sondern ein schleichendes Auflösen eines polit-gesellschaftlichen Geflechts, das sich seiner selbst noch vor einem Jahrzehnt gewiss war und funktionierte.
Um zu verstehen, was damit gemeint ist, müssen wir zu den Anfängen der Bundesrepublik zurückkehren, vor allem aber zu den Intentionen des Grundgesetzes. Dessen Autoren hatten die Gräuel der nationalsozialistischen Verbrechen, aber auch die für den Aufstieg des Hitlerismus ursächlichen Mechanismen noch plastisch vor Augen und zogen im Grundgesetz die Lehren daraus.
Der Bundespräsident kann deshalb den Bundestag heute nicht mehr so ohne Weiteres auflösen. Der Bundestag selbst kann es schon gar nicht. Das vorzeitige Ende der Legislaturperiode, die Kanzler Gerhard Schröder 2005 mutwillig herbeiführen ließ, war ein in dieser Form nicht wiederholbarer Trick, der die bestehende Rechtslage weit über Gebühr dehnte. Man kann nicht einfach so lange wählen, bis das Ergebnis passt. Die Aufteilung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern, unter der wir heute so oft stöhnen, folgte einem klugen und lange Zeit eben auch funktionierenden Ratschluss, dass nämlich eine deutsche Bundesregierung nicht wieder von Berlin (oder von wo auch immer) aus durchregieren können sollte.
Die Unterteilung in Bund und Länder folgte ebenfalls dieser Logik: Wenn erneut düstere Stimmungsstürme über dem Kernland Europas aufzögen, würden sie allenfalls nach und nach in manifeste Politik umschlagen können. Fiele etwa der Bund in die Hände von Scharlatanen, so gäbe es noch sechzehn Bundesländer, die über den Bundesrat und ganz unterschiedliche parteipolitische Landesregierungen die Schlagkraft von Kanzleramt und Bundeskabinett ausbremsen könnten. Das ist der klugen Architektur unserer Verfassung geschuldet, die uns auch in anderer Hinsicht bis heute einen sehr tragenden Rahmen gibt.
Erst längerfristig anhaltende politische Strömungen würden nach diesem im Grundgesetz angelegten Schnittmuster nach und nach auf die föderalen Ebenen überschwappen, sodass bruchhaftes Umschlagen der deutschen Politik kaum möglich wäre. Im Falle der Grünen beispielsweise – die Ende der Siebziger-, Anfang der Achtzigerjahre als Bewegung, später als Partei aufstiegen – hat es Jahre gedauert, bis sie die ersten Landesminister stellten; der erste Ministerpräsident folgte Jahrzehnte später. Und die im Osten ehedem starke Linkspartei stellt erst seit 2014 einen Landeschef.
Das personalisierte Verhältniswahlrecht trägt ebenfalls dazu bei, dass populäre Parteien kaum einen Durchmarsch hinlegen können wie etwa im anglo-amerikanischen Wahlsystem. Und selbst der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) ist so zugeschnitten, dass ein einseitiger politischer Zugriff kaum möglich ist, weil die nach unterschiedlichen parteipolitischen Farben regierten Länder sich gegenseitig kontrollieren. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Zwischenzeit die Finanzierung des ÖRR zur zentralen Säule demokratischer, freier und (vermeintlich) verlässlicher Information erklärt, sodass auch ein einfaches Zudrehen des Geldhahns nicht funktioniert.
Im Zusammenspiel dieser Gesamtkonstruktion sollte nach dem Willen der Verfassungsväter und -mütter eines garantiert sein: Stabilität. Demokratische Verlässlichkeit und Unanfälligkeit für kurzfristige politische Schlagwetter. Ein weiser Entwurf, der die Bundesrepublik mindestens siebzig Jahre gut durch die stürmischen Zeitläufe gebracht hat und von den Bürgern – vorsichtige, evolutionäre Reformen eingeschlossen – ohne grundsätzliches Murren mitgetragen wurde.
Ein stabiles Gerüst, das in den letzten Jahren von immer mehr Menschen als ein starres Korsett wahrgenommen wurde, eine beengende Schale wie das Außenskelett eines Krustentiers, das sich nicht abstreifen lässt. Es ist immer schwierig, historische Abläufe nach den entscheidenden Wendemarken zu sortieren. In meiner Wahrnehmung als im Innern des Berliner Politikbetriebs agierender Beobachter waren die Finanz- und Euro-Krise, in der es fast zum Rauswurf Griechenlands gekommen wäre, gewittrige Vorläufer tiefer Polarisierung in der Gesellschaft, die allerdings noch keine wirklich umwälzende Wucht erlangten.
Das war in der Migrationskrise 2015/2016 und den Folgejahren anders. Im Herbst 2015 schlug die ursprüngliche Hilfsbereitschaft gegenüber den zuströmenden Flüchtlingen mehr und mehr in Sorge, Angst und Entsetzen um, weil die Überforderung in Bund, Ländern und Kommunen entgegen dem Kanzlerdiktum «Wir schaffen das» immer deutlicher wurde. Auch die Veränderungen im Straßenbild bis hin zu Kleinstädten und kleineren Ortschaften alarmierten über Parteigrenzen hinweg die Pragmatiker, die mit Unterbringung, Integration, Betreuung usw. zu tun hatten.
Dass Vertreter einer staatstragenden Partei wie der Union ernsthaft darüber nachdachten, die Kanzlerin zu stürzen, so etwas ist mir in mehr als dreißig Jahren journalistischer Erfahrung nicht untergekommen. Damals kamen auch Überlegungen auf, ob es nicht plebiszitäre Elemente brauche, um eine Politik zu stoppen, die das Land nicht nur teuer zu stehen kam, sondern ihm in den Augen vieler auch massiv schadete.
Die Migrationskrise war nicht die Geburtsstunde des wiedererstarkenden Populismus in Gestalt der AfD, aber es war jener historische Wendepunkt, an dem die AfD aufstieg und sich im Parteienspektrum etablierte. Seitdem ist das Knirschen im demokratischen Gebälk der Bundesregierung nicht leiser geworden. Im Sommer 2018 drohte tatsächlich das vorfristige Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels, die sich nur mit allerlei Tricks (z. B. völlig sinnlosen EU-Gipfeln) und durch das Einlenken der CSU (vor allem des damaligen Bundesinnenministers Horst Seehofer) retten konnte.
In Deutschland zumindest ist es genau diese in der Staatsverfasstheit angelegte Orientierung auf Stabilität, die knapp achtzig Jahre nach Kriegsende von vielen Menschen nicht mehr als verlässlich wahrgenommen wird, sondern als verkrustet, als Stillstand und unfähig zur Reform. Wenn in einer INSA-Umfrage für die CSU 76 Prozent der Befragten einen «Politikwechsel» wünschen, wird das mehr als deutlich. Dabei wurde im Nachkriegsdeutschland akribisch darauf geachtet, gerade durch Bildungsföderalismus eine Vielstimmigkeit zu etablieren, die mit einer Zentralregierung und zentraler Bildungspolitik nicht möglich gewesen wäre. So sollte verhindert werden, dass die Jugend abermals, wie im Dritten Reich, indoktriniert werden kann. Der Bildungsföderalismus sollte durch einen «gesunden» Wettbewerb der bildungspolitischen Ansätze auf Landesebene die besten Konzepte zum Vorschein bringen und ihnen durch Nachahmung zum Durchbruch verhelfen.
In der Realität hat das nur in Teilen funktioniert. So eindrücklich, wie der Pluralismus hochgehalten wurde, so dramatisch waren die Unterschiede in der Exzellenz: Bayern, durchweg CSU-regiert, lag mit seinen Ergebnissen 70 Jahre lang an der Spitze der Bildungsergebnisse, Bremen, 70 Jahre durchweg SPD-regiert, lag ebenso dauerhaft und hartnäckig am Ende der Leistungsskala. Mit anderen Worten: Anstatt um die «Best Practice» zu eifern, haben sich hier offensichtlich über Jahre Apparate geweigert, die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Anstatt «der Stadt Bestes zu suchen»6 und der nächsten Generation die Steigbügel zu halten, verwaltete man stoisch die rote Laterne. Das schafft Verdruss, lässt Innovation ersticken und Bürger an den Institutionen zweifeln. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie die demokratische Verfasstheit der Bundesrepublik als unzulänglich empfunden wird und der Eindruck entsteht, das System tauge und liefere nicht.
Frustpunkt deutsches Wahlsystem
Ein weiterer wichtiger Frustpunkt, der am Ende zu einer Steilvorlage für Protestwähler und sogenannte Populisten wird, ist das deutsche Wahlsystem. So tragend, wie sich die Verfassung erwiesen hat, so destabilisierend und frustrierend wirkt das Wahlverfahren. Es ist das Gegenteil von einfach; man könnte auch sagen, es ist kompliziert. Die Mischung von Personen- und Verhältniswahlrecht ist bis heute vielen Menschen unverständlich und stellt für sie ein echtes Ärgernis dar. Demokratie ist eine sehr anspruchsvolle Regierungsform. Umso einfacher sollte sie in den Grundzügen sein, nämlich dort, wo gewählt wird.
Ein weiteres Problem der Entfremdung vom Bürger liegt vermutlich an der massiven Verflechtung unterschiedlicher Ebenen. Land, Bund und Europa greifen z. T. so ineinander, dass selbst im Falle eines Erdrutschsieges einer politischen Kraft nahezu endlose Möglichkeiten bestehen, der Mehrheitspartei auf unterschiedlichen Ebenen – etwa im Bundesrat – in die Speichen zu greifen oder auf europäischer Ebene durch Europarecht die Handlungsspielräume zu verengen.
Es ist kaum möglich, sich rechtsstaatlich zu verhalten und gleichzeitig die Grenzen zu schließen, wenn sich ein Migrantenansturm auf das Land zubewegt. Grenzkontrollen müssen als Ausnahmesituation in Brüssel beantragt und zeitlich befristet werden. Auch ein komplettes Dichtmachen der Grenzen ist nur in sehr eng begrenzten Sondersituationen möglich.
Diese Einschränkungen via Verflechtung sind definitiv ein Grund, warum sich Politik zunehmend vom Bürger entfernt hat: In vielen Situationen kann ein europäischer Einzelstaat nicht einfach pragmatisch handeln und liefern, was seine Bürger erwarten – selbst dann nicht, wenn der politische Wille dafür klar artikuliert ist. In der Wahrnehmung vieler Bürger ist das Gemeinwesen deshalb etwa durch das europäische Beihilferecht, Umwelt- und andere Auflagen nicht handlungsfähig.
Das Amalgam, das hier durch die unterschiedlichen Verflechtungen und durch die weithin unumgänglichen Koalitionen der demokratischen Parteien entsteht, lässt beim Bürger weithin den Eindruck entstehen, dass seine Wahlabsicht in den Ergebnissen dieser Politik nicht mehr vorkommt. Das ist auf Dauer frustrierend und kann zu Ohnmachtsgefühlen führen. Es scheint immer häufiger gleichgültig zu sein, was man wählt. Die Politik, so der weit verbreitete Eindruck, gruppiert schlussendlich die beteiligten Parteifarben ein wenig um und macht am Ende weiter wie bisher. Das will ein Großteil der Bürger ganz offensichtlich so nicht mehr.
Dass sich nach den multiplen Krisen der zurückliegenden Jahre die Unzufriedenheit mit der gleichzeitigen Ineffektivität des Gemeinwesens geradezu angereichert hat, kann nicht verwundern. Und selbst wenn dies erkannt ist, scheint es oft so, als gäbe es keinen legalen Ansatz, es zu beheben.
Bestes Beispiel ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Diese Institution hat massiv an Vertrauen eingebüßt, leidet an Zuschauer- bzw. Hörerschwund und wird zudem per Zwangsgebühr von jenen milliardenschwer finanziert, die sich hier überhaupt nicht mehr repräsentiert sehen und ihn zum Teil gar nicht mehr nutzen. Gleichzeitig gibt es kaum eine Chance auf Abhilfe oder tiefgreifende Reform, weil die Zuständigkeit der Länder durch unterschiedliche Interessen keine einheitliche, kraftvolle Veränderung zustande bringt.