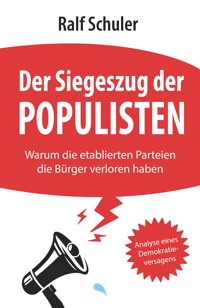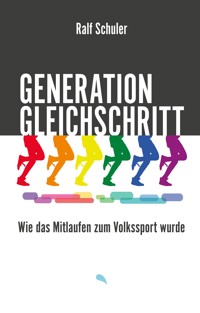
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Süddeutsche Zeitung titelte am 12. August 2022: "Schuler wird’s zu bunt". Dies als bekannt wird, dass der langjährige Leiter des Parlamentsbüros der BILD seinen Posten räumt. Weiter wird gefragt: Wird die BILD zu "woke"? Ralf Schuler antwortet mit einem Buch. Für ihn steht fest: Ukraine-Krieg, Migration, Islam, Regenbogenfahne oder Corona – es gibt Themen, bei denen die öffentliche Debatte im mentalen Gleichschritt zu marschieren hat. Ausscheren unerwünscht. Ralf Schuler (Jg. 1965) hat den DDR-Sozialismus selbst erlebt und geht heute der Frage nach, wie sich Konformität in freien Gesellschaften scheinbar selbst organisiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
«Die meisten, die sich schämen, mit einem abgelegten Hut oder Mantel zu gehen, laufen freudig mit abgelegten Meinungen herum.»
Søren Kierkegaard
Ralf Schuler
Generation Gleichschritt
Wie das Mitlaufen zum Volkssport wurde
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Der Fontis-Verlag wird von 2021 bis 2024
vom Schweizer Bundesamt für Kultur unterstützt.
© 2023 by Fontis-Verlag Basel
Umschlag: René Graf, Fontis-Verlag
Satz: Justin Messmer, InnoSet AG, Basel
Redaktion: Dr. Dominik Klenk
ISBN 978-3-03848-260-4
Inhalt
Impressum
Einleitung von Dieter Nuhr
Prolog
Wie es zu diesem Buch kam
Ein Kniefall und eine Zäsur
Binnenpluralität bei Springer
Die LGBTQ Safe Zone
Expedition zum Ursprung des Nebels
1.Links, zwo, drei… Oder: Eine Bestandsaufnahme
Damals, der Gleichschritt
Vorsicht Redeverbot!
Viele kleine Puzzleteile
Schleichende Veränderung
Smells like Zensur
Vielfalt? Klingt gut!
Links, schwenk – marsch?
2.Herdentrieb: Wie Konformität die Freiheit unterwandert
Gewärmte Seelen im Gleichklang… Oder: Der Machtmensch
Der Hass der Herde
Die stillen Netzwerke der Macht
Die Umwertung der Werte
Universitäten und radikale Intellektuelle
Vom «neuen Menschen» zum «neuen Bürger»
Quoten als Fachwerk einer neuen Gesellschaft
«Hass und Hetze» als Nebelkerze
Sprache zur Umprogrammierung im Kopf
Die (Un-)Kultur des Löschens und Verschweigens
Universitäten als Nährböden von Intoleranz
Verbissen und verbiestert
Meinungsfreiheit und die «falsche» Ausgewogenheit
Eine Debatte mit nur einer zulässigen Meinung ist keine
Trickreiches Aushebeln der Meinungsfreiheit
Die Rückkehr der Räterepublik
Wie man Meinung macht
Der Fall Karon
Die Masse macht’s – Mitlaufen aus Kollektivgeist
3.Der Preis der Meinungsfreiheit: Man kann alles sagen, aber…
Die Freiheit des Andersdenkenden
Heul doch!
Freie Meinung, sozialer Tod?
4.Vom Jeder zum Ich… Oder: Wie man mentale Leitplanken aufbricht
Rezepte gegen den Ungeist
Heilsame Individualität
5.Merkel-Jahre
Das Phänomen Merkel
Vermeidung kognitiver Dissonanzen
Überzeugungen? Flexibel!
Meinungsstreit-Verweigerung
Unmusikalisch auf der konservativen Saite
Machtmechanikerin Merkel
Machtprobe: Die einsamste Reise der Kanzlerin
Entkerntes Unions-Erbe
Epilog
Der Verfassungsschutzchef als Polit-Kommissar
Küsse unterm Regenbogen: Die Fußball-WM in Katar
Mein Ende bei BILD
Mit fröhlichem Ernst aus der Reihe tanzen!
Personenverzeichnis
Über den Autor
Außerdem bei Fontis erhältlich
Einleitung von Dieter Nuhr
Meinungsfreiheit ist ein seltsam unfassbares Gut. Sie kann niemals absolut sein: Die «Meinung», es hätte keinen Holocaust gegeben, ist zu Recht verboten. Auch wenn wissenschaftliche Wahrheiten im Sinne des Positivismus nie bewiesen werden können (Karl Popper), müssen wir annehmen, es gäbe sie. Anders geht es nicht. Den Holocaust gab es, seine Leugnung wird zu Recht bestraft.
Wo beginnt nun die abweichende Meinung, die wir aushalten müssen? Sind echte Klimawandelleugner oder Verschwörungstheoretiker, die behaupten, die USA hätten 9/11 selbst inszeniert, zu tolerieren? Es ist problematisch, hier festzulegen, wo die Grenzen zu ziehen sind.
Wer Mitte 2020 laut darüber nachdachte, ob das Coronavirus nicht vielleicht einem chinesischen Labor entwichen sein könnte, wurde als Verschwörungsfreak und seine Meinung als abwegig bis irre abgetan. Nur ein Jahr später galt diese vermeintlich nicht zu hinterfragende Wahrheit plötzlich unter Wissenschaftlern als denkbar.
Wie konnte es sein, dass etwas vehement als absurd abgekanzelt wurde, das eigentlich logisch klingt? Ein Hochsicherheitslabor, das a) offenbar zu den wenigen Orten auf der Welt gehörte, an denen man mit Coronaviren experimentierte, und das b) wenige Meter von einem Wildtiermarkt entfernt lag, als möglicher Ausgangspunkt von Corona.
Der Ursprung des Virus ist bis heute ungeklärt. Dennoch: Hier zeigt sich, dass bei uns unterdessen auch Gedanken als verrückt abgetan werden, die dem gesunden Menschenverstand keineswegs abwegig erscheinen.
Welche Macht haben wir, eine solche – entschuldigen Sie bitte – Massenidiotie zu unterbinden? Wir erleben heute in der Shitstorm-Kultur, dass es keine Konkurrenz der Meinungen mehr gibt, sondern nur noch gegenseitige Versuche des Ausschlusses: Meinung, Wahrheit und Wahnsinn verschwimmen. Die Diskussionskultur ist in bedenklichem Zustand, wenn überhaupt noch vorhanden.
Ich freue mich deshalb, dass Ralf Schuler im vorliegenden Buch den Mechanismen nachgeht, die heute bei dieser Einengung der freien Meinungsäußerung angewendet werden und den Gleichschritt im Denken und Reden begünstigen.
In den Meinungsblasen der Gegenwart gilt der konstruktive Austausch mit Andersdenkenden zunehmend als Haltungsschwäche. Innerhalb der eigenen Blase versichert man sich gegenseitig, dass die andere Seite entweder dumm oder böse ist. Radikale rufen zur Vernichtung auf. Massenhaft wird Häme verbreitet, Memes haben eine enorme Meinungsmacht. Zu einem Austausch von Argumenten kommt es in der Regel nur noch selten.
Gerade die Blase meiner Berufskollegen beweist, dass daraus teilweise eine Art Gleichschaltung folgt, die kaum noch zu durchbrechen ist: Es werden Meinungskorridore festgelegt, deren Verlassen sofortigen Ausschluss bedeutet.
Ich gelte unter den klassisch linken Kabarettisten als schwarzes Schaf. Die politische Kabarettsendung «Die Anstalt» arbeitet sich regelmäßig an mir ab – wenig erfolgreich, Gott sei Dank. Doch: Wer in meiner Sendung zu Gast war, hat mit beruflichen Benachteiligungen woanders zu rechnen.
Trotzdem nimmt die Anzahl der Kollegen, die gerne zu Nuhr im Ersten kommen würden, gerade zu. So ist zumindest mein Eindruck, ich führe da keine Statistik. Offenbar wird die Einengung der Gedankenvielfalt zunehmend als unangenehm erachtet, und es trifft immer öfter auch die Gutwilligen…
Sendungen von Kollegen spiegeln häufig nur noch die vorhersehbaren Standpunkte einer Linken, die sich in ihrer Illiberalität kaum noch von der extremen Rechten unterscheidet. Es ist wenig überraschend, dass Wähler von der extremen Linken nahtlos zur extremen Rechten wechseln und (momentan eher selten) umgekehrt – eint doch beide die Ablehnung des Kompromisses als Ergebnis demokratischer Entscheidungsfindung, die Ablehnung parlamentarischer Riten als Quasselei, der Hass auf Andersdenkende, die Missachtung von Repräsentanten der bürgerlichen Gesellschaft und das Einkalkulieren der Dummheit der Masse, die man, abwertend gemeint, «Mainstream» nennt.
Ralf Schuler gelingt es auf beeindruckende Art und Weise, auch die unguten Mechanismen in den Medien, die hierbei eine Rolle spielen, an Fallbeispielen zu belegen. Das ist umso erstaunlicher, weil Medien ihren eigenen Herrschaftsbereich ungern zum Thema machen. Ralf Schuler kennt sich aus, denn er war lange genug mittendrin im Zentrum der journalistischen Machtzentralen.
Er erinnert an das Neutralitätsgebot für Journalisten und zeigt auf, wie sich die mediale Meinung schleichend, aber kontinuierlich immer weiter auf die linke Seite des Spielfeldes verschoben hat. Interessant ist, dass bereits die Feststellung, die Meinungsfreiheit sei gefährdet, heute schon als rechter Standpunkt gilt. Man wird von selbst ernannten Linksliberalen sogleich ins rechtspopulistische Lager gesteckt … Hier hat sich der Begriff der Liberalität ins Absurde verkehrt.
Man darf sich fragen, wo diese Absurdität ihren Anfang genommen hat. Für mich steht das Umdefinieren von Begriffen durch Minderheiten im Zentrum der gesellschaftlichen Ausgrenzung. Nur ein Beispiel: Als «Rassismus» galt mein Leben lang die Diskriminierung von Menschen aufgrund von Hautfarbe oder Ethnie. Heute gilt es als Rassismus – so zu lesen im FAZ-Feuilleton –, wenn Weiße sich so verhalten, dass sich Nichtweiße unwohl fühlen. Mit anderen Worten: Jede Kritik an Schwarzen ist Rassismus. Daraus folgt: Nur Weiße können Rassisten sein. Wenn ich also im Senegal aufgrund meiner Hautfarbe angegriffen werde, ist dies eine vielleicht kritisch zu betrachtende, aber im Wesentlichen verständliche Reaktion auf meine Zugehörigkeit zur Gruppe der Kolonialisten, die sich an meiner Hautfarbe festmacht. Wahnsinn.
In Buchtiteln wie «Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen» wird Menschen eine Haltung nach Hautfarbe zugeordnet, gefeiert von Menschen, die sich für Antirassisten halten. Man könnte dies als umgekehrten Rassismus werten, darf man aber nicht, weil nach neuer Definition nur Weiße Rassisten sein können. Wer sich der neuen Definition nicht anschließt, ist ebenfalls bereits Rassist. Im Prinzip gilt heute jeder Weiße, der sich dem Vorwurf des Rassismus widersetzt, als Rassist. So wird durch die Umdeutung der Begriffe jeder Widerspruch ausgegrenzt.
Mit der Etikettierung von Menschen nach Hautfarbe soll die Diskurshoheit den Nichtweißen zugeordnet werden. Ich halte dies für ein gutes Beispiel dafür, wie Minderheiten durch moralisches Framing und Umdefinieren von Begriffen versuchen, Macht über die Sprache zu erlangen und Kritik an ihren Forderungen abzuwerten – in diesem Fall als Rassismus. Der entsprechende Shitstorm, den ich bekam, weil ich darauf hinwies, dass ich Hautfarbe nicht für ein geeignetes Mittel der Kategorisierung von Menschen und Meinungen halte, war beträchtlich. Ich bin daran gewöhnt. Andere ziehen sich zurück und schließen ihre Social-Media-Accounts. So gewinnen Radikale die Diskurshoheit.
Wenn man die aktuellen Umfragen sieht, dann fühlt sich offenbar eine Mehrheit der Bevölkerung in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt. Hier sollten die Alarmglocken klingeln. Oder wie es Kurt Tucholsky ausdrückte: «Das Volk versteht das meiste falsch; aber es fühlt das meiste richtig.»
Die Einschränkung der Freiheit wird bei uns nicht von Staatsseite aus betrieben, sondern durch im Framing geschulte Minderheiten, die in der Lage sind, Shitstorms zu erzeugen und Meinungstendenzen durch Einführung von manipulativen Begriffen zu lenken.
Der Begriff «Gendergerechtigkeit» beispielsweise, heute weitgehend kritiklos auch von Konservativen in die Sprache integriert, suggeriert, dass nicht gegenderte Sprache Ungerechtigkeit manifestiert, ja sogar erst entstehen lässt. Im Wesentlichen aber dient Gendersprache nicht der Herstellung von Gerechtigkeit, sondern der Manipulation.
Wenn heute über das Verhältnis der Geschlechter diskutiert wird, soll das Gendern die Unterwerfung unter vermeintlich gerechte Normen sicht- und hörbar machen. Es wird von Sprechenden verlangt, eine Sprache zu verwenden, die Unterwerfung unter die vermeintlich gerechte Norm signalisiert. Wer darauf beharrt, weiterhin die Sprache zu verwenden, die seit den ersten Lebenstagen tief im Unterbewussten als Teil seiner Persönlichkeit verankert ist, muss sich den Vorwurf, ungerecht zu sprechen, gefallen lassen.
Sprache dient Gender-Befürwortern dabei zur Kennzeichnung von Gesinnung. Dies ist ein klassisches Merkmal totalitärer Systeme. Verweigerung wird sozial abgestraft. Dies hat dazu geführt, dass sich Gendersprache inzwischen zumindest im offiziellen Schriftverkehr weitgehend durchgesetzt hat, gegen den Willen der breiten Bevölkerungsmehrheit. Firmen passen sich oft gegen den Willen ihrer Mitarbeiter und Kunden an, aus Angst vor Shitstorms, Boykottdrohungen oder anderen unangenehmen Konsequenzen.
Da sieht man, wie wirkmächtig die Manipulatoren in unserer Gesellschaft sind.
Die analogen Medien wirken da oft wie Opfer ohne eigene Beteiligung, sie übernehmen unkritisch das Framing. Die Shitstormkultur kann – verstärkt durch die Inkompetenz unseres schlecht bezahlten und dementsprechend zunehmend niveauarmen regionalen Clickbait-Journalismus – die Internetblase verlassen. Einzelpersonen werden nach Belieben und oft auch beliebig stigmatisiert. Täter ist nicht der Staat, sondern in der Regel gut organisierte und nicht selten vom Staat alimentierte Minderheiten. Die Demokratie, deren zentrales Ziel das Finden von Mehrheitskompromissen ist, wird so auf Dauer ausgehebelt.
Eine kleine Gruppe radikaler Anhänger von Theorien wie strukturellem Rassismus, Postkolonialismus, Sexismus ist heute in der Lage, Meinungsöffentlichkeit massiv zu manipulieren. Auch radikale Rechte haben ein großes Mobilisierungspotenzial über die sozialen Medien, ihnen fehlt aber die Machtperspektive. Die ist bei den Linksidentitären gegeben, nicht nur durch direkte persönliche Nähe zur Macht, sondern auch durch ihre Präsenz in Medien, Kultur und im Hochschulbereich. Schulers Diagnose einer «Generation Gleichschritt», die wir uns auf diese Weise herangezogen haben, ist darum ebenso treffend wie alarmierend.
Ich sehe unsere Demokratie, deren Grundlage die nüchterne Diskussion unterschiedlicher Interessen und das Herbeiführen von Kompromissen ist, insofern als massiv gefährdet an. Wir erleben in der Tat eine Zeitenwende. Und ich bin aus den oben aufgeführten Gründen wenig optimistisch, dass unsere Medien diesen Wandel mit der gebotenen Objektivität begleiten…
Prolog
Wie es zu diesem Buch kam
Als ich Anfang Juli 2022 nach gut 11 Jahren bei BILD kündigte, hatte ich eigentlich nur an einen ganz normalen Job-Wechsel gedacht.
Meine Begründung schickte ich an Chefredakteur Johannes Boie und an Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner. Die Diversitätsstrategie des Konzerns, das Hissen der Regenbogen-Flagge vor dem Haus und die publizistische Verlagerung hin zu immer affirmativer werdender Begleitung der LGBTQ-Bewegung wollte ich nicht mehr mittragen.
Vorausgegangen war diesem Schritt eine heftige Debatte, die das Medienhaus Axel Springer viel tiefer erschütterte, als dies außerhalb vermutlich wahrgenommen wurde.
Ein Kniefall und eine Zäsur
Am 1. Juni 2022 hatte eine Reihe zum Teil namhafter Wissenschaftler in der «Welt» einen Aufruf an die öffentlichen Rundfunksender veröffentlicht, in dem sie dazu aufforderten, «biologische Tatsachen und wissenschaftliche Erkenntnisse wahrheitsgemäß darzustellen. Wir fordern eine Abkehr von der ideologischen Betrachtungsweise zum Thema Transsexualität und eine faktenbasierte Darstellung biologischer Sachverhalte nach dem Stand von Forschung und Wissenschaft.» Und weiter:
Wir, die Unterzeichner, beobachten als Wissenschaftler seit langem, wie sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Darstellungen der «queeren» Transgenderideologie zu eigen macht und dabei naturwissenschaftliche Tatsachen leugnet.
Ausgangspunkt ist stets die Falschbehauptung, es gäbe nicht nur ein männliches und weibliches Geschlecht, sondern eine Vielfalt von Geschlechtern bzw. Zwischenstufen zwischen Mann und Frau. Der klar umrissene Begriff des Geschlechts, das die anisogame Fortpflanzung ermöglicht, wird vermengt mit psychologischen und vor allem soziologischen Behauptungen, mit dem Ergebnis, dass konzeptionelle Unklarheit entsteht.
Ein im Grunde unspektakulärer Beitrag mit einer völlig legitimen Sicht, die man teilen oder infrage stellen kann, die aber in keiner Weise die Grenzen der Verfassung überschreitet und aus meiner Sicht sogar sehr nötig war, weil die Transgender-Theorie kurz zuvor sogar im Kinderprogramm der ARD in der «Sendung mit der Maus» angekommen war, die sich an Vier- bis Neunjährige wendet. Biologie spielte in der betreffenden Folge gar keine Rolle mehr.
Da sogenannte «Trans-Personen» deutlich unter ein Prozent der Bevölkerung ausmachen, hätte man allenfalls eine sich an dem Gastbeitrag entzündende publizistische Debatte erwarten dürfen.
Doch es kam anders.
Die Trans-Lobby – allen voran der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Staatssekretär Sven Lehmann (Bündnis 90/Die Grünen) – ging auf die Barrikaden. Er legte Springer öffentlich auf Twitter nahe, zu überlegen, wem man eine Bühne biete: der unübersehbare Wink eines Mitglieds der Bundesregierung, Pressefreiheit hinter politische Opportunität zurückzustellen.
Das zum Springer-Verlag gehörende Jobvermittlungsportal «Stepstone» wurde von der queeren Jobmesse «Sticks & Stones» ausgeladen. «Die Existenz von LGBTIQ+ Menschen darf nicht verhandelt werden!», schrieb der Ausrichter Stuart Bruce Cameron und machte klar, dass es neben der Trans-Weltsicht keine weitere geben könne und dürfe und deshalb auch Biologie und Wissenschaft hinter die Trans-Agenda zurücktreten müssten.
Nun mag man akzeptieren, dass eine Lobby solcherart autoritäre Töne anschlägt, als könne es in einer gesellschaftlichen Debatte (so man eine solche denn überhaupt für zulässig erklärt) nur Ja oder Ja geben.
Die wirkliche Eskalation brachte dann jedoch Döpfner ins Spiel, der sich mit einem brutalen Verriss des Gastbeitrages der Wissenschaftler vom 1. Juni zu Wort meldete, in dem er den Beitrag als «unterirdisch», «oberflächlich», «ressentimentgeladen» und «herablassend» bezeichnete.
Gleichzeitig ließ er auf verschiedenen Ebenen, auch über den Queerbeauftragten, sondieren, ob Springer nicht doch noch zur Job-Messe wieder zugelassen werden könne. Ein unglaublicher Kniefall vor Politik und der Lobby einer krassen Minderheit, den viele bis dahin für grundsätzlich undenkbar gehalten hatten, der aber vor allem auch im Hause des großen Verlegers Axel Springer bei namhaften Autoren eine Verstörung hinterließ, die man getrost «traumatisch» nennen darf.
Springer, das Bollwerk gegen Zeitgeist und linkes Revoluzzertum im deutschsprachigen Raum, knickte ein vor einer Lobby. Das große Haus an der früheren Berliner Mauer, das zu Recht die «DDR» immer in Anführungsstrichen geschrieben und durch die Zeiten des Kalten Krieges an der Deutschen Einheit festgehalten hatte, bat jetzt darum, in die Gunst der Trans-Lobby wieder aufgenommen zu werden.
Gegen Kommunismus und links-grünen Zeitgeist hatte man all die Jahre gestanden und ging jetzt in die Knie wegen einer queeren Job-Messe?
Traumatisch war der Vorgang für viele im Verlag aus verschiedenen Gründen: Zum einen kann es nicht sein, dass gesellschaftspolitische Weichenstellungen im vorpolitischen Raum – eine Trans-Weltsicht als alternativlose Agenda – durch Boykott gewissermaßen erzwungen und die Spielregeln diskursiver, demokratischer Willensbildung durch offene Machtdemonstrationen ersetzt werden.
Zum anderen ist in der Nachkriegsgeschichte, politisch wie verlegerisch, bisher selten so offen brutal gegen eine völlig vertretbare Meinung vorgegangen worden.
Und schließlich begriffen und begreifen viele Köpfe im Hause Springer diese Episode als Zäsur im Konzern, aber auch in der politischen Kultur der Bundesrepublik überhaupt: Wenn die Unantastbarkeit von Presse- und Meinungsfreiheit schon im Hause Springer anlassbezogen aufgehoben werden kann, anstatt sie mit allen Mitteln zu verteidigen, dann werden künftig weitere Themen und Gelegenheiten folgen, bei denen politischer, wirtschaftlicher oder Lobbydruck triumphieren.
Wie viele Kollegen auch hielt ich die Intervention des Vorstandsvorsitzenden für völlig inakzeptabel. Ich hatte den Eindruck, dass auch BILD-Chefredakteur Johannes Boie von den Vorgängen überrascht und überrollt wurde. Er lud Döpfner Anfang Juni in die große BILD-Konferenz ein, um über das Thema und sein Vorgehen zu sprechen. Der Andrang am 9. Juni im Konferenzraum, dem sogenannten «Glaskasten» im 16. Stock, war riesig. Aus allen Teilen der Redaktion waren Mitarbeiter per Video zugeschaltet.
Ich hatte im Wesentlichen sieben Kritikpunkte, die ich in dieser Konferenz vorbrachte:
1. Döpfners Intervention wurde inner- wie außerhalb des Verlages nicht als Meinungsäußerung, sondern als inhaltliche Befehlsausgabe gewertet.
2. Der inkriminierte Text war völlig akzeptabel und weit unterhalb der Schwelle, an der ein Konzernchef eingreifen muss.
3. Im Falle eines Eingriffs hätte der erste Satz lauten müssen: «Selbstverständlich muss ein solcher Text im Hause Axel Springers möglich sein, aber…»
4. Die Autoren des Aufrufs haben und hatten schlicht recht, weil Biologie sich nicht durch Verbal-Aikido überlisten lässt und Formulierungen wie «im falschen Körper» eher ins Mittelalter passen, wo Geister und Seelen in Körper fahren und vermeintlich wieder ausgetrieben werden konnten.
5. Es ging hier um die demokratische Kultur: Auf den Druck einer politischen Lobby, durch Ausladung und Boykott Meinungskonformität zu erzwingen, kann man unmöglich mit Unterwerfung reagieren, sondern muss erst recht die Fahne des Diskurses hochhalten.
6. Ich halte es aus Gründen des Jugendschutzes für völlig unverantwortlich, Heranwachsenden zu suggerieren, in Pubertät und Lebenskrisen sei der Wechsel des Geschlechts ein probates Mittel zur Linderung, Behebung oder gar ein gängiger Ausweg aus ihrer Identitätsverunsicherung. Schon jetzt zeigen die stark gestiegenen Zahlen von Hormonbehandlungen und sogenannte «geschlechtsangleichende Operationen» (vor allem bei Teenager-Mädchen) einen fatalen Trend, weil viele irreversibel geschädigt werden, wenn die erhoffte Wirkung ausbleibt.
7. Der Verlag machte sich hier mit einer Bewegung gemein, die meiner Meinung nach radikal und militant den Umbau der Gesellschaft betreibt, das «heteronormative Weltbild» überwinden will und im Übrigen beispielsweise im Autonomen-Milieu voll anschlussfähig ist.
Unterstützt wurde ich vor allem durch den Kollegen Alexander von Schönburg, der ebenfalls seiner tiefen Verunsicherung über das im Hause Springer noch Sagbare Ausdruck gab.
Döpfner gab mir im Punkt des Jugendschutzes recht, wollte sich auf eine klare Anzahl der Geschlechter aber nicht festlegen lassen. Dinge und Sichtweisen änderten sich, schließlich habe man auch vor wenigen Jahren noch mit dem Paragrafen 175 StGB ein Verbot von Homosexualität im Gesetzblatt gehabt. Dass die LGBTQ-Bewegung auch von Leuten unterstützt werde, mit denen man sonst nichts gemein habe, sei kein Argument, und im Übrigen bedeute Meinungsfreiheit nicht, dass man im Hause Springer beispielsweise auch offen sei für «eine kritische Hinterfragung des Holocaust». Es gebe da klare Grenzen.
Den Holocaust-Vergleich fand ich wenig passend und eher einen Ausdruck von Argumentationsnot. Deutlich zur Kenntnis nehmen musste ich, dass die Intervention des Vorstandschefs ihre Wirkung nicht verfehlt hatte: In der Konferenz selbst äußerten sich kaum Kollegen. Dafür bekam ich hinterher aus allen Teilen des Hauses Mails, Direktnachrichten und SMS, die mir für die klare Aussprache dankten. Das war einerseits ermutigend, gab mir andererseits aber auch gehörig zu denken:
Warum musste man mir so ausdrücklich für eine offene Debatte «danken» oder «Respekt» zollen? Es sollte eigentlich Konsens herrschen, dass wir als Berichterstatter in einer offenen Gesellschaft arbeiten und nicht mehr in der DDR, wo vermeintlich «falschen Meinungen» tatsächlich Mut und Respekt gebührte, weil sie nämlich verfolgt und sanktioniert wurden.
Binnenpluralität bei Springer
Das Thema blieb auch in der Folgezeit präsent. Ich hatte kurz zuvor einen BILD-Kommentar für die Seite zwei geschrieben, der sich mit der Änderung der Flaggenverordnung durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) beschäftigte. Meine Botschaft: Es gibt schon eine Fahne, hinter der wir uns alle versammeln können, die maximal integrativ und inklusiv ist, und diese Fahne ist Schwarz-Rot-Gold.
In Teilen der Redaktion brach daraufhin ein Sturm der Entrüstung los, weil der Kommentar angeblich «transphob» sei, queeren Menschen ins Gesicht schlage und man sich fragen müsse, ob ich für das Haus noch tragbar sei. Der Chefredakteur stellte sich klar hinter mich und wies die Kritiker in die Schranken.
Als wenig später ein Kommentar zum sogenannten «Selbstbestimmungsgesetz» der Ampel anstand, mit dem künftig einmal pro Jahr ein Wechsel des Personenstandes und des Geschlechts per einfacher Ansage auf der Meldestelle möglich sein soll, war die Lob-Fraktion an der Reihe und kommentierte, dass das Gesetz Ausdruck des Respekts vor Trans-Menschen sei.
Ob der Kommentar ein Zeichen der Binnenpluralität und eine Art Kompensation für meinen Regenbogen-Kommentar war, weiß ich nicht, nahm aber zur Kenntnis, dass der Kurs des Hauses auf diesem Gebiet der Identitätspolitik künftig weniger klar und entschieden sein würde.
Zu den kleinen Kuriositäten des Vorgangs gehörte übrigens, dass drei Tage später der Vortrag einer Biologin an der Berliner Humboldt-Universität unter den Protesten der Queer-Lobby abgesagt werden musste, und derselbe Kommentator im Hause Springer jetzt einen Beitrag nachschob, in dem er klarstellte, dass solche Art der Repression in Forschung und Lehre natürlich nicht hilfreich sei.
Und eben hier, im Hinundher des Kollegen, zeigt sich das Dilemma: Wenn man sich mit einer Bewegung gemein macht, dann sitzt man eben auch mit den Radikalinskis im gleichen Boot.
Die LGBTQ Safe Zone
Wie ich erwartet hatte, führte die Döpfner-Intervention in einem hierarchisch geordneten Haus wie Springer zu einem deutlichen Schub für die Queer-Community und einer tiefen Verunsicherung aller anderen.
Man könnte es auch ein Stillhalten oder Wegducken nennen im Lager der Kritiker der Queer-Ideologie. Man spürte hier auch die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz. Wenn dieser wegen differenzierter Berichterstattung in Gefahr gerät, dann allerdings ist noch weit mehr in Gefahr: Demokratie üben bedeutet den Widerspruch einüben.
In dieser Hinsicht war Döpfners Eingriff eine historische Bruchstelle im Hause Springer. Kurz darauf übertrug BILD TV den Christopher Street Day live, und ein stellvertretender Chefredakteur schrieb in der morgendlichen Rundmail, die Marke BILD stehe fest an der Seite der LGBTQ-Bewegung.
In einem persönlichen Gespräch mit Mathias Döpfner, in dem er mir durchaus die Wertschätzung für meine Arbeit versicherte, entnahm ich verschiedenen Andeutungen – Schaden vom Unternehmen abwenden, den Konzern von dieser Seite her unangreifbar machen … –, dass der Regenbogen-Kurs von Springer zumindest auch, wenn nicht gar in Gänze, verlagsstrategischen Überlegungen folgte. Das bedeutet, dass nicht länger der journalistische Anspruch, sondern ökonomische und konzernstrategische Überlegungen die Agenda setzen.
Verschiedene Top-Manager des Hauses machen keinen Hehl daraus, dass der inzwischen größte Geschäftsbereich des Unternehmens, der Handel mit und die Beteiligung an Online-Plattformen und hoffnungsvollen Startups, gefährdet sei, wenn man sich nicht klar zu den Zielen Diversität, Vielfalt und LGBTQ-Community bekenne.
Vor allem in Amerika, in der Tech-Branche an Ost- und West-Küste, sei es geradezu ein Marktausschluss, wenn man in dieser Hinsicht Zweifel hinterlasse.
So ähnlich ist es auch im Hause Springer: Die Tech-CEOs machen Druck in Sachen Regenbogen und kritisieren intern etwa auch den liberalen Kurs der «Welt» in dieser Frage, während die publizistischen Aushängeschilder «Welt» und BILD noch immer zuweilen mokant und kritisch mit dem Thema umgehen.
Ein deutliches Zeichen dafür, dass das demokratisch nie legitimierte, sondern über die Geschäftsordnung der Bundesregierung eingesickerte «Gender-Mainstreaming als gesellschaftliche Querschnittsaufgabe» auch in den letzten freien journalistischen Hochburgen angekommen ist: Mit dem konzerninternen Programm «Gender Balance» wird auch im Hause Springer an der gezielten Herbeiführung von mehr Diversität gearbeitet.
Damit aber verlässt man den Boden journalistisch klarer und neutral recherchierter Gesichtspunkte und reiht sich ein in das bunte Spiel politisch korrekter Sommersprossen.
Eine eigens etablierte Abteilung mit dem Namen «People & Culture» engagiert sich ebenfalls eifrig in der Sache, produziert Aufkleber, die die sexuelle Orientierung als eine Art hippen Lifestyle darstellen («Oh deer – I’m queer» oder «Ich bin ein Homo-Saurus»).
An allen Eingängen der Springer-Zentrale finden sich inzwischen Regenbogen-Aufkleber mit der Aufschrift «LGBTQ Safe Zone», als würden Transsexuelle in Deutschland regelmäßig durch die Straßen getrieben und könnten sich zu Springer flüchten.
In einer verlagsinternen Umfrage zur Unternehmenskultur begann die Erhebung mit der Frage: «Welches Geschlecht wurde Ihnen bei der Geburt zugewiesen?»
Und auch Versuche, eine verquaste, vermeintlich sensible Sprache einzuführen, müssen von den Redaktionen immer häufiger zurückgewiesen werden. So wurde etwa in Rundmails nahegelegt, den Begriff «Behinderte» nicht mehr zu verwenden, weil das eingeschränkt und defizitär klinge. «An den Rollstuhl gefesselt», erinnere an Folter und Erleiden von Repression und sollte deshalb nicht mehr verwendet werden.
Ich antwortete in solchen Fällen regelmäßig dem gesamten Verteiler, dass ich nicht bereit sei, mich einem Sprachverständnis zu unterwerfen, das in seiner Denkfigur der wortwörtlichen Bibel-Auslegung der Zeugen Jehovas entspreche, und dass ich nur davor warnen könne, solche Ansätze weiter zu verfolgen. Antworten erhielt ich regelmäßig nicht.
Um möglichen Missverständnissen vorzubeugen: Ich bin selbstverständlich gegen jedwede Art von Diskriminierung. Auch gegen Diskriminierung von Menschen, die sich selbst einer anderen geschlechtlichen Identität zuordnen, als es ihr biologischer Sexus vorgibt. Deshalb bin ich aber ganz entschieden nicht Teil irgendeiner Bewegung und lasse mich von keinerlei politischen Ideologie vereinnahmen.
In meiner Ausbildung zum Journalisten habe ich gelernt, Positionen anderer zu verstehen und Hintergründe und Motive zu recherchieren und darzustellen. Und ich habe das zentrale Gebot journalistischer Redlichkeit verinnerlicht, mich dabei immer mit einem gewissen Abstand zu den Menschen und Themen zu verhalten, über die ich berichte. Ein Journalist hat sich mit niemandem gemein zu machen, nicht mit den «Guten» und nicht mit den «Schlechten». Wenn allerdings «die richtige Haltung» zu einem zentralen Kriterium in der Berichterstattung wird, dann sind der Journalismus und die Demokratie in Gefahr.
Mancher mag all das vielleicht für Petitessen halten und sich längst mit solchen Entwicklungen arrangiert haben. Womöglich liegt es an meinem eigenen biografischen Erleben in der DDR und daran, dass der damals allgegenwärtige Bekenntniszwang und die umfassende Indoktrinierung in mir einen tiefen Widerwillen und ein untrügliches Gespür für totalitäre Wabernebel hinterlassen hat.
Ich habe mich seinerzeit unter den Bedingungen der Repression nicht verbogen, warum sollte ich es heute tun?
Mir wurde klar, dass ich mich entscheiden musste, ob ich mich dieser Melange weiter aussetzen wollte. Im Grunde genommen wusste ich sofort, dass ich das nicht mit meinen Grundsätzen vereinbaren konnte. Darum reichte ich die Kündigung ein.
Expedition zum Ursprung des Nebels
Nach Bekanntwerden meiner Kündigung und der Gründe Anfang August 2022 brach mein Handy schier zusammen unter Hunderten eingehender Mails, Nachrichten, Anrufen, die durchweg Bedauern, vor allem aber Respekt für die Konsequenz meines Schrittes ausdrückten.
Die Reaktionen kamen von aktiven und ehemaligen Politikern, von Comedians und Kabarettisten, von Kollegen aus dem eigenen Haus und von anderen Journalisten sowie von Hunderten von Lesern, Facebook-Freunden und Twitter-Nutzern.
Das Echo war überwältigend, aber auch ein wenig verblüffend. Offenbar teilten viele meinen Blick auf den kritiklosen Umgang mit der Regenbogen-Bewegung und auf den zuweilen autoritär-aggressiven Versuch, die Gesellschaft ohne Diskurs und Gegenrede nach einer totalitären Ideologie umzubauen.
Warum aber löste ein schlichter Job-Wechsel solch einen Wirbel aus? Warum gratulierte man mir zu «Geradlinigkeit» und «Konsequenz», obwohl mir ja niemand öffentlich den Mund verboten hatte?
Offensichtlich gibt es längst Schweigespiralen in unserer Gesellschaft: Dinge, die man nicht hinterfragen darf, Positionen, zu denen man sich lieber nicht äußert, Hintergründe, die man besser nicht recherchiert und publiziert.
Dass sich ein solcher Bodennebel in einer Gesellschaft ausbreitet, ist möglich. Dass der Journalismus meines Hauses mit dem Anspruch einer aufklärenden Berichterstattung ebenfalls in diesem Bodennebel versinkt, war für mich inakzeptabel. Darum habe ich gekündigt.
Offenbar war auch das keine Selbstverständlichkeit. Die Resonanz darauf deute ich auch als einen Ausdruck des unterschwelligen Bedürfnisses nach Unverbogenheit, das zu verkörpern ich gar nicht vorgehabt hatte.