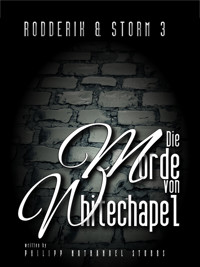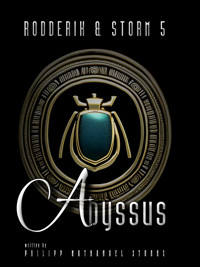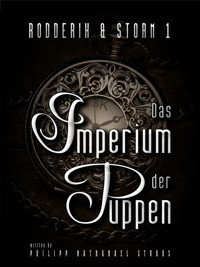5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dieser Planet ist tot. Er weiß es nur noch nicht. Denn hinter dem Lärm der Maschinen, der Fahrzeuge und der Menschen fehlt etwas: Das Summen der Bienen. Nach wochenlanger Arbeit hat Miranda van Storm es geschafft, den Prototyp einer aetherbetriebenen Zeitmaschine zu bauen, mit deren Hilfe Graham Rodderik in seine Zeit zurückkehren kann. Und weil die Bedienung kompliziert ist und es sich um einen Prototyp handelt - und ganz sicher nicht, weil Miranda Graham nicht zutraut, die wertvolle Maschine alleine zu benutzen - begleitet sie ihn. Die Freude über das gelungene Experiment ist nur kurz: zwar landen sie in der richtigen Zeit, aber etwas stimmt nicht. Ausgemergelte Menschen schleppen sich durch London, Lebensmittelkarten, Reiseverbote und Ausgangssperren bestimmen das Leben. Und über alles wacht Wales Green, der einzige Konzern, der in einer unwirtlichen Welt noch Lebensmittel produzieren kann. Wer sich den Regeln des Konzerns unterwirft, überlebt, wer nicht... verhungert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
PHILIPP NATHANAEL STUBBS
DER STILLE PLANET
Steampunk-Roman
Rodderik & Storm
Band 4
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Über das Buch
Rodderik & Storm - Die Steampunk-Abenteuerserie
Sichere dir jetzt dein kostenloses Buch!
Was bisher geschah
Prolog
Kapitel 1 - Gute neue Zeit
Kapitel 2 – In der Erinnerung sah es besser aus
Kapitel 3 – Gemeinsam für alle
Kapitel 4 – Ein Viscount zum ... äh, nein.
Kapitel 5 – Kriegserklärung
Kapitel 6 – Zutritt verboten
Kapitel 7 – Nordwärts
Kapitel 8 – Feldforschung
Kapitel 9 – Eden
Kapitel 10 – Auf Bewährung
Kapitel 11 – Spione wider Willen
Kapitel 12 – Der Hive
Kapitel 13 – Doppelgänger
Kapitel 14 – Fleischpasteten
Kapitel 15 – Invasion
Kapitel 16 – Ein Abend in der BBC
Kapitel 17 – In der Falle
Kapitel 18 – Getrennte Wege
Kapitel 19 – Zurück zu den Anfängen
Kapitel 20 – Saal der Entscheidung
Kapitel 21 – Dokumente bitte!
Kapitel 22 – Kurz davor
Kapitel 23 – Auferstanden von den Toten
Kapitel 24 – Erwachen
Danksagung
Sichere dir jetzt dein kostenloses Buch!
Rodderik & Storm - Die Steampunk-Abenteuerserie
Impressum
Über das Buch
Dieser Planet ist tot. Er weiß es nur noch nicht.Denn hinter dem Lärm der Maschinen, der Fahrzeuge und der Menschen fehlt etwas: Das Summen der Bienen.
Nach wochenlanger Arbeit hat Miranda van Storm es geschafft, den Prototyp einer aetherbetriebenen Zeitmaschine zu bauen, mit deren Hilfe Graham Roddrik in seine Zeit zurückkehren kann.Und weil die Bedienung kompliziert ist und es sich um einen Prototyp handelt - und ganz sicher nicht, weil Miranda Graham nicht zutraut, die wertvolle Maschine alleine zu benutzen - begleitet sie ihn.Die Freude über das gelungene Experiment ist nur kurz: zwar landen sie in der richtigen Zeit, aber etwas stimmt nicht. Ausgemergelte Menschen schleppen sich durch London, Lebensmittelkarten, Reiseverbote und Ausgangssperren bestimmen das Leben der Menschen. Und über alles wacht Wales Green, der einzige Konzern, der in einer unwirtlichen Welt noch Lebensmittel produzieren kann. Wer sich den Regeln des Konzerns unterwirft, überlebt, wer nicht... verhungert.
Mehr davon? Ein Gratis-eBook gibts am Ende des Buches!
Rodderik & Storm - Die Steampunk-Abenteuerserie
Alle Bücher in der chronologischer Reihenfolge:
Prequel - Die mechanische Braut (exklusiv für Newsletter-Empfänger)
Band 1 - Das Imperium der Puppen
Band 2 - Die verlorene Welt
Band 3 - Die Morde von Whitechapel
Band 4 - Der stille Planet
Band 5 - Abyssus
Kurzgeschichte - Keine Ehre unter Dieben (exklusiv für Newsletter-Empfänger)
Band 6 - Ex Machina (erscheint 2025)
Sichere dir jetzt dein kostenloses Buch!
Wenn zwei sich betrügen, dann freut sich der Dritte - falls er überlebt.
Auch Corelius Vanderbild hat einmal klein angefangen. Doch als der Taschendieb und Trickbetrüger den Auftrag bekommt, einem der berüchtigtsten Gangsterbosse Londons ein unbezahlbar wertvolles Gemälde zu stehlen, ist das die Gelegenheit, an der Herausforderung zu wachsen. Oder auf dem Friedhof zu enden.
Du bekommst das eBook “Keine Ehre unter Dieben” geschenkt, wenn du dich meinen VIP-Lesern anschließt.
Klicke hier, um loszulegen: https://philippnathanaelstubbs.de/vip-leserliste/
Was bisher geschah
Die einzelnen Bände der Rodderik & Storm Reihe enthalten zwar in sich abgeschlossene Geschichten, ich empfehle aber, die Bücher in der angegebenen Reihenfolge zu lesen, um die Rahmenhandlung mitzubekommen.
Für Quereinsteiger habe ich die hier soweit wie möglich spoilerfrei zusammengefasst:
DAS IMPERIUM DER PUPPEN
Aether ist eine wunderbare Sache: unerschöpfliche Energiequelle, vielseitig einsetzbar und umweltfreundlich. Nur einen kleinen Nachteil hat der Stoff: in großen Mengen komprimiert gelagert, bringt er das Zeit-Raum-Gefüge durcheinander.
Das bemerkt der Datenanalyst Graham, als er im heutigen London auf der Flucht vor einer Gruppe Rowdies ist. Im letzten Augenblick kann er er sich in eine enge Gasse retten, die zwei Sekunden vorher noch gar nicht da war. Um anschließend festzustellen, dass der Weg heraus schwieriger ist als hinein und dass er nicht durch ein Method-Acting-Camp stolpert, sondern tatsächlich durch das viktorianische London. Zwar schafft es Miranda – geniale Erfinderin menschenähnlicher Mechanoiden und Besitzerin besagter großen Menge komprimierten Aethers – ihn wieder in seine Zeit zurück zu katapultieren, aber die Zeitreise bleibt nicht ohne Konsequenzen.
Das mit seiner Zukunft etwas nicht stimmt bemerkt Graham, als sein bester Freund sich erstens als Mechanoid entpuppt und zweitens versucht, ihn umzubringen. Mit Hilfe einer Sonde, die Miranda durch die Zeit geschickt hat, springt Graham in die Vergangenheit zurück, um dort herauszufinden, dass Miranda und er nur Schachfiguren im Spiel eines erbarmungslosen Genies mit Weltherrschaftsgelüsten sind. Es gibt nur einen Weg, es aufzuhalten – leider zerstört er jede Möglichkeit zur Rückkehr Grahams in seine eigene Zeit.
DIE VERLORENE WELT
Gefangen in der Vergangenheit und ausgerüstet mit dem Wissen der Zukunft - auch wenn es zum größten Teil aus Fernsehserien und Kinofilmen stammt - versucht Graham sich mit der Situation zu arrangieren, ohne dabei ein Zeitparadoxon auszulösen, welches im schlimmsten Fall die Menschheit, im besten Fall nur ihn auslöschen würde. Was nichts daran ändert, dass auch ein Zeitreisender einen Job braucht, um Essen und Miete zu bezahlen. Keine einfache Aufgabe in einer Gesellschaft, in der Handwerker einen höheren Status genießen als BWLer.
Da kommt die Chance zur Teilnahme an der Expedition Professor Challengers nach Südamerika gerade recht. Miranda ist Feuer und Flamme, denn die Erforschung eines abgelegenen Plateaus und die Suche nach prähistorischen Lebewesen ist genau das, was sie braucht, nachdem Graham in einem unbedachten Moment seine Abneigung gegen die Institution Ehe bekannt gemacht hat. Graham selbst hat oft genug Jurassic Park gesehen, um der ganzen Angelegenheit skeptisch gegenüber zu stehen und da niemand auf ihn hört, muss er wohl oder übel mit auf die Reise gehen.
DIE WHITECHAPEL-MORDE
Knapp dem Tod entronnen kehrt die Expedition nach London zurück, im Gepäck das Ei eines Velociraptors, welches Challenger im Brutkasten ausbrütet. Leider entwischt ihm der junge Saurier kurz darauf, was kein Grund zur Panik ist; schließlich sollte ein wärmeliebendes, an subtropisches Klima gewöhntes Reptil im nasskalten London nicht lange überleben, gnadenloser Fleischfresser und brutaler Jäger hin oder her. Challenger wischt alle Bedenken nonchalant zur Seite, was eine Gefahr durch das Tier angeht.
Als aber in Whitechapel Frauen verstümmelt und zerfetzt aufgefunden werden, wird Graham misstrauisch. Er beginnt zu ermitteln und findet schnell heraus, dass es mehr als ein Monster gibt. Das macht sein Leben zwar aufregend und abwechslungsreich, aber möglicherweise auch sehr kurz – zu kurz, um es auch nur eine Sekunde ohne Miranda zu verbringen. Er will ihr gerade einen Antrag machen, als die Tinkerin ihm ihre neueste Erfindung präsentiert: eine Zeitmaschine, die ihn zurück in seine Zeit bringt.
Prolog
Der Tag, an dem die Welt unterging. Und es nicht mitbekam.
»Das ist sie!« sagte der Mann im weißen Laborkittel. Sein strohblondes Haar stand in alle Richtungen ab, das Hemd war falsch geknöpft und sein Krawattenknoten befand sich im fortgeschrittenen Zustand der Auflösung. Er konnte die Erregung in seiner Stimme kaum verbergen und hoffte, dass die darunter mitschwingende Panik nicht auffiel.
Nummer 1 war noch nie hier unten gewesen, dreizehn Stockwerke unter der Erde. Diese Etage gehörte den Nerds, hier waren sie unbehelligt von den Großköpfen, ungestört und frei zu tun und zu lassen, was sie wollten. Sofern man davon absah, dass jeder von ihnen ein Non-Disclosure-Agreement unterschrieben hatte, welches unter Androhung drakonischer Strafen verbat, auch nur ein einziges Wort über ihre Arbeit zu verlieren, oder dieses Labor und die angrenzenden Wohneinheiten zu verlassen, solange sie hier arbeiteten. Was die wenigsten störte, da bei der Auswahl der Angestellten Sozialkompetenz eine eher untergeordnete Rolle spielte und für den durchschnittlichen Mitarbeiter im Hive der Begriff Freunde ein theoretisch abstraktes Konzept darstellte. Wenn einer aus der Führungsetage auftauchte, bedeutete das nichts Gutes, sondern im Regelfall Budgetkürzungen. Budgetkürzungen bedeuteten Kündigungen und Kündigungen bedeuteten, dass man wieder in die Welt da draußen musste. Mit anderen Worten: der reinste Horror. Als Nummer 1 hier auftauchte – was nach den Legenden der Nerds noch nie passiert war – ging man vom Schlimmsten aus. Die Nerds hatten sich bei seiner Ankunft schneller verzogen als Kakerlaken, wenn das Licht angeht. Aus ihren Verstecken heraus beobachteten sie den Mann mit den blonden Haaren, der allein in der Mitte des Labors stand, als Nummer 1 zielstrebig auf ihn zuging. »Zeigen Sie sie mir«, sagte er.
Es gehörte zur Politik des Labors, dass einer vom anderen nicht wusste, womit der sich beschäftigte. Keiner hatte eine Ahnung, was der Blonde, der vermutlich einen Doktor in Biologie und Zoologie hatte, in seinem Büro machte. Dorthin führte er Nummer 1 jetzt. »Ziehen Sie das hier an«, war das Letzte, was die Beobachter im Labor hörten, bevor sich die Tür hinter den beiden schloss.
Nummer 1 ignorierte die Schutzkleidung, die ihm der Doktor entgegenhielt, musterte mit kalten, leblosen Augen die Versuchsaufbauten im Raum, nahm jedes Detail in sich auf und reagierte überhaupt nicht. »Wo ist sie, Simmons?« Simmons wurde blass – soweit das ging, wenn man die letzten siebzehn Monate in einem Labor fast eine halbe Meile unter der Erde verbracht hatte und die Sonne nur eine ferne Erinnerung war. Nummer 1 kannte seinen Namen. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut! Und er schien Ahnung von dem zu haben, was Simmons hier unten trieb. Damit hatte der Wissenschaftler nicht gerechnet. Er hatte vermutet, dass die Berichte, die er schrieb, ungelesen in irgendeinem Postfach Staub fingen. Einmal hatte er einen Test gemacht und zwanzig Seiten mit der Silbe bla gefüllt. Ernsthaft: Zwanzig Seiten bla bla bla. Wenn die Berichte gelesen würden – soweit seine Theorie – sollte das jemandem auffallen. Er erhielt nie eine Beschwerde, auch nicht, als er anschließend seine Arbeitsweise anpasste, nur nach griffigen Titeln für die Texte suchte und den Rest aus einem Lorem-Ipsum-Generator kopierte. »Hier entlang«, stammelte er. »Sie haben eine sehr kreative Art, die Silbe bla einzusetzen. Das hat meine Aufmerksamkeit erregt«, bemerkte Nummer 1 beiläufig. »Sonst wäre mir Ihre Arbeit vielleicht entgangen.« Nummer 1 lächelte. Falls das Simmons beruhigen sollte, verfehlte es seine Wirkung. Der Blonde schluckte. »Die Königin ist hier«, sagte er. Nummer 1 wandte seine eigenartig starren Augen in die gezeigte Richtung. Dort stand ein schmuckloser Kasten von der Größe einer Umzugskiste mit einer Öffnung in der Vorderseite. »Ich möchte sie sehen«, sagte Nummer 1. »Aber ohne Schutzanzug, Sir, ...« »Machen Sie sich um mich keine Gedanken. Sie dürfen natürlich einen tragen, wenn Sie das möchten.« Das wollte Simmons. Er hatte sich den kleinen Biestern nur einmal ungeschützt genähert und war die nächsten vier Tage von einem prallgefüllten Luftballon kaum zu unterscheiden gewesen. Nur dass er bei Berührung nicht platzte, sondern herzzerreißend jammerte1. Aber er brauchte mehr Zeit, den Vollkörperschutz anzuziehen, als Nummer 1 Geduld hatte.
Nummer 1 hatte die Kiste schon geöffnet, als Simmons zu ihm trat.
Wenn Simmons an etwas arbeitete, hörte die Welt um ihn herum auf zu existieren. Die Wunder, welche die Natur bereithielt, waren viel zu bemerkenswert, um Zeit mit schnöden Dingen wie essen, duschen oder schlafen zu verschwenden. Und obwohl das kleine Volk, das in diesem Kasten lebte, für ihn hochgefährlich war – der Allergie sei Dank – bewunderte er die Komplexität ihrer Gesellschaft, die Genialität jedes einzelnen Individuums und die Feinheit der Körpermechanik.
Die Bienen krabbelten über die Waben. Für einen Uneingeweihten mochte es wie das reinste Chaos aussehen, aber Simmons erkannte die darin verborgene Struktur. Jede Zelle war zum Bersten mit Honig gefüllt, auch wenn die Tiere in ihrem Leben noch nie eine echte Blüte gesehen hatten. Simmons konnte in seinem Labor alle benötigten Nährstoffe synthetisieren und dem Schwarm zur Verfügung stellen. Trotzdem hatten sie die Instinkte ihrer Urahnen beibehalten: Tag für Tag tanzten sie den komplexen Schwänzeltanz, mit dem sie ihren Artgenossen mitteilten, wo sie Nahrung finden konnten. Obwohl die Entfernung weniger als zwei Fuß betrug und das Futter immer an exakt derselben Stelle stand. Simmons brauchte nur eine Sekunde, bevor er das Zentrum des Schwarms ausmachen konnte und – ruhend in diesem Gewusel wie im Auge eines Orkans – dessen Königin. Mit einem Bleistift deutete er auf das Tier. »Da ist sie. Die letzte und die erste ihrer Art.« Das Einzige, was antwortete, war Stille. Und Simmons unterlag dem fatalen Drang, diese zu füllen. »Ich habe das genetische Material aus der letzten vorhandenen Probe von Apis mellifera extrahiert und das Exemplar in einer Nährlösung herangezogen. Sie ist die erste Königin des neuen Volkes. Der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Die Wiedererschaffung der Insekten. Übrigens: Die Sozialstruktur des Schwarms herzustellen war eine Herausforderung. Das System ist immer noch äußerst fragil. Wenn die Königin stirbt, stirbt das Volk. Und das war es dann. Keine Bestäubung, keine Früchte, keine Hoffnung auf Besserung. Meinen Berechnungen zufolge würde die Menschheit innerhalb von vier Jahren am Rand der Auslöschung stehen, selbst mit den Fortschritten, die die Mechaniker machen. Deshalb würde ich das Projekt gern ausweiten, wie ich es in meinem letzten Bericht ausgeführt habe.« »Ich erinnere mich. In ihm fehlte vollständig die Silbe bla.« Simmons hüstelte verlegen. »Möglicherweise ein Kopierfehler.« »Möglicherweise. Das ist Menschen früher sehr häufig passiert.« Simmons hoffte inständig, dass sich das Wort früher nicht auf eine Vergangenheit bezog, zu der er bald zählen würde. Nummer 1 inspizierte weiterhin den Bienenschwarm. »Faszinierend. Und einmalig, wenn ich richtig verstanden habe.« »Korrekt. Für einen weiteren Klon gibt es nicht mehr genug fehlerfreies genetisches Material. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal.« Nummer 1 nickte bedächtig. »Ich bin zu exakt demselben Ergebnis gekommen.« Simmons Mund blieb erstaunt offen. Die oberen Etagen sollten seine Arbeit nicht verstehen. Sie sollten Budgets genehmigen und den kaufmännischen Kram erledigen. Sie sollten sich nicht hier unten blicken lassen, sie sollten kein Interesse an dem haben, was die richtigen Wissenschaftler machten und vor allem: Sie sollten sich nicht einmischen. Simmons war viel zu perplex, um zu reagieren, als Nummer 1 den Finger ausstreckte und vorsichtig die Königin aus dem Stock pflückte. »Allerdings ist mein Vertrauen in die Mechaniker äußerst ausgeprägt«, sagte er. Ohne Zeichen einer Emotion zerquetschte Nummer 1 die Königin. In Zeitlupe sah Simmons die Bruchteile des Chitinpanzers und die Flügel nach unten fallen. Unbewegt säuberte sich Nummer 1 mit einem blütenweißen und den Initialen J.H.M. bestickten Taschentuch die Finger, bevor er Simmons mit einem Blick anschaute, der diesen frösteln ließ. »Sehr gute Arbeit, Simmons. Damit ist das Projekt Stiller Planet zu einem äußerst erfolgreichen Abschluss gekommen. Ihnen empfehle ich, sich ein neues Fachgebiet zu suchen. Wir wollen doch nicht, dass Sie das gleiche Schicksal ereilt wie diesem bedauernswerten Insekt. Und verbrennen Sie alle Aufzeichnungen und die Überreste dieses Experiments.«
Simmons stand regungslos da, selbst als Nummer 1 schon lange gegangen war. Der Blick dieses Mannes hatte ihn überzeugt, dass er selbst als fehlgeschlagenes Experiment gelten würde, wenn er zu viel Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Durch Atmen zum Beispiel.
Simmons wagte sich gar nicht erst vorzustellen, was passieren würde, wenn Nummer 1 vom Backup erfuhr.
1 Unberührt davon ließen sich seine Kollegen nicht abhalten, ihn hartnäckig zu quälen. Wie gesagt, Sozialkompetenz war keine Einstellungsvoraussetzung.
Kapitel 1 - Gute neue Zeit
»Und jetzt rutsch rüber, das ist ein Zweisitzer.« Graham Rodderik rührte sich nicht von der Stelle. Er tat auch sonst nichts, sondern blieb wie versteinert sitzen. Verdammt! In seinem Kopf war das viel besser abgelaufen. Reibungsloser. Mit Worten, die tatsächlich aus seinem Mund kamen und nicht auf dem Weg zum Kehlkopf verendeten. Miranda stupste ihn ungeduldig an. »Hörst du nicht? Rutsch zur Seite.« »Ich muss dir was sagen.« Miranda hielt inne. Sie war aufgeregt wie ein kleines Mädchen, da sie Graham gerade in den Prototyp ihrer Zeitmaschine gesetzt hatte und deren Funktion demonstrieren wollte. Ihre Hand verharrte über dem Startknopf. »Was?« fragte sie – mit ihren Gedanken eindeutig woanders. »Ich liebe dich. Ich meine so richtig. Mit allem Drum und Dran. Für die Ewigkeit oder bis dass der Tod uns scheidet, je nachdem, was zuerst kommt. Meinetwegen können wir sogar heiraten.« Diese Worte schafften es, in Mirandas Bewusstsein einzudringen. Und jetzt war sie es, die einen Karpfen imitierte. »Du meine Güte«, sagte sie schließlich. »Das war der zweitromantischste Heiratsantrag, den ich in meinem Leben bekommen habe.« »In meinem Kopf klang es besser.« »Hast du da vor mir gekniet?« »Ging wegen dem Platz nicht.« Damit hatte er objektiv betrachtet recht. Es war eine sehr kleine Zeitmaschine. Keine blaue Polizeikabine, die innen größer war als außen, sondern eher Typ Isetta, die innen noch kleiner war als sie von außen aussah. Und das war schon nicht sehr groß. Außerdem war sie nicht sehr bequem. Wie alle Erfinder, die Graham kennengelernt hatte, neigte Miranda van Storm zu Effizienz und Pragmatismus. Vermutlich hatte sie bei der Konstruktion der Zeitmaschine nicht berücksichtigt, darin einen Heiratsantrag zu bekommen. »Des Platzes«, sagte Miranda. Vielleicht war die Sache mit dem Heiratsantrag doch nicht so eine gute Idee gewesen. Zwischenzeitlich lief Grahams Gedankenkarussell auf Hochtouren. Der zweitromantischste Antrag also. Wenn man davon ausging, dass sie bisher nur einen weiteren bekommen hatte – den des verstorbenen Alexander Hastings, der später versucht hatte, seine Gattin umzubringen und durch eine Mechanoiden-Kopie zu ersetzen – sah das nicht nach einem guten Start aus. Andererseits bestand die Möglichkeit, dass Lord Roxton in einem der wenigen Augenblicke ohne Grahams fürsorgliche Überwachung um Mirandas Hand angehalten hatte. Falls Roxtons romantische Anwandlungen bei Miranda auf echtes Interesse gestoßen waren, sah es für Graham schlecht aus. Den Lord zu einem standesgemäßen Duell herauszufordern wäre Selbstmord: Graham war Pazifist und Roxton Waffenfetischist. Mit seinen Gedanken beschäftigt bemerkte Graham kaum, dass Miranda ihn küsste. Als er es realisierte, traf ihn die Erkenntnis wie ein Blitz und ließ ihn sprachlos zurück. Leider begann sein Mundwerk ein paar Sekunden vor seinem Hirn, wieder in Betrieb zu gehen. »Was ist mit deinem Vorsatz, mich erst nach Ich erkläre euch zu Mann und Frau zu küssen?« »Wir stehen kurz davor, den Prototyp einer Zeitmaschine zu testen. Es besteht die zugegeben unwahrscheinliche Möglichkeit, dass ein oder zwei Dinge schiefgehen könnten. Möglicherweise überleben wir nicht. Und ich wollte wissen, was du zu bieten hast.« »War es also ein Ja oder ein Nein?« Ein Kuss konnte beides bedeuten. Willkommen und Abschied. Miranda seufzte. »Es war ein: Ich analysiere die Situation und werde dir zu gegebener Zeit meine Antwort mitteilen.« Vor einigen Monaten hatten sie über das Thema Ehe gesprochen und Grahams Bemerkung, dass man ja nicht gleich heiraten müsste, hatte eine neue Ära in ihrer Beziehung eingeläutet. Eine, gegen die die letzte Eiszeit ein Karibikurlaub gewesen war. »Wie kommt es zu diesem Sinneswandel?« »Weil mir bewusst geworden ist, dass das Leben zu kurz und kostbar ist, um auch nur einen Tag ohne den Menschen zu verbringen, den man liebt.« »Das ist ...«, sagte Miranda. »... wirklich romantisch.« Graham rückte näher an Miranda heran. Diese Zeitmaschine war auch wirklich eng, er hatte kaum Platz sich zu bewegen. »Nicht zweitromantisch?« »Nein. Und sei vorsichtig, dieser Hebel ...« Graham hatte sich auf dem Armaturenbrett abgestützt, um sich näher an Miranda zu schieben. Das, was er für einen Griff hielt, gab unter seiner Hand nach.
Sofort erfüllte ein hohes, singendes Geräusch den Raum. Beide schauten auf den Hebel, den Graham – versehentlich! – umgelegt hatte. Und auf den Miranda in Großbuchstaben "NICHT BERÜHREN!" geschrieben hatte. Mirandas ohnehin schon helle Haut war noch einige Nuancen heller geworden, nahezu weiß. Eine Tatsache, die Graham mehr als alles andere besorgte. »Ups«, sagte er, dann implodierte die Welt.
Es lief anders als in Die Zeitmaschine. Der Zeitreisende in Wells Roman – beziehungsweise der Verfilmung – hatte bequem in seiner Maschine gesessen und beobachtet, wie die Kalenderblätter in seinem Zimmer immer schneller davonflatterten, er hatte gesehen, wie vor dem Fenster die Jahreszeiten in rasender Geschwindigkeit wechselten, bis alles in einem Kaleidoskop von Farben und Formen ineinander überging und er achthunderttausend Jahre in der Zukunft zum Halt kam. Es wäre schön gewesen, wenn eine Zeitreise wirklich so abliefe. Stattdessen fühlte sich Graham, als würde er in Boxershorts im schlimmsten Gewittersturm aller Zeiten stehen. Mit einer Metallantenne auf dem Kopf und einem metaphorischen Schild in der Hand, welches jedem Blitz zu sagen schien: Hier bin ich! Graham war unfähig sich zu bewegen und konnte nur erstaunt registrieren, wie Miranda unter Aufbringung all ihrer Kräfte Hebel und Regler umstellte. Die Blitze ließen nach, das Rauschen in den Ohren ebenfalls. Als jenseits der Barrikade aus elektrischen Entladungen die Welt wieder sichtbar wurde, bestand sie aus grauen Betonwänden, Müllcontainern, vier verstörten Katzen und einer glücklichen Ratte, welche die Gelegenheit zur Flucht ergriff. Es waren weit und breit keine Menschen zu sehen und das war gut. Menschen neigten dazu, Fragen zu stellen und Graham wusste, wie Miranda reagierte, wenn ihr jemand dumme Fragen stellte. Es war besser für beide Seiten, dass keiner da war. »Leben wir noch?« fragte Graham. »Was habe ich dir über Knöpfedrücken und Hebelziehen gesagt?« »Es war keine Absicht.« »Hast du ein Glück, dass ich schon die Zielzeit eingegeben hatte. Wir hätten wer weiß wo landen können.« »Dann hätten wir einfach den Rückreiseknopf gedrückt.« »Einfach ist hier gar nichts. Die Zielkoordinaten waren das Ergebnis von siebzehn Stunden intensiver Berechnungen. Denn Zeitreisen bewegen nur durch die Zeit, nicht durch den Raum. Und ich mag es, am Ende des Sprungs etwas Festes unter den Füßen zu haben und da ist es ganz praktisch, wenn die Erde nicht gerade an einer anderen Position auf ihrer Sonnenumlaufbahn ist. Zeitreisen sind nicht ganz so trivial, wie du denkst.« »Gut. Abgesehen davon, ändert das etwas an deiner Antwort?« »Worauf?« »Auf den zweitromantischsten Heiratsantrag aller Zeiten.« Graham lächelte vorsichtig. »Ich muss darüber nachdenken.« Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. »Wo sind wir überhaupt? Oder besser: Wann sind wir überhaupt?« Miranda hatte sich der Zeitmaschine gewidmet und Graham redete sich ein, dass Miranda vollständig auf die Maschine konzentriert war und deshalb im Moment nicht über seinen Antrag nachdenken konnte. Ein spontanes und optional enthusiastisches Ja! wäre nicht schlecht gewesen, aber eine gründlich durchdachte Antwort hatte auch ihre Vorteile. »Drei Tage nach deinem zweiten Zeitsprung.« »Gut. Es wäre unheimlich, wenn ich plötzlich in mein altes Ich rennen würde. Das Trauma bekommt so schnell kein Psychiater weg. Vorausgesetzt, ich finde einen. Aber an so eine Begegnung müsste ich mich erinnern, meinst du nicht auch?« Graham stutzte, als er Mirandas Gesichtsausdruck sah. Er kannte diesen Ausdruck. Er bedeutete, dass sie ihm etwas verheimlichte. »Was ist?« »Hast du das ernst gemeint, mit dem Heiratsantrag?« Miranda musste ihm wirklich etwas Schlimmes verheimlichen. Es war möglich, dass sie ehrlich den Status ihrer Beziehung klären wollte, aber Graham erkannte ein Ablenkungsmanöver, wenn er eins sah. Er zog Miranda zu sich heran und schloss sie fest in seine Arme. »Ja, das ist mein voller Ernst.« »Und warum?« Graham hätte ihr von Lilly und Robert erzählen können, dem Straßenmädchen und dem missgestalteten Sohn Frankensteins, die sich in Whitechapel getroffen hatten und sofort wussten, dass sie zueinander gehörten1. Er hätte ihr erzählen können, dass er sogar aus einer Meile Entfernung spüren konnte, dass diese beiden nichts voneinander trennen würde und dass er das Gleiche mit Miranda erleben wollte. Aber er sagte nichts davon, denn obwohl Miranda klug und pragmatisch war, konnte sie sehr nachtragend sein. Die Erwähnung einer anderen Frau in dieser Situation konnte ungeahnte Konsequenzen haben. »Weil ich dich liebe. Was mir Angst macht. Aber trotzdem kann und will ich mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen.« Miranda sagte nichts, aber sie lächelte. Und das erhellte Grahams Tag mehr als die Sonne2. Auf der anderen Seite hielt er Miranda gerade so fest, dass sie nicht weglaufen konnte. Zeit für Frage zwei: »Was hast du mir gerade nicht gesagt?« »Dass ich dich liebe?« »Davon bin ich ausgegangen. Nein, ich meine über die Zeitreise.« Miranda versuchte unauffällig, sich aus seiner Umarmung zu lösen. Graham gab nicht nach. »Nichts.« »Oh doch! Irgendwas verheimlichst du mir!« Miranda wehrte sich einen Moment, bevor sie sagte: »Es gibt kleine mathematische Unsicherheiten. Ich weiß nicht, ob du ...« »Chaostheorie. Ja, ich weiß. Wie klein sind die Unsicherheiten?« »Plus minus vier Wochen.« Plus minus vier Wochen. Plus vier Wochen waren kein Problem. Aber minus vier Wochen? Er könnte in sein altes Ich rennen – aber daran hätte er sich doch erinnern müssen, oder? Allerdings war er zu dem Zeitpunkt seiner Vergangenheit noch nicht in die Vergangenheit und dann wieder in die Zukunft gereist. Welche Implikationen das mit sich brachte, darüber wollte er gar nicht nachdenken. Das ist der Grund, warum Zeitreisen nichts für Anfänger sind.
Gedankenversunken löste Graham seine Umarmung. Miranda nutzte die Gelegenheit und schaute sich neugierig um, betrachtete die Umgebung mit weit aufgerissenen Augen. Viel gab es nicht zu sehen: Sie standen in einer engen Gasse zwischen zwei Bürotürmen. Grau gestrichene Fluchttüren brachten die einzige Abwechslung in öde Betonwände. Nicht einmal Graffiti-Künstler hatten sich hierher verirrt, obwohl das der Umgebung gutgetan hätte. Licht gab es nur, wenn die Sonne direkt über dem Spalt zwischen den Türmen stand; das dürfte zweimal im Jahr zur Sonnenwende der Fall sein. Überquellende Mülltonnen, leere Flaschen und der überwältigende Geruch nach Katzenurin vervollständigten das Ambiente. »Wo sind wir hier? Wir hätten uns gar nicht durch den Raum bewegen dürfen. Wir sollten immer noch in meinem Labor sein. Ich habe letzte Woche extra mein Testament angepasst und verfügt, dass absolut nichts an Hastings Manor verändert werden darf.« Graham zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Vielleicht wurde das Stadthaus im 2. Weltkrieg weggebombt.« »Zweiter Weltkrieg? Hat der erste nicht gereicht?« »Nach dem zweiten war Schluss.« »Hast du nicht gesagt, die Zukunft wäre besser?« »Auf dem Weg dahin gab es ein paar Fehlstarts.« »Noch etwas, was du mir erzählen willst?« »Ja. Wir sollten die Zeitmaschine an einen sicheren Ort bringen. Sonst stehen nachher zwei da.« »Das bezweifle ich. Die Technologie ist extrem fortschrittlich, sogar für meine Verhältnisse. Ich glaube nicht, dass jemand die kopieren kann.« Ironie war nicht Mirandas Stärke. »Weißt du was? Warum setzen wir uns nicht in die Zeitmaschine und springen zurück?« Miranda zögerte. Immer wenn Miranda zögerte, schrillten bei Graham die Alarmglocken. Denn sie zögerte nur dann, wenn das, was sie als Nächstes sagen würde, dem Zugeben eines Fehlers nahekam. Statt weiterzureden, widmete sich Miranda den Anzeigen der Zeitmaschine. »Der Sprung hat etwas mehr Aether verbraucht, als meine Berechnungen vorhergesagt haben.« »Heißt das, wir stecken hier fest?« »Nein. Der Aethergenerator regeneriert vollautomatisch den verbrauchten Treibstoff. Wir müssen nur warten, bis die Tanks wieder voll sind.« »Wie lange?« »Drei Tage. Plus minus.« »Also stecken wir hier drei Tage lang fest.« »Wir stecken nicht fest! Wir ... wir haben die Gelegenheit, deine Super-Zukunft anzuschauen. Sofern die Weltkriege was davon übrig gelassen haben.« Das Einzige, was noch schlechter war als Mirandas Ironie-Verständnis, waren ihre Versuche, ironisch zu sein. »Also stecken wir hier drei Tage fest und du möchtest, dass ich dir den Reiseführer mache.« »Ja.« Dann lächelte sie und Graham vergaß alle spöttischen Kommentare, die ihm auf der Zunge lagen. Frauen hatten generell diesen Effekt auf ihn3, aber Miranda besonders. Irgendetwas passierte gerade mit seinem Herzen. Wenn sie schon drei Tage hierbleiben mussten, dann ließ sich bestimmt ein Besuch beim Kardiologen einschieben. »Drei Tage lang können wir die Kiste nicht hier stehen lassen.« Graham tippte mit dem Fuß gegen die Karosse, so wie ein Kaufinteressent gegen die Reifen eines Gebrauchtwagens tritt, um Interesse und Fachkenntnis zu vorzutäuschen. Während ein Gebrauchtwagenhändler spätestens in diesem Moment weiß, dass er ein unbedarftes Opfer vor sich hat, schaltete sich bei Miranda der Beschützerinstinkt ein. Sie zerrte Graham von der Zeitmaschine weg. »Das ist keine Kiste! Das ist Anni!« Anni war die Kurzform von Anastasia und Anastasia war der Name ihrer Mutter. Miranda schien tatsächlich eine emotionale Bindung zu ihrer Erfindung aufgebaut zu haben. Der Blick, den sie Anni zuwarf ... Graham wünschte, Miranda würde ihn so ansehen. Aber er musste realistisch bleiben. »Okay. Bringen wir Anni in ein Parkhaus. Hat sie Räder?« »Natürlich. Wie sollte ich sie sonst bewegen können?« Und tatsächlich hatte die Zeitmaschine Räder. Winzig kleine. Wie die eines Einkaufswagens. Und die waren genauso störrisch wie ihre Supermarktpendants. Eins quietschte.
Graham hatte es riskiert, Miranda und die Zeitmaschine zurückzulassen4 und die Gegend außerhalb der Gasse zu erkunden. Sie hatten Glück. Das Bürogebäude rechts neben ihnen hatte für die Mieter eine Tiefgarage, die auch für die Öffentlichkeit zugänglich war. Graham hatte einen Blick hinein geworfen und die Unterstellmöglichkeit für gut befunden. Miranda dagegen blieb dreiundzwanzig Minuten später wie versteinert stehen. »Was ist das?« Sie wies mit dem Finger auf ein unauffälliges Schild. Graham hatte es bereits gesehen; es war für ein Parkhaus im Londoner Zentrum ganz okay. »Die Preise.« »Siebenundzwanzig Pfund, um eine pferdelose Kutsche für einen Tag abzustellen? Die müssen ja nicht einmal Tiere füttern und striegeln!« »Das ist nicht so viel.« »Von siebenundzwanzig Pfund kann eine Familie ein ganzes Jahr lang leben!« beharrte Miranda auf der Ungeheuerlichkeit dieser Tatsache. Sie hatte recht: Siebenundzwanzig Pfund waren zu ihrer Zeit ein kleines Vermögen, aber das war hundertfünfzig Jahre her. Da hatte die Inflation mehr als genug Zeit, ihren Job zu erledigen. »Nicht so laut!« meinte er, obwohl das unnötig war. Die wenigen Passanten vermieden jeglichen Kontakt zu anderen. Die Blicke waren stur auf den Boden gerichtet, niemand schaute nach links oder rechts. Graham schenkte ihnen kaum Beachtung. Sein Unterbewusstsein registrierte die Bilder und nahm sich vor, nach genauerer Analyse das Großhirn auf die Unstimmigkeiten aufmerksam zu machen. Im Moment war dafür keine Zeit. Miranda drückte Graham gegen die Hauswand. »Siebenundzwanzig Pfund ist glatter Raub! Das werde ich nicht unterstützen!« »Erstens«, erwiderte Graham, während er versuchte, sich aus ihrem Griff zu befreien, »solltest du mich loslassen, bevor ein Polizist auf uns aufmerksam wird. Zweitens, wenn wir in meiner Zeit gelandet sind, dann sollte ich Zugriff auf mein Konto haben. Und wie du weißt, bin ich wohlhabend. Und drittens werden wir diese Garage durch die Zeit verlassen und nicht durch den Ausgang, bei dem wir bezahlen müssten.« »Ich bin mir sicher, dass dieser Keller zu meiner Zeit noch nicht da war. Kehren wir von hier aus zurück, landen wir unter der Erde. Lebendig begraben. Denk an sowas, bevor du das nächste Mal an irgendwelchen Hebeln spielst.« »Schaffen wir sie trotzdem rein. Da ist sie sicherer als auf der Straße. Um den Rest kümmere ich mich.« »Okay. Auf deine Verantwortung. Und unter meinem ausdrücklichen Protest! Raubritter!« Graham warf einen Blick auf die Fußgänger. Irgendwas war seltsam, aber er konnte nicht sagen, was. »Steh nicht da rum!« Miranda brauchte Hilfe beim Schieben.
Anni in die Tiefgarage zu verfrachten war ein hartes Stück Arbeit und durfte keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Graham bemerkte Überwachungskameras, aber er bezweifelte, dass es irgendwo ein fensterloses Büro gab, in dem ein Wachmann den ein- und ausfahrenden Verkehr beobachtete. Kein Manager würde eine teure Arbeitskraft dafür bezahlen.
Sie verließen die Garage zwanzig Minuten später5 und standen auf dem fast menschenleeren Fußweg. Das kam Graham wirklich seltsam vor. Zugegebenermaßen war der Finanzdistrikt kein touristisches Highlight und Menschen lebten in diesem Teil der Stadt schon lange nicht mehr – der eine oder andere im Büro übernachtende Workaholic ausgenommen – aber soweit er sich erinnern konnte, tobte hier bis zur Last Order das Leben. Jetzt waren nur vereinzelt Menschen unterwegs; meist solche, die keine andere Wahl hatten. Kuriere, Paketboten und Pizzalieferanten zum Beispiel. Und irgendwie war es dem National Health Service während Grahams Abwesenheit gelungen, die Fettleibigkeit komplett zu besiegen. Die meisten Menschen, denen sie begegneten, konnten als schlank durchgehen, aber an der Grenze zu ausgemergelt. Als fit konnte keiner gelten, dachte Graham. Die paar Leute, denen sie begegneten, wirkten eigenartig energielos. Männer wie Frauen trugen etwas, was laut Modezeitschriften Smokey Eyes genannt wurde, wofür sie aber kein Make-up brauchten. Und alle hatten einen schlurfenden Gang – manche mehr, manche weniger. Graham vergaß das alles sofort, als er seine Aufmerksamkeit Miranda zuwandte. Ihre Augen sahen aus, als würden sie gleich aus dem Gesicht ploppen. Um das zu verhindern, hatte sie ihren Kopf in den Nacken gelegt und starrte nach oben. Graham schaute in die gleiche Richtung. Alles, was er sah, war ein Büroturm, einer von vielen. Im Londoner Finanzdistrikt gab es dutzende davon. Erst nach einigen Sekunden begriff er: Für jemanden, für den die Erbauung der Londoner Tower Bridge, dem damals höchsten Gebäude der Stadt, noch in ferner Zukunft lag, musste ein Wolkenkratzer gleich nach den sieben Weltwundern kommen. Oder kurz davor, je nach klassischer Bildung. Graham stellte sich vorsichtig hinter Miranda. Zu lange in die Luft zu starren konnte seltsame Dinge mit dem Gleichgewichtssinn anstellen. Und falls sie umkippte, wollte er der Mann sein, der sie auffing. Aber Miranda war nicht die Frau, die so leicht in Ohnmacht fiel. »Neunhundertsiebenunddreißig Fuß«, sagte sie. »Auf den Inch genau«, bestätigte Graham. Er hatte keine Ahnung, wie hoch das Haus wirklich war, aber Miranda irrte sich in solchen Sachen nie. Und für den Fall, dass sie sich irrte, wollte er nicht der Überbringer dieser Nachricht sein. Don't shoot the messenger mochte sich in einem Lied gut anhören, leider hielt sich in der Praxis nicht jeder daran. »Das ist unglaublich!« »Okay, aber wir müssen weiter! Hochhäuser sind nun wirklich nichts Besonderes.« Miranda sah Graham entgeistert an. »Nichts Besonderes?« Oh. Wenn sie kursiv sprach, lief es auf eine Grundsatzdiskussion hinaus. »Dieses Wunder der Ingenieurskunst? Der Sieg des Verstandes über die Gravitation? Diese Eleganz und Grazie!« Die verloren an Charme, wenn man jahrelang von neun bis fünf6 im Inneren arbeitete, so wie es Graham getan hatte. Meist innerhalb einer kleinen, mit Pappwänden abgetrennten Zelle im Zentrum einer Etage, weitab von Tageslicht und frischer Luft. »Es ist ein Büroturm. Sieh dich um – hier gibt es dutzende davon!« Aber Miranda hatte nur Augen für den Wolkenkratzer direkt vor ihr. »Wir sollten den Eigentümer fragen, ob er uns eine Führung gibt. Wem gehört dieses Gebäude?« »Wahrscheinlich irgendeinem Hedgefonds.« »Ich habe noch nie von dieser Familie gehört.« »Es ist keine Familie, es ist ein ...« Graham zögerte. Hedgefonds waren schwer zu erklären. Es waren Unternehmen. Aber in Mirandas Welt waren Unternehmen Geschäftsmänner, die irgendetwas Nützliches produzierten. Die Werte schufen oder wenigstens Expeditionen in unbekannte Gegenden unternahmen, um dort Werte aus dem Boden zu graben. Hedgefonds taten nichts davon. Graham entschloss sich, Miranda mit den feineren Details von Finanzkonglomeraten zu verschonen und versuchte sie vom Bürgersteig wegzuziehen. Erste Passanten wurden auf sie aufmerksam. »Ich will da hoch.« »Machen wir. Später.« »Warum später? Warum nicht jetzt?« Das war eine gefährliche Frage. Hätte sie gesagt "Ich will", dann hätte Graham sie wie ein kleines Kind behandeln können. Aber sie fragte nach dem Warum und das konnte sehr schnell in einer Spirale enden, aus der es kein Entkommen gab. Und sie standen schon ein paar Minuten vor dem Wolkenkratzer. Jeder trainierte und durch die permanente Terrorismusgefahr an den Rand der Paranoia getriebene Sicherheitsbeamte würde langsam misstrauisch werden. Zudem hatte Graham in den letzten vierzig Sekunden zweimal denselben Polizisten an ihnen vorbeigehen sehen. Nach einem prüfenden Blick des Uniformierten hatte er in sein Funkgerät gesprochen. Graham kannte genug Verschwörungsthriller, um zu wissen, dass die Behauptung, Unschuldige hätten nichts zu befürchten, einen starken Mangel an Realitätssinn verriet. »Weil ich gern wissen möchte, in welcher Zeit wir sind, bevor wir irgendwas machen. Es könnte ja sein, dass die Nazis den Krieg gewonnen haben.« Die Wahrscheinlichkeit war gering, denn dann würden die Fußgänger im Stechschritt marschieren und es gäbe einen wesentlich höheren Anteil an Flaggen und Uniformen im Straßenbild. Trotzdem: Das Prinzip kam hin. »Okay. Aber danach werden wir bei diesem Lord Hedgefonds vorsprechen. Er wird sich einer Besichtigung dieses formidablen Gebäudes nicht verweigern. Diese Snobs lieben es, mit ihrer Habe anzugeben.« Miranda musste das wissen. Für eine aus ärmlichen Verhältnissen stammende Tinkerin war sie zuweilen unglaublich versnobt. Doch Graham hütete sich, das laut zu sagen.
Viel hatte sich in London nicht verändert. Wenn er wirklich nur drei Tage7 weg gewesen war, dann war auch nicht davon auszugehen. Graham fand den Weg zu seiner Wohnung wie im Schlaf8. Die Häuser bestanden immer noch aus demselben grauen Beton und die Bürgersteige waren dreckig wie immer. Heerscharen von Tauben ... nein, die Stadt musste auch das Taubenproblem in den Griff bekommen haben. Graham hatte die Viecher noch nie leiden können; sein Mitgefühl hielt sich in Grenzen. Dafür beunruhigte ihn der Anblick der Menschen, die ihnen begegneten, umso mehr: Keine Fettleibigkeit mehr war ganz in Ordnung. Man durfte es nur nicht übertreiben – aber genau das war anscheinend der Fall. Skinny-Jeans schlackerten um dürre Oberschenkel wie Fahnen im Wind, Hemden wurden körperbetont geschnitten, um den Luftwiderstand gering zu halten. Anderenfalls wären die Träger schon bei einer leichten Brise nicht mehr vorwärtsgekommen. Graham hatte dank Mrs. Tingles das obere Ende der BMI-Skala erreicht, durch die Rennerei der vergangenen Monate aber ein wenig9 Gewicht verloren. Damit fiel er auf.
Miranda bekam davon nichts mit. Sie schaute nach oben und achtete nicht auf ihren Weg. Wenn Graham nicht korrigierend eingegriffen hätte, wäre sie vor Straßenlaternen, Mülleimer oder Telefonzellen gelaufen. Auch sie wurde angestarrt, was Graham bei ihrem Aussehen verständlich fand. Aber die Blicke, die ihnen zugeworfen wurden, hatten etwas anderes in sich. Etwas hungriges.
Graham war froh, als sie sein Appartementgebäude erreichten. Der Eingang war mit einem Nummerncode gesichert, der Schlüssel überflüssig machte und sich nicht geändert hatte. »Hier lebst du?« fragte Miranda. Graham sah sich das graue Gebäude an, in dem er wohnte. Kein Schmuckstück, aber höher als Miranda gewohnt sein dürfte. Die Appartements hatten fließend Wasser und Heizung – Sachen, die einer Frau aus dem viktorianischen Zeitalter wie Weltwunder vorkommen mussten – und vor allem: Es war bezahlbar. Das war für Graham das echte Wunder. »Wie sind die Nachbarn so? Sind sie nett?« Die Frage erwischte Graham kalt. Die Nachbarschaft war kein Kriterium bei seiner Wohnungswahl gewesen. Er konnte sich nicht erinnern, einen seiner Nachbarn jemals persönlich gesprochen zu haben. Manchmal sah er graue Schemen, die auf dem Weg zur Arbeit waren oder von dort zurück eilten. Ein Inder wohnte auf dem gleichen Flur, aber den hatte Graham einmal bei seinem Einzug gesehen und danach nie wieder. Der Mann konnte inzwischen tot sein, ohne dass Graham davon etwas mitbekommen hätte. Wenn sich Graham richtig erinnerte, kam aus der Wohnung des Inders seit vier Jahren permanent Fernsehlärm. Vielleicht saß der Mann tot vor der Glotze; anders konnte man das Programm kaum ertragen. Ein anderer Nachbar musste eine Katze haben, die ab und zu mauzte. Aber von keinem wusste Graham den Namen. Um solche Details hatte er sich nie gekümmert. Jetzt befürchtete Graham, dass Miranda von seinen fehlenden sozialen Verbindungen erfahren würde – und welchen Eindruck das bei ihr hinterließ. Denn obwohl sie sich manchmal tagelang in ihrer Werkstatt vergrub, kannte sie die Namen der Kinder des Postboten. So viel Interesse an anderen Menschen hatte Graham nie aufbringen können. Und davon wäre Miranda wirklich enttäuscht – genau das wollte er ihr ersparen. »Ich war eine Weile weg«, lenkte Graham ab. »Hoffentlich nehmen sie keinen Anstoß daran, dass du eine unverheiratete Frau mit in dein Heim bringst.« »Definitiv nicht.« Wahrscheinlich würden sie nicht einmal Notiz davon nehmen. »Ich möchte einen Skandal vermeiden.« »Keine Sorge. Die Zeiten haben sich geändert.« »Hoffentlich sagst du das nicht nur, um mich zu beruhigen.«
Im Hausflur steuerte Graham den Aufzug und Miranda die Treppe an. Erstaunlich, wie schnell alte Gewohnheiten zurückkehrten. »Ich wohne in der neunten Etage«, bemerkte Graham. »Und warum bleibst du dann vor einer Tür stehen?« Mit einem Gefühl für perfektes Timing öffnete sich der Fahrstuhl. »Ich präsentiere: Das Wunder des Aufzugs!« Miranda schaute in die kleine, hell erleuchtete Kabine. »Das ist sowas wie der Aufstiegsraum von Burton und Homer. Ohne die Aussicht natürlich. Habe ich recht?« »Möglicherweise. Ich bin mir beim Funktionsprinzip nicht sicher.« Graham war sich auch nicht sicher, was ein Aufstiegsraum war oder wer Burton und wer Homer. Er war sich nur sicher, dass er das nicht zugeben wollte. Miranda tippte auf das Typenschild. »Otis. Ich habe mit diesem Gentleman bei früherer Gelegenheit über Fallsicherungen korrespondiert. Seine praktische Demonstration war beeindruckend. Er ließ seinen Gehilfen das Zugseil der Fahrkabine durchschneiden und sie ist nicht abgestürzt. Etwas effektheischend, aber ich nehme an, dass System hat sich durchgesetzt. Man muss auf den Knopf der Etage drücken, zu der man gelangen will, oder?« »Korrekt.« Miranda schaute weiter in den Aufzug. »Das ist ein entsetzlich kleiner Raum.« »Ich wusste nicht, dass du Platzangst hast.« »Nein. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es schicklich ist, wenn zwei unverheiratete Menschen über einen ungewissen Zeitraum ohne Begleitung auf so engem Raum zusammen sind.« Ja, das moderne Leben hielt eine Menge Hürden bereit. Leider war Miranda in dieser Situation unangenehm pragmatisch. »Weißt du was? Ich nehme diese Aufzugsmaschine und du die Treppe. Damit ist die Schicklichkeit gewahrt.« Sie schob sich an Graham vorbei in den Aufzug. Schicksalsergeben drückte er auf die Neun. Miranda winkte, als sich die Tür schloss. »Es sind neun Stockwerke!« rief Graham ihr hinterher, als sich die Tür schon längst geschlossen hatte. Sein Hirn war überrumpelt worden.
Als Graham zwanzig Minuten später oben ankam10 wartete Miranda bereits ungeduldig auf ihn. Geschah ihr recht, befand Graham. Sie hätte ihn wirklich mitnehmen können. »Faszinierende Erfindung.« »Ja.« »Und außen der Knopf dient dazu, die Kabine dorthin zu rufen, wo man gerade ist?« Graham nickte. »Warum hast du nicht den Knopf gedrückt, nachdem ich hier ausgestiegen bin? Die Kabine wäre dann doch hinuntergefahren, oder?« »Es ist gesünder, die Treppe zu nehmen. Bewegung und so.« Dass Graham nicht auf diese Idee gekommen war, erwähnte er nicht. »Ich wohne da drüben.« Und nach einer kurzen Pause. »Ich bin mir aber nicht sicher, ob du die Wohnung eines unverheirateten Mannes ohne Begleitung betreten darfst.« »Wir könnten sagen, dass du mein Butler bist. Damit wäre die Etikette gewahrt.« »Wir könnten auch sagen, dass du mein Hausmädchen bist.« »Nein. Zu unglaubwürdig.«
Grahams Wohnung war ebenfalls mit einem Zahlenschloss gesichert. Irgendwann war es der Hausverwaltung zu viel beziehungsweise zu teuer geworden, bei verlorenen Schlüsseln die gesamte Schließanlage austauschen zu lassen; davon abgesehen, dass man Schließanlagen und austauschende Handwerker kaum und wenn, dann zu horrenden Preisen bekam. Graham hatte nichts dagegen, vor allem, da er den Code selbst bestimmen konnte. Er hatte sich für die letzten zwölf Ziffern von Pi entschieden11. An der Tür zögerte Graham kurz. »Was ist, wenn ich da drin bin?« »Du bist ein cleverer Mann. Dein altes Ich würde ohne Probleme begreifen, was los ist.«
1 Siehe "Die Morde von Whitechapel" für diese Geschichte.
2 Das ist London. Da scheint nie die Sonne.
3 Auch wenn Graham nicht behaupten konnte, dass es Frauen außer Miranda gab, die ihn so angelächelt hatten.
4 Die beiden zu trennen wäre sowieso ein Ding der Unmöglichkeit gewesen.
5 Dreizehn Minuten davon hatte Miranda gebraucht, um sich von Anni zu verabschieden.
6 Das bezog sich natürlich nur auf die bezahlte Arbeitszeit. Wer nicht mindestens doppelt solange blieb, wollte einfach keine erfolgreiche Karriere.
7 plus/minus
8 Reine Übungssache. Spätestens nach einer Woche mit achtzehnstündigen Arbeitstagen erfolgte der Weg nach Hause in einem schlafähnlichen Zustand.
9 Ein Pfund. Wenn man großzügig aufrundete.
10 Wurde schon erwähnt, dass es neun Stockwerke waren? Neun sehr hohe Stockwerke?
11 Pi ist unendlich? Das wollen die euch glauben machen! Aber Scherz beiseite: Sobald ein neuer Berechnungsrekord aufgestellt wurde, besorgte sich Graham die neuen Zahlen und änderte seinen Zugriffsschlüssel. Das einzige Mal, als jemand bei ihm eingebrochen war, hatte der Dieb die Feuerleiter benutzt und das Fenster eingeschlagen. Gegen brutale Gewalt war selbst Pi machtlos.
Kapitel 2 – In der Erinnerung sah es besser aus
Die Befürchtung war unbegründet. Es wartete kein Parallel-Graham in der Wohnung, dem ein paar verwirrende Dinge über Zeitreisen erklärt werden mussten. Dafür würde Graham Miranda ein paar unangenehme Dinge über den Zustand seiner Wohnung erklären müssen. Mirandas entsetzter Gesichtsausdruck war Graham nicht entgangen. Sie strich unauffällig mit einem Finger über das kleine Regal neben der Tür. Das hinterließ eine deutlich sichtbare Spur im Staub. »Schätze, wir sind bei plus vier Wochen, seit ich hier weg bin«, murmelte Graham. »Diese Staubschicht ist deutlich älter als einen Monat.« »Vielleicht hast du dich verrechnet, und wir sind noch später angekommen.« Die Chance, dass Miranda sich verrechnet hatte, war winzig. Die Wahrscheinlichkeit, dass Junggesellen-Graham es mit dem Staubwischen nicht so genau nahm, war dagegen gigantisch. Vor allem, da außer ihm niemand die Wohnung betrat. Es war eine reine Optimierungsfrage. Unauffällig lenkte Graham Miranda Richtung Wohnzimmer. Es war besser, wenn sie das in Augenschein nahm, bevor sie zur Küche kam. Wenn Graham Glück hatte, war der Inhalt des Mülleimers zusammen mit dem Inhalt der Spüle nach Gretna Green durchgebrannt. Wenn er Pech hatte, dann war das Zeug sesshaft geworden und verteidigte sich mit Zähnen und Klauen gegen seine Entsorgung.
Trotz Mirandas Beteuerung roch die Luft schal, abgestanden und definitiv älter als vier Wochen. Graham zog die Gardine zur Seite und riss das Fenster auf. Der Vorteil einer Wohnung im neunten Stockwerk war, dass Smog sich unterhalb ausbreitete während man oben Frischluft hatte. Oder was man so als Frischluft bezeichnete. Durch sein Leben in der prä-automobilen Zeit war er eindeutig Besseres gewohnt. Aber das was hereinströmte war immer noch besser als der Mief hier drin.
Miranda erforschte währenddessen den Rest der Wohnung. Graham schaffte es, vor ihr im Schlafzimmer zu sein, um sicherzugehen, dass keine verfänglichen Zeitschriften herumlagen. Miranda mochte mit gesellschaftlicher Etikette begründen, dass kein Mann ihr Schlafzimmer betreten durfte. Anders herum bestanden solche Hemmungen nicht.
Aber der Graham, der in dieser Wohnung lebte – oder gelebt hatte – musste ordentlicher sein als der Jetzt-Graham. Oder etwas war ganz und gar nicht in Ordnung. Graham tendierte zu Letzterem. Zum einen lag auf seinem Schreibtisch ein Kalender aus Papier, etwas, was Graham noch nie in seinem Leben benutzt hatte. Laut Eintrag befand sich Jetzt-Graham auf einer Geschäftsreise in Dubai oder Abu Dhabi – die Handschrift seines Zeitzwillings war genauso mies wie seine eigene – und würde dort noch mindestens einen Monat bleiben. Das erklärte seine eigene Abwesenheit, änderte aber nichts daran, dass Grahams Instinkt Alarm schlug. Als wäre nicht alles das, was es auf den ersten Blick zu sein schien, sondern die Realität zwei Zentimeter nach links verrutscht. Alles sah wie gewohnt aus, doch auf den zweiten Blick offenbarten sich kleine Fehler – obwohl er noch keinen entdeckt hatte. In dem Augenblick hörte er Mirandas Schrei aus dem Bad. Sekundenbruchteile später war er bei ihr und atmete erleichtert auf: Sie hatte das warme Wasser entdeckt.
»Das ist fantastisch!« jauchzte Miranda, als sie ihre Hände unter den Wasserhahn im Waschbecken hielt. »Das muss ein Vermögen gekostet haben!« Graham kratzte sich am Kopf. Beim Blick auf die jährliche Nebenkostenabrechnung fühlte es sich nach einem Vermögen an, aber er wusste, dass Miranda andere Maßstäbe ansetzte. In ihrer Zeit galt man als privilegiert, wenn man genug Holz hatte, um Wasser über einem Feuer warm zu machen. »Das ist Standard.« »Heißes Wasser, direkt aus der Wand?« »Ja. Und ein WC.« Graham wies darauf. »Was ist das?« fragte Miranda. »Eine Toilette. Mit Wasserspülung.« Mirandas Augen wurden groß. Selbst Hastings Manor hatte im Grunde genommen nur luxuriös verkleidete Plumpsklos. Es gehörte zu den unliebsamsten Aufgaben der Dienerschaft, die darunter liegende Sickergrube zu leeren. »Ich habe sowas bisher nur in London Nr. 1 gesehen. Und du hast eine?« Graham erinnerte sich an die Gegend, in der Miranda aufgewachsen war. Dort hatte nicht einmal jedes Haus einen eigenen Eimer. »Wow. Das ist beeindruckend.« »Warte, bis du den Kühlschrank siehst.«
Keine zehn Sekunden später schauten beide in den Kühlschrank. Es war kein besonderer Kühlschrank; er war Teil der Einbauküche und in der Miete eingeschlossen. Das Gerät hatte ein Gefrierfach, welches gerade groß genug für drei Pizzen war, wenn man sie aus der Pappschachtel nahm, aber keinen Eiswürfelgenerator. »Eine Kältemaschine. Aber das Bad ist beeindruckender. Warmes Wasser zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach durch Öffnen eines Ventils? Das ist Wahnsinn! Wie hält man das Ammoniak im Kreislauf?« Miranda inspizierte den Kühlschrank gründlich, lauschte am Kompressor und befühlte den Wärmetauscher. »Ammoniak?« Was zum Geier wollte sie mit Ammoniak? »Ammoniak. Carré hat seine Kältemaschine erst kürzlich vorgestellt. Sie basiert auf der Verflüssigung und dem Verdunsten von Ammoniak. Aber das Gas riecht sehr unangenehm, wenn es in die Luft gelangt. Und das tut es. Es ätzt sich über kurz oder lang durch jedes Metall. Deshalb würde nie jemand so ein Ding in seine Wohnung stellen.« »Offensichtlich hat man die letzten hundertfünfzig Jahre genutzt, um einige Verbesserungen vorzunehmen.« Das Miranda die Errungenschaften der Moderne bereits kannte, nahm der ganzen Angeberei den Spaß. Miranda hätte das an Grahams Gesicht ablesen können, aber ihr Kopf steckte im Gefrierfach. »Warum hast du einen Schrank voll kalter Luft in der Wohnung? Ist der für heiße Tage gedacht?« Graham runzelte die Stirn. »Der ist zur Aufbewahrung von Lebensmitteln.« »Ah. Interessant. Und warum sind keine Lebensmittel drin?« »Gute Frage.« Graham hatte einen Stapel Tiefkühlpizzen und eine anderthalb Liter Flasche Cola erwartet, denn das war seine Standardbefüllung. »Schätze, ich muss einkaufen gehen.«
Sein Geld bewahrte Graham im abgeschlossenen Fach des Schreibtischs auf. Der zugehörige Schlüssel fand sich im üblichen Versteck1 und passte. Neben seiner Ersatzkreditkarte lag etwas Bargeld mit dem Konterfei von Elisabeth II in der Schublade. Wenigstens das war gleich geblieben. Er zog sein Tablet aus dem Fach, schaltete es ein, öffnete den Browser2 und schob das Gerät zu Miranda. »Miranda, darf ich vorstellen: das Internet. Internet, das ist Miranda. Ich glaube, ihr zwei werdet euch prächtig verstehen.« »Möglicherweise. Was ist das?« »Das Fenster zur Welt.« »Ziemlich flach, oder?« »Lass dich von Äußerlichkeiten nicht blenden.« Graham rollte seinen Stuhl zum Schreibtisch und setzte Miranda darauf. »Hier. Stell deine Frage und das Internet wird sie beantworten.« Ja, es gab Schwachstellen in dieser Argumentation, aber Graham verzichtete darauf, Miranda auf die Gefahren der Online-Welt hinzuweisen. Und vor allem darauf, dass Antworten aus dem Internet nicht immer für bare Münze zu nehmen waren. Miranda war eine clevere Frau. Sie würde es schon merken. »Woher soll das Internet die Antwort kennen?« »Stell es dir als eine unendlich große Bibliothek vor.« Beim Wort Bibliothek leuchteten Mirandas Augen auf. »Wirklich?« »Wirklich.« Graham klopfte ihr leicht auf die Schulter. »Hab Spaß. Ich gehe und besorge etwas zu essen.« »Ja, mach das nur. Es gibt keine Bibliothek, in der ich mich nicht zurechtfinde.« »Da bin ich sicher.« Mit diesen Worten schnappte sich Graham seine Jacke3 und zog die Tür hinter sich zu.
Draußen atmete Graham erleichtert auf. Es hatte Vorteile, dass Miranda ihn nicht sehen konnte. Dann hätte sie mitbekommen, welche Sorgen er sich wirklich machte. Er war zwar zu Hause, aber alles wirkte so falsch. Die dünnen Menschen, die Ruhe, die Ordnung. Das London, das er kannte, brodelte voller Leben, mit schrägen Typen überall, chaotisch, bunt, unberechenbar. Über dem London hier lag eine Decke, ein grauer Schleier, der alles erstickte. Die Menschen sahen aus, als wären sie schon tot und würden sich nur die Zeit bis zu ihrer eigenen Beerdigung vertreiben – und alle mit demselben Programm. Konformität stand über allem. Von den bunten Paradiesvögeln auf den Straßen war nichts mehr zu sehen. Selbst ein beiger Anzug stellte einen grellen Farbtupfer im grauen Einerlei dar. Was war hier los? Graham musste die Antwort finden – und das ohne Miranda unnötig in Aufregung zu versetzen.
Er nahm die Treppe nach unten4. Draußen wandte er sich automatisch nach rechts – den Weg zu seiner bevorzugten Marks & Spencer-Filiale kannten seine Füße. Seltsamerweise hatte sein Kopf es nie für nötig gehalten, sich die Straßennamen einzuprägen. Daher blieb Graham genug Gelegenheit, seine Umgebung zu beobachten. Bis auf sein Bauchgefühl, welches darauf beharrte, dass hier etwas grundlegend falsch sei, konnte Graham keine Abweichungen von der Normalität entdecken. Der Verkehr lief flüssig und ruhig5, die schwarzen Londoner Taxis schlängelten sich über die Fahrbahnen und zwischen den anderen Autos hindurch, Limousinen chauffierten wichtig aussehende Diplomaten von einer Botschaft zur anderen, gestresste Mütter kutschierten ihren Nachwuchs vom Schachclub zum Balletttraining. Und doch: Die Taxifahrer saßen still hinter ihren Lenkrädern und klärten ihre Fahrgäste nicht über die Welt, das Universum und den Rest auf, die Diplomaten-Limousinen ordneten sich in den Verkehr ein, die Diplomaten nahmen sich nicht wichtiger, als sie waren und die Kinder betrugen sich so mustergültig, als wollten sie gleich für eine Rolle in Unsere kleinen Farm vorsprechen. Sogar Geschwisterkinder, die von Geburt an natürliche Todfeinde sein müssten6, kamen mustergültig miteinander aus. Es gab keinen Streit, selbst wenn es nur ein Spielzeug auf der Rückbank des Mutterschiffs gab. Fußgänger schritten gesittet im Gleichtakt auf den Fußwegen, nicht einmal rempelte einer einen anderen an. Man ging sich höflich aus dem Weg. Zumindest sah es so aus, bis Graham genauer hinschaute. Das war kein höfliches Aus-Dem-Weg-Gehen. Die Menschen ignorierten sich gegenseitig vollständig. Graham entschied sich zu einem Experiment. Dem Nächsten, der ihm entgegenkam, schaute er direkt in die Augen und lächelte dabei. Die Reaktion folgte prompt: Der Mann sah aus, als hätte ihn der Schlag getroffen. Er keuchte, sah verwirrt zur Seite und geriet ins Straucheln. Er stolperte in einen Laternenpfahl hinein, ließ seine Aktentasche fallen, hob sie wieder auf und rannte, ohne einen Blick zurückzuwerfen, von Graham weg. Niemand nahm Notiz von diesem Vorfall. Stattdessen wichen die anderen Passanten Graham und seinem Opfer aus, taten, als wäre nichts Ungewöhnliches passiert und machten einen großen Bogen um beide. Danach gelang es Graham nicht mehr, weitere Blickkontakte herzustellen. Dafür tauchten zwei oder drei Uniformierte aus dem Nichts auf, die Gesichter in seine Richtung gewandt. Und obwohl er hinter den Sonnenbrillen ihre Augen nicht sehen konnte, war Graham sicher, dass sie ihn beobachteten.
Graham stoppte an einem Geldautomaten. Das schien eine unverdächtige Tätigkeit zu sein, denn die Polizisten kamen nicht auf ihn zugestürmt, um ihn zu verhaften. Graham versuchte, sie in der Reflexion des Bildschirms im Auge zu behalten, während er seine Karte in den Automaten schob. Der akzeptierte Karte und PIN und zeigte wenige Sekunden später 10.373 Pfund an – komfortabel, aber weit entfernt von den siebenundzwanzig Millionen, die Graham erwartet7 hatte. Womöglich hatte sein Parallel-Ich das Geld in Aktien angelegt – zu Hause würde er das Online-Depot checken. Der Automat spuckte widerspruchslos Grahams Geld aus und es kam kein Strauchdieb von hinten, um ihm die Kohle abzunehmen. Ja, man konnte sagen, dass mit diesem London etwas nicht stimmte.
Es gab keinen Marks & Spencer mehr. Das erschütterte Graham bis ins Mark8. Statt des alten Supermarkts mit dem vertrauten Logo, welchen er zwei- bis dreimal im Monat aufgesucht hatte – sein Einkaufsverhalten war auf minimalen Zeitaufwand hin optimiert – stand dort ein grauer Klotz mit dem Schriftzug Wales Green an der Seite. Den Namen hatte Graham noch nie gehört. Er erwägte, bis zur nächsten Filiale zu laufen, aber die war eine halbe Meile entfernt. Und es bestand keine Garantie, dass die nicht auch übernommen worden war. Außerdem gingen Kunden in den Wales-Green-Markt rein und kamen mit gefüllten Tüten wieder raus. Den Hauptaspekt eines Supermarkts erfüllte der Laden schon mal. Graham nahm sich einen Einkaufswagen und betrat den Laden.
Die Beschaffung von Lebensmitteln empfand Graham generell als lästige Pflicht. Es war billiger als jeden Tag im Pub zu essen und gesünder, als es bei McDonald's zu tun. Unter den Büchern in seiner Wohnung befand sich ein Exemplar mit dem Titel 100 leicht zu kochende Junggesellen-Gerichte in unter 10 Minuten, welches den vollen Umfang seiner kulinarischen Versorgung beschrieb. Die Rezepte kamen mit Einkaufslisten und einer idiotensicheren Anleitung, die unter anderen Umständen eine Beleidigung für Grahams Intellekt gewesen wäre. Er kochte jeden Tag eins der Gerichte und sobald er mit dem Buch durch war, begann er wieder von vorn – das ersparte langes Nachdenken darüber, was es geben sollte. Außerdem blieben die Einkaufslisten bereits nach dem ersten Durchlauf in seinem Kopf gespeichert, das minimierte den Zeitaufwand beim Einkauf. Seine Vorliebe für exakt diese Marks & Spencer-Filiale basierte darauf, dass die Anordnung der Waren sich nie veränderte und er seinen Einkauf im Automatikmodus erledigen konnte.
Hier begannen die Probleme. Wales Green hatte ein völlig anderes Konzept als das gute alte Marks & Spencer. Andere Waren, andere Anordnung, anderer Aufbau der Regale. Graham hatte drei Schritte in den Laden gemacht und verabscheute ihn schon. Die langen Stahlregale waren sparsam gefüllt, mit Waren des täglichen Bedarfs hinten und den Luxusgütern vorn. Die teuersten Waren standen in Augenhöhe, die günstigeren entweder im Bodenregal oder ganz oben; knapp außerhalb der Reichweite eines Kunden mit durchschnittlicher Körpergröße. Jemand hatte eindeutig ein schlechtes Buch über Kundenpsychologie gelesen und jeden Ratschlag darin umgesetzt – ohne sich um Ästhetik, Design und Feng Shui zu kümmern. Umsatzfördernde Supermarktmusik lief bis zum Anschlag aufgedreht und die Temperatur war nicht zu warm und nicht zu kalt eingestellt. Wenigstens verzichtete der Laden auf Werbedurchsagen und drängelte seinen Kunden nicht die tollsten Angebote der Woche auf, denn es gab keine Angebote. Die Waren in den Regalen hatten kleine Preisschilder, von denen keines sagte: Kauf eins, bekomme zwei! Und der Laden setzte auf Eigenmarken: Wales Green Kartoffeln, Wales Green Karotten, Wales Green Brot, Wales Green Müsli, Wales Green Mais, Wales Green Reis, Wales Green Lauch, Wales Green Brokkoli, Wales Green Spinat, Wales Green Hafermilch. Und was nicht grün war9, gab es nicht: kein Fleisch und kein Fisch. Wales Green musste eine dieser neumodischen veganen Supermarktketten sein. Eine Schande, wie weit es mit der kulinarischen Vielfalt bergab gegangen war. Graham würde sich einen neuen Laden suchen müssen. Es bestand natürlich die Gefahr10, dass die Regierung ein Fleischverbot erlassen hatte. Graham schüttelte sich, während er durch die Regalreihen lief.
Sein Kochbuch enthielt zwei oder drei vegetarische Gerichte11 und er fand alle Zutaten, die er brauchte – zu Preisen jenseits von Gut und Böse. Wenn er jeden Tag Kartoffeln oder Reis auf dem Tisch haben wollte, sollte besser sein Job bei Poor, Moore & Moody noch auf ihn warten. Ansonsten wären seine Ersparnisse schneller aufgebraucht als der Whiskyvorrat einer Schottenkneipe. Im Laden begegneten ihm weniger als eine Handvoll Kunden, die ebenfalls sorgsam darauf bedacht waren, jeglichen Augenkontakt zu vermeiden. Wie Wales Green mit derart wenig Kundschaft profitabel sein wollte, blieb Graham ein Rätsel. Wales Green musste sich mit Eigenmarken dumm und dämlich verdienen. Jedes – wirklich jedes – Produkt, ob billig oder Luxus, stammte von Wales Green. Das machte den Einkauf einfach. Es gab von jedem Produkt exakt eine Sorte in den Qualitätsstufen A (teuer, im Regal auf Augenhöhe), B (erschwinglich, einsortiert auf dem obersten Regalbrett und damit unerreichbar) und C (Resteverwertung, Regalbodenplatte). Wollte man Kartoffeln, nahm man Wales Green Kartoffeln. Keine festkochenden, keine mehligen, keine regionalen, keine ägyptischen: einfach Wales Green. Oder gar nichts. Das Gleiche galt für Reis, Mais, Karotten, Erbsen, Bohnen, Möhren, Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Wirsing, Äpfel, Birnen und ein paar Sachen, die Graham nicht identifizieren konnte. Sogar Chips und Bier stammten von Wales Green, rangierten aber in der Preisklasse von Kaviar und Hummer. Ein gemütlicher Abend mit Knabberzeug und Bier war da maximal einmal pro Monat drin. Kein Wunder, dass auf der Straße nur dürre Menschen herumliefen: Um jeden Tag satt ins Bett zu gehen, musste man Milliardär sein. In diesem Augenblick wusste Graham noch nicht, wie nah er der Wahrheit war.
Graham brauchte für seinen Einkauf weniger als zehn Minuten, der knappen Auswahl und seines knappen Budgets geschuldet. Es würde für eine Kartoffelsuppe ohne Fleischeinlage reichen. Vielleicht hätte er in einem anderen Laden mehr bekommen, aber das hieße, weiter zu laufen – diese Option kam nicht infrage. Als er sich der Kasse näherte, fiel ihm eine weitere Unregelmäßigkeit auf: Es fehlte die Schlange. Stattdessen stand ein Angestellter, den Graham noch nie vorher hier gesehen hatte12, hinter einem Tresen und wartete auf Kundschaft. Dabei stand er völlig unbeteiligt da und bemühte sich, mittels Körpersprache jeden Kunden davon abzuhalten, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Es gab vier Selbstbedienungskassen, die Graham ignorierte. Mit Selbstbedienungskassen konnte man keinen Small Talk machen und herausbekommen, was hier los war. Small Talk war zwar nicht Grahams Stärke, aber er musste es darauf ankommen lassen. Vielleicht würde er der Höhepunkt des Tages für den Kassierer werden. Oder vielleicht das Gegenteil; das ließ sich im Moment schwer sagen. Auf jeden Fall war Graham gespannt, ob sich eine emotionale Reaktion bei seinem Gegenüber erzeugen ließ.
Als sich Graham der bemannten Kasse näherte, flackerte Panik in den Augen des Angestellten auf. Um gleich darauf einem Ausdruck von Verärgerung zu weichen. Wenigstens das hatte sich nicht geändert. »Howdy!« grüßte Graham in einem breiten Akzent, von dem er hoffte, dass es als texanisch durchging. Graham hatte sich aus einer Intuition heraus entschieden, einen unbedarften Touristen zu spielen, in der Hoffnung, dass der sich dumme Fragen erlauben durfte. Der Blick, den er für diese Nummer kassierte, sagte ihm, dass sein Gegenüber ihn als menschliches Äquivalent einer Made ansah; egal woher er kam. Graham stellte den Korb mit den Lebensmitteln auf die Theke und wurde dafür angesehen, als hätte er sich soeben unsittlich entblößt.