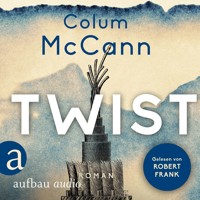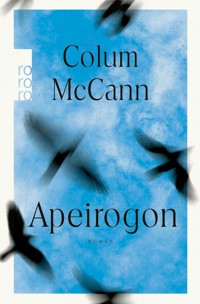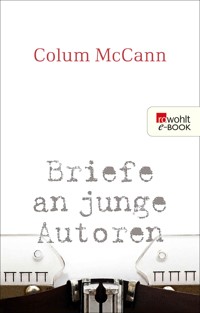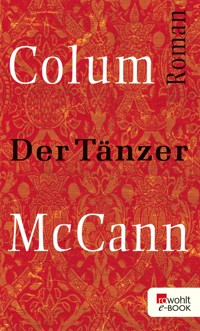
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rudolf Nurejew galt als einer der größten Tänzer aller Zeiten. McCann begibt sich in seinem Roman auf die Spuren eines Künstlerlebens, das rätselhaft bleibt. Aus der Sicht der Wegbegleiter des Genies erzählt, entsteht ein schillerndes Kaleidoskop, das von Ost und West, Partyleben und Künstlereinsamkeit, Genialität, Trieb und Tod erzählt. Ein Leben wie ein Roman – ein wilder Tanz. «Das Buch ist so schwerelos wie ein Grand jeté seines Helden.» (Der Spiegel) «McCann ist ein Geschichtenerzähler, wie wir wirklich nur wenige haben.» (Elke Heidenreich) «Der sowjetische Tänzer Nurejew (1938–1993) setzt sich gleich bei seiner ersten Tournee 1961 in Paris von seiner Truppe ab und bleibt im Westen. Von nun an ist der Tatare ein internationaler Superstar. Rasant erzählt der irische Schriftsteller Colum McCann von den glorreichen und tragischen Lebensstationen im wüsten Leben eines Jahrhundertgenies. Im doppelten Sinn des Wortes wird die Lektüre zu einem schwindelerregenden Erlebnis.» (Focus) «Man muss rein gar nichts von Ballett verstehen, um den fast überirdischen Zauber auch beim Lesen zu spüren. Was daran liegt, dass der Autor ebenfalls ein Genie ist.» (Brigitte)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Colum McCann
Der Tänzer
Roman
Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren
Dies ist ein Roman. Mit Ausnahme einiger Personen des öffentlichen Lebens, die ihre wirklichen Namen tragen, sind alle hier geschilderten Personen, Namen und Ereignisse frei erfunden.
Für Allison.
Für Riva Hocherman.
Und für Ben Kiely.
Mit tiefem Dank für eure Inspiration und euren Zuspruch.
Was wir, oder zumindest ich, überzeugt als Erinnerung ausgeben – womit wir einen Augenblick, eine Begebenheit, einen Sachverhalt meinen, die einem Fixierbad ausgesetzt und so vor dem Vergessen bewahrt wurden –, ist in Wirklichkeit eine Form des Geschichtenerzählens, die sich unaufhörlich in unserem Geist vollzieht und sich oft noch während des Erzählens verändert. Zu viele widerstreitende Gefühlsinteressen stehen auf dem Spiel, als dass das Leben jemals ganz und gar annehmbar sein könnte, und möglicherweise ist es das Werk des Geschichtenerzählers, die Dinge so umzuordnen, dass sie sich diesem Zweck fügen. Wie dem auch sei, wenn wir über die Vergangenheit reden, lügen wir mit jedem Atemzug.
WILLIAMMAXWELL:Also dann bis morgen
Paris 1961
Was in seiner ersten Saison in Paris auf die Bühne geworfen wurde:
zehn mit einem Gummiband umwickelte Hundertfrancscheine;
einPäckchenrussischerTee;
einManifestderFront de Libération National, einer Bewegung der algerischen Nationalisten, in dem gegen die Ausgangssperre für Muslime protestiert wurde, die nach der Explosion einiger Autobomben in Paris verhängt worden war;
Narzissen, die aus den Gärten des Louvre gestohlen worden waren, sodass die Gärtner Überstunden machen und die Beete bis sieben Uhr abends bewachen mussten, damit sie nicht weiter geplündert wurden;
weiße Lilien, an deren Stengel Centime-Münzen geklebt waren, sodass sie, derart beschwert, bis auf die Bühne flogen;
so viele andere Blumen, dass der Bühnenarbeiter Henri Long, der nach der Vorstellung die Bühne zu fegen hatte, aus ihnen Sträuße band, die er an den folgenden Abenden vor dem Bühneneingang an Verehrer verkaufte;
ein Nerzmantel, der am zwölften Abend durch die Luft flog, sodass die Zuschauer in den ersten Reihen einen Augenblick lang glaubten, über ihren Köpfen sei ein fliegendes Tier;
achtzehn Damenslips – ein Phänomen, das es in diesem Theater noch nie gegeben hatte; die meisten waren diskret mit Bändern umwickelt, doch mindestens zwei waren in aller Eile ausgezogen worden, und einen davon hob er nach dem letzten Vorhang auf und roch, zum Entzücken der Bühnenarbeiter, mit großer Gebärde daran;
ein Porträt des Kosmonauten Juri Gagarin mit der Unterschrift: Flieg, Rudi, flieg!;
einige mit Pfeffer gefüllte Papierbomben;
eine wertvolle Münze aus der Zarenzeit, die ein Emigrant hinaufwarf und die in ein Stück Papier gewickelt war, auf dem stand, dass er, wenn er sich seinen nüchternen Verstand bewahre, so gut sein werde wie Nijinski, wenn nicht besser;
Dutzende erotischer Polaroidfotos, auf deren Rückseite die Namen und Telefonnummern der Frauen standen;
Zettel, auf denen stand: Vous êtes un traître de la Révolution;
Glasscherben, geworfen von protestierenden Kommunisten; die Vorstellung musste für zwanzig Minuten unterbrochen werden, damit die Scherben entfernt werden konnten, und der Vorfall erregte solchen Unmut, dass die Pariser Sektion der Partei wegen des negativen Echos in der Öffentlichkeit eine Sondersitzung anberaumte;
Todesdrohungen;
Hotelschlüssel;
Liebesbriefe;
und am fünfzehnten Abend eine langstielige, vergoldete Rose.
Buch Eins
1
Sowjetunion 1941–56
Drei Winter. Mit Pferden bahnten sie Wege durch Schneeverwehungen, sie trieben sie voran, bis sie starben, und dann aßen sie sehr traurig das Pferdefleisch. Die Sanis stapften durch den Schnee und hatten die Morphiumampullen mit Pflastern unter ihren Achseln befestigt, damit das Morphium nicht gefror, und je länger der Krieg dauerte, desto schwerer fiel es ihnen, die Venen der verwundeten Soldaten zu finden – die Soldaten verfielen zusehends und starben schon lange bevor sie wirklich starben. In den Gräben banden sie die Ohrenklappen ihrer Uschinkis fest um den Kopf, stahlen die Mäntel von Gefallenen und schliefen dicht zusammengedrängt, die Verwundeten in der Mitte, wo sie am besten gewärmt wurden. Sie trugen gefütterte Hosen, mehrere Lagen Unterwäsche, und manchmal machten sie Witze darüber, dass sie am liebsten Huren um den Hals tragen würden wie Schals. Nach einer Weile zogen sie die Stiefel nicht mehr allzu oft aus. Sie hatten Soldaten gesehen, deren erfrorene Zehen plötzlich einfach abfielen, und begannen zu glauben, dass man die Zukunft eines Mannes an seinem Gang ablesen konnte.
Zur Tarnung nähten sie zwei weiße Bauernhemden aufeinander, sodass sie über die Mäntel passten, zogen mit Schnürsenkeln die Halsausschnitte wie Kapuzen um das Gesicht zusammen und konnten stundenlang unerkannt im Schnee liegen. Die Flüssigkeit in den Rückstoßdämpfern ihrer Geschütze gefror. Die Pufferfedern ihrer MGs zersprangen wie Glas. Wenn sie Metall mit nackten Fingern berührten, riss die Haut in Fetzen ab. Sie machten Holzkohlefeuer und legten Steine hinein, die sie später in die Taschen steckten, damit sie ihnen die Hände wärmten. Wenn sie scheißen mussten, was nicht oft vorkam, hielten sie es für das Beste, in die Hosen zu machen. Dort blieb die Scheiße, bis sie gefroren war. Wenn sie dann einen Unterstand gefunden hatten, brachen sie die Masse heraus, und nichts stank, noch nicht einmal ihre Handschuhe – bis Tauwetter einsetzte. Sie banden Beutel aus Öltuch unter ihren Hosen fest, damit sie ihre Schwänze beim Pinkeln nicht der Kälte aussetzen mussten, und sie lernten, die Wärme in den Pissbeuteln zwischen ihren Beinen zu genießen, und manchmal half ihnen das, an Frauen zu denken, bis die Pisse gefror und sie wieder im Nirgendwo waren, auf einer weiten, von der Flamme über dem Schornstein einer Ölraffinerie beleuchteten Schneefläche.
Sie blickten über die Steppe und sahen die Leichen anderer Soldaten, erfroren, eine Hand in die Luft gereckt, ein Knie durchgedrückt, die Bärte weiß vom Frost, und sie lernten, den Toten die Kleider auszuziehen, bevor sie darin in Leichenstarre verfielen, und dann beugten sie sich hinunter und flüsterten: Tut mir Leid, Kamerad, und danke für den Tabak.
Sie hörten, dass der Feind aus Mangel an Bäumen Leichen auf die Wege legte, und versuchten, nicht hinzuhören, wenn Geräusche über die Eisfläche hallten – Reifen, die über Knochen knirschten und weiterrollten. Nie herrschte Stille, denn die Luft trug alle Geräusche weit: das Zischen der Skier, auf denen die Spähtrupps unterwegs waren, das Summen der Hochspannungsleitungen, das Pfeifen der Granaten, ein Kamerad, der nach seinen Beinen, seinen Fingern, seinem Gewehr, seiner Mutter schrie. Morgens wärmten sie ihre Gewehre mit einer halben Ladung, damit ihnen der Lauf nicht bei der ersten Salve um die Ohren flog. Sie wickelten Kuhhaut um die Griffe der Flugabwehrkanonen und deckten die Kühlschlitze der MGs mit alten Hemden ab, um den Schnee am Eindringen zu hindern. Die Soldaten auf Skiern lernten, im Hocken zu gleiten, sodass sie ihre Handgranaten seitlich werfen und im Vorstoßen kämpfen konnten. Sie fanden einen zerstörten T-34, einen Verwundetentransporter oder sogar einen feindlichen Panzer, ließen die Kühlflüssigkeit durch den Aktivkohlefilter ihrer Gasmasken laufen und betranken sich damit. Manchmal tranken sie so viel Kühlflüssigkeit, dass sie nach ein paar Tagen blind waren. Sie strichen die Geschütze mit Sonnenblumenöl ein – nicht zu viel auf den Schlagbolzen, gerade die richtige Menge auf die Federn –, und mit dem überschüssigen Öl rieben sie ihre Stiefel ein, damit das Leder nicht brach und Kälte und Nässe hereinließ. Sie sahen in den Munitionskisten nach, ob ein Fabrikmädchen in Kiew, Ufa oder Wladiwostok ein Herz für sie hineingemalt hatte, und selbst wenn nicht, war es, als hätte sie es getan, und dann schoben sie die Magazine in ihre Katjuschas, ihre Maxims, ihre Degtjarows.
Wenn sie vorstießen oder sich zurückzogen, sprengten sie mit 100-Gramm-Ladungen Schützenlöcher in die Erde, um ihr Leben zu retten, sofern ihr Leben etwas war, das sie retten wollten. Sie teilten sich Zigaretten, und wenn sie keinen Tabak mehr hatten, rauchten sie Sägemehl, Teeblätter oder Kohl, und wenn es nichts anderes gab, rauchten sie Pferdescheiße, doch die Pferde litten solchen Hunger, dass sie kaum noch schissen. In den Bunkern hörten sie Radio: Schukow, Jeremenko, Wassilewski, Chruschtschow, auch Stalin, dessen Stimme nach Schwarzbrot und gesüßtem Tee klang. In den Gräben wurden Lautsprecherkabel verlegt, man brachte Verstärker an die Front und richtete die Lautsprecher nach Westen, damit man die Deutschen mit Tangos, Radiosendungen und Sozialismus wach halten konnte. Man erzählte ihnen von Verrätern, Deserteuren, Feiglingen und schärfte ihnen ein, sie zu erschießen. Die roten Orden, die diese Toten an der Brust trugen, nahmen sie ihnen ab und befestigten sie an den Innenseiten ihrer Kittelhemden. Zur Tarnung bei Nacht beklebten sie die Scheinwerfer der Wagen, Verwundetentransporter und Panzer mit Abdeckband. Sie stahlen es auch und wickelten es um Hände, Füße und ihre Fußlappen, und manche wickelten es sogar um die Ohren, doch das Band riss ihnen die Haut auf, und sie schrien, wenn die Erfrierungen kamen, und dann noch mehr, wenn die Schmerzen einsetzten, und einige hielten sich die Pistole an den Kopf und sagten Adieu.
Sie schrieben an Galina, Jalena, Nadia, Tania, Natalia, Dascha, Pawlena, Olga, Sweta und Walia – sorgsam geschriebene Briefe, die zu ordentlichen Dreiecken gefaltet waren. Sie erwarteten keine lange Antwort, vielleicht nur eine Seite, deren Parfümduft an den Fingern des Zensors blieb. Die Briefe an die Front bekamen Nummern, und wenn eine Nummernserie fehlte, wussten die Männer, dass es einen Posttransport erwischt hatte. Die Soldaten saßen in den Gräben, starrten ins Leere und schrieben in Gedanken Briefe an sich selbst, und dann waren sie mit einem Mal wieder mitten im Krieg. Granatsplitter trafen sie unter dem Auge. Gewehrkugeln durchschlugen ihre Wadenmuskeln. Bombensplitter fuhren in ihren Hals. Mörsergranaten brachen ihnen das Rückgrat. Phosphorbomben setzten sie in Brand. Die Toten wurden auf Pferdewagen geladen und in mit Dynamit ausgehobenen Massengräbern beerdigt. Frauen aus der Umgebung kamen mit umgebundenen Kopftüchern zu den Gruben, um die Gefallenen zu betrauern und heimlich zu beten. Die Totengräber, die man aus den Gulags geholt hatte, blieben abseits stehen und ließen den Frauen ihre Rituale. Auf die Toten wurden noch mehr Tote gehäuft. Gefrorene Knochen waren schwer zu brechen, und so lagen die Leichen schrecklich verkrümmt da. Die Totengräber schaufelten Erde darüber, und manchmal stürzten sie sich in ihrer Verzweiflung selbst in die Grube, und noch mehr Erde wurde darüber geschaufelt, sodass es nachher hieß, man könne dort ein leises Beben spüren. Oft kamen abends die Wölfe aus dem Wald und trabten hochbeinig durch den Schnee.
Die Verwundeten wurden auf Wagen, Pferde oder Schlitten geladen. In den Feldlazaretten waren sie mit einer ganz neuen Sprache konfrontiert: Dysenterie, Typhus, Kongelation, Grabenfuß, Ischämie, Pneumonie, Zyanose, Thrombose, Herzschmerzen – und wenn sie von diesen Krankheiten genesen waren, schickte man sie wieder an die Front.
Auf dem Land suchten die Soldaten nach kürzlich abgebrannten Dörfern, denn dort war die Erde weich, sodass man sie aufgraben konnte. Der Schnee gab Geschichten preis: hier eine Blutlache, dort einen Pferdeknochen, das Gerippe eines PO-2-Sturzkampfbombers, die Leiche eines Pioniers, den sie in der Spasskajastraße gekannt hatten. In Charkow versteckten sie sich in Trümmern und Ruinen, in Smolensk tarnten sie sich unter Ziegelsteinhaufen. Sie sahen Eisschollen auf der Wolga und entzündeten Öllachen auf dem Eis, sodass es aussah, als stehe der Fluss in Flammen. Bei den Fischerdörfern am Asowschen Meer fischten sie nach abgestürzten Piloten, die dreihundert Meter über das Eis geschlittert waren. An den Stadträndern standen ausgebrannte Häuser, und darin lagen noch mehr Tote im blutverschmierten Chaos. Sie fanden ihre Kameraden an Straßenlaternen aufgehängt – groteske Dekorationen, die Zungen von der Kälte geschwärzt. Wenn sie sie abnahmen, richteten die Laternen sich ächzend auf, und der Lichtkegel sprang ein Stück weiter. Sie versuchten, Deutsche gefangen zu nehmen, um sie den Männern vom NKWD zu übergeben, die ihnen Löcher in die Zähne bohrten, sie im Schnee an einen Pfahl banden oder sie in einem Lager hungern ließen wie die Deutschen ihre eigenen Gefangenen. Manchmal behielten sie einen, drückten ihm einen Spaten in die Hand, sahen zu, wie er sich mühte, in der steinhart gefrorenen Erde sein Grab auszuheben, schossen ihm, wenn er es nicht schaffte, von hinten in den Kopf und ließen ihn liegen. In ausgebrannten Häusern fanden sie feindliche Verwundete, die sie einfach aus den Fenstern warfen, sodass sie bis zum Hals im Schnee lagen, und dabei riefen sie: Auf Wiedersehen, Fritz, aber manchmal hatten sie auch Mitleid mit dem Feind – die Art Mitleid, die nur ein Soldat haben kann –, wenn sie seine Brieftasche durchsuchten und feststellten, dass der Tote einen Vater, eine Frau, eine Mutter und vielleicht auch Kinder gehabt hatte.
Sie sangen Lieder für ihre eigenen fernen Kinder, doch wenige Augenblicke später stießen sie einem deutschen Jungen den Gewehrkolben in den Mund, und noch später sangen sie andere Lieder: Warum umkreist du mich, du schwarzer Rabe?
Sie erkannten die Manöver der Flugzeuge – die halbe Rolle, die Kerze, den Turn, den Immelmann-Turn –, das Aufblitzen des Hakenkreuzes, das Schimmern des roten Sterns, und sie jubelten, wenn ihre Pilotinnen die Maschinen der Luftwaffe jagten, sahen zu, wie diese Frauen aufstiegen und brennend abstürzten. Sie brachten Hunden bei, Sprengladungen zu tragen, und gaben ihnen mit schrillen Pfeifsignalen den Befehl, unter feindliche Panzer zu kriechen. Krähen inspizierten die Schlachtfelder, mästeten sich an den Toten und wurden dann selbst geschossen und gegessen. Die natürliche Ordnung wurde auf den Kopf gestellt: Der Morgen war verdunkelt vom Staub, den die Bombenexplosionen aufwirbelten, und in der Nacht leuchteten die Feuer meilenweit. Die Tage hatten keine Namen mehr; nur sonntags konnte man manchmal über die weite Eisfläche hinweg hören, wie die Deutschen ihren Gott verehrten. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten gestattete man ihnen ihren eigenen Gott: Sie zogen mit Kruzifixen, Rosenkränzen und Gebetsmänteln in die Schlacht. Jedes Symbol war recht, sei es nun Gott, Pawlik Morosow oder Lenin. Die Soldaten sahen zu ihrer Überraschung, dass orthodoxe Priester und sogar Rabbis ihre Panzer segneten, doch nicht einmal mit diesem Segen vermochten sie dem Feind standzuhalten.
Damit dem nichts in die Hände fiel, sprengten sie auf dem Rückzug Brücken, die ihre Brüder gebaut hatten, zerstörten die Gerbereien ihrer Väter, brachten mit Schneidbrennern Hochspannungsmasten zu Fall, trieben Rinderherden in Abgründe, machten Molkereien dem Erdboden gleich, gossen Benzin in Silos, fällten Telegrafenmasten, vergifteten Brunnen, legten Zäune um und rissen ihre eigenen Scheunen ab, um das Holz zu verfeuern.
Und als sie dann wieder vorrückten – im dritten Winter, als das Kriegsglück sich wendete –, fragten sie sich, wie irgendjemand ihrem Land so etwas hatte antun können.
Die Lebenden marschierten nach Westen, die Verwundeten fuhren nach Osten, in von Dampfloks langsam über die gefrorene Steppe gezogenen Viehwaggons. Sie drängten sich aneinander, die Gesichter dem Licht zugewandt, das durch die Ritzen drang. In der Mitte eines jeden Waggons stand ein eiserner Eimer, in dem ein Feuer brannte. Die Männer zogen Läuse aus Achsel- und Schamhaaren und warfen sie in die Flammen. Sie drückten Brot auf ihre Wunden, um die Blutung zu stillen. Einige wurden aus den Waggons geholt und in Krankenhäuser oder Schulen gekarrt. Dorfbewohner kamen mit Geschenken. Die Männer, die im Zug bleiben mussten, hörten, wie ihre Kameraden weggebracht wurden, begleitet von Wodka und Siegeszuversicht. Und dennoch unterlag ihre Reise keiner Logik: Manchmal fuhr der Zug ohne anzuhalten durch ihre Heimatstadt; diejenigen, die ihre Beine noch gebrauchen konnten, versuchten, die Bretter der Wände herauszutreten, und wurden wegen Insubordination von den Wachen erschossen, und später, in der Nacht, stapfte dann eine Familie mit Kerzen durch den Schnee, denn es hatte geheißen, ihr Sohn liege tot, entehrt und steif gefroren neben der Bahnlinie, nur wenige Kilometer von seinem Zuhause entfernt.
In ihren blutverkrusteten Mänteln lagen sie wach, und die Waggons schaukelten hin und her. Sie ließen die letzte Zigarette herumgehen und warteten darauf, dass eine Frau oder ein Kind ein neues Päckchen durch die Ritzen steckte oder ihnen vielleicht sogar ein freundliches Wort zuflüsterte. Man gab ihnen Essen und Wasser, doch das brannte in ihren Gedärmen und machte sie nur noch kränker. Es gab Gerüchte über neue Gulags im Westen und Süden, und sie sagten sich, dass ihre Götter sie bisher geliebt hatten, aber vielleicht nicht mehr viel länger, und so ließen sie ihre Amulette und Glücksbringer heimlich zwischen den Bodenbrettern hindurch auf das Schotterbett der Gleise fallen, wo eines Tages andere sie finden würden. Sie zogen die Decken bis zu den Bärten hoch und warfen noch mehr Läuse ins Feuer. Und noch immer spien die Lokomotiven Dampf in die Luft und zogen sie durch Wälder, über Brücken und Berge; die Männer hatten keine Ahnung, wo sie landen würden, und wenn eine Lokomotive den Dienst versagte, warteten sie, bis eine andere kam und sie weiterschob, nach Perm, Bulgakowo, Tscheljabinsk, wo man in der Ferne den Ural aufragen sehen konnte.
Und so dampfte im Spätwinter des Jahres 1944 täglich ein Zug durch Baschkirien, ließ den dichten Wald entlang des Belaja hinter sich, durchquerte die weite, schnee- und eisbedeckte Ebene und fuhr in die Stadt Ufa ein. Die Züge krochen über die zweihundertfünfzig Meter lange Stahlgitterbrücke; unter der Last gaben die Träger ein dumpfes Pochen und hohe, klingelnde Geräusche von sich, als trauerten sie schon im Voraus. Die Züge erreichten das andere Ufer des zugefrorenen Flusses und fuhren vorbei an den Holzhäusern, den Wohnblöcken, den Fabriken, den Moscheen, den ungepflasterten Straßen, den Lagerhäusern und Betonbunkern, bis sie schließlich den Bahnhof erreichten, wo der Stationsvorsteher in seine Trillerpfeife blies und die Blaskapelle auf verbeulten Instrumenten spielte. Muslimische Mütter warteten auf dem erhöhten Bahnsteig und umklammerten Fotos. Alte Tataren stellten sich auf die Zehenspitzen und hielten Ausschau nach ihren Söhnen. Babuschkas kauerten hinter Eimern voller Sonnenblumenkerne. Händler standen in ihren Kiosken und ordneten feierlich aufs Neue die Leere ihrer Auslage. Krankenschwestern mit harten Gesichtern und braunen Uniformen machten sich bereit, die Verwundeten abzutransportieren. Unter den roten Metallschildern, die in der Brise hin und her schaukelten und auf denen die Elektrifizierung der ländlichen Räume gefeiert wurde – Unser großer Führer und Lehrer bringt euch die Elektrizität! –, lehnten müde Milizionäre an Säulen, und ein stechender Geruch nach Schweiß und Fäulnis lag in der Luft und ging den Verwundeten voraus. Und jeden Winternachmittag saß ein magerer, hungriger, gewitzter Sechsjähriger auf der Klippe über dem Fluss, sah auf die Züge hinab und fragte sich, wann sein Vater nach Hause kommen würde und ob er dann ebenso gebrochen wäre wie die Männer, die man unter den Dampfwolken zu den Klängen der Blasmusik aus den Viehwaggons hob.
Zuerst säuberten wir das riesige Gewächshaus. Nurija schenkte die Tomatenpflanzen einem Bauernjungen, der immer in der Nähe des Krankenhauses herumlungerte. Katja, Marfuga, Olga und ich schaufelten den größten Teil der Erde hinaus. Ich war die Älteste und musste nicht so schwer arbeiten. Bald war das Gewächshaus ausgeräumt – eine Fläche so groß wie zwei Häuser. Wir schleiften acht Holzöfen hinein, stellten sie an den Wänden auf und machten Feuer. Nach einer Weile roch es im Gewächshaus nicht mehr so stark nach Tomaten.
Als Nächstes kamen die großen Stahlplatten an die Reihe. Nurijas Cousine Miljauscha war Schweißerin in der Ölraffinerie, und man hatte ihr erlaubt, fünfzehn Platten mitzunehmen. Sie lieh sich einen Traktor, hängte die Platten daran und zog sie durch die Krankenhauseinfahrt und den schmalen Weg entlang zum Gewächshaus. Die Platten waren zu groß für die Tür, und so mussten wir die hinteren Fenster ausbauen, um sie hineinschieben zu können. Der Bauernjunge half uns dabei. Er hielt den Kopf immer gesenkt – vielleicht war es ihm peinlich, dass wir Frauen so hart arbeiteten, aber uns machte das nichts aus, es war ja unsere Pflicht.
Miljauscha war eine hervorragende Schweißerin. Sie hatte es kurz vor dem Krieg gelernt. Sie trug eine Spezialbrille, und die blaue Flamme ließ die Gläser aufleuchten. Nach zwei Tagen war es fertig: ein riesiges Bad aus Stahlplatten.
Doch wir hatten nicht bedacht, wie wir das Wasser erwärmen sollten.
Wir versuchten es, indem wir es auf den Holzöfen zum Kochen brachten, aber obwohl die Luft im Gewächshaus warm war, weil die Sonne darauf schien, kühlte das Wasser zu schnell ab. Das Bad war einfach zu groß. Stumm und wütend standen wir herum, doch dann hatte Nurija eine andere Idee. Sie fragte ihre Cousine Miljauscha, ob sie um etwa ein Dutzend weiterer Stahlplatten bitten könne, und schon am nächsten Morgen kam sie mit dem Traktor von der Raffinerie und hatte fünf Platten im Schlepp! Nurija erklärte uns ihren Plan. Er war ganz einfach. Miljauscha machte sich gleich an die Arbeit und schweißte die Platten kreuz und quer in das riesige Bad, bis das Ganze aussah wie ein Schachbrett aus Stahl. Sie bohrte ein Loch in den Boden eines jeden Abteils, und Nurija lieh sich von ihrem Schwager einen alten Automotor, an den sie eine Pumpe anschloss, mit der man das Wasser entfernen konnte. Es funktionierte perfekt. Wir jubelten. Jetzt hatten wir sechzehn Wannen, und weil sie klein waren, wussten wir, dass das Wasser warm bleiben würde. Auf die Ränder legten wir Planken, sodass wir von einer Wanne zur anderen gehen konnten, und schließlich hängten wir über die Tür ein Porträt unseres großen Führers und Lehrers.
Wir entzündeten Feuer in den Öfen, erhitzten das Wasser und füllten die Wannen. Als das Wasser warm blieb, lächelten alle, und dann zogen wir uns aus, setzten uns in die Wannen und tranken Tee. Die Scheiben des Gewächshauses waren beschlagen, und uns war so mollig wie in einem Suppentopf.
Schön, sagte Nurija.
Am Abend gingen wir ins Krankenhaus und sagten den Schwestern, wir könnten am nächsten Tag anfangen. Sie sahen erschöpft aus und hatten dunkle Ringe unter den Augen. Von drinnen hörten wir das Stöhnen der Soldaten. Es müssen Hunderte gewesen sein.
Nurija nahm mich beiseite und sagte: Wir fangen sofort an.
Am ersten Abend badeten wir nur acht, aber am nächsten Tag waren es sechzig, und gegen Ende der ersten Woche kamen sie in ihren blutigen Lumpen und Verbänden direkt vom Bahnhof zu uns. Es waren so viele, dass sie auf langen Segeltuchplanen vor dem Gewächshaus Schlange stehen mussten. Manchmal war die Plane ganz steif von Blut und musste mit dem Schlauch abgespritzt werden, aber sie waren geduldig, diese Männer.
Katja legte denen, die draußen warten mussten, Decken um. Manche freuten sich, aber andere weinten natürlich, und viele saßen einfach da und starrten vor sich hin. Die Parasiten krochen auf ihnen herum, und die Fäule hatte bereits eingesetzt. Aber das Schlimmste waren ihre Augen.
Drinnen schor Nurija ihnen den Kopf. Sie war schnell mit der Schere, und der Großteil der Haare war in Sekunden ab. Ohne sie sahen die Männer so anders aus – manche wie Jungen, manche wie Verbrecher. Den Rest rasierte sie mit einem Rasiermesser ab. Danach kehrte sie die Haare rasch zusammen, denn die Läuse krochen darin herum. Das Haar wurde in Eimer geschaufelt, die an der Tür abgestellt wurden, wo sie der Bauernjunge abholte.
Die Soldaten genierten sich so sehr, dass sie sich nicht vor uns ausziehen wollten. In unserer Brigade arbeiteten keine jungen Frauen – die meisten von uns waren dreißig oder älter. Ich war siebenundvierzig. Und Nurija sagte ihnen, sie sollten sich keine Gedanken machen, wir seien alle verheiratet – und das stimmte auch. Nur ich war nie verheiratet gewesen, warum auch?
Trotzdem wollten sie sich nicht ausziehen, bis Nurija brüllte: Nun macht schon! Ihr habt nichts, was wir nicht schon mal gesehen haben!
Schließlich legten sie die Uniformen ab, nur die auf den Tragbahren nicht. Für sie nahmen wir Nurijas Schere. Es gefiel ihnen nicht, wenn wir ihre Hemden und Unterhemden aufschnitten. Vielleicht dachten sie, wir würden ihnen versehentlich die Kehle durchschneiden.
Die Soldaten standen da und hielten sich die Hände vor das Geschlecht. Die Ärmsten waren allesamt so mager, dass sogar Katja sich dick vorkam.
Die verschlissenen Uniformen verheizten wir in den Öfen. Allerdings nahmen wir vorher die Orden ab und legten sie zu kleinen Bündeln zusammen, bis die Männer gebadet hatten. Alle hatten natürlich Fotos und Briefe in den Taschen, aber es kamen auch einige seltsame Dinge zum Vorschein: die Tülle einer Teekanne, Haarlocken, Goldzähne, und einer trug sogar einen gekrümmten, verschrumpelten kleinen Finger mit sich herum. Manchmal waren auch unanständige Bilder dabei, die wir eigentlich nicht sehen sollten, aber Nurija sagte, die Männer hätten für unser großes Vaterland viel durchgemacht, es stehe uns nicht zu, über sie zu urteilen.
Olga sprühte die Wartenden mit einer Chemikalie ein, die in Kisten den ganzen Weg von Kiew gekommen war. Wir vermischten sie mit Wasser und füllten sie in Düngemitteltanks – das Zeug roch nach faulen Eiern. Wir mussten die Gesichter der Soldaten abdecken, hatten aber nicht immer genug Verbandsstoff, und manchmal kam etwas davon in ihre offenen Wunden. Dann schrien die Männer, und sie taten mir so Leid. Danach stützten sie sich auf uns und weinten und weinten. Wir wuschen die Wunden mit Schwämmen aus, so gut es ging. Sie gruben die Finger in unsere Schultern und ballten die Fäuste. Ihre Hände waren so schwarz und knochig.
Nachdem die Wunden gesäubert waren, stiegen die Männer in die Wannen. Wenn einer seine Beine verloren hatte, mussten wir ihn zu viert hinunterlassen und aufpassen, dass er nicht ertrank. Die Armamputierten lehnten wir an die Stahlwand der Wanne, und dann blieb eine von uns bei ihnen, um sie zu stützen.
Wir wollten ihnen nicht zu viel zumuten und sorgten dafür, dass das Wasser anfangs nur lauwarm war. Wenn die Männer in den Wannen saßen, gossen wir kochendes Wasser aus den Kesseln nach und gaben dabei Acht, dass wir sie nicht bespritzten. Sie riefen Aah! und Ooh!, und ihr Lachen war so ansteckend – jeder, der damit anfing, brachte uns wieder zum Lachen, ganz gleich, wie oft am Tag.
Das Gewächshaus hatte die Eigenart, alle Geräusche zu verstärken. Es war nicht direkt ein Hall, aber es schien, als würde das Gelächter von Glas zu Glas und schließlich zu uns, die wir uns über die Wannen beugten, zurückgeworfen.
Olga und ich waren die mit den Schwämmen. Anfangs nahmen wir keine Seife – das sparten wir uns für den Schluss auf. Ich fuhr ihnen mit dem Schwamm über das Gesicht – was für Augen sie hatten! –, und dann rieb ich ganz vorsichtig Kinn, Augenbrauen, Stirn und die Stelle hinter den Ohren ab. Den Rücken, der immer schmutzig war, wusch ich besonders gründlich. Man konnte die Rippen und die Biegung des Rückgrats sehen. Ich arbeitete mich zu ihren Hintern vor und tupfte sie mit dem Schwamm ab, aber nicht so sehr, dass es ihnen unangenehm wurde. Manchmal nannten sie mich Mama oder Schwester, und dann beugte ich mich vor und sagte: Schon gut, schon gut …
Doch meist starrten sie nur wortlos geradeaus. Ich nahm mir wieder ihr Genick vor, diesmal allerdings viel sanfter, und spürte, wie sie sich entspannten.
Die Vorderseite des Körpers war schwieriger. Oft war die Brust von Granatsplittern schlimm zugerichtet. Manchmal, wenn meine Hände auf ihrem Bauch waren, krümmten sie sich ganz schnell zusammen, weil sie dachten, ich würde sie da unten berühren, doch für gewöhnlich ließ ich sie das selbst tun. Ich war ja nicht dumm.
Aber Soldaten, die schwer verletzt oder apathisch waren, musste ich dort waschen. Meistens schlossen sie dann die Augen, weil es ihnen peinlich war, doch ein- oder zweimal geschah es, dass einer erregt wurde, und dann ließ ich ihn für fünf Minuten allein.
Olga tat das allerdings nicht. Wenn ein Soldat erregt war, zog sie seinem Ding eins mit dem Löffel über, den sie in der Schürzentasche hatte, und dann war der Fall erledigt. Wir anderen lachten nur.
Ich weiß nicht, warum, aber die Beine waren immer am schlimmsten – vielleicht lag es daran, dass sie die ganze Zeit in Stiefeln gesteckt hatten. Die Füße waren voller offener Wunden oder Schorf. Meist konnten die Männer kaum laufen. Sie sprachen viel über ihre Beine und erzählten, dass sie früher Fußball oder Eishockey gespielt hätten oder wie gute Langstreckenläufer sie gewesen seien. Wenn der Soldat noch fast ein Junge war, ließ ich ihn den Kopf an meine Brust legen, damit er sich seiner Tränen nicht schämen musste. Doch wenn er schon älter war und etwas Ordinäres sagte, war ich sehr viel schneller mit ihm fertig. Manche machten gemeine Bemerkungen über die schlaffe Haut meiner Arme. Die bekamen dann zur Strafe keine Seife.
Zum Schluss wuschen wir ihnen die Köpfe, und manchmal, wenn sie nett waren, rieben wir ihnen noch einmal über die Schultern.
Das Ganze dauerte nicht länger als fünf Minuten. Danach mussten wir jedes Mal das Wasser ablassen und die Wanne desinfizieren. Mittels der Schläuche, die wir an den alten Automotor angeschlossen hatten, konnten wir das Wasser schnell abpumpen. Im Sommer starb das Gras ab, wo das Wasser landete, und im Winter färbte das Blut darin den Schnee bräunlich.
Schließlich wickelten wir die Soldaten in Decken und zogen ihnen neue Fußlappen, Krankenhaushemden, Pyjamas und sogar Mützen an. Es gab keinen Spiegel, doch manchmal wischten die Männer die beschlagenen Gewächshausfenster ab und versuchten, sich darin zu betrachten.
Wenn alle angekleidet waren, wurden sie auf Pferdewagen zum Krankenhaus gefahren.
Die Männer, die vor dem Gewächshaus warteten, sahen ihre gewaschenen Kameraden davonfahren. Was für Gesichter sie machten! Ihre Augen leuchteten, als wären sie in einer Filmvorführung! Manchmal kamen Kinder, die sich hinter den Pappeln versteckten und zusahen. Man kam sich vor wie auf einem Volksfest.
Wenn ich abends nach Hause in die Aksakowstraße kam, war ich immer ganz erschöpft. Ich aß etwas Brot, drehte die Öllampe neben meinem Bett aus und schlief sofort ein. Die Leute im Zimmer nebenan waren ein altes Ehepaar aus Leningrad. Sie war Tänzerin gewesen, und er stammte aus einer reichen Familie. Sie waren Verbannte, darum hatte ich keinen Kontakt mit ihnen. Eines Nachmittags aber klopfte die Frau an meine Tür und sagte, die freiwilligen Helfer machten unserem Land Ehre, kein Wunder, dass wir den Krieg gewinnen würden. Dann fragte sie mich, ob sie ebenfalls helfen könne. Ich sagte, nein danke, wir hätten mehr als genug Helfer. Das stimmte nicht, und ich merkte, wie peinlich es ihr war, aber was sollte ich tun? Sie war ja nicht erwünscht. Sie ging wieder fort, aber am nächsten Tag fand ich vor meiner Tür vier Laibe Brot: Bitte geben Sie das den Soldaten. Ich verfütterte es an die Vögel im Leninpark. Ich wollte mich durch den Kontakt zu diesen Menschen nicht beschmutzen.
Als Anfang November die Feiern zum Gedenken an die Revolution stattfanden, hatten wir nur noch ein paar Dutzend Soldaten pro Tag zu baden, Nachzügler von der Front.
An den Nachmittagen ging ich nun ins Krankenhaus. Die Säle waren voll belegt, die Betten waren zu fünft übereinander gestapelt und wie Regale an die blutbespritzten, schmutzigen Wände geschraubt. Das einzige Gute waren die Kinder, die hin und wieder ins Krankenhaus gebracht wurden, um etwas vorzuführen, und die Musik, die aus den Lautsprechern kam: Eine der Schwestern hatte Kabel verlegt, sodass man die Schallplatten, die unten am Empfang gespielt wurden, im ganzen Krankenhaus hören konnte – lauter wunderschöne Siegeslieder. Trotzdem stöhnten die Männer und riefen nach ihren Liebsten. Ein paar von ihnen freuten sich, mich zu sehen, aber viele erkannten mich zunächst nicht. Als ich sie erinnerte, lächelten sie, und einer oder zwei waren keck genug, mir Kusshände zuzuwerfen.
Unter all den Soldaten gab es einen Jungen, an den ich mich sehr gut erinnere: Nurmahammed aus Tscheljabinsk, dem eine Mine den Fuß abgerissen hatte. Nurmahammed war ein Tatar wie viele andere, hatte schwarzes Haar, hohe Backenknochen und große Augen, und er humpelte auf Krücken, die aus Ästen gemacht waren. Wir sprühten ihn mit dem Mittel gegen Ungeziefer ein, und ich nahm den Verband an seinem Stumpf ab. Er hatte viele Parasiten, und so bat ich Nurija, sich gut um ihn zu kümmern. Sie säuberte seine Wunde, während ich das Bad bereitete. Ich prüfte die Temperatur mit dem Handgelenk, und dann halfen wir ihm zu dritt in die Wanne. Er schwieg die ganze Zeit. Ich wusch ihn, und als ich fertig war, sagte er: Danke.
Als er sauber war und einen Krankenhauspyjama trug, sah er mich mit einem seltsamen Blick an und begann, mir vom Gemüsegarten seiner Mutter zu erzählen: dass sie ihn mit Hühnermist düngte, damit die Karotten besser wuchsen, und dass es die besten Karotten seien, die man sich nur vorstellen könne, und dass er sich nach diesen Karotten mehr sehne als nach irgendetwas anderem.
In meiner Brotdose hatte ich noch etwas Martsowka. Nurmahammed beugte sich darüber, sah mich lächelnd an und hörte nicht auf zu lächeln, während er aß. Dabei hob er hin und wieder den Kopf, als wollte er sich vergewissern, dass ich noch da war.
Ich beschloss, mit Nurmahammed zum Krankenhaus zu fahren. Wir setzten uns auf die Ladefläche eines Wagens, und die Pferde trotteten los.
Wegen der Feiern war an jenem Tag viel Betrieb – ein zusätzlicher Lastwagen mit Lebensmitteln stand vor der Küche des Krankenhauses, aus den Fenstern hingen rote Fahnen, zwei Kommissare waren eingetroffen, die den Soldaten Orden an die Brust heften sollten, auf der Treppe saß ein Mann und spielte Balalaika, und Kinder liefen in baschkirischen Trachten herum.
Aus den Lautsprechern kam das Lied vom Vaterland, und alle standen auf und sangen mit.
Ich drückte Nurmahammeds Hand und sagte: Siehst du? Alles wird gut.
Ja, sagte er.
Im Krankenhaus wurden die Männer gewöhnlich in Schubkarren herumgefahren, doch zu unserer freudigen Überraschung gab es an diesem Tag einen Rollstuhl für Nurmahammed. Ich half ihm bei dem Papierkram und schob ihn dann durch den Korridor zu seiner Station. Dort war es laut – die Männer lärmten in einer gewaltigen Wolke aus Tabakrauch. Ein paar Soldaten hatten einen großen Bottich Methylalkohol aufgetrieben; sie füllten Becher und reichten sie von Bett zu Bett.
Alle trugen Verbände – einige waren von Kopf bis Fuß darin eingewickelt –, und an den Wänden hinter den Betten stand alles Mögliche geschrieben: die Namen von Liebsten und Fußballmannschaften und sogar einige Gedichte.
Ich schob Nurmahammed zum Saal D368, der in der Mitte der Station lag. Sein Bett war das zweite von unten in einem Fünf-Betten-Turm. Er versuchte, mit seinem gesunden Bein auf das unterste Bett zu steigen, hatte aber nicht genug Kraft. Ich schob ihn von hinten, aber dennoch schaffte er es nicht bis in sein Bett. Einige Männer kamen hinzu und hoben ihn hinauf. Nurmahammed ließ sich auf das Bett fallen, ohne die Decke beiseite zu schieben, lag kurz da und lächelte dann zu mir herab.
In diesem Augenblick kam die große Kindergruppe herein. Es waren etwa zwanzig Kinder, alle in roten und grünen Kostümen mit Mützen. Der Jüngste war vielleicht vier oder fünf Jahre alt. Sie sahen so hübsch und sauber und adrett aus.
Die Frau, die sie beaufsichtigte, bat um Ruhe. Eine Sekunde lang dachte ich, es sei meine Nachbarin, aber glücklicherweise war sie es nicht. Diese Frau war größer und strenger, keine Spur von Grau in ihrem Haar. Sie bat ein zweites Mal um Ruhe, doch die Soldaten lärmten und lachten weiter. Die Frau klatschte zweimal in die Hände, und die Kinder begannen zu tanzen. Nach einigen Augenblicken legte sich Stille über den Saal – sie kam wie eine träge Welle, als ginge eine gute Nachricht im Flüsterton durch eine Menge.
In dem freien Raum zwischen den Betten führten die Kinder einen tatarischen Volkstanz auf: Sie drehten sich, sie wirbelten herum, sie gingen unter aus Armen gebildeten Bögen hindurch. Sie knieten nieder, standen wieder auf, riefen etwas, klatschten in die Hände und gingen aufs Neue in die Knie. Ein kleines Mädchen verschränkte die Arme und stieß die Beine nach vorn. Ein anderes Kind mit roten Haaren war ganz verlegen, weil seine Schnürsenkel aufgegangen waren. Alle strahlten, und ihre Augen leuchteten. Sie waren so hübsch herausgeputzt, als hätten sie Geburtstag.
Als wir dachten, sie seien fertig, trat ein kleiner blonder Junge vor. Er war etwa fünf oder sechs Jahre alt. Er stellte sich in Positur, stemmte die Hände in die Hüften und drückte die Daumen in seinen Rücken. Dann beugte er leicht den Kopf, reckte die Ellbogen nach außen und begann zu tanzen. Die Soldaten auf ihren Betten richteten sich auf. Diejenigen, die an den Fenstern lagen, beschatteten mit der Hand die Augen. Der Junge ging in die Hocke und tanzte einen Kasatschok. Wir standen schweigend da und sahen ihm zu. Der Junge grinste. Ein paar Soldaten begannen, im Takt zu klatschen, aber kurz bevor der Tanz zu Ende war, verlor der Junge beinahe das Gleichgewicht. Er stützte sich mit der Hand auf und fing den Sturz ab. Einen Augenblick lang sah es so aus, als würde er in Tränen ausbrechen, aber das tat er dann doch nicht – er tanzte vielmehr weiter, und das blonde Haar fiel ihm über die Augen.
Als er fertig war, brandete Applaus auf. Jemand bot dem Jungen einen Zuckerwürfel an. Er errötete und steckte ihn in einen Socken, und dann stand er mit den Händen in den Taschen da und wiegte sich in den Schultern. Die strenge Frau schnippte mit den Fingern, und die Kindertanztruppe ging weiter zur nächsten Station. Die Soldaten begannen zu rufen und zu pfeifen, und als beinahe alle Kinder den Saal verlassen hatten, zündeten die Männer ihre Zigaretten an und tauchten die Becher wieder in den Bottich mit Alkohol. Der blonde Junge warf über die Schulter einen Blick zurück.
In diesem Augenblick hörte ich Bettfedern quietschen. Ich hatte Nurmahammed ganz vergessen. Er starrte auf sein Bein. Er bewegte die Lippen, als würde er etwas essen, holte ein paar Mal tief Luft, betastete den Stumpf und strich mit den Händen über die Stelle, wo einmal sein Schienbein gewesen war. Dann bemerkte er meinen Blick und versuchte zu lächeln. Ich lächelte zurück. Es gab nichts zu sagen. Was hätte ich auch sagen können? Ich wandte mich ab. Als ich hinausging, nickten einige Soldaten mir zu.
Als ich die Station verließ, hörte ich den armen Nurmahammed schluchzen.
Ich kehrte zum Bad zurück. Die Sonne war untergegangen, und es war kalt geworden, doch man konnte bereits einige Sterne sehen. Ein Windstoß schüttelte die Bäume. Aus der Richtung des Krankenhauses erklang Balalaikamusik.
Ich schloss die Türen des Gewächshauses und machte kein Licht. Auf dem Boden lagen Kleinholz und ein Haufen Uniformen. Ich stopfte alles in den Ofen, machte Feuer, füllte einen Kessel mit Wasser und wartete. Es dauerte lange, bis das Wasser kochte, und dort, im Gewächshaus, dachte ich, dass von allen guten Dingen auf dieser Welt ein warmes Bad im Dunkeln das beste ist.
Am Morgen erwacht er neben seiner Mutter, den Kopf in ihrem Arm. Seine Schwester ist bereits aufgestanden, um Wasser vom Brunnen zu holen und das Frühstück zu machen.
Vor kurzem hat seine Mutter zwei Bilderrahmen gegen ein Stück Seife eingetauscht. Anfangs fand er den Geruch der Seife seltsam, doch nun holt Rudik sie jeden Morgen nach dem Aufstehen aus der Tasche des Bademantels seiner Mutter und saugt tief ihren Geruch ein. Ihm ist aufgefallen, dass es im Krankenhaus, wo er tanzt, keine Seife gibt. Die Soldaten riechen streng und erschöpft, und er fragt sich, ob sein Vater auch so riechen wird, wenn er aus dem Krieg zurückkehrt.
Seine Mutter kämmt ihn und nimmt seine Kleider vom Ofen, wo sie zum Wärmen liegen. Sie zieht ihn an. Einige der Sachen hat er von seiner Schwester geerbt. Seine Mutter hat aus einer Bluse ein Hemd gemacht – die Manschetten verlängert und den Kragen mit einem Stück Pappe versteift –, doch trotzdem kommt es dem Jungen so vor, als würde ihm das Hemd nicht passen, und er zappelt, als sie es zuknöpft.
Beim Frühstück darf er auf dem Stuhl sitzen, während seine Schwester rings um ihn den Boden fegt. Er beugt sich über seinen Becher Milch und die Kartoffel, die noch vom Abendessen übrig ist. Als die Milch durch seine Kehle rinnt, zieht sich sein Magen zusammen, und er schlingt mit drei Bissen die halbe Kartoffel hinunter und steckt die andere Hälfte in die Tasche. In der Schule haben viele Kinder eine Brotdose. Der Krieg ist vorbei, und beinahe alle Väter sind wieder da, aber seiner nicht. Er hat gehört, dass der Lohn seines Vaters wegen der gewaltigen Kosten, die der Krieg verursacht hat, stark gekürzt worden ist. Man muss Opfer bringen, sagt seine Mutter. Aber es gibt Tage, da wünscht sich Rudik, er könnte in der Schule an seinem Platz sitzen, eine Brotdose öffnen und darin Schwarzbrot, Fleisch und Gemüse finden. Seine Mutter hat zu ihm gesagt, der Hunger werde ihn stark machen, doch für ihn ist Hunger das schrille Gefühl der Einsamkeit, das ihn überfällt, wenn die Züge aus dem Wald kommen und ihr Klang über das Eis des Belaja holpert.
In der Schule stellt er sich vor, dass er draußen auf dem Fluss ist und Schlittschuh fährt. Auf dem Heimweg sucht er die höchsten Schneewehen, damit er hinaufklettern und den neuen Telegraphendrähten nahe sein kann, die knapp über ihm knistern.
Abends hören sie Radio, und danach liest seine Mutter ihm Geschichten von Zimmermännern vor, von Wölfen und Wäldern und Sägen und Sternen, die mit Nägeln am Himmel befestigt sind. In einer der Geschichten reckt sich ein riesiger Zimmermann zum Himmel und nimmt einen Stern nach dem anderen ab, um sie Arbeiterkindern zu schenken – er liebt diese Geschichte.
Wie groß ist der Zimmermann, Mama?
Eine Million Kilometer.
Und wie viele Sterne hat er in seinen Taschen?
Einen für jedes Kind.
Und zwei für mich?
Einen für jedes Kind, wiederholt sie.
Farida sieht zu, wie Rudik auf dem Lehmboden der Hütte tanzt, wie er sich auf dem Stiefelabsatz dreht. Er wirbelt Staub auf, wenn er das tut. Nicht so schlimm, soll er tanzen, es macht ihm solche Freude. Eines Tages wird sie genug Geld gespart haben, um bei einem der alten Türken auf dem Markt einen Teppich zu kaufen. Die Teppiche hängen an Schnüren und schwingen im Wind hin und her. Sie hat schon oft darüber nachgedacht, wie es wohl wäre, so viel Geld zu haben, dass sie auch Teppiche an die Wände hängen könnte, damit es hier drinnen nicht so kalt wäre, damit diese Hütte schöner wäre, wohnlicher. Doch Teppiche würde sie erst kaufen, wenn sie neue Kleider für ihre Tochter, richtige Schuhe für ihren Sohn, ein anderes Leben als dieses gekauft hätte.
Rudiks Mutter zeigt ihm oft die Briefe, die von der deutschen Grenze kommen, wo sein Vater noch immer als Politruk, als Lehrer, stationiert ist. Die Mitteilungen sind kurz und präzise: Mach dir keine Sorgen, Farida, alles ist gut. Stalin ist stark. Die Worte begleiten Rudik, wenn er mit seiner Mutter durch den Regen zum Krankenhaus geht, an dessen Eingang sie seine Hand loslässt, ihm einen Klaps auf den Hintern gibt und sagt: Komm nicht zu spät, mein kleiner Sonnenstrahl.
Sie hat ihm die Brust mit Gänsefett eingerieben, um die Kälte abzuhalten, denn inzwischen geht es auf den Herbst zu.
Die Kranken heben ihn durchs Fenster herein und klatschen schon jetzt Beifall. Seine Auftritte sind ein wöchentlich wiederholtes Ritual geworden. Er grinst, als man ihn von Arm zu Arm reicht. Später wird er von einer Station zur anderen geführt, wo er die neuen Volkstänze zeigt, die er in der Schule gelernt hat. Manchmal kommen auch die Schwestern, um ihn zu sehen. Rudiks Tanzkostüm hat keine Taschen, und wenn er fertig ist, sind seine Strümpfe von so vielen Zuckerstücken ausgebeult, dass die Patienten über seine kranken Beine witzeln. Man schenkt ihm Brot und Gemüsereste, die die Männer für ihn aufgehoben haben, und er steckt das alles in eine Papiertüte und nimmt es mit nach Hause.
In einem entlegenen Seitenflügel ist die Station für die verrückt gewordenen Soldaten. Es ist die einzige, in der er nicht auftritt. Er hat gehört, dass es dort elektrische Maschinen gibt, mit denen man Wahnsinn heilen kann.
Die Station ist voll belegt – in den Fenstern Gesichter mit herausgestreckten Zungen und starr blickenden Augen –, und er hält sich davon fern, doch manchmal schlendert eine Frau vom Gewächshaus dort hinauf. Sie steht an einem der Fenster der Station und spricht mit einem Soldaten, dem die Pyjamajacke lose um die Schultern hängt. Diesen Soldaten sieht Rudik eines Nachmittags auf Krücken durch den Garten humpeln – das Ende eines Pyjamahosenbeins ist unterhalb des Knies verknotet, und er bewegt sich entschlossen von einem Baum zum anderen. Der Mann ruft ihm etwas zu, irgendwas von einem Tanz, aber Rudik ist schon durch das Tor hinausgerannt, blickt verängstigt zurück und läuft über die ausgefahrenen Wege davon. Im Laufen stellt er sich vor, dass er die Sterne wie Nägel aus dem Himmel zieht. Auf einem Bein durch die Dunkelheit hüpfend, kehrt er nach Hause zurück.
Wo bist du gewesen?, fragt seine Mutter und dreht sich zu ihm um. Sie liegt im Bett neben Rudiks Schwester.
Er streckt die Hand aus und zeigt ihr die Zuckerstücke.
Sie werden sich auflösen, sagt sie.
Nein, werden sie nicht.
Leg sie weg und geh ins Bett.
Rudik schiebt einen Zuckerwürfel zwischen Zahnfleisch und Wange und legt die restlichen Stücke auf einen Teller, der auf dem Tisch steht. Er sieht quer durch den Raum zur Mutter, die sich die Decke über die Schulter gezogen und das Gesicht zur Wand gekehrt hat. Reglos wartet er, bis er sicher ist, dass sie wieder schläft, dann legt er den Kopf an den Radioapparat und dreht langsam an dem Regler, der die Markierung über die gelbe Skala zieht: Warschau, Luxemburg, Moskau, Prag, Kiew, Wilnius, Dresden, Minsk, Kischinew, Nowosibirsk, Brüssel, Leningrad, Rom, Warschau, Stockholm, Kiew, Tallin, Tiflis, Belgrad, Prag, Taschkent, Sofia, Riga, Helsinki, Budapest.
Er weiß, wenn er lange genug wach bleibt, wird er mit dem weißen Knopf Moskau einstellen, wo er Punkt Mitternacht Tschaikowsky hören kann.
So, so, so! Sein Vater steht in der Tür und streift den Schnee von den Schultern. Schwarzer Schnurrbart. Kräftiges Kinn. Die Stimme rau von Zigaretten. Er trägt eine Pilotka, deren Aufschlag er vorn und hinten heruntergeklappt hat, sodass es aussieht, als würde er zugleich kommen und gehen. Zwei rote Orden an seiner Brust. Ein Marx-Abzeichen am Kragen seines Uniformhemdes. Seine Mutter eilt zur Tür, während Rudik sich in der Ecke beim Feuer niederkauert. Den Vater anzusehen ist für ihn so, als sähe er ein Bild zum ersten Mal: Er sieht, dass es existiert, sieht die Farben, die Struktur, sieht den Rahmen, in dem es hängt, und doch weiß er nichts darüber. Vier Jahre im Krieg, und dann noch einmal achtzehn Monate als Besatzungsoffizier. Seine ältere Schwester Tamara hat schon längst Willkommensgeschenke gemacht: fein bedruckte Tücher und Gläser voll Beerensaft. Sie drückt sie dem Vater in die Hände, klammert sich an ihn, küsst ihn. Rudik hat kein Geschenk. Doch sein Vater – breite Backen und gelbe Zähne – kommt auf ihn zu, stößt in seiner Freude den Stuhl mit der hohen Lehne um, hebt Rudik hoch in die Luft und wirbelt ihn zweimal herum. Was für ein großer Junge! Sieh dir das an! Sieh doch nur! Und wie alt bist du jetzt? Sieben? Sieben! Fast acht! Donnerwetter! Sieh dir diesen Jungen an!
Rudik bemerkt, dass die Stiefel seines Vaters an der Tür Pfützen hinterlassen haben, geht zur Schwelle und stellt sich auf die nassen Fußabdrücke. Mein kleiner Junge! Mehrere Gerüche umgeben den Vater, nicht unangenehm, eine seltsame Mischung aus Zügen, Straßenbahnen und dem Geruch, der einem anhaftet, wenn man die Tafel mit dem Ellbogen abgerieben hat.
Sie gehen hinaus auf die Straße, an den Reihen von Hütten und Holzhäusern entlang, in den Nachmittag hinein. Von den Laternenpfählen hängen Eiszapfen. Die Gartentore sind mit Schnee überzogen. Der frostgehärtete Matsch knirscht unter ihren Füßen. Rudik trägt den alten Mantel seiner Schwester. Der Vater starrt den Mantel an und sagt, dass der Junge nicht die abgelegten Sachen seiner Schwester tragen und dass Rudiks Mutter die Knöpfe auf die andere Seite versetzen soll. Seine Mutter wird blass, nickt und sagt, natürlich wird sie die Knöpfe versetzen. Sie sehen, wie der Wind die Pappe und das Sackleinen von den Fensterrahmen der Holzhäuser reißt. In einem Autowrack sitzen Männer und trinken Wodka. Der Vater mustert sie, schüttelt angewidert den Kopf und hakt sich bei der Mutter unter. Sie flüstern; es ist, als hätten sie einander Jahre voller Geheimnisse zu erzählen. Eine schmalschultrige Katze balanciert auf einem krummen Zaun. Rudik wirft einen Stein nach ihr. Beim zweiten Wurf fällt der Vater ihm in den Arm, doch dann lacht er und setzt Rudik seine Pilotka auf, sie jagen einander die Straße hinunter, und ihr heißer Atem dampft. Nach dem Abendessen – Kohl, Kartoffeln und ein besonderes Stück Fleisch, das Rudik noch nie gesehen hat – drückt ihn der Vater so fest an die Brust, dass sein Kopf die Papirossy in der Brusttasche des Uniformhemds zerdrückt.
Sie breiten die Zigaretten auf dem Tisch aus, ziehen sie glatt und füllen den losen Tabak wieder in die Hülsen. Das ist es, sagt der Vater, wovon Männer träumen: Zerdrücktes zu glätten.
Oder etwa nicht?
Ja, Vater.
Nenn mich Papa.
Ja, Papa.
Er lauscht auf die seltsamen Höhen und Tiefen in der Stimme des Vaters, die manchmal ganz verzerrt klingt, wie die Radiosender, wenn er an der Skala dreht. Der Radioapparat – das Einzige, was sie noch nicht gegen Lebensmittel getauscht haben – steht mahagonidunkel über dem Kamin. Der Vater stellt eine Sendung aus Berlin ein und sagt: Hört euch das an! Hört doch! Musik – ah, das ist Musik!
Die Finger seiner Mutter sind lang und schmal, und sie trommeln den Rhythmus auf dem Stuhl. Rudik will noch nicht ins Bett, also sitzt er auf ihrem Schoß. Er betrachtet den Vater, ein fremdes Wesen. Seine Wangen sind hohl, und die Augen sind größer als auf den Fotografien. Er hustet – es ist ein tiefes Husten, ein Männerhusten – und spuckt ins Feuer. Ein paar Glutstückchen springen auf den Lehmboden, und der Vater streckt die Hand aus und zerdrückt sie mit bloßen Fingern.
Rudik versucht es ebenfalls, doch im Nu hat er am Daumen eine Brandblase, und der Vater sagt: Das ist mein Junge.
Rudik wiegt sich an der Schulter seiner Mutter hin und her und schluckt die Tränen hinunter.
Das ist mein Junge, sagt der Vater noch einmal, und dann geht er hinaus. Zwei Minuten später ist er wieder da und sagt: Wenn einer behauptet, es gäbe kein Übel auf der Welt, dann sollte er mal bei diesem Wetter auf das verdammte Scheißhaus da draußen gehen!
Seine Mutter sieht auf und sagt: Hamet.
Wieso?, sagt der Vater. Er hört solche Worte nicht zum ersten Mal.
Sie schluckt, lächelt, sagt nichts.
Mein Soldat hat solche Worte schon mal gehört, oder?
Rudik nickt.
In dieser Nacht schlafen alle vier im Bett, Rudiks Kopf nahe der Achselhöhle des Vaters. Später steigt er vorsichtig über den Vater und schmiegt sich an seine Mutter und ihren Geruch: Kefir und Süßkartoffeln. Tief in der Nacht spürt er Bewegungen, das Bett schaukelt leise, der Vater flüstert, und Rudik dreht sich ganz plötzlich um und stößt die Füße in die Wärme seiner Mutter. Das Schaukeln hört auf, und er fühlt die Finger seiner Mutter an der Stirn. Gegen Morgen wird er erneut geweckt, doch diesmal rührt er sich nicht, und als seine Eltern wieder eingeschlafen sind und der Vater schnarcht, sieht Rudik, wie sich das erste Licht durch den Spalt im Vorhang schiebt. Lautlos steht er auf.
Einen Happen Kohl aus dem Eisentopf. Der Rest Milch, der zur Kühlung auf dem Fensterbrett steht. Das graue Schulhemd mit dem Stehkragen hängt an der Wand. Auf Zehenspitzen geht er durch den Raum und zieht sich dabei an.
Seine Schlittschuhe hängen am Innenknauf der Haustür. Er hat sie selbst gebaut – Stahlblechreste aus der Raffinerie zurechtgefeilt, sie in dünne Brettchen eingelassen und aus Lederstücken, die er hinter den Lagerhäusern an der Bahnlinie gefunden hat, Schnürriemen gemacht.
Leise nimmt er die Schlittschuhe, schließt die Tür und rennt zum See in der Stadt, die zusammengeknoteten Schlittschuhe um den Hals gehängt und die Handschuhe über die scharfen Kufen gezogen, damit sie ihm nicht das Gesicht zerschneiden. Auf dem See ist bereits dunkles Gewimmel. Das erste Sonnenlicht lässt kalten Dunst aufsteigen. Männer in Mänteln laufen auf Schlittschuhen zur Arbeit, gebeugt, rauchend, massiv wirkende Gestalten vor den schmalen Baumskeletten. Die Frauen mit Einkaufstaschen laufen anders, irgendwie höher aufgerichtet. Rudik tritt auf das Eis und läuft gegen den Verkehr, gegen den Strom, und die Leute lachen, weichen aus, schimpfen. Heh, du! Bursche! Herbstlachs!
Er geht ein wenig in die Knie, verkürzt das Pendeln der Arme, beschleunigt das Tempo. Die Kufen sitzen nicht mehr ganz fest, doch er hat gelernt, das auszugleichen und sie mit einer kleinen Bewegung aus dem Fußgelenk wieder ins Holz zu drücken. In der Ferne sieht er das Dach der Banya, wo er jeden Donnerstag mit seiner Mutter und seiner Schwester badet. Seine Mutter schlägt ihn mit Birkenzweigen auf den Rücken. Er liegt gern auf der Holzbank und genießt das Klatschen der Zweige. Er entdeckt Muster in den winzigen Laubfetzen, die an seinem Körper kleben. Seine Mutter hat ihm gesagt, dass diese Bäder ihn immun gegen Krankheiten machen, und er kann es in dem heißen Dampf länger aushalten als alle anderen Kinder seines Alters.
Er springt, dreht sich, landet und spürt, wie die Kufen wieder greifen.
In das Eis sind viele Muster geritzt, und die Spuren verraten ihm, wer ein guter Schlittschuhläufer ist und wer nicht. Würde er lange auf der Stelle wirbeln, könnte er alle anderen auslöschen, ihre Spuren tilgen, der Einzige sein, der dort gelaufen wäre. Unter einer Kufe verfängt sich ein Stückchen Holz, und er hebt den anderen Fuß leicht an und dreht auf der Stelle, um es zu zermahlen. Eiskristalle stieben auf. Von weither hört er seinen Namen, die Stimme kommt vom Ufer und wird vom Wind getragen. Rudik! Rudik! Anstatt zu wenden, stößt er sich mit dem rechten Fuß ab und saust in die entgegengesetzte Richtung davon. Er weiß, wie eng er die Bogen fahren darf und wie weit er sich in die Kurven legen kann, ohne zu fallen. Jetzt jagt er gegen den Wind dahin, an der Kufe kleben noch Holzsplitter. Rudik! Rudik! Er beugt sich weiter vor, sein Körper konzentriert sich ganz auf die Schultern. Auf der Piste am anderen Ufer sieht er Lastwagen, Motorräder, ja sogar Fahrräder, mit breiten Reifen, die auf dem Eis mehr Haftung bieten. Er würde sich zu gern an die Stoßstange eines Wagens hängen und sich von ihm ziehen lassen wie die älteren Jungen, vorsichtig, damit der Schal sich nicht in den Rädern verfängt, und immer ein Auge auf das Bremslicht, um im rechten Augenblick loszulassen und schneller zu sein als alle anderen.
Ru-dik! Ru-dik!
Er gleitet auf die Piste zu, doch dann gellt eine Trillerpfeife, und ein Wächter winkt ihn fort. Er wendet auf einem Fuß, den anderen hoch erhoben, beschreibt einen weiten Bogen und kann den Anblick des Vaters nicht mehr vermeiden, der mit rot angelaufenem Gesicht, schnaufend und ohne Schlittschuhe am Flussufer steht. Ein Windstoß fegt über das Eis und lässt die Zigarettenglut aufleuchten. Wie klein er aussieht. Der Rauch aus seinem Mund wird verweht.
Du bist schnell, Rudik.
Ich hab dich nicht gehört.
Was hast du nicht gehört?
Ich hab dich nicht rufen hören.
Der Vater öffnet den Mund, um etwas zu sagen, überlegt es sich aber anders und sagt: Ich wollte dich zur Schule bringen. Du hättest auf mich warten sollen.
Ja.
Das nächste Mal wartest du.
Ja.
Rudik hängt sich die Schlittschuhe um den Hals, und gemeinsam gehen sie weiter, die Hände in den Handschuhen zu Fäusten geballt. Die Straße führt im Bogen um ein paar alte Häuser herum zur Schule. Auf der Schulmauer ist ein geschwungenes Schild befestigt, auf dem vier Krähen sitzen. Vater und Sohn schließen eine Wette ab, welche zuerst auffliegen wird, doch alle vier bleiben sitzen. Die beiden stehen schweigend da, bis die Glocke läutet und Rudik seine Hand zurückzieht.
Wissen, sagt der Vater, ist das Fundament für alles Übrige. Verstehst du, was ich meine?
Rudik nickt.
Die Glocke läutet abermals, und die Kinder auf dem Hof rennen zum Schulhaus.
Na, dann, sagt der Vater.
Bis nachher.
Bis nachher.
Rudik wendet sich ab, kommt aber noch einmal zurück, stellt sich auf die Zehenspitzen und drückt dem Vater einen Kuss auf die Wange. Hamet bewegt den Kopf ein wenig, und Rudik spürt die Schnurrbartspitze, die nass ist vom Eis.
Der Weg zum Klassenzimmer ist ein Spießrutenlauf. Blondchen. Frosch. Mädchen. Er ist kleiner als die meisten und wird oft verprügelt. Die Jungen nageln ihn an der Wand fest, packen seine Hoden und drücken zu – Stutzen nennen sie das. Erst wenn ein Lehrer um die Ecke biegt, lassen sie ihn in Ruhe. Drinnen: Fahnen an der Wand, Banner, Porträts. Die Pulte, deren Platten man hochklappen kann. Gojanow, der Lehrer, auf dem Katheder, gelassen, mit teigigem Gesicht. Der Morgenappell. Das Vaterland ist gütig. Das Vaterland ist stark. Das Vaterland beschützt mich. Rascheln, als die Jungen und Mädchen sich setzen, das Quietschen der Kreide auf der Tafel, Mathematik, er wird aufgerufen, fünf mal vierzehn, du, ja, du, fünf mal vierzehn, ja, du, Schlafmütze! Er gibt eine falsche Antwort, und Gojanow schlägt mit dem Lineal auf das Pult. Nach drei weiteren falschen Antworten schlägt er ihn auf die Fläche der linken Hand. Und dann, bevor die Rechte dran ist, bildet sich auf dem Boden eine Pfütze. Die anderen Kinder lachen, als sie merken, dass er sich in die Hose gemacht hat, sie kichern hinter vorgehaltener Hand und stellen ihm ein Bein, als er durch den Mittelgang geht. Siebzehn Schritte von der Toilette zum Absatz der knarzenden Treppe, wo der Fensterrahmen die Moschee und den blauen Himmel umschließt. Er steht dort wie verwurzelt und streicht über die Vorderseite seiner nassen Hose. Jenseits der Moschee sind die Schornsteine, die Brücken, die niedrigen Kamine von Ufa. Die klaren, harten Konturen des Horizonts ragen wie Zacken in den Himmel. Gojanow kommt von hinten und führt ihn am Ellbogen zurück zum Klassenzimmer, wo er beim Eintreten ein zweites Mal in die Hose macht, doch jetzt sind alle Schüler still, beugen sich über die Tintenfässer und klecksen schwarze Flecken in ihre Hefte. Er bleibt auf seinem Platz sitzen und wartet, sogar in der Mittagspause, Unser Führer und Lehrer ist stark, unser Führer und Lehrer ist groß, und sein Bauch ist hart und angespannt, bis schließlich alles getrocknet ist, und dann verschwindet er abermals auf die Toilette, wo der Spiegel gesprungen und sein Gesicht in tausend Stücke gebrochen ist, ringsum der stechende Geruch nach Pisse, aber still ist es hier, und er beugt sich zu seinem Spiegelbild, wo ihm die Winkel der Scherben das Gesicht entstellen.
Nach der Schule erwartet ihn der Vater schon wieder, an die Mauer gelehnt, den Mantelkragen hochgeschlagen. An seinem Oberschenkel lehnt ein Baumwollfutteral. In der anderen Hand hält er eine große Tasche, die ausgebeult ist, als wäre eine Laterne darin. Hamet winkt ihn herbei, legt den Arm um Rudiks Schulter, und schweigend gehen sie in Richtung Straßenbahn.
Als sie die Hügel vor der Stadt erreichen, verdunkelt sich der Himmel bereits. Armeen von Birken stehen entlang der vereisten Straße. Die Zweige filtern das letzte rote Licht. Sie überqueren einen breiten Erdrutsch, über den sich Wildfährten ziehen. Von den Bäumen fällt in Klumpen der Schnee. Es geht ein kalter Wind, sie bleiben dicht zusammen. Der Vater nimmt eine Jacke aus der Tasche und legt sie um Rudiks Schultern. Dann gehen sie durch eine enge Schlucht, und als sie an ihrem Ende den kleinen, zugefrorenen Fluss erreichen, sieht Rudik eine Reihe von Feuern auf dem Eis, an denen Männer sitzen und in Löchern fischen.
Forellen, sagt der Vater. Er klopft Rudik auf den Rücken. Jetzt such Feuerholz.
Rudik sieht zu, wie der Vater zu einem unbesetzten Eisloch geht. Er zerhackt das neue Eis, stellt zwei schmale Holzblöcke als provisorische Hocker auf und breitet über jeden eine Decke. Er stellt die Laterne zwischen die Hocker und zieht aus dem Baumwollfutteral eine Angelrute. Er steckt sie zusammen, zieht eine Schnur durch die Ösen, versieht den Haken mit einem Köder, verankert die Angel, und dann steht er bei dem Loch und klatscht in die Hände.
Rudik wartet bei den Bäumen. Er hat zwei große Äste unter einen Arm geklemmt, und in der anderen Hand hält er ein paar Zweige.
Der Vater sieht auf. Wir brauchen mehr Holz!
Rudik stapft am Waldsaum entlang außer Sicht, streift Schnee von einem Felsen, setzt sich darauf und wartet. Er ist noch nie fischen gewesen. Wie können Forellen in einem so dick zugefrorenen Fluss leben? Wie können sie durch das Eis schwimmen? Er haucht in die Öffnungen seiner Handschuhe. Ein einzelner Stern erklimmt den Himmel. Kein Mond. Er denkt an das warme Bett zu Hause, an seine Mutter, wie sie ihn bis zum Kinn in die grauen Decken einschlägt, wie sie den Arm anwinkelt, um ihn an sich zu drücken. Er ist sicher, dass im Wald jenseits des Flusses Tiere auf ihn warten – Dachse, Bären, sogar Wölfe. Er hat Geschichten von Wölfen gehört, die Kinder verschleppt haben. Andere Sterne tauchen am Himmel auf, wie mit Winden dort hinaufgezogen. Er hört ein Flugzeug, kann aber keine sich bewegenden Lichter sehen. Er schnieft, lässt das Holz fallen und rennt zurück über das Eis des Flusses.
Ich will nach Hause.
Du willst was?
Mir gefällt es hier nicht.