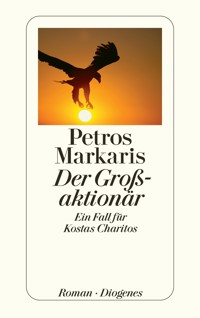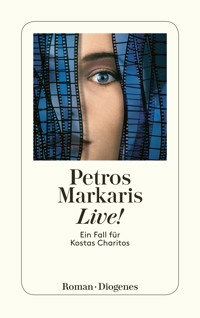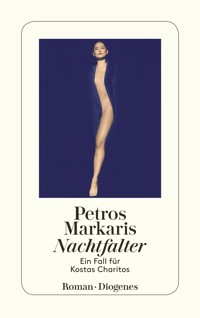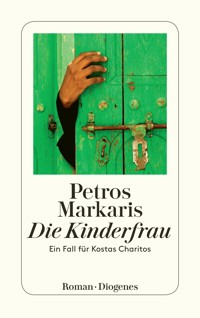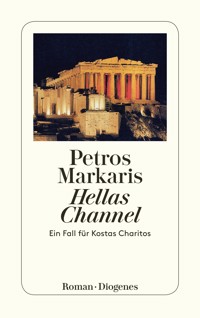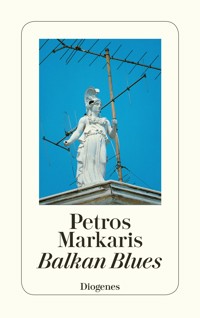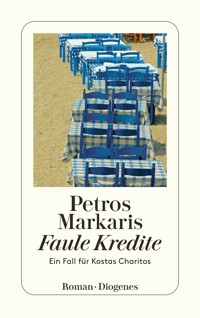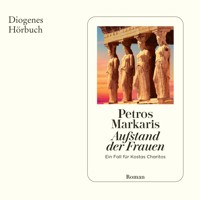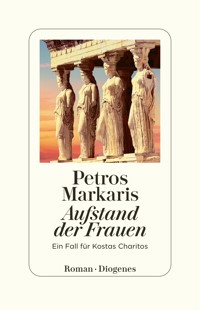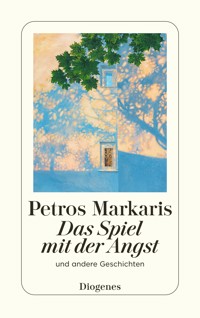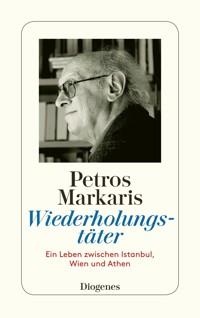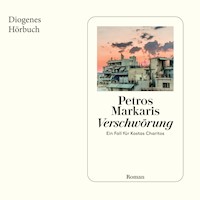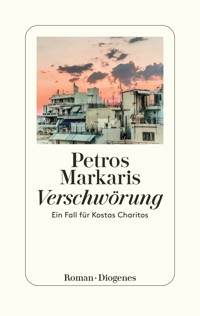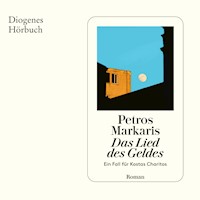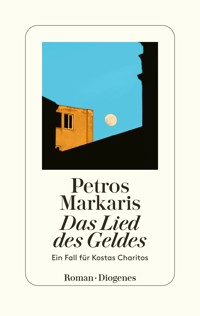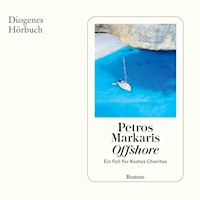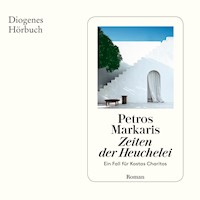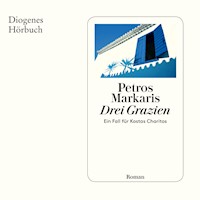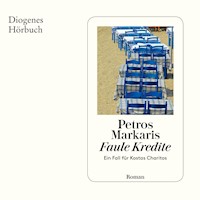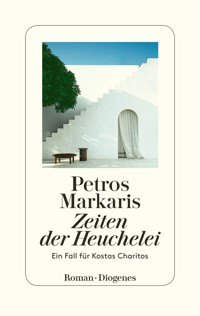9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sieben Geschichten über Irrfahrer und Glückssucher in Griechenland, Deutschland und in der Türkei. Über Verbrechen aus Hass, Neid und Angst gegenüber Rivalen und Fremden. Auch Kommissar Charitos tritt auf und beweist einmal mehr, dass finstere Zeiten nur mit Humor und Zusammenhalt zu überstehen sind. Der große griechische Krimiautor Petros Markaris – selbst ein Grenzgänger zwischen den Kulturen – gibt sich hier sehr persönlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Petros Markaris
Der Tod des Odysseus
Geschichten
Aus dem Neugriechischen von Michaela Prinzinger
Diogenes
{5}Für die kleine Abril
{9}Mord an einem Unsterblichen
Die Nachricht erreichte uns während der morgendlichen Kaffeerunde, die unser Chef, Kriminalrat Gikas, vor kurzem eingeführt hat. Sein halbes Leben geht er nun schon in den Besprechungszimmern von Ministern jeglicher Couleur ein und aus. Dabei ist ihm irgendwann zu Ohren gekommen, dass der Premierminister seinen Arbeitstag mit einer morgendlichen Kaffeerunde beginnt. Und so hat er diesen Brauch flugs kopiert. Was die politischen Führungskräfte mit ihrem Mitarbeiterstab bereden, weiß ich nicht. Wir jedenfalls reden nur Unsinn. Statt über den Vortag Bericht zu erstatten und die Einsatzpläne für den aktuellen Tag festzulegen, vertrödeln wir unsere Zeit damit, Gikas’ Erinnerungen zu lauschen, die er aus seinem Gedächtnisarchiv hervorkramt.
Als das Telefon klingelt, Gikas abnimmt und »Es ist für Sie« zu mir sagt, habe ich so ein Vorgefühl, das mir Vlassopoulos prompt bestätigt.
»Wir haben einen Mord, Herr Kommissar.«
{10}»Ist die Identität des Opfers bekannt oder nicht?«
»Weithin bekannt. Es handelt sich um den Schriftsteller Lambros Spachis. Seine Haushälterin hat ihn heute Morgen tot in seinem Arbeitszimmer gefunden.«
»Und dir sagt der Name Spachis etwas?«, frage ich ihn verwundert, denn ich kenne ihn nicht.
»Nein, aber ich habe bei Wikipedia nachgeschaut und seinen Lebenslauf gelesen.«
›Oje‹, sage ich mir. ›Wenn ich jetzt frage, was in Wikipedia steht, setze ich meine ganze Autorität aufs Spiel.‹
»Wo hat das Opfer gewohnt?«
»In der Romanou-Melodou-Straße, an der Ringstraße um den Lykavittos.«
»Ich bin gleich unten.«
Vlassopoulos erwartet mich in einem Streifenwagen am Ausgang.
»Ich habe die Spurensicherung und die Gerichtsmedizin verständigt. Ein Streifenwagen bewacht die Wohnung. Das Opfer hat allein gelebt.«
Spachis wohnte in einem dreistöckigen Einfamilienhaus, das aus den dreißiger Jahren stammen muss. Zur Linken befindet sich das Wohnzimmer mit alten Möbeln und Erbstücken, an den Wänden hängen vorwiegend Familienaufnahmen. Auf einem {11}ausladenden Sessel mit geschwungenen hölzernen Armlehnen sitzt eine dunkelhaarige Fünfzigjährige mit einer Adlernase und hat den Kopf in die Hände gestützt. Auf den ersten Blick wirkt sie wie eine Ausländerin auf mich, doch woher genau, könnte ich nicht sagen. Der junge Kriminalhauptwachtmeister, der sie beaufsichtigen soll, raucht stehend am Fenster und blickt verträumt nach draußen.
Die Küche liegt dem Wohnzimmer genau gegenüber. Daneben führt eine Holztreppe in die oberen Etagen. Zuerst werfe ich einen Blick in die Küche. Die Türen der Küchenschränke sind zu, ein Stoß Teller wurde achtlos im Spülbecken abgestellt. Der Kühlschrank enthält reichlich Obst und Gemüse.
Im zweiten Stock erwarten mich zwei Schlafzimmer. Dazwischen liegt ein enger Flur, der zum Badezimmer führt. Das Opfer muss das linke Schlafzimmer benutzt haben, denn in den Kleiderschränken befinden sich jede Menge Anzüge und Unterwäsche. Auf dem Nachttisch liegt ein Buch, daneben eine Brille. Das andere Schlafzimmer sieht unbenutzt aus. Wahrscheinlich diente es als Gästezimmer. Auf dem einzigen Balkon vegetieren ein paar darbende Pflanzen dahin, bei deren Anblick es meine Frau Adriani gruseln würde.
Die oberste Etage besteht aus einem einzigen, riesigen Arbeitszimmer mit Bücherregalen, die bis {12}zur Decke reichen. Gikas wäre bestimmt neidisch darauf – nicht wegen der Bücher, sondern wegen des Ausblicks. Vor den beiden großen Fenstern liegt einem hier ganz Athen mitsamt Akropolis zu Füßen.
Das wunderbare Licht, das den ganzen Raum durchströmt, schafft eine angenehme Atmosphäre – wäre da nicht das Opfer, das vor dem linken Fenster mit eingeschlagenem Schädel vornübergestürzt ist. Eine Blutlache hat sich um die Wunde ausgebreitet, an den Ohren und am Hemdkragen klebt verkrustetes Blut. Das Arbeitszimmer weist sonst keinerlei Kampfspuren auf. Das bedeutet, dass das Opfer den Mörder gekannt und ihm vertraut haben muss. Nur so konnte es vor dem Fenster unvermutet hinterrücks angegriffen werden.
Nachdem ich mich in Spachis’ Arbeitszimmer umgesehen habe, beschließe ich, die Untersuchung des Tatorts der Spurensicherung und der Gerichtsmedizin zu überlassen, und dafür jetzt gleich die Haushälterin zu vernehmen.
Auf der Treppe kommt mir Gerichtsmediziner Stavropoulos entgegen.
»Was gibt’s?«, frage ich.
»Eine Leiche mit zertrümmertem Schädel. Das Opfer wurde von hinten erschlagen, als es gerade aus dem Fenster schaute. Da es keine {13}Kampfspuren gibt, muss der Täter ein Bekannter gewesen sein. Schon allein deshalb, weil er ihn nicht bloß im Wohnzimmer empfangen, sondern in sein Arbeitszimmer gelassen hat. Der Mörder hatte es nicht auf Diebesgut abgesehen, sondern kam ganz offiziell zu Besuch.«
Er hält sich mit Kommentaren zurück und geht weiter die Treppe hoch, während die Haushälterin fast genauso dasitzt wie vorhin. Nur hat sie jetzt den Kopf in die eine Hand gestützt und zerknüllt mit der anderen ein Taschentuch.
»Woher kommen Sie?«, frage ich sie.
Jeden Griechen fragt man heutzutage, woher sein Geld kommt, jeden Einwanderer hingegen, woher er selbst kommt.
»Aus Armenien.«
»Arbeiten Sie schon lange für Herrn Spachis?«
»Neun Jahre. Seine Frau Ourania war damals noch am Leben.«
»Wann sind Sie heute Morgen gekommen?«
»Um neun, wie immer.«
»Kommen Sie jeden Tag?«
»Nein, jeden zweiten. Als Erstes gehe ich immer in die Küche. Ich war überrascht, dort schmutzige Teller vorzufinden. Herr Lambros erledigt den Abwasch immer sofort, weil wir hier nah am Park des Lykavittos-Hügels sind und deshalb Ameisen {14}haben. Aber dann habe ich mich noch mehr gewundert.«
»Wieso?«
»Weil ich ins Schlafzimmer hinaufgegangen bin und das Bett gemacht war.«
»Hat er nie selbst das Bett gemacht?«
»Nein, ich habe das jeden zweiten Tag übernommen. Dann habe ich gerufen: ›Herr Lambros! Herr Lambros!‹ Keine Antwort. So bin ich ins Arbeitszimmer gegangen und … da lag er dann!«
Sie bricht erneut in Tränen aus und wischt sich mit dem Taschentuch über die Augen.
»Gut, gehen Sie jetzt nach Hause und erholen Sie sich von dem Schrecken«, sage ich. »Morgen kommen Sie zur Vernehmung ins Präsidium auf den Alexandras-Boulevard.«
»Herr Lambros war ein guter Mensch«, sagt sie, während sie seufzend aufsteht. »Schlimm, dass er so gestorben ist. Wirklich schlimm.«
Im Anschluss an unser Gespräch gehe ich ins dritte Stockwerk hoch, um mich nach Stavropoulos umzuschauen. Inzwischen hat auch die Spurensicherung losgelegt. Der Gerichtsmediziner ist mit seiner Arbeit fertig und packt gerade seine Utensilien ein.
»Viel kann ich nicht dazu sagen«, meint er. »Der Mord muss zwischen zehn Uhr abends und ein {15}Uhr nachts passiert sein. Der Schädel zeigt Spuren mehrerer Hiebe, die mit einem schweren Gegenstand ausgeführt wurden, vermutlich mit einer Schale oder einem anderen Gefäß aus Metall. Darin müssen die Büroklammern, die Heftklammern und der Radiergummi aufbewahrt gewesen sein, die überall im Raum verstreut liegen. Der Mörder muss die Tatwaffe mitgenommen haben. Wir konnten sie nirgends finden.«
»Untersucht seinen Schreibtisch und den Computer«, sage ich zu Sfakianakis von der Spurensicherung.
Sein konsternierter Blick sagt mir, dass ich mir die Anweisung hätte sparen können.
Vlassopoulos kommt die Treppe heraufgekeucht.
»Er hatte keine Angehörigen außer einer Nichte seiner Frau, die in Patras lebt. Er war ein ruhiger Typ und scheint allen gegenüber freundlich und offen gewesen zu sein.«
»Hat jemand gesehen, wie er nach Hause gekommen ist?«
»Nein. Es gibt ja keine Mitbewohner.«
»Gut. Sag in Patras Bescheid, sie sollen die Nichte morgen in einem Streifenwagen nach Athen bringen. Komm, wir machen uns auf den Weg. Das war’s fürs Erste. Hier ist nichts Interessantes mehr zu finden, fürchte ich.«
{16}»Ich kann Ihnen nicht groß weiterhelfen«, meint Afroditi Stergiopoulou, die Nichte des Schriftstellers, als wir sie am nächsten Tag in dem Haus am Lykavittos treffen. »Mein Onkel und ich hatten ein distanziertes Verhältnis. Er konnte mich nicht leiden, und ich ihn auch nicht. Nach dem Abitur wollte ich studieren und Mathematiklehrerin werden. Doch der Onkel hat meiner Mutter das Studium ausgeredet. Er meinte, ich solle lieber Friseuse werden, das sei ein sicherer Job. Und da das Wort meines Onkels in der Familie Gesetz war, bin ich Friseuse geworden. Ein paar Jahre später habe ich Charis kennengelernt. Er ist Finanzbeamter, und als er nach Patras versetzt wurde, ging ich mit ihm. Dort haben wir dann geheiratet. Ein Jahr nach der Hochzeit ist meine Mutter gestorben, und seit damals hatten wir keinen Kontakt mehr – bis auf seltene Telefonate mit meiner Tante. Auf ihrem Begräbnis habe ich Onkel Lambros zum letzten Mal gesehen.«
»Kannten Sie jemanden aus seinem Freundes- oder Kollegenkreis?«
Sie stößt ein kurzes, spöttisches Lachen aus.
»Immer wenn meine Mutter und ich meine Tante besuchten, Herr Kommissar, wurden wir gleich ins Wohnzimmer geführt. Dann habe ich ehrfürchtig auf genau diesem Stuhl hier gesessen, und meiner {17}Mutter ging es ganz genauso. Mein Onkel thronte in seinem Sessel und redete ununterbrochen auf uns ein. Keiner wagte es, ihn zu unterbrechen, nicht mal meine Tante Ourania. Wenn einer seiner Freunde vorbeikam, hat er ihn direkt in sein Arbeitszimmer geführt, ohne ihn uns vorzustellen. Dann waren wir ganz erleichtert, dass wir unter uns waren und in aller Ruhe quatschen konnten.« Nach einer kurzen Pause fährt sie fort: »Onkel Lambros hatte zwei Gesichter, Herr Kommissar. Das eine hat er seiner Familie gezeigt, das andere den Außenstehenden. Zu den Außenstehenden war er immer freundlich und höflich, zu seinen Angehörigen jedoch hochfahrend und arrogant. So hat er sich auch meiner Tante gegenüber verhalten. Vor den anderen hat er honigsüß getan, wenn er mit ihr sprach. Doch wenn die beiden allein waren, hat er sie von morgens bis abends fertiggemacht.«
»Aber er hat sich doch zu Ihnen gesetzt und mit Ihnen geplaudert«, wende ich ein, da ihre Worte übertrieben kritisch klingen.
Erneut lacht sie auf.
»Mein Mann Charis, der einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften hat, hat zu mir gesagt, nachdem er ihn kennengelernt hatte: ›Lass mich das nächste Mal bloß zu Hause. Den halte ich nicht aus. Der ist mir viel zu selbstherrlich.‹ Ja, so war {18}Onkel Lambros: absolut selbstherrlich. Er hat sich selbst unglaublich gern reden hören.«
»Werfen Sie bitte mit uns einen Blick in sein Arbeitszimmer, vielleicht fällt Ihnen ja irgendetwas auf.«
»Gern, aber ich muss Sie enttäuschen. Zu seinem Büro hatten nur seine Freunde und ein paar Kollegen Zutritt. Da meine Mutter und ich nicht zu dieser Kategorie zählten, mussten wir draußen bleiben.«
Unbewusst hat sie mir einen wertvollen Hinweis geliefert. Da er nur Freunde und Kollegen in seinem Arbeitszimmer empfangen hat, muss der Täter aus diesen Kreisen stammen. Nicht, dass die Zahl der Verdächtigen dadurch kleiner würde. Es wäre ganz schön aufwendig, jeden Dichter, Literaten, Künstler und ähnliche Genossen einzeln zu überprüfen.
»Sie hat ordentlich Gift über ihren Onkel versprüht«, bemerkt Vlassopoulos nach dem Abgang der Stergiopoulou. »Da kann sie sagen, was sie will: Spachis hat großartige Romane geschrieben.«
»Woher weißt du das denn? Hast du die Romane ihres Onkels gelesen?«, frage ich überrascht, da ich weiß, dass er – als eingefleischter Olympiakos-Piräus-Anhänger – nur die Sportzeitung Protathlitis liest.
{19}»Einer seiner Romane wurde fürs Fernsehen verfilmt. Da habe ich keine Folge verpasst. Wenn ich nicht gucken konnte, habe ich mir die Wiederholung angeschaut oder einen Freund von der Kriminaltechnik gebeten, die Folge aufzuzeichnen. Der Mann war einsame Spitze, sage ich Ihnen.«
Der Verleger von Lambros Spachis residiert in der Salongou-Straße. Vor dem Haus steht ein Akkordeonspieler und spielt in einer Endlosschleife den Donauwalzer. Er muss aus Serbien stammen. Die Kombination aus Akkordeon und Donauwalzer lässt im Allgemeinen auf einen Serben schließen.
Der Verleger ist ein sympathischer Mittfünfziger. Sein dunkelblondes Haupthaar ist leicht angegraut, die Farbe seines Schnauzers hingegen hält noch stand.
»Ein herber Verlust«, sagt er mit betrübter Miene. »Ganz schlimm. Und auch noch ein so schreckliches Ende.« Er seufzt tief auf, um seine Betroffenheit zu unterstreichen. »Er war ein großartiger Schriftsteller und ein großartiger Mensch.«
Den ersten Teil der Aussage hat mir Vlassopoulos bereits bestätigt, den zweiten Teil seine Nichte, allerdings nur, was sein Verhalten Außenstehenden gegenüber betraf. Von dem Verleger würde ich gern noch mehr erfahren.
{20}»Wissen Sie, er kam sehr gut an. Jeder neue Roman wurde innerhalb eines Monats gleich drei- oder viermal nachgedruckt. Genauso erfolgreich war er im Fernsehen.« Er pausiert kurz und fährt dann fort: »Man hätte erwarten können, dass Lambros hochnäsig und arrogant geworden wäre, aber weit gefehlt. Unsere Lektorinnen haben ihn heiß geliebt, weil er immer auf sie gehört hat. Er hat ihre Anregungen gern aufgegriffen und seinen Text entsprechend überarbeitet. Ganz anders als die jungen Autoren, die sich wer weiß wie aufregen, wenn man ihnen eine Korrektur vorschlägt. ›Ich hab es aber so und nicht anders gemeint‹, sagen sie. Oder: ›Das ist ein Eingriff in meine Urheberrechte!‹ Dann bleibt einem nichts anderes übrig, als sie entweder rauszuwerfen oder ihr Werk unlektoriert herauszubringen. Normalerweise macht man dann das Zweite.«
»Wieso das Zweite?«, frage ich neugierig.
Der Verleger lacht auf.
»Bücher dienen nicht allein der Lektüre, Herr Kommissar.«
»Sondern?«
»Dazu, die Büchertische in den Buchläden zu füllen. Je mehr Bücher du herausgibst, desto größer wird dein Anteil auf den Büchertischen. Die richtig guten Bücher verkaufst du. Und die {21}übrigen stampfst du ein, weil es zu teuer kommt, sie zu lagern.«
»Hatte Lambros Spachis Feinde?«
Spachis’ Feinde interessieren mich viel mehr als die Büchertische mit den guten und den schlechten Büchern.
Der Verleger denkt nach.
»Wenn Sie mit ›Feinden‹ Schriftstellerkollegen meinen, die auf ihn neidisch waren, dann hatte er viele Feinde«, antwortet er. »Griechenland ist ein kleines Land, Herr Kommissar, und unsere Zunft ist ganz besonders klein. Hat jemand Erfolg, glauben die meisten seiner Kollegen: Ohne den wäre mein Erfolg größer. Das ist natürlich Blödsinn, aber wie soll man sie vom Gegenteil überzeugen?« Er überlegt noch ein wenig und meint dann gepresst: »Ich fürchte, die Zahl der Neider ist seit seiner Kandidatur zum Akademiemitglied noch angewachsen.«
»Er wollte Akademiemitglied werden?«
Ich weiß zwar nicht, was genau das bedeutet, aber der wichtigtuerische Gesichtsausdruck des Verlegers untermalt die enorme Tragweite des Vorgangs.
»Ja, und seine Chancen, gewählt zu werden, standen sehr gut.« Dann fügt er etwas zurückhaltender hinzu: »Hieß es wenigstens.«
{22}»Jetzt mal langsam: Sie behaupten also, dass man in die Akademie gewählt wird?«
»Aber natürlich, Herr Kommissar. In die Akademie kommt man weder mit Eintrittskarte noch mit Wartenummer«, erklärt der Verleger und bedenkt mich mit einem Blick, der mich – freundlich ausgedrückt – zum Banausen und – unfreundlich ausgedrückt – zum Rindvieh stempelt.
»Wissen Sie vielleicht, wer Spachis’ Mitbewerber waren?«
»Nein, ehrlich gesagt, interessiert es mich auch nicht. Die Wahl zum Akademiemitglied bringt heutzutage keine künstlerische oder wissenschaftliche Anerkennung. Sie befriedigt bloß die persönliche Eitelkeit und bringt ein saftiges Gehalt ein, so um die dreitausend Euro pro Monat.«
Kann sein, dass die Frage für den Verleger uninteressant ist oder er zumindest so tut, als ob. Mich jedenfalls interessiert es brennend, wer sich sonst noch beworben hat.
»Eine gewisse Kourani soll darunter sein«, erläutert mir Vlassopoulos am nächsten Morgen.
»Was hast du über sie rausgekriegt?«
»Dass sie in diversen Zeitungen und Zeitschriften Bücher bespricht. Sie ist reich und verbittert. Und sie regiert wie eine Bienenkönigin – sie kann {23}honigsüß sein, hat aber auch einen sehr giftigen Stachel.«
»Du fliegst gleich raus aus dem Ermittlerteam«, sage ich kurz angebunden.
»Wieso?«, wundert sich Vlassopoulos, der sich Lob erwartet hat und stattdessen einen Rüffel kassiert.
»Weil du mit poetischen Vergleichen arbeitest, und das gehört sich nicht für einen Bullen. Wenn Gikas dich hört, sitzt du gleich unten im Archiv und bearbeitest Akten.«
Er schweigt – was er immer tut, wenn er mir zeigen will, dass ihn mein Verhalten verbittert.
Alkistis Kourani wohnt in der Patriarchou-Ioakim-Straße in Kifissia, in einem alten Haus mit Garten aus der Zwischenkriegszeit in der Nähe der Ajia-Anna-Kirche. Bei meinem Eintreffen sitzt sie, mit einem Kissen im Rücken, in einem altmodischen Korbsessel und liest in einem Buch. Obwohl sie das Klacken der schmiedeeisernen Gartentür gehört haben muss, die hinter mir ins Schloss gefallen ist, hebt sie den Blick nicht von ihrer Lektüre. Erst als ich auf sie zutrete, blickt sie auf und legt gleichzeitig den Bleistift, den sie in der Hand hält, zwischen die Seiten des Buches. Sie ist über achtzig, doch sie hält sich gut und sieht mindestens fünf Jahre jünger {24}aus. Vor ihr steht ein niedriges Tischchen mit einer Porzellankanne, einer Tasse und einem Tellerchen mit Zitronenscheiben.
»Setzen Sie sich, Herr Kommissar«, sagt sie, nachdem ich mich vorgestellt habe. »Möchten Sie eine Tasse Tee?«
Ich lehne höflich ab. Liebend gern hätte ich einen süßen Mokka getrunken, doch ich verkneife es mir, den Wunsch zu äußern.
»Ich wollte Sie im Fall Lambros Spachis um Ihre Mithilfe bitten«, sage ich und nehme in einem zweiten Korbsessel Platz.
Sie schüttelt bedauernd den Kopf.
»In meiner Kindheit hörte man überall das Lied ›Armer Athanassopoulos, warum musstest du so enden?‹. Jetzt, als alte Frau, sage ich kopfschüttelnd: ›Armer Spachis, warum musstest du so enden?‹. Wer weiß, vielleicht schließt sich so symbolisch der Kreis meines Lebens.«
»Wissen Sie, ob Lambros Spachis Feinde hatte?«
Sie hält inne, die Teetasse einen Fingerbreit von ihrem Mund entfernt, und antwortet leichthin: »Alle haben ihn gehasst.«
»Warum? Aus Neid auf den Ruhm, den er als großer Schriftsteller genoss?«
Sie verschluckt sich und ringt nach Luft. Mir rutscht vor Schreck das Herz in die Hose, und ich {25}weiß nicht, ob ich der alten Dame auf den Rücken klopfen soll oder nicht. Zum Glück beruhigt sie sich wieder.
»Ein großer Schriftsteller, Herr Kommissar? Wissen Sie, wir in Griechenland haben die Tradition, mittelmäßigen Künstlern Größe zuzusprechen und durchschnittliche Werke als Meisterwerke zu feiern. Nur um uns selbst davon zu überzeugen, dass wir etwas wert sind.« Nach einer kurzen Pause fügt sie hinzu: »Wenn Sie meine persönliche Meinung hören wollen, dann lag die Qualität seiner Bücher knapp über der eines Groschenromans.«
Ich muss an meine Frau denken. Adriani liest jeden Morgen, wenn sie mit der Hausarbeit fertig ist, Groschenromane. Am Nachmittag drückt sie auf den Einschaltknopf und verfolgt die verfilmten Groschenromane.
»Ich erzähle Ihnen mal von seinem Werdegang, dann werden Sie verstehen, was ich meine. Spachis hatte eine Schauspielausbildung und verdiente sein Geld als Sprecher in der Sendung Radiobibliothek. Durch seine Tätigkeit als Schauspieler ist er überhaupt erst mit der Literatur in Berührung gekommen. Dann hat er begonnen, selber zu schreiben. Was für ein Talent kann man schon von jemandem erwarten, der durch die Radiobibliothek zum Autor wurde?«
{26}»Ja, aber er hat es bis zum Kandidaten für die Athener Akademie gebracht.«
Sie gießt sich erst frischen Tee ein, bevor sie antwortet.
»Solche Institutionen vereinten früher die Geistesriesen, doch heute sind sie reiner Popanz und ein Schatten ihrer selbst, Herr Kommissar. Jeder kann Akademiemitglied werden. Man braucht nur die richtigen Verbindungen. Spachis’ eigentliches Talent war es, die richtigen Verbindungen zu haben. Darüber hinaus war er goldenes Mittelmaß. Also hatte er die beiden Eigenschaften, welche die Voraussetzungen bilden, um heutzutage Akademiemitglied zu werden.«
»Gab es keine anderen Kandidaten?«
»Doch. Der erste, Makis Petropoulos, war chancenlos, und das war ihm selbst auch bewusst. Er hat sich einzig und allein deshalb beworben, um Spachis, der ihn nicht ausstehen konnte, eins auszuwischen. Der zweite war Kleon Romylos. Er hätte es, im Gegensatz zu den anderen, wirklich verdient gehabt. Romylos ist der Großmeister der kleinen Form, der literarischen Vignette. Für mich ist er der griechische Borges. Um nicht zu sagen, Borges ist der argentinische Romylos.«
Mir sagt weder Romylos etwas noch dieser »Borches«, und in meiner Verwirrung weiß ich {27}schon gar nicht mehr, wer der Grieche und wer der Argentinier ist. Doch die Tatsache, dass Romylos Akademiemitglied werden wollte, lässt mich vermuten, dass er der Grieche ist.
Kleon Romylos sitzt am hintersten Ecktisch der Brasserie Valaoritou. Vor ihm liegt ein aufgeschlagenes schwarzes und in Leder gebundenes Notizbuch und darauf ein sündteurer Füller.
»Schon als junger Schriftsteller habe ich immer in Cafés geschrieben, und von Anfang an mit Füller«, erläutert er. »Wenn es vollkommen still ist, bin ich abgelenkt und unkonzentriert. Der Lärm im Café, das Kommen und Gehen der Leute, die sich hinsetzen und – sei es auch noch so laut – plaudern, weckt meine Lebensgeister und schärft meine Wahrnehmung.«
Er ist etwa Mitte sechzig, mittelgroß, dünn und weißhaarig. Seine Haut ist so hell, als hätte er sein ganzes Leben in geschlossenen Räumen unter künstlichem Licht verbracht.
»Seit ich schreibe, also mein halbes Leben, habe ich die meiste Zeit auf der Galerie im Café Zonar’s verbracht«, fährt Romylos fort. »Aber seit der Renovierung ist es nicht mehr dasselbe. Deshalb bin ich hierher umgezogen.« Er seufzt tief auf. »Im Zonar’s hatte ich meinen Stammplatz. Hier ist es {28}nicht so. Jeden Tag sitze ich woanders, also dort, wo ich einen freien Tisch finde. Im Zonar’s kannten mich die Kellner und haben mit mir geplaudert. Hier wirft man mir ein trockenes ›Kalimera!‹ zu und geht sofort zur Tagesordnung über, also zur Bestellung. Ich bin ihnen vollkommen gleichgültig. Sie begrüßen nur die Politiker, die hier ihre Ränke schmieden. Heutzutage ist ein Schriftsteller nichts Besonderes und ein Gast wie jeder andere.«
Mir schwant, dass er mir seine ganze schriftstellerische Vita erzählen will, und ich komme ihm schnell mit der Frage zuvor: »Kannten Sie Lambros Spachis?«
»Griechenland ist ein kleines Land, Herr Kommissar, und die Literatenzirkel bestehen aus einer Handvoll Autoren. Jeder kennt jeden, und wir treten uns gegenseitig auf die Füße, um uns irgendwo ein Pöstchen zu sichern.«
»Wenn ich nicht irre, haben Sie beide für die Athener Akademie kandidiert.«
»Also, ich hatte mich schon vor ein paar Jahren beworben, wurde aber nicht gewählt. Ich wollte mich dieser psychisch anstrengenden Prozedur nicht noch einmal unterziehen. Aber Alkistis Kourani hat mich so lange bearbeitet, bis ich schließlich ja gesagt habe.«
»Warum wollten Sie nicht erneut kandidieren?«
{29}»Der weise Mann macht nicht zweimal denselben Fehler, Herr Kommissar.«
»Haben Sie sich keine Hoffnungen gemacht?«
»Genauso wenig wie beim ersten Mal. Bloß jetzt bin ich nicht mehr in dem Alter, in dem man gegen den Strom schwimmt. Ich bin mit den kleinen Geschichten, die ich schreibe, vollauf zufrieden. Die einen beurteilen sie als Vignetten oder als chinesische Miniaturen, die anderen als Vogelkacke. Doch genau darin liegt mein Talent. Wenn ich mich zur größeren Form verleiten lasse, merke ich, dass das Resultat gekünstelt ist und mich vom richtigen Weg abbringt.«
»Kannten Sie den zweiten Mitbewerber?«
»Makis Petropoulos? Aber sicher. Nur, um es gleich klarzustellen: Wir sind miteinander nur bekannt, nicht befreundet.«
»Das klingt so, als würden Sie ihn nicht besonders mögen. Oder täusche ich mich da?«