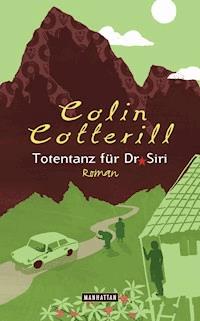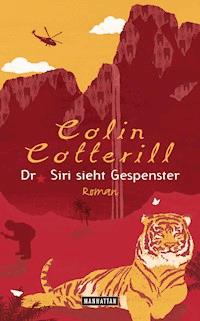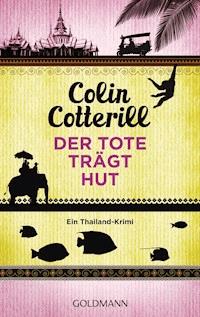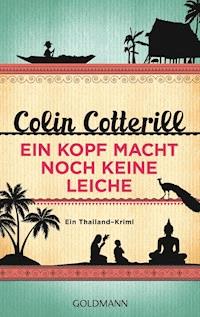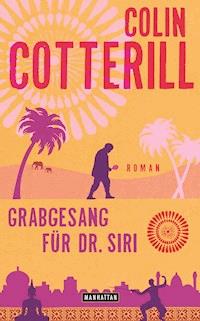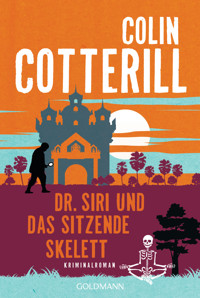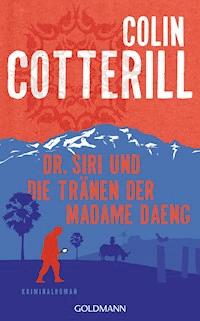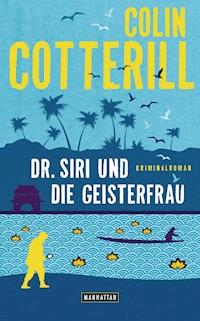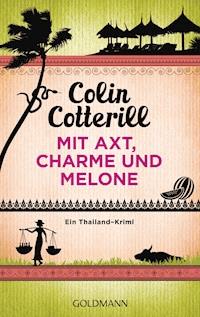8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Krimi
- Serie: Dr. Siri ermittelt
- Sprache: Deutsch
Der fünfte Laos-Krimi mit dem unverwechselbaren Dr. Siri
Der 73-jährige Dr. Siri Paiboun, einziger und querköpfiger Leichenbeschauer in Laos, leidet. Man hat ihn verdonnert, an einer politischen Konferenz im Norden des Landes teilzunehmen, wo es ihn kaum überrascht, als einer der Genossen mutmaßlich aus Langeweile tot vom Stuhl fällt. Unterdessen hält seine Assistentin Dtui in der Hauptstadt die Stellung und hat es auch nicht leichter. Im Leichenschauhaus wurde versehentlich ein Toter tiefgefroren – die neue sowjetische Kühlkammer ist unerwartet effektiv –, der sich später als höchst explosiv erweist: Im Bauch der Leiche findet sich eine Hand granate, die wohl für Dr. Siri gedacht war. Während Dtui der Sache nachgeht, wird Siri entführt und bekommt es mit einem Fall zu tun, der mindestens ebenso mysteriös ist wie das Rätsel des eisgekühlten Unbekannten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Colin Cotterill
Der Tote im Eisfach
Dr. Siri ermittelt
Roman
Aus dem Englischen von Thomas Mohr
MANHATTAN
Dieses Buch ist den Hmong und allen anderen laotischen Bergvölkern gewidmet, die notgedrungen auf beiden Seiten des politischen Schlachtfelds gekämpft haben. Dass sie so oft verkauft und verraten wurden, tut mir im Herzen weh. Ich hoffe, ich habe sie nicht falsch dargestellt, und danke allen, die mir bei meinen Recherchen behilflich waren. Ich bitte um Entschuldigung für die Freiheiten, die ich mir habe nehmen müssen, um etwas mehr Heiterkeit und Hoffnung in mein Buch zu bringen, als den Hmong im wahren Leben vergönnt gewesen ist. Außerdem möchte ich mich bei den Missionaren Dr. G. Lynwood Barney und William A. Smalley dafür entschuldigen, dass ich meine eigene Transkription verwendet und ihr gar vortreffliches phonetisches System verworfen habe – aber es hat mir in jedem Sinne Kopfschmerzen bereitet.
FORMULAR A223-79Q
AN:
Richter Haeng Somboun p. A. Justizministerium Demokratische Volksrepublik Laos
VON:
Dr. Siri Paiboun
BETR.:
Amtlicher Leichenbeschauer
DATUM:
13.06.1976
LEBENSLAUF:
1904
Plus/minus ein Jahr – das nahm man seinerzeit nicht so genau. Geboren in der Provinz Khammouan, angeblich als Sohn Hmong-stämmiger Eltern. Ich selbst kann mich nicht daran erinnern.
1908
Ich werde zu einer bösen Tante abgeschoben, die mich …
1914
… der Obhut eines Tempels in Savannaketh und damit dem Wohlwollen Buddhas überlässt.
1920
Abschluss der Tempelschule. Keine Glanzleistung.
1921
Die Buddha-Investition zahlt sich aus: Eine überaus großzügige französische Gönnerin schickt mich nach Paris, auf dass etwas aus mir werde. In Frankreich muss ich von Neuem die Schulbank drücken, um zu beweisen, dass ich mir meine Zensuren nicht ergaunert habe.
1928
Besuch der Ancienne Faculté de Médecine.
1931
In Paris eheliche ich Bouasawan und trete spaßeshalber in die Kommunistische Partei ein.
1934
Praktikum am Hôtel-Dieu-Krankenhaus. Ich beschließe, doch noch Arzt zu werden.
1939
Rückkehr nach Laos.
1940
Spiel, Spaß und Spannung im Dschungel von Laos und Vietnam. Ich flicke kaputte Soldaten wieder zusammen und versuche, dem Bombenhagel zu entgehen.
1975
Ich komme in der Hoffnung auf einen friedlichen Lebensabend nach Vientiane.
1976
Ich werde von der Partei zwangsrekrutiert und zum amtlichen Leichenbeschauer ernannt. (Bei dem Gedanken an die mir zuteilgewordene große Ehre vergieße ich nicht selten heiße Tränen.)
Hochachtungsvoll, Dr. Siri Paiboun
PROLOG
Da keine Aufzeichnungen mehr existierten, wussten die Hmong noch nicht einmal, wann ihnen ihre Vergangenheit abhandengekommen war. Die Geschichte hatte sich unwiederbringlich ausgelöscht. Die im nicht eben verlässlichen Stille-Post-Verfahren überlieferte Legende aber lautete wie folgt:
Die Ältesten der Hmong-Stämme hatten sich versammelt, um den großen Exodus anzuführen. Seit unzähligen Jahrhunderten schon waren sie von den Chinesen gepeinigt und geknechtet worden. Nun, da sie der Kampfesmut verlassen hatte, war die Zeit zur Flucht gekommen. Als Nomaden führten sie kaum wertvolle Besitztümer mit sich. Sie wollten mit ihren Tieren gen Süden ziehen, ins Gelobte Land, und sich dort eine neue Heimat schaffen. Einen Gegenstand aber gab es, der allen Hmong gehörte. Es war die heilige Hanfrolle, die nicht nur ihre Schrift enthielt und die Sagen und Mythen ihrer Vorfahren, die einst aus einem sonnenlosen, eisbedeckten Land gekommen waren, sondern vor allem eine Karte, die ihnen den Weg in ihr Nirwana wies: das Reich der Toten in der Anderwelt.
Die Schriftrolle wurde feierlich aus ihrem Versteck geholt, in Ziegenhaut gewickelt und bekam einen Ehrenplatz an der Spitze der Karawane. Die Hmong wanderten hundert Tage und hundert Nächte, und in der einhundertersten Nacht prasselte ein Monsun auf sie nieder, der sie bis auf die Knochen durchweichte, noch ehe sie Unterschlupf gefunden hatten. Zitternd vor Kälte saßen sie in einer Höhle, bis die Sonne aufging. Der Hüter der Schriftrolle stellte mit Bestürzung fest, dass der Regen durch die Ziegenhaut gedrungen und die heilige Schrift nass geworden war. Die passenden Mantras skandierend, entrollten sie den Text und legten ihn ins Gras, damit er in der heißen Morgensonne trocknen konnte. Und von der schlaflosen Nacht erschöpft, suchten die Gefährten sich ein schattiges Ruheplätzchen unter einem Baum und nickten ein.
Während sie so in tiefem Schlummer lagen, zog eine Rinderherde über den Gebirgspass und entdeckte erst die schlafenden Hmong und dann die mit Pflanzenfarben beschriebene Rolle. Nach neuen kulinarischen Erfahrungen lechzend, machten die Wiederkäuer sich mit Wonne über das köstliche Frühstück her. Als die Hmong erwachten, mussten sie feststellen, dass sich das Vieh an ihren Schriften gütlich getan hatte. Sie jagten die Rinder davon und klaubten die kläglichen Überreste der Hanfrolle zusammen. Diese übergaben sie dem Schamanen, der sie sicher und trocken verwahrte und die nächsten hundert Tage und Nächte bei ihnen wachte. Doch schließlich, am einhundertersten Tag, teilten sich die Wolken, und die Sonne kam hervor, und die Hmong fanden sich in einem verlassenen Weiler wieder. Der Schamane war aus Schaden klug geworden und legte die Reste der Rolle auf dem Dachboden eines Langhauses aus, wo Rinder, Ziegen oder Vögel ihnen nichts anhaben konnten. Dann sank er wie seine Brüder und Schwestern in wohlverdienten Schlaf. Doch er hatte die Rechnung ohne die Ratten gemacht. Begierig stürzten sich die halb verhungerten Nager auf den Hanf und hatten ihn im Nu verschlungen. Dann, auf den Geschmack gekommen, fielen sie übereinander her. Als die Hmong schließlich auf den Dachboden kletterten, fanden sie nur noch tote Ratten und ein paar unentzifferbare Fetzen ihrer Kultur. So verloren die Hmong ihre Geschichte und ihre Schrift. Sagt die Legende.
Der Geist des allerersten Hmong-Schamanen See Yee blickte aus der Anderwelt empor und war stocksauer über die Achtlosigkeit seiner Stammesgenossen. Sein Groll währte ein oder zwei Menschenleben, dann erst brachte er es über sich, ihnen zu vergeben. Doch da er das Schicksal nicht unnötig herausfordern wollte, sandte er ihnen weder eine neue Hanfrolle noch eine neue Schrift. Stattdessen lehrte er sechs irdische Brüder, sechs Pfeifen von unterschiedlicher Länge zu spielen. Bald erkannte das Sextett, dass es die Toten auch ohne die Karte, allein durch ihr Spiel, in die Anderwelt geleiten konnte. Aber je älter die sechs wurden und je mehr persönliche Verpflichtungen sie hatten, desto schwieriger wurde es, sie zu einem gemeinsamen Auftritt zu bewegen. Und so lehrte See Yee die Menschen, die sechs Pfeifen zu einer Flöte zusammenzufügen und sie mit sechs Fingern zu spielen. Die geng war geboren.
Wenn die geng gespielt wurde, glaubten die Leute die Stimmen ihrer Vorfahren zu hören, ganz so als würden die Geister durch das Instrument zu ihnen sprechen und ihnen den Weg ins Jenseits weisen. Fortan überlieferten die Hmong ihre Legenden in Form von Musik. Die Töne ersetzten ihnen die Schrift. Mit Hilfe der geng konnten sie neuen Generationen von ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft künden. Sie brauchten keine Bücher.
Bei den Missionaren aus dem Westen stießen derlei Narreteien natürlich auf taube Ohren. Ein Volk ohne Schrift war in ihren Augen barbarisch und primitiv. Und so ersannen sie ein lateinisches phonetisches System als Grundlage für eine Hmong-Schrift, die nur lesen konnte, wer zahllose komplizierte Regeln beherrschte. Die klugen Kirchenmänner glaubten, die zerstreuten Hmong-Stämme auf diese Weise unter ein gemeinsames sprachliches Joch gezwungen zu haben, aber so leicht ließen die Hmong sich nicht beirren. Um die Missionare bei Laune zu halten, lernten sie die Schrift, doch verfügten sie über ein System, das sämtlichen Erfindungen des Westens haushoch überlegen war. Sie besaßen eine musikalische Sprache, die den direkten Austausch zwischen zwei Seelen möglich machte.
1
KALTERWISCHT
»Was ist denn das für ein grauenhafter Lärm?«
»Ein Hmong-Bettler, der Flöte spielt, wenn mich meine Ohren nicht täuschen.«
»Das hält ja kein Mensch aus. Wir sind hier in einem Krankenhaus, verdammt noch mal. Kannst du ihm nicht sagen, dass er Ruhe geben soll?«
»Du hast doch Beine. Also sag es ihm gefälligst selbst.«
»Ich bin beschäftigt.«
»Ich etwa nicht?«
Die Pathologie war aus Beton und hatte weder Risse noch Spalten, in denen sich Geheimnisse hätten verstecken können. Auf ihren Logenplätzen links und rechts der Leiche hörten Schwester Dtui und Madame Daeng jedes abfällige Wort der beiden Beamten. Die Buchprüfer erinnerten an ein unglückliches Ehepaar. Die blassen Männer in zerschlissenen weißen Hemden und Polyesterhosen waren gestern Vormittag hereingeschneit. Sie hatten Dtui den amtlichen Bescheid des Justizministeriums in die Hand gedrückt und das Büro in Beschlag genommen. Sie wollten die einwöchige Abwesenheit des Leichenbeschauers nutzen, um seine Buchführung des Jahres 1977 durchzugehen. Wie es schien, hatte man sie ausdrücklich angewiesen, in dem Wust von Papieren nach Fehlern zu suchen. Dtui wusste, dass dies ein nahezu aussichtsloses Unterfangen war, denn ihr Chef hatte eine so erbärmliche Handschrift, dass er sie selbst kaum lesen konnte. Hätte man eine Kakerlake in Tinte getunkt und sie kreuz und quer über das Papier krabbeln lassen, wäre das Resultat vermutlich leserlicher ausgefallen.
Aber Schwester Dtui musste die Buchprüfer für ihre Entschlossenheit bewundern. Sie hatten jeden freien Quadratzentimeter des Büros mit grauen Papierstapeln gepflastert und tänzelten nun barfuß und auf Zehenspitzen von einem zum anderen. Die gesamte erste Schublade des Aktenschrankes hatten sie bereits durchforstet und füllten ihre Kassenbücher nun eifrig mit Notizen. Da es ihnen strengstens untersagt war, mit dem Hilfspersonal über ihren Auftrag zu sprechen, konnte Dtui ihnen leider nicht helfen, das zu finden, was sie suchten.
»Komm, wir gehen Mittag essen«, sagte einer von ihnen.
»Mh-hm.«
Zum ersten Mal seit ihrem Erscheinen waren sie sich einig. Dtui und Daeng hörten Papier rascheln, dann wurde die Bürotür, die seit Jahren niemand mehr in ihren verzogenen Rahmen gezwängt hatte, geschlossen und verriegelt, und einer der beiden Männer ließ aus sicherer Entfernung ein verhaltenes Hüsteln vernehmen.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte Dtui.
»Genosse Bounhee und ich machen dann Mittag«, sagte er.
»Möchten Sie nicht hereinkommen und sich ein Sandwich mit uns teilen?«, schlug sie vor. Daeng schüttelte lächelnd den Kopf. Seit heute Morgen, als die Leiche eingeliefert worden war, hatten die Männer keinen Fuß mehr in den Sektionssaal gesetzt.
»Äh, nein. Lieber nicht. Wohlsein, Genossin«, sagte der Mann und verschwand.
Die einzige Pathologie in der Demokratischen Volksrepublik Laos hatte vier Räume. Da war zunächst das verbotene, mit Papieren übersäte Büro. Dann gab es noch die enge Lagerkammer, wo der Labortechniker Herr Geung die Präparatgläser polierte. Und schließlich den Sektionssaal selbst, den alle nur den Schneideraum nannten. Hier saßen Schwester Dtui und Madame Daeng beidseits des verstorbenen Offiziers und nahmen ihr zweites Frühstück ein. Diese kleine Respektlosigkeit war keineswegs so pervers, wie es den Anschein hatte, sondern eine nachgerade zwangsläufige Folge der Ereignisse des zurückliegenden Vormittags.
Herr Geung litt an einer milden Form des Down-Syndroms und war wie geschaffen für monotone Aufgaben, die er stets gründlich und zu aller Zufriedenheit erfüllte. Alles Ungewöhnliche hingegen machte ihn nervös. Fremden Menschen oder Geräten, die seine gewohnte Routine durcheinanderbrachten, begegnete er mit Argwohn. Die Buchprüfer waren ein solcher Störfaktor, und Herr Geung grummelte in einem fort missgelaunt vor sich hin. Aber das war nicht das einzige Ärgernis in dieser Woche. Die völlig intakte französische Kühlkammer der Pathologie war durch ein doppelt so großes Monstrum sowjetischer Bauart ersetzt worden. Weder der Krankenhaustechniker, der sie installiert hatte, noch Herr Geung, der für das An- und Abschalten zuständig war, kannte sich mit der Anlage aus. Dtui konnte zwar Russisch lesen, doch keiner der Regler schien die angegebene Funktion zu erfüllen. Und so hatte Herr Geung mit Entsetzen feststellen müssen, dass der Armeehauptmann schon nach knapp zwei Stunden tiefgefroren war.
Bei ihrem Eintreffen hatte Madame Daeng, die Verlobte des Leichenbeschauers, nicht nur Dtui vorgefunden, die den tränenüberströmten Geung zu trösten versuchte, sondern auch einen riesigen Eiszapfen von Leiche, der auf einer stählernen Rolltrage ruhte. Zu allem Übel erwarteten sie einen unbekannten Chirurgen, der am Nachmittag im Beisein des Klinikdirektors, Herrn Suk, die Obduktion vornehmen sollte. Bis dahin mussten sie den Leichnam irgendwie auf Zimmertemperatur erwärmen. Ihn in Decken zu wickeln, kam nicht in Frage, denn das hätte den Auftauvorgang nur verzögert. Es war ein verhältnismäßig kalter Tag Anfang Dezember, und es gab keine Heizung. Madame Daeng, die in jeder Krise einen kühlen Kopf bewahrte, schlug vor, den Soldaten in die Sonne zu schieben, die durch die Fensterjalousien fiel, und sich neben die Leiche zu setzen, damit ihre Körperwärme auf ihn abstrahlen konnte. Die einzige andere verfügbare Wärmequelle war ein rumänischer Wasserkocher. Sie verbanden ihn mit der Steckdose, stellten den Topf ans Ende der Edelstahltrage und sahen dem Wasser beim Blubbern zu.
Jetzt, wo das Wasser schon einmal kochte und auch eine Dose Erdnuss-Margarinen-Kekse bereitstand, konnten sich die beiden Damen ebenso gut ein Tässchen Tee genehmigen. Aus Gründen des Anstands – und um die Krümel aufzufangen – breiteten sie ein weißes Tuch über den Unterleib des Hauptmanns. Und da saßen sie nun und unterhielten sich über die immer leerer werdenden Regale der Geschäfte.
»Wie sieht’s aus?«, fragte Madame Daeng.
Dtui machte die Löffelprobe. »Noch eine Stunde, und er ist so weit.«
»Und wer führt die Obduktion durch? Ich dachte, Siri bringt als Einziger im ganzen Land die nötige Qualifikation mit.«
»Na ja« – Dtui lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück –, »von Qualifikation im strengen Sinne kann eigentlich nicht die Rede sein. Siri ist zwar gut, aber ein gelernter Pathologe ist er nicht. Was unsere Politbürokraten offenbar für nebensächlich hielten; Chirurg – Pathologe, gehopst wie gesprungen. Die können von Glück sagen, dass der Doc gleich in mehrfacher Hinsicht ein kleines Genie ist.« Da Dtui keine Ahnung hatte, wie viel Daeng über Siris Verbindungen zur Geisterwelt wusste, ging sie nicht weiter ins Detail.
»Und heute …?«
»Vertritt ihn ein junger Starchirurg, der erst seit Kurzem wieder im Lande ist. Er ist vor sechs Jahren als Sanitäter in die DDR gegangen. Erstaunlich, was im Ostblock alles möglich ist. Dort gehen die Uhren anscheinend etwas schneller als bei uns. Aber Obduktionen durchführen darf der Neue auch nicht. Wenn unser Freund hier kein Soldat wäre, hätte man ihn vermutlich auf Eis gelegt, bis Siri wieder da ist. Die Militärs möchten allerdings unbedingt so bald wie möglich wissen, wie ihr Offizier ums Leben gekommen ist. Wie man hört, haben sie bislang keinen Schimmer, wer er ist. Sie warten darauf, dass seine Einheit ihn als vermisst meldet. Der Klinikdirektor hat unseren Jungstar gefragt, ob er auf die Schnelle eine Obduktion durchführen könnte, worauf der Knabe meinte: ›So schwierig kann das ja wohl nicht sein.‹ Nun ja, wir werden sehen.«
»Es wäre jedenfalls weitaus schwieriger, wenn wir ihn nicht aufgetaut hätten. Es scheint zu funktionieren. Allmählich fängt er an zu müffeln.«
»Ja, jetzt rieche ich’s auch.«
»Sieht aus, als würden wir mehr Wärme ausstrahlen, als wir dachten.«
In der Tat. Und die beiden Frauen hatten allen Grund zu strahlen. Die dralle, wunderschöne Dtui verdankte ihrer ersten sexuellen Erfahrung ein Baby, das unter ihrem Herzen wuchs. Zum Glück hatte Phosy, der Polizist, das einzig Richtige getan und ihr das Jawort gegeben. Tante Bpoo, die Wahrsagerin, hatte Dtui prophezeit, dass es ein Mädchen werden würde. Sie war zwar erst im dritten Monat, hatte ihrer Tochter aber schon einen Namen gegeben und ihr rosa Sonnenhüte gehäkelt. Die Kleine würde fröhlich, rund und intelligent werden wie ihre Mutter … und Medizin studieren … und sich erst schwängern lassen, wenn sie verheiratet war, statt mit dem positiven Testergebnis in der Tasche vor den Traualtar zu treten. In dieser Hinsicht würde sie ganz anders werden als ihre Mutter.
Madame Daeng strahlte, weil sie im vorgerückten Alter von sechsundsechzig Jahren einen Antrag von dem Mann erhalten hatte, den sie seit ihrer Jugend heimlich liebte. Als Siri und sie sich vor ein paar Monaten im Süden des Landes wiedergefunden hatten, waren die alten Jungmädchengefühle von Neuem erwacht. Sowohl Siri als auch sie waren verwitwet – der hohe Preis des Krieges, der das Land jahrzehntelang verwüstet hatte. Trotzdem waren die beiden alten Kampfgenossen offen für eine neue Liebe. Dreist und schamlos war sie ihm nach Vientiane gefolgt und hatte alle verfügbaren Daumen gedrückt. Siri hatte auf denkbar unlaotische Art um ihre Hand angehalten: mit Blumen. Ein Brauch, den er zu ihrer großen Freude aus Frankreich mitgebracht hatte. Sie hatte ihm selbstverständlich einen Korb gegeben. Welche Frau, die etwas auf sich hielt, wäre auch auf das erstbeste Angebot eingegangen? Zum Glück hatte er sie ein zweites Mal gefragt, bei einer Tasse Kaffee, keine Blumen weit und breit, und diesmal hatte sie Ja gesagt. Gleich nach seiner Rückkehr aus dem Norden wollten sie Hochzeit feiern.
»Meinen Sie, wir können unseren kleinen Soldaten jetzt allein lassen?«, fragte sie Dtui.
»Na klar! Am besten, wir fahren gleich in Ihr Restaurant. Wenn er noch weiter auftaut, will er am Ende womöglich mitkommen.«
Herr Geung erklärte sich bereit, ein Auge auf die Leiche zu haben, und die beiden strahlenden Damen stiegen auf ihre Räder und rollten vom Klinikgelände. Sturm klingelnd bogen sie links ab in die Mahosot Road, obwohl es außer anderen Fahrrädern wenig gab, womit sie hätten kollidieren können. Für Radfahrer war Vientiane das reinste Paradies. Nur die wenigen Auserwählten, die Verbindungen zur Parteispitze hatten, konnten es sich leisten, den Tank ihres Mopeds mit Benzin zu füllen. Autos waren zu bloßem Vorgartenschmuck verkommen. Wenn auf der Straße ein Wagen vorbeifuhr, standen kleine Kinder am Bordstein Spalier und winkten. Siri hatte vermutlich recht. Laos fiel in ein vorindustrielles Zeitalter zurück.
Dtui und Daeng radelten vorbei an den verwitterten Schildern von Läden und Geschäften, die schon lange nicht mehr existierten, an verlassenen Geisterhäusern und windschiefen Telegrafenmasten, die offenbar allein von den durchhängenden Kabeln aufrecht gehalten wurden. Die wenigen asphaltierten Straßen waren an den Rändern ausgefranst wie ein angeknabbertes Stück Lakritz, die Gehwege mit Gras und Unkraut überwuchert. Sie fuhren am Mekongufer entlang, vorbei am Chantabouli-Tempel, zu der kleinen Garküche, die Daeng nach ihrem Umzug in die Hauptstadt gekauft hatte. Es war nicht gerade der ideale Zeitpunkt, um sich selbstständig zu machen, aber sie genoss den Ruf einer meisterlichen Nudelköchin. Das hatte sich herumgesprochen, und obwohl es erst halb zwölf war, hatte sich bereits eine Schar hungriger Gäste vor dem verschlossenen Laden eingefunden. Als die beiden Frauen ankamen, jubelten sie und machten unflätige Bemerkungen. Humor gehörte zu den wenigen Dingen, die die Menschen in schweren Zeiten zusammenschweißten.
»Sie waren wahrscheinlich wieder mal bei Ihrer Frauenärztin, was, Madame Daeng?«, fragte einer. »Da steht uns wohl demnächst was Kleines ins Haus?«
»Wenn dem so wäre, hätte sich hier vermutlich längst die Weltpresse versammelt«, sagte sie. »Und jetzt Platz da, und Schluss mit den Unverschämtheiten.«
Dtui und die Gäste halfen ihr, das Scherengitter zu öffnen und die Tische auf die Straße zu stellen. Sie schoben den Küchenkarren vor den Laden, und Daeng entzündete die Holzkohle mit Reisig und setzte Wasser auf. Die Zutaten hatte sie vorbereitet, ehe sie in die Pathologie gefahren war; jetzt brauchte sie nur noch die Nudeln zu kochen. Um den Kunden die Wartezeit zu verkürzen, schenkte sie Jasmintee aus. Schließlich standen Dtui und Daeng hinter dem Karren und verteilten riesige Schüsseln mit feu-Nudeln. Als der Großteil der Gäste gesättigt war, beugte sich Daeng zu ihrer Freundin.
»Wollen Sie mir nicht verraten, was Sie auf dem Herzen haben?«, fragte sie.
»Was meinen Sie, Tante?«
»Seit wir die Klinik verlassen haben, beschäftigt Sie doch etwas.«
»Ach, ich weiß nicht …«
»Raus mit der Sprache.«
»Die Leiche. Irgendetwas stimmt mit ihr nicht.«
»Und was?«
»Ich weiß auch nicht. Es ist nur so ein Gefühl. Als würde ich schauen, aber nicht sehen. Oder sehen, aber nicht verstehen. Meine Güte. Jetzt rede ich schon genauso kariert daher wie Dr. Siri. Wissen Sie was? Ich wollte, er wäre hier.«
»Ich auch.«
Sie waren da und schlichen sich unbefugt in seinen Schlummer. Sie – die bösen Geister – lungerten in seinen Träumen herum wie halbwüchsige Strolche, undeutlich, aber immer da. Ganz gleich, wohin seine nachmittägliche Siesta Dr. Siri Paiboun auch führte – ob über verlassene Waldwege oder durch zerbombte Städte –, stets lauerten sie im Halbdunkel und wachten über seine Schritte. Er spürte ihre Präsenz in jedem Traum. Die Phibob, die Waldgeister, hatten offenbar nichts Besseres zu tun, als sich in seinem Unterbewusstsein herumzutreiben und ihn daran zu erinnern, dass sie eine ständige Bedrohung darstellten.
Auch wenn es ihm widerstrebte, beherbergte Dr. Siri in seinem altersschwachen Körper den Geist Yeh Mings, eines tausendjährigen Schamanen. Während seines verhältnismäßig kurzen Daseins auf Erden und seines vergleichsweise langen Aufenthalts im Jenseits hatte der alte Medizinmann den bösen Geistern reichlich Ärger bereitet, und nun sannen sie auf Rache. »Alberner Hokuspokus«, würde mancher meinen, und noch vor zwei Jahren hätte Siri lauthals in diesen Chor mit eingestimmt. Doch jetzt gab es keinen Zweifel mehr, keine Frage: Nur das verzauberte Steinamulett, das er um den Hals trug, bewahrte Dr. Siri vor einem üblen Ende.
Obwohl er mit diesem unerwünschten Schicksal haderte, hatte er gelernt, sich damit zu arrangieren. Unbeschadet aller okkulten Scherereien und Schikanen schnurrte er im Schlaf wie ein weißhaariger Kater. Sein Kinn ruhte auf seiner Brust, und ein kaum hörbares Schnarchen wehte durch seine Nüstern. Mit seinen dreiundsiebzig Jahren hatte er den Dreh heraus und wusste, wie man Sitzungen und Konferenzen unbemerkt verschlief. Er war noch nicht ein einziges Mal vom Stuhl gefallen. Dank seiner kleinen, stämmigen Statur warf ihn so leicht nichts aus dem Gleichgewicht, und vom Rednerpodium aus wirkte er wie einer von über tausend gebannten Zuhörern, die ihren tiefschürfenden Gedanken nachhingen. Dabei sorgte allein die ohrenbetäubende Lautstärke der vietnamesischen Verstärkeranlage dafür, dass das kollektive Brummen mehrerer hundert dösender Funktionäre nicht zu hören war. Wäre an diesem kühlen Nachmittag der Generator ausgefallen, hätten die Einwohner von Xieng Khouang panisch die Flucht ergriffen, aus Angst vor einer Hummelplage.
Die meisten Regionaldelegierten hatten die ganze Nacht beisammengesessen, süßen Reiswhisky durch Bambushalme geschlürft und mit längst verschollen geglaubten Kampfgefährten Erinnerungen ausgetauscht. Heldenmutig hatte Siri den Dank zahlloser alter Soldaten über sich ergehen lassen, die ihm ihr Leben schuldeten, weil er sie an der Front zusammengeflickt hatte. Da er mit jedem einzelnen von ihnen hatte anstoßen müssen, war er für weitere sieben Stunden voller Grundsatzreden und Berichte nur unzureichend gerüstet. Ohne das eine oder andere Nickerchen hätte er diese Tortur kaum lebend überstanden.
Es war gegen drei, als er wieder zu sich kam, gerade rechtzeitig, um zu erfahren, dass »der ideale Sozialist ein aufrechter Patriot ist, der sich durch Sachverstand und Führungseifer, moralische Integrität und selbstloses Engagement für die Sache und das Gemeinwohl auszeichnet«. Leider hatte er seinen Notizblock vergessen. Sein Blick fiel auf seinen Vorgesetzten, Richter Haeng, der eifrig nickend in der zweiten Reihe saß. Siri reckte den Hals, sodass die Knochen knackten, und hob instinktiv die Hand, um sich am linken Ohrläppchen zu kratzen. Er hatte es vor einigen Monaten bei einem Handgemenge eingebüßt, doch sein Geist wollte partout keine Ruhe geben und raubte ihm den letzten Nerv. Er verlagerte das Gewicht von einer Hinterbacke auf die andere, um seinen Blutkreislauf wieder in Gang zu bringen, und schaute sich selbstvergessen um. Die Regionalvertreter saßen stocksteif und regungslos da und zählten im Stillen die Minuten. Auch wenn bei Stalin davon nicht ausdrücklich die Rede war, wusste Siri, dass ein guter Sozialist in erster Linie ein guter Buddhist zu sein hatte. Ohne Meditation und Schmerzabschaltung war dieses Parteigequatsche nicht zu ertragen.
Staunend ließ Siri den Blick durch die Reihen wandern. Nur ein disziplinloser Kader hatte seinem Schlafbedürfnis ungeniert nachgegeben. Er saß zwei Reihen vor ihm, sechs Plätze weiter. Die vierteljährliche Planungs- und Fortschrittstagung der Partei hatte ihn anscheinend überfordert. Wie ein nasser Sack hing er auf seinem Stuhl – sein Kopf baumelte leicht verdreht über die Rückenlehne – und starrte an das provisorische Zeltdach. Man musste schon extrem müde sein, um eine derart drastische Haltung einzunehmen – oder tot wie ein fehlendes Ohrläppchen. Siri tippte auf Letzteres. Seelenruhig stand er auf, zwängte sich an den Knien der Funktionäre vorbei zum Ende seiner Sitzreihe und weiter zum Platz des verstorbenen Genossen. Die Störung der bislang reibungslos verlaufenen Veranstaltung brachte den Redner auf dem Podium aus dem Konzept. Ratlos blickte er in die raunende Menge.
Siri, dem es diebisches Vergnügen bereitete, ein wenig Schwung in diesen – ansonsten vertanen – Tag zu bringen, fühlte dem alten Funktionär den Puls und verkündete mit unverhohlener Schadenfreude: »Diese Tagung hat ihr erstes Todesopfer gefordert. Und es wird gewiss nicht das letzte sein.«
2
WIEMANEINENPATHOLOGENINDIELUFTJAGT
In Vientiane begann die Obduktion des unbekannten Soldaten nicht zuletzt deshalb mit vierstündiger Verspätung, weil der Sozialismus die Zeit ein wenig dehnbarer gemacht hatte. Da konnte aus 13 auch schon einmal 17 Uhr werden. Und so trudelten Direktor Suk und Chirurg Mot pünktlich zum Feierabend in der Pathologie ein. Der Direktor war durch die Einweihung des ersten klinikeigenen Blumenbeetes aufgehalten worden, das der Vietnamesische Witwenverband dem Krankenhaus gestiftet hatte. Nun wachte ein Regiment leuchtend gelber Chrysanthemen über das Gelände. Gleichzeitig war die erste Abteilung laotischer Schwesternschülerinnen von ihrem Studienaufenthalt in Bulgarien zurückgekehrt. Natürlich hatte Suk sich erst einmal mit ihnen und den Blumen fotografieren lassen und unzählige Dokumente unterzeichnen müssen. Der Doktor hingegen war zur Teilnahme an einem kurzfristig anberaumten Seminar verdonnert worden, das sich von zwölf Uhr mittags bis in den frühen Abend hingezogen hatte, ohne dass es in Sachen Kollektivierung des Bohnenanbaus zu einer Einigung gekommen wäre.
Die Verzögerung hatte den Vorteil, dass der Hauptmann inzwischen komplett aufgetaut war. Und dass Dtui zusätzliche vier Stunden Zeit gehabt hatte, den Soldaten und die Uniform in Augenschein zu nehmen, in der er eingeliefert worden war. Wobei sich ihr anfänglicher Verdacht bestätigt hatte, dass mit dem Toten irgendetwas ganz und gar nicht stimmte. Was, wusste sie zwar noch nicht genau, aber ihr untrüglicher Instinkt sagte ihr, dass die Obduktion unter keinen Umständen wie geplant stattfinden konnte.
Sie stand neben der Leiche und tastete den Unterbauch des Hauptmanns ab, als Chirurg Mot zur Tür hereinmarschiert kam.
»Schwester!«, herrschte er sie an. »Was treiben Sie denn da?« Er war so dünn wie eine Regenspur an einer Fensterscheibe, und seine Frisur erinnerte an eine schlecht sitzende Beatles-Perücke. Seine Nase war groß und aufgequollen, und unter seinen Augen wölbten sich dicke Tränensäcke. Dtui konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Chirurg Mot in der DDR gelitten hatte. Zum Ausgleich dafür befleißigte er sich einer typisch deutschen Arroganz, die nicht recht zu ihm passen wollte. Er hatte nichts Laotisches mehr an sich.
»Dr. Mot«, begann sie.
»Schwester, bitte treten Sie zurück.«
»Aber Genosse …«
»Haben Sie mich nicht verstanden?«
In diesem Moment betrat Direktor Suk den Schneideraum und postierte sich in größtmöglicher Entfernung von der Leiche. Das ganze Krankenhaus wusste, dass ihm alles Medizinische zuwider war. Er war mit Haut und Haaren Bürokrat. Ihm folgte ein Mann in Uniform, dessen Identität sein wohlgehütetes Geheimnis blieb. Dtui hielt ihn für einen militärischen Beobachter, obgleich die Abzeichen auf seiner Brust vom vielen Waschen ausgebleicht waren und er weiße Socken trug, die aus seinen Stiefeln lugten.
Mit dem übertriebenen Schwung eines mediokren Zauberkünstlers riss Mot der Leiche das Handtuch vom Schoß. Dtui wurde von Sekunde zu Sekunde nervöser. Sie wandte sich direkt an Suk.
»Herr Direktor! Ich möchte Ihnen dringend raten, die Obduktion zu verschieben.«
»Ach, so läuft das hier neuerdings«, sagte Suk mit dem üblichen süffisanten Grinsen. »Dr. Siri ist auf Reisen, und seine Assistentin übernimmt die Leitung der Pathologie.«
Mot schnappte sich das große Skalpell und ließ Dtui keine Wahl. Sie ging dazwischen und ergriff sein dürres Handgelenk. Falls es zu einem Gerangel kam, würde sie zwar mit Mot, nicht aber mit allen dreien fertigwerden.
»Was …?« Mot starrte sie entsetzt an.
»Schwester Dtui«, brüllte Suk. »Was ist bloß in Sie gefahren?«
»Diese Leiche«, sagte sie. »Ich glaube …«
»Ja?«
»Ich glaube, sie könnte eine versteckte Sprengladung enthalten.«
Eine Weile herrschte fassungsloses Schweigen, dann brachen die drei Besucher in schallendes Gelächter aus. Mot entwand seine Hand dem festen Griff der Krankenschwester.
»Da hat wohl jemand am Formaldehyd geschnüffelt«, sagte er lachend.
Herr Geung stahl sich unbemerkt in den Lagerraum und ließ Dtui ohne Rückendeckung zurück.
»Ich meine es ernst«, sagte sie. »Sehen Sie hier. Sie sind doch Arzt. Fällt Ihnen am Bauch irgendetwas auf?«
»Könnten wir sie bitte hinauswerfen?«, flehte Mot. »Ich habe keine sechsjährige Ausbildung bei den Besten ihrer Zunft absolviert, um mich in der alten Heimat von einem Bauernmädchen belehren zu lassen. Meine Arbeit ist so schon schwer genug.«
Dtui war vor Wut rot angelaufen.
»Völlig Ihrer Meinung«, sagte Suk. »Verzeihen Sie. Schwester, würden Sie uns freundlicherweise allein lassen? Und kommen Sie doch morgen früh in mein Bü…«
Seine Gesichtszüge entgleisten, als Herr Geung mit einem AK-47 aus dem Lagerraum gestürmt kam. Das Gewehr war auf den neuen Chirurgen gerichtet, der rückwärts gegen einen Laborschrank taumelte.
»S… Sie d… dürfen die Genossin Dt… Dt… Dtui nicht auslachen«, stammelte Geung. »D… d… das gehört sich nicht.«
»Na, na, mein Junge«, sagte Suk, als spräche er mit einem wilden Tier. »Ganz ruhig. Machen Sie keinen …«
Geung riss das AK-47 herum, und der Direktor drückte sich platt wie eine Flunder gegen die Wand. Nur der Soldat rührte sich nicht. Vielleicht spielte sogar der Anflug eines Lächelns um seine Lippen.
»Lassen wir die Schwester ausreden«, schlug er vor.
»Vielen Dank«, sagte Dtui und blickte mit hochgezogenen Augenbrauen zu Geung. »Was eine Frau heutzutage nicht alles anstellen muss, um sich Gehör zu verschaffen.« Sie strich ihren weißen Schwesternkittel glatt, der sich an den Knöpfen spannte, als sie ihre üppige Brust herausstreckte.
»Dr. Mot«, sagte sie. »Ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber Sie wollten ja nicht auf mich hören, dabei geht es möglicherweise um Leben und Tod. Zugegeben, es könnte sich auch um falschen Alarm handeln, aber ich sage immer: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Meinen Sie nicht auch?«
Geung richtete die Waffe wieder auf den Chirurgen, worauf dieser heftig nickte.
»Gut, dann können Sie uns ja vielleicht auch verraten, was Sie am Abdomen des Toten zu erkennen glauben.«
Der Chirurg trat zu der Leiche. »Natürlich, eine Wunde.«
»Ausgezeichnet. Und um was für eine Wunde handelt es sich?«
»Sie ist offenbar ziemlich frisch. Die Fäden sind noch nicht gezogen.«
»Exakt. Und jetzt sehen Sie sich die Wunde etwas genauer an.«
Er beugte sich darüber. »Aber das ist eine ganz norma… Hm. Das ist ja eigenartig.«
»Was?«, fragte der Soldat.
»Sie ist nicht verheilt, es gibt keinerlei Narbengewebe.«
»Und das heißt?«
»Dass dieser Einschnitt post mortem vorgenommen worden ist.«
»Warum sollte jemand eine Leiche aufschneiden und wieder zunähen?«, erkundigte sich der Soldat.
»Gute Frage. Und das ist noch nicht alles«, sagte Dtui. »Fühlen Sie mal hier, Doktor.«
Behutsam führte sie die Hand des Chirurgen zu einer Stelle direkt unterhalb des Rippenbogens. »Nicht zu fest drücken.«
Der Doktor ließ den Finger sacht darübergleiten.
»Eine leichte Wölbung. Vielleicht ein gebrochener Knochen? Nein, dafür ist sie zu schmal.«
»Auf der anderen Seite ist es genau dasselbe«, sagte sie.
»Wirklich? Seltsam.«
»Wenn Sie mich fragen«, meinte Dtui, »hat jemand etwas in seinem Bauch deponiert, als er schon tot war.«
»Und wozu?«, fragte Suk und kratzte sich von der Wand.
»Wenn uns jemand einen Streich spielen will«, fuhr Dtui fort, »ist dieser Jemand ziemlich ausgebufft, um nicht zu sagen pervers. Sonst hätte er uns keine explosive Leiche ins Haus geschickt.«
»Um Himmels willen«, stieß Mot hervor und trat einen Schritt zurück. »Wer macht denn so etwas?«
»Jemand, der etwas gegen Pathologen hat«, mutmaßte Dtui. »Genauer gesagt, jemand, der Dr. Siri nicht eben gewogen ist. Der Täter wusste wahrscheinlich nicht, dass der Doc im Norden weilt und wilde Feste feiert.«
Der Soldat drängelte sich an Geung vorbei und trat an den Tisch. »Wenn sie recht hat, und es spricht einiges dafür, hat Ihre Krankenschwester uns soeben das Leben gerettet.«
»Wenn sie recht hat«, sagte Suk und schielte mit einem Auge auf das AK-47. »Das Ganze klingt doch ziemlich weit hergeholt.«
»Und noch etwas«, fuhr Dtui fort. Die Uniformjacke des Hauptmanns hing über einer Stuhllehne. Sie hob sie hoch und steckte den Finger durch ein kleines Loch im Rücken. »Kennen Sie vielleicht einen Offizier, der in Friedenszeiten wissentlich eine Jacke mit Einschussloch im Rücken tragen würde? In unserer Leiche ist kein entsprechendes Loch, das heißt, der Uniformrock gehört ihr nicht.«
»Stimmt«, sagte der Soldat. »Ich kenne keinen Kommandanten, der den Mann mit einem Loch in der Jacke herumlaufen lassen würde. Womöglich ist er überhaupt kein richtiger Soldat. Und der Täter hat die Leiche lediglich in eine alte Uniform gesteckt.«
»Warum?«, fragte Suk.
»Weil er wusste, dass sie sonst nicht obduziert werden würde«, gab Dtui zu bedenken. »Wenn es sich bei dem Toten dagegen um einen Soldaten handelt, sind wir zu einer Obduktion sogar verpflichtet. Was sagen Sie dazu, Doktor?«
Mot schüttelte ratlos den Kopf.
»Ich würde sagen, Krankenschwestern sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.«
»Trotzdem«, sagte Suk, »brauchen wir eine Bestätigung für diese Sprengstoffhypothese, sonst stehen wir dumm da. Hören Sie, können Sie diesem Idioten nicht sagen, dass er aufhören soll, mit dem Gewehr herumzufuchteln?«
»Die ist doch nur Dekoration, Herr Direktor«, sagte der Soldat. »Selbst wenn er wollte, könnte er damit nicht schießen.«
»Gut erkannt.« Dtui lachte. »Das Gewehr ist ein Theaterrequisit. Das Rote Ballett hat es nach seinem Gastspiel letzten Monat hier vergessen. Wenn es echt wäre, würde unser Herr Geung es nicht einmal mit der Kneifzange anfassen. Er kann keiner Fliege was zuleide tun, nicht wahr, Herzchen?«
Geung verzog den Mund zu einem lückenhaften Grinsen und hielt Direktor Suk die Gewehrattrappe hin, der sie wütend beiseitewischte.
»Was die Bombentheorie angeht«, fuhr Dtui fort. »Wir wissen nicht, wie empfindlich die Sprengladung ist. Ich schlage vor, wir bugsieren ihn vorsichtig in die Kühlkammer zurück und frieren ihn wieder ein. Wenn er steif ist, schaffen wir ihn in die Röntgenabteilung hinüber. Dann werden wir ja sehen, womit wir es zu tun haben.«
»Ausgezeichnete Idee«, meinte der Soldat. »Und in der Zwischenzeit verständige ich für alle Fälle unseren Kampfmittelräumdienst. Gute Arbeit, junge Frau. Sehr gute Arbeit.«
Erst gegen Mitternacht klärte sich die Sache schließlich auf. Wie sich herausstellte, hatte Dtui mit ihrer Vermutung ins Schwarze getroffen. Die Sprengladung in der Bauchhöhle des Hauptmanns war alles andere als raffiniert. Sie bestand aus einem zum Halbkreis gebogenen Sägeblatt aus Federstahl, das der Täter mit Angelschnur fixiert hatte. Am Mittelstück des straff gespannten Bogens war eine Handgranate befestigt, deren Splint über eine zweite Schnur mit dem oberen Ende des Sägeblattes verbunden war. Den gesamten Magen hatte der Bombenbauer entfernt, vermutlich um zu verhindern, dass austretende Magensäure die Schnur vorzeitig zersetzte. Die Sprengladung war so platziert, dass die Bogenenden gegen die Bauchinnenwand drückten. Schon mit einem einfachen Y-Schnitt hätte selbst der versierteste Chirurg die Angelschnur durchtrennt. Der Bogen wäre auseinandergeschnellt und hätte auf einen Schlag sowohl den Splint aus der Granate als auch den messerführenden Pathologen ins Jenseits befördert. Keine Frage: Dr. Mot, Direktor Suk, Geung und der namenlose Soldat verdankten Dtui ihr Leben.
Madame Daeng musste unwillkürlich lachen, als sie erfuhr, dass sie neben einer hochexplosiven Leiche Tee getrunken hatte. Ihre Reaktion verwunderte Dtui ebenso wenig wie der Vorschlag der alten Dame, die Leiche gemeinsam aufzuwärmen. Sie war eine Widerstandskämpferin, eine Saboteurin, wenn nicht sogar eine Mörderin. Was war dagegen schon eine kleine Bombe in einer tiefgefrorenen Leiche? Da sie inzwischen die Arthritis plagte und sie eine Lesebrille brauchte, bezeichnete Madame Daeng sich gern als »eine ganz normale alte Schachtel«.
Doch sie hatte eine scharfe Zunge und ein unverkennbares Blitzen in den Augen. Und im Unterschied zu anderen Frauen ihres Alters trug sie auch keine weiße Wattedauerwelle, sondern eine schicke Kurzhaarfrisur. Hätte es in Laos ein Meer und eine Marineflotte gegeben, hätte sie sämtliche Matrosen mühelos unter den Tisch getrunken. Und sie kannte Geschichten, die selbst einem Mönch die Haare hätten zu Berge stehen lassen.
Dtui hatte Daeng vom ersten Augenblick an in ihr Herz geschlossen, und da sie denselben Mann bewunderten, waren sie geradezu zwangsläufig Freundinnen geworden. Obwohl Dtui älteren Menschen, anders als die meisten Laoten, nicht grundsätzlich Respekt entgegenbrachte, kannte ihre Hochachtung für die alte Dame keine Grenzen. Es war Samstag, und der Mittagsansturm hatte sich gelegt. Sie saßen an einem Tisch vor dem Restaurant, aßen gekochte Erdnüsse und beobachteten die Fischreiher, die auf dem Luftstrom über dem Mekong segelten. Nicht nur Zyniker hatten den Eindruck, dass das andere Ufer in immer weitere Ferne rückte. Seit die Kommunisten vor zwei Jahren die Macht in Laos übernommen hatten, war der Fluss zu einem Ozean geworden und ihr kleines Land zu einer Insel. Im ersten Jahr hatten die Menschen sie aus Angst vor politischer Verfolgung fluchtartig verlassen. Jetzt machten sie die riskante Fahrt über den Fluss, weil sie ihre Kinder nicht ernähren konnten. Die Pasason Lao hatte diese Woche stolz bekannt gegeben, das Pro-Kopf-Einkommen sei auf astronomische neunzig US-Dollar jährlich gestiegen. Dass jedes vierte Kind vor dem Erreichen des fünften Lebensjahres starb, war der Zeitung dagegen keine Meldung wert gewesen. Selbst die Flüchtlinge in den Lagern hinter der Grenze hatten mehr zu essen. Dtui hatte diese Freiheit kurzzeitig gekostet, doch sie war mit Leib und Seele Laotin und liebte ihr Heimatland mit all seinen Vor- und Nachteilen. Auch wenn Letztere langsam, aber sicher überhandzunehmen drohten.
Auf den Telegrafenleitungen am anderen Ufer reihte sich eine Schar Vögel wie Noten zu einer kleinen Melodie. Daeng hatte versucht, die ornithologische Tonfolge zu summen. Jetzt stellte sie ihre Bemühungen ein und sah ihre Freundin an.
»Wird in dem Fall eigentlich ermittelt?«, fragte sie.
»Die Polizei gibt sich die größte Mühe. Aber die Hälfte aller Hauptstadtbeamten weilt in Xieng Khouang, um die Parteitagsdelegierten zu bewachen.«
»So auch Ihr reizender Herr Gemahl.«