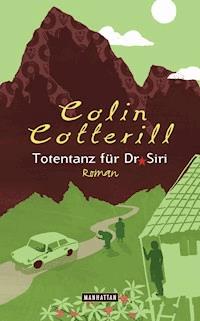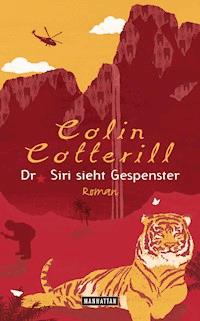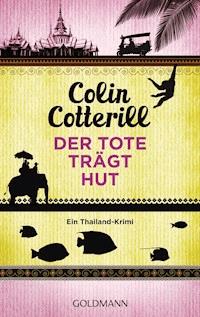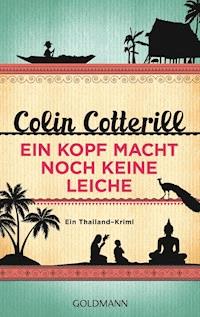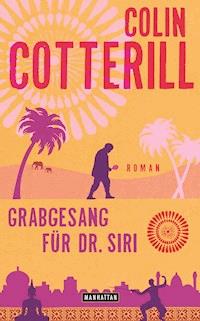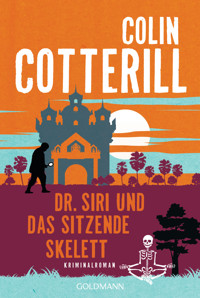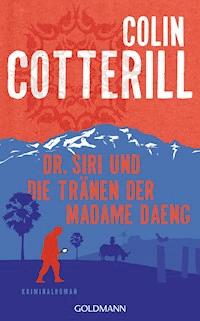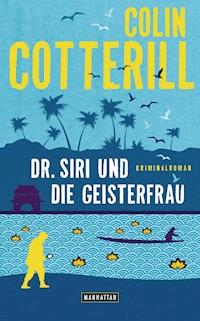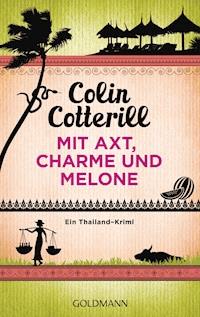Inhaltsverzeichnis
DEMOKRATISCHE VOLKSREPUBLIK LAOS, OKTOBER 1976
Kapitel 1 – VIENTIANE, ZWEI WOCHEN SPÄTER
Kapitel 2 – DIE GATTIN DES GENOSSEN KHAM
Kapitel 3 – REQUIEM FÜR EINEN FISCHER
Kapitel 4 – TRAN DER ÄLTERE
Kapitel 5 – DER HÜHNERZÄHLER
Kapitel 6 – OBDUKTIONSNEID
Kapitel 7 – DER EWIGE REBELL
Kapitel 8 – EIN KLEINER ANGELAUSFLUG
Kapitel 9 – VERSUCHTER MORD
Kapitel 10 – UNTERWEGS NACH KHAMMOUAN
Kapitel 11 – DER HELFER DES EXORZISTEN
Kapitel 12 – ANGST VOR DER LANDUNG
Kapitel 13 – MUSSESTUNDEN
Kapitel 14 – DAS HÄMATOM DER FRISEUSE
Kapitel 15 – STERBENDER SUCCUBUS
Kapitel 16 – TOD DURCH GESCHLECHTSVERKEHR
Kapitel 17 – DAS VERSCHWUNDENE ZIMMER
Kapitel 18 – KLINIK OHNE ÄRZTE
Kapitel 19 – ZWIEGESPRÄCH MIT DEN TOTEN
Kapitel 20 – VERPASSTE FESTE
Kapitel 21 – DER ANDERE FALL
Kapitel 22 – MAN STIRBT NUR DREI MAL
Kapitel 23 – DIE TAFELRUNDE DES TOTEN PATHOLOGEN
Kapitel 24 – DAS DICKE ENDE
Copyright
Herzlichen Dank und alles Liebe:
Pornsawan, Bouasawan, Chantavone, Sounieng, Ketkaew, Dr. Pongruk, Bounlan, Don, Souk, Soun, Michael und seinem Sekretär Somdee, David L, Nok, Dtee, Siri,Yayoi und Steph
DEMOKRATISCHE VOLKSREPUBLIK LAOS, OKTOBER 1976
Tran, Tran und Hok brachen durch die letzten schweren Wolken der Regenzeit. Die warme Nachtluft verzerrte ihre Lippen zu einem gequälten Lächeln und ließ ihnen die Haare buchstäblich zu Berge stehen. Sie fielen in perfekter Formation, wie Hagelkörner. Für elegante Figuren oder waghalsige Kunstflüge war keine Zeit; sie folgten einfach den Bomben, die mit rosa Nylonschnur an ihren Fußgelenken befestigt waren.
Tran der Ältere lag in Führung. Er war der Schwerste der drei. Als er die Oberfläche des Nam-Ngum-Stausees durchschlug, hatte er bereits zwei Sekunden Vorsprung. Bei den Olympischen Spielen hätte er damit eine Note von etwa 9.98 erzielt. Es spritzte kaum. Tran der Jüngere und der doppelttote Hok stachen fast gleichzeitig ins Wasser.
Eine Vierteltonne entschärfter Artillerie zog die drei Männer rasch auf den schlammweichen Grund des Sees und verankerte sie dort. Zwei Wochen lang wiegten sich Tran, Tran und Hok sanft in der Strömung und nährten die Fische und Algen, die sich an ihnen gütlich taten wie an einer träge dahintreibenden Unterseegarküche.
1
VIENTIANE, ZWEI WOCHEN SPÄTER
Es war eine deprimierende Audienz und beileibe nicht die letzte ihrer Art. Jetzt, wo Haeng, der pickelige Richter, wieder da war, musste Siri jeden Freitag bei ihm zum Rapport antreten und seinen Kotau machen vor einem Mann, der ohne Weiteres sein Enkel hätte sein können.
Die Marxisten-Leninisten nannten eine solche Aussprache »Enlastungsschulung«. Aber nachdem er eine geschlagene Stunde vor Richter Haengs verzogenem Sperrholzpult gesessen hatte, drückte ihn seine Last noch schwerer als zuvor. Der frischgebackene Richter machte sich einen Spaß daraus, laienhafte Zweifel an Siris Obduktionsberichten anzumelden und deren Rechtschreibung zu korrigieren.
»Und worauf führen Sie den Blutverlust zurück?«, erkundigte sich Richter Haeng.
Siri überlegte zum wiederholten Mal, ob es sich um eine Fangfrage handelte. »Nun ja.« Er dachte einen Augenblick nach. »Vielleicht auf das Unvermögen des Körpers, das Blut bei sich zu behalten?« Der kleine Richter machte »Hm« und warf einen neuerlichen Blick in den Bericht. Er war selbst für Sarkasmus zu dumm. »Es könnte natürlich auch damit zu tun haben, dass dem armen Mann die Beine oberhalb der Knie abgeschnitten wurden. Es steht alles im Bericht.«
»Das sagen Sie, Genosse Siri. Ich hingegen kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Sie bei der Auswahl dessen, was Sie Ihren Lesern mitzuteilen gedenken, äußerst selektiv verfahren. Ich würde es begrüßen, wenn Sie künftig etwas mehr ins Detail gehen könnten. Außerdem habe ich, ehrlich gesagt, so meine Zweifel, ob tatsächlich der Blutverlust zum Tod geführt hat und nicht doch...«
»Herzversagen?«
»Genau. Als ihm die Beine abgetrennt wurden, war das ohne Frage ein fürchterlicher Schock. Da wäre es doch durchaus möglich, dass er einen Herzanfall erlitten hat. Er war schließlich nicht mehr der Jüngste.«
Schon in den drei zuvor besprochenen Fällen hatte der Richter für eine natürliche Todesursache plädiert und versucht, die Fakten entsprechend zu verdrehen, aber dies war sein bislang kreativster Vorschlag. Siri hatte das Gefühl, dass der Richter regelrecht entzückt gewesen wäre, wenn in sämtlichen Obduktionsberichten, die über seinen Schreibtisch wanderten, »Herzversagen« gestanden hätte.
Gewiss, das Herz des Fischers hatte aufgehört zu schlagen, aber das war eher das untrügliche Zeichen für seinen Tod als dessen eigentliche Ursache. Die mit einer neuen Panzerung versehene Armeebarkasse war gegen den Betonkai in Tha Deua gekracht. Wegen des zusätzlichen Gewichts hatte sie besonders tief im Wasser gelegen. Zum Glück der Besatzung wurde der Aufprall durch den Fischer abgefangen, der in seinem hölzernen Langboot an der Kaimauer stand und der Barkasse nicht ausweichen konnte. Wie so viele Fischer auf dem Mekong war er Nichtschwimmer.
Das vorspringende Stahldeck schnitt ihn entzwei wie eine Sichel einen Reishalm, während die Reling ihn gegen die Mauer presste. Der peinlich berührte Kapitän und seine Crew zogen ihn – oder, besser, seinen Torso – an Deck, wo er in dumpfer Verwirrung liegen blieb, lachend und plappernd, als wüsste er nicht, dass ihm zwei Gliedmaßen fehlten.
Das Boot setzte zurück, und die Leute am Ufer sahen, wie die abgetrennten Beine ins Wasser fielen und versanken. Binnen weniger Stunden würden sie vermutlich aufschwemmen und wieder an die Oberfläche treiben. Dennoch standen die Chancen schlecht, dass der Mann zusammen mit seinen Beinen beerdigt werden würde: Er hatte verschiedenfarbige Plastiksandalen getragen.
»Wenn Sie als Todesursache prinzipiell ausschließlich Herzversagen gelten lassen, weiß ich nicht, warum wir überhaupt einen Pathologen brauchen, Genosse.« Siri verlor allmählich die Geduld, obwohl er sich gewöhnlich nicht so schnell aus der Ruhe bringen ließ. In seinen zweiundsiebzig Lebensjahren hatte er so viel durchgemacht, dass er inzwischen über die Gelassenheit eines Astronauten verfügte, der ziellos durchs All treibt. Obwohl er dem Buddhismus nur unwesentlich näher stand als dem Kommunismus, half ihm die Meditation, seinen Zorn im Zaum zu halten. Niemand hatte ihn je aus der Haut fahren sehen.
Dr. Siri Paiboun wurde oft als Zwerg bezeichnet. Er hatte die seltsame Statur eines buckligen Leichtgewichtsringers. Beim Gehen schien es, als hätte seine untere Körperhälfte Mühe, mit der oberen Hälfte Schritt zu halten. Sein kurzgeschnittenes Haar war schneeweiß. Während viele Laoten seines Alters eines schönen Tages aufwachten und feststellten, dass der Herr im Himmel ihrem Haar auf wundersame Weise das jugendliche Schwarz zurückgegeben hatte, wusste Siri mit seinem kärglichen Salär wahrhaftig Besseres anzufangen, als es für chinesisches Yu-Dum-Haarfärbemittel auf den Kopf zu hauen. Nichts an ihm war unecht, künstlich oder nachgemacht. Er war ganz er selbst.
Sein Bartwuchs ließ zu wünschen übrig, dafür sprossen seine Brauen umso wilder. Inzwischen wucherten sie derart üppig, dass man seine sonderbaren Augen kaum erkennen konnte. Selbst Reisende, die zehnmal um die Erde gefahren waren, hatten solche Augen noch nie gesehen. Sie waren hellgrün wie der Filz auf einem Snookertisch und amüsierten Siri immer wieder, wenn sie ihm aus dem Spiegel entgegenstarrten. Er wusste nicht viel über seine leiblichen Eltern, aber dass außerirdisches Blut in seinen Adern floss, hielt er für unwahrscheinlich. Wie er zu solchen Augen gekommen war, konnte er weder sich noch anderen erklären.
Obwohl die »Entlastungsschulung« bereits vierzig Minuten dauerte, hatte Richter Haeng ihm noch kein einziges Mal in die Augen geblickt. Er hatte auf seinen zuckenden Bleistift gestarrt. Auf den lose baumelnden Manschettenknopf des Doktors. Er hatte angestrengt durch das zerbrochene Jalousiefenster gespäht, als funkelte der rote Stern am Abendhimmel über dem Justizministerium. Aber er hatte nicht ein einziges Mal in Siris leuchtend grüne Augen geschaut.
»Selbstverständlich brauchen wir einen Pathologen, Genosse Siri, denn wie Sie wohl wissen, ist jedes sozialistische System allen Brüdern und Schwestern Rechenschaft schuldig. Das revolutionäre Bewusstsein gedeiht allein im hellen Schein des sozialistischen Leuchtturms. Dennoch hat das Volk ein Recht darauf, die saubere Unterwäsche des Leuchtturmwärters auf den Felsen trocknen zu sehen.«
Verdammt, eins musste man dem Knaben lassen: Er war ein wahrer Meister in der Kunst, zur richtigen Zeit genau die falsche Losung aus dem Hut zu zaubern. Wer sich im stillen Kämmerlein Gedanken über derlei Sprüche machte, kam schnell und unausweichlich zu dem Schluss, dass sie rein gar nichts zu bedeuten hatten. Siri betrachtete das blässliche Bürschchen und empfand einen Anflug von Mitleid.
Haengs einziger Anspruch auf Respekt bestand in einem sowjetischen Juradiplom auf so dünnem Papier, dass man dadurch die Wand sehen konnte, an der es hing. Er hatte seine Ausbildung im Eilverfahren absolvieren müssen, um eine der zahlreichen Lücken zu schließen, die durch die überstürzte Flucht der Oberschicht entstanden waren. Er hatte in einer Sprache studiert, die er eigentlich nicht verstand, und ein Diplom erhalten, das er eigentlich nicht verdiente. Die Sowjets setzten seinen Namen auf die Liste der asiatischen Kommunisten, die im großen, ruhmreichen Mutterland des Sozialismus ihre Erziehung genossen hatten.
Siri war der Ansicht, dass ein Richter im Laufe eines langen Lebens Schritt für Schritt zur Weisheit finden, gleichsam Jahresringe des Wissens ansetzen musste, und es nicht damit getan war, bei einem russischen Multiple-Choice-Test zufällig die korrekten Antworten getippt zu haben.
»Kann ich jetzt gehen?« Siri stand auf und ging zur Tür, ohne die Erlaubnis abzuwarten.
Haeng sah ihn an, als sei er der letzte Dreck. »Ich glaube, das nächste Mal müssen wir uns dringend über Ihre Einstellung unterhalten. Meinen Sie nicht auch?«
Siri lächelte und verkniff sich einen Kommentar.
»Und, Doktor« – der Pathologe stand mit dem Gesicht zur Tür – »was glauben sie wohl, warum die demokratische Republik ihren Beamten gratis schwarze Qualitätsschuhe zur Verfügung stellt?«
Siri betrachtete seine zerschlissenen braunen Sandalen. »Um den Chinesen Arbeit zuzuschustern?«
Richter Haeng senkte den Blick und schüttelte in Zeitlupe den Kopf. Diese Geste hatte er sich bei älteren Männern abgeschaut, und sie passte nicht zu ihm.
»Wir leben nicht mehr im Urwald, Genosse. Und wir hausen auch nicht mehr in Höhlen. Wir verlangen den Respekt der Massen, und unsere Kleidung spiegelt unseren Status in der neuen Gesellschaft wider. Zivilisierte Menschen tragen Schuhe. Die Genossen erwarten das von uns. Haben Sie mich verstanden?« Er sprach jetzt langsam, wie eine Krankenschwester mit einem senilen Patienten.
Siri wandte sich zu ihm um, ohne sich die Demütigung anmerken zu lassen. »Ich glaube schon, Genosse. Aber ich finde, wenn das Proletariat mir schon die Füße küssen will, sollte ich ihm wenigstens ein paar Zehen bieten, um die es seine zarten Lippen schließen kann.«
Er riss die verklemmte Tür auf und ging hinaus.
Am Ende dieses langen Freitags ging Siri durch die staubigen Straßen von Vientiane nach Hause. Normalerweise schenkte er jedem ein fröhliches Lächeln, doch dieses Lächeln wurde neuerdings immer seltener erwidert. Zwar hatten die Händler, die ihn kannten, stets ein freundliches Wort für ihn bereit, aber Fremde schienen seine Miene häufig zu missdeuten. »Weiß er mehr als wir, der kleine Mann? Oder warum lächelt er?«
Er sah eine Gruppe von Beamtinnen, die sich nach getaner Arbeit auf den Heimweg machten. Sie alle trugen Khakiblusen und die traditionellen knöchellangen, schwarzen Phasin, die steif an ihnen herunterhingen. Dennoch gelang es ihnen, ihrer Uniform eine persönliche Note zu geben: hier eine Brosche, da ein anderer Kragen, dort ein individueller Faltenwurf.
Er sah Schulkinder in weißgeschrubbten Hemden und kratzigen roten Schals. Der zurückliegende Tag hatte sie offenbar so sehr verstört, dass ihnen die Lust am Kichern oder Herumalbern vergangen war. Siri konnte es ihnen nachfühlen.
Er sah dunkle, halbleere Geschäfte, die alle die gleichen Waren feilzubieten schienen. Er sah den Brunnen, in dessen Hähnen Insekten nisteten, und unfertige Häuser, an deren Bambusgerüsten sich Efeu emporrankte.
Er brauchte zwanzig Minuten bis nach Hause: Zeit genug, um die lästige Erinnerung an Richter Haeng zu verdrängen. Siri wohnte in einem von den Franzosen erbauten alten, zweistöckigen Haus mit einem kleinen Vorgarten, randvoll mit Gemüse. Dem Gebäude fehlte es praktisch an allem: Farbe, Mörtel, intakten Fensterscheiben, Kacheln; aber damit war in nächster Zeit wohl nicht zu rechnen.
Saloop kam im Halbschlaf wie ein Krokodil zwischen den Kohlköpfen hervorgekrochen und jaulte Siri an. Der Hund jaulte ihn – und nur ihn – an, seit er vor zehn Monaten hier eingezogen war. Niemand wusste, weshalb das räudige Vieh es ausgerechnet auf den Doktor abgesehen hatte, aber wer konnte schon ahnen, was im Kopf eines Hundes vorging?
Auf Saloops gespenstisches Geheul erhob sich in der Nachbarschaft wildes Gebell, während Siri die knarrende Haustür aufstieß. Er konnte sich nie unbemerkt hereinschleichen. Selbst die Treppe verriet ihn. Unter seinen Schritten hallte ihr Ächzen durch den leeren Flur, und die losen Dielen kündeten von seiner Ankunft auf der Galerie.
Weder die Haustür noch die Tür zu seinem Zimmer war verschlossen. Das war auch nicht nötig. Es gab schließlich keine Kriminalität. Seine Wohnung ging nach hinten hinaus, mit Blick auf den kleinen Haisok-Tempel. Er stieg rückwärts aus seinen Sandalen und trat ein. Am Fenster erwartete ihn ein mit Büchern übersäter Schreibtisch. An der Wand lag eine dünne Matratze zusammengerollt unter einem Moskitonetz. Drei mit rissigem PVC bezogene Stühle drängten sich um einen blechernen Teetisch, und ein fleckiger kleiner Ausguss thronte auf einem dicken Eisenrohr.
Das Badezimmer im Parterre teilte er sich mit zwei Paaren, drei Kindern und einer Frau, ihres Zeichens amtierende Leiterin der erziehungswissenschaftlichen Abteilung des Bildungsministeriums. Eine der vielen Segnungen, die der Sieg der Kommunisten mit sich gebracht hatte. Aber da die Verhältnisse nicht schlechter waren als zuvor, beklagte sich niemand. Er entzündete die Flamme seines Gaskochers und setzte einen Kessel Kaffeewasser auf. Es war eigentlich ganz schön, wieder zu Hause zu sein.
Noch wusste er nicht, dass ihm an diesem Wochenende ein seltsames Erwachen bevorstand, und das gleich in doppelter Hinsicht. Den Freitagabend verbrachte er am Schreibtisch und las im Schein der Öllampe, bis ihm das Geschwirr der Motten lästig wurde. Von seiner Matratze aus beobachtete er, wie der Mond hinter einer Wolke und noch einer und noch einer verschwand, bis er schließlich in einen friedlichen Schlaf sank.
Siris Traumwelt war immer schon bizarr gewesen. Als Kind hatten ihn die Bilder, die dort lauerten, fortwährend aus dem Schlaf gerissen. Dann trat die kluge Frau, bei der er aufwuchs, an sein Bett und erklärte ihm, dies seien seine Träume, in seinem Kopf, und darum habe er von ihnen auch nichts zu befürchten. Er lernte, erhobenen Hauptes durch seine Albträume zu wandeln und sich von ihnen keinen Schrecken einjagen zu lassen.
Nun hatte er zwar keine Angst mehr, aber noch immer keine Macht über seine Träume. So gelang es ihm zum Beispiel nicht, ungebetene Gäste fernzuhalten. Immer wieder suchten ihn in seinen Träumen Fremde heim, die nicht die Absicht hatten, zu seiner Unterhaltung beizutragen. Sie lungerten faul und untätig herum, als sei Siris Kopf ein Wartezimmer. Er hatte nicht selten das Gefühl, dass seine Träume sich hinter den Kulissen der Träume anderer abspielten.
Aber die bei weitem kuriosesten Besucher seines Unterbewusstseins waren die Toten. Seit seinem ersten Todesfall, dem ersten von Kugeln durchsiebten Opfer einer Schießerei, das auf seinem Operationstisch gestorben war, hatten ihm ausnahmslos alle, die vor seinen Augen vom Diesseits ins Jenseits gegangen waren, einen Besuch abgestattet.
Als junger Arzt hatte er sich gefragt, ob das vielleicht die Strafe dafür war, dass er sie nicht gerettet hatte. Keiner seiner Kollegen wusste von solchen Heimsuchungen zu berichten, und ein Psychologe, mit dem er in Vietnam zusammengearbeitet hatte, glaubte, sie seien nichts weiter als Manifestationen seiner Gewissensbisse. Jeder Arzt frage sich, ob er auch wirklich alles für seinen Patienten getan habe. In Siris Fall, meinte der Seelenforscher, nähmen diese Zweifel plastische Gestalt an. Was Siri einigermaßen beruhigte, war der Umstand, dass die Verstorbenen in seinen Träumen ihm keine Schuld an ihrem Ableben gaben; sie waren bloße Zeugen, die das Geschehen wie er stumm verfolgten. Sie hatten ihn noch nie bedroht. Der Psychologe versicherte ihm, dies sei ein gutes Zeichen.
Seit Siri als Pathologe arbeitete und mit den Leichen ihm unbekannter Menschen in Berührung kam, hatten diese Erscheinungen an Tiefe und Bedeutsamkeit gewonnen. Aus irgendeinem Grunde wusste er um die Gefühle und den Charakter der Toten. Dabei schien es keine Rolle zu spielen, wann das Leben aus ihnen gewichen war; seine Traumwelt konnte ihren Geist auch nach Jahren noch rekonstruieren. Wenn er sich dann mit ihnen unterhielt, bekam er eine Ahnung vom Wesen der Menschen, die sie zu Lebzeiten gewesen waren.
Natürlich konnte Siri sich seinen Freunden und Kollegen unmöglich anvertrauen. Es hatte schließlich niemand etwas davon, wenn er gestand, dass ihn nach Einbruch der Dunkelheit der Wahnsinn packte. Denn seine Anwandlungen waren erstens völlig harmlos und drängten ihn zweitens, den sterblichen Hüllen der Toten mit größerem Respekt zu begegnen, weil er wusste, dass ihre ehemaligen Bewohner früher oder später zurückkehren würden.
Angesichts der mysteriösen Dinge, die Siri im Schlaf durchlebte, war es kaum verwunderlich, dass er oft verwirrt erwachte. Und so fand er sich auch an diesem Samstagmorgen in einer solchen Weder-noch-Dimension wieder. Er wusste, dass er in seinem Zimmer war und eine Mücke ihn zweimal in den Finger gestochen hatte. Er hörte den Wasserhahn tropfen. Er roch den Duft des Laubes, das im Tempelgarten verbrannt wurde. Trotzdem träumte er noch.
Auf einem der beiden Stühle saß ein Mann. Die Morgensonne sickerte durch den Stoffvorhang gleich hinter seinem Kopf. Wegen des Moskitonetzes konnte Siri sein Gesicht nicht erkennen, aber eine Verwechslung war ausgeschlossen. Er trug kein Hemd, und sein schmächtiger Oberkörper war mit verblassten blauen Mantratätowierungen bedeckt. Unter seinem karierten Lendenschurz ragten zwei Beinstümpfe hervor. Das geronnene Blut hatte dieselbe Farbe wie der PVC-Bezug.
»Wie fühlen Sie sich?«, fragte Siri. Schon komisch, einem Toten eine solche Frage zu stellen, aber dies war schließlich ein Traum. Er bemerkte das schrille Jaulen der Hunde auf der Straße vor dem Haus. Die Anzeichen dafür, dass er bei Bewusstsein war, mehrten sich, aber der Fischer wollte partout nicht verschwinden.
Er saß da, sah Siri an, und ein zahnloses Grinsen machte sich in seiner unteren Gesichtshälfte breit. Dann wandte er den Blick und streckte einen langen dürren Finger aus. Siri setzte sich im Bett auf, damit er besser sehen konnte. Auf dem blechernen Teetisch stand eine Flasche Mekong-Whisky. Oder vielmehr eine Mekong-Flasche, denn der Inhalt war dunkler und dickflüssiger als Whisky. Siri tippte auf Blut, aber das war typisch für seine krankhafte Fantasie.
Er sank wieder in die Kissen und fragte sich, wie wach er eigentlich noch werden musste, damit der alte Mann endlich verschwand. Leise bauschte sich der Vorhang, und der Wind trug frischen Tempelrauch ins Zimmer. Er war einen Moment lang abgelenkt, und plötzlich kamen ihm Zweifel. Der Kopf des Fischers konnte ebenso gut eine Falte im Vorhang sein, sein Körper die Vertiefung, die unzählige Rücken in der Stuhllehne hinterlassen hatten.
Als hätte ein Dirigent seinen Stab geschwungen, verstummte der Hundechor, und Siri hörte nur noch das Tropfen des Wasserhahns. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr, er war wach. Wieder staunte er über die Magie der Träume, seiner Träume, und kicherte bei dem Gedanken, dass einer seiner Gefangenen einen Fluchtversuch unternommen hatte.
Erfrischt und seltsam gut gelaunt schlug er das Moskitonetz zurück und stand auf. Er sah die Mücke, die sich zu ihm hineinverirrt und sich an seinem Blut gemästet hatte. Sie flog zum Fenster hinaus, um mit ihrer Heldentat zu prahlen.
Siri setzte den Wasserkessel auf, zog den schiefhängenden Vorhang zu und stellte sein kleines Transistorradio auf den Tisch. Es war eine Sünde, aber dieser Sünde machte er sich gerne schuldig.
Die Sendungen des laotischen Rundfunks dröhnten ab fünf Uhr morgens aus den öffentlichen Lautsprecheranlagen in der ganzen Stadt. Manche Mitbürger hatten die zweifelhafte Ehre, mit Erfolgsmeldungen über die nationale Reisernte aus dem Bett geworfen zu werden. Anderswo ließen gellende Ratschläge zur Bekämpfung der allgemeinen Schneckenplage die Wände erzittern.
Aber Siri befand sich in einem segensreichen schwarzen Loch, so weit von den Lautsprechern entfernt, dass er die Durchsagen nur als fernes Gemurmel wahrnahm. Stattdessen lauschte er seinem geliebten Transistorradio. Wenn er es nicht allzu laut drehte, konnte er die Weltnachrichten des thailändischen Militärsenders hören. Im laotischen Rundfunk kam ihm die Welt in letzter Zeit etwas zu kurz.
Die Sendungen des thailändischen Rundfunks und Fernsehens waren in der Demokratischen Volksrepublik naturgemäß verboten. Zwar kam man nicht gleich ins Gefängnis, wenn man sie hörte, aber früher oder später klopfte der Abschnittsbevollmächtigte an die Tür und rief so laut, dass die ganze Nachbarschaft es hören konnte: »Genosse, wissen Sie denn nicht, dass diese ausländische Propaganda Sie nur auf verquere Gedanken bringt? Sind wir nicht alle zufrieden mit dem, was wir haben? Warum müssen wir den Kapitalistenschweinen Genugtuung verschaffen, indem wir uns ihren Schmutz und Schund anhören?«
Der Name des Übeltäters wurde auf eine Liste von Subversiven vierter Klasse gesetzt, und theoretisch konnten seine Mitarbeiter ihm das Vertrauen entziehen. In Siris Augen entging dem laotischen Volk durch den Erlass allenfalls ein wenig wohlverdiente Unterhaltung.
Die Thais waren entsetzt, dass gleich nebenan, in Laos, die bösen Kommunisten Einzug gehalten hatten. Zudem gehörte Subtilität nicht unbedingt zu den Stärken ihres Militärs, weshalb Siri dessen Sendungen besonders gerne hörte. Hätte das Politbüro den freien Empfang des Thai-Rundfunks gestattet, hätte das Volk selbst entschieden, in welchem System es leben wollte, davon war Siri überzeugt.
Den Kommentaren thailändischer »Experten« zufolge hegten die Roten eine angeborene Vorliebe für den Partnertausch, eine Schwäche, die ihre Gesellschaft in ein derartiges Chaos stürze, dass »Inzest unvermeidlich« sei. Ob es tatsächlich dem Kommunismus anzulasten war, dass immer mehr Kinder mit zwei Köpfen geboren wurden, vermochte Siri nicht zu sagen, aber der thailändische Rundfunk konnte dies mit Zahlen einwandfrei belegen.
Die Samstagmorgensendungen hörte er am liebsten, weil die Thais annahmen, dass die Laoten sich am Wochenende um ihre Empfangsgeräte scharten und nach Propaganda förmlich gierten. Aber heute war Siri nicht recht bei der Sache. Er kam noch nicht einmal dazu, das Radio einzuschalten. Er trug seinen dicken, braunen Vietnam-Kaffee zum Tisch, setzte sich auf seinen Lieblingsstuhl und sog den köstlichen Duft tief ein. Der Kaffee roch sehr viel besser, als er schmeckte.
Er wollte eben einen Schluck trinken, als er auf der blechernen Tischplatte etwas schimmern sah. Es war ein Wasserkringel, wie von einem feuchten Glas. Das war nicht weiter bemerkenswert, nur hatte er heute Morgen noch nichts auf den Tisch gestellt. Sein Becher war trocken, und er hielt ihn in der Hand. Und bei dem heißen Klima von Vientiane konnte er unmöglich noch vom Vorabend stammen.
Er nippte an seinem Kaffee, starrte versonnen auf den Wasserkringel und versuchte, sich einen Reim darauf zu machen. Sein Blick wanderte zu dem Stuhl, wo ihm die morgendlichen Schatten etwas vorgegaukelt hatten, und wieder zurück zum Tisch. Perverserweise befand sich der Kringel genau an der Stelle, wo die Whiskyflasche des Fischers gestanden hatte. Siri drehte sich um und riss ein Stück Papier von der Rolle im Wandregal.
Als er sich wieder dem Tisch zuwandte, war der Wasserkringel verschwunden.
Sein zweites seltsames Erwachen an diesem Wochenende war nicht ganz so mysteriös. Fräulein Vong vom Bildungsministerium hatte die Angewohnheit, erst an die Tür zu klopfen, nachdem sie eingetreten war. Sie hatte Siri schon oft beim An- oder Ausziehen überrascht und warf ihm jedes Mal strafende Blicke zu. Wäre er so bei ihr hereingeplatzt, hätte sie ihn gewiss längst vor Gericht gezerrt.
Aber als sie an diesem Sonntagmorgen kam, lag er noch im Bett und schlief, woraus er schloss, dass es noch früh sein musste. Vom Tempel wehte bereits Weihrauchduft ins Zimmer, aber die Hähne träumten noch von majestätischen Flügen über Berge und Seen.
»Na los, Sie Schlafmütze. Raus aus den Federn.«
Da sie keine eigenen Kinder hatte, war sie dazu übergegangen, alle und jeden zu bemuttern. Sie trat ans Fenster und riss den Vorhang auf. Das Licht strömte nicht herein, es quoll. Es war in der Tat noch früh. Sie stemmte die Hände in die Hüften. »Wir müssen einen Bewässerungsgraben ausheben.«
Er stöhnte innerlich. Gab es eigentlich keine Wochenenden mehr, keine Freizeit, keine Feiertage? Schon samstags wurde aus einem halben unweigerlich ein ganzer Arbeitstag, und jetzt wollten sie ihm auch noch den Sonntag stehlen. Mühsam klappte er ein Auge auf.
Fräulein Vong trug eine Arbeitshose aus Cord und eine praktische, an Hals und Handgelenken zugeknöpfte langärmelige Bluse. Sie hatte ihr dünnes Haar zu Zöpfen geflochten und erinnerte Siri an die auf Mao-Postern verewigte chinesische Bäurin. Die chinesische Propaganda ging mit Gesichtszügen ebenso sparsam um, wie die Natur es bei Fräulein Vong getan hatte. Sie war zwischen dreißig und sechzig und hatte die Statur eines unterernährten Knaben.
»Warum foltern Sie mich so? Lassen Sie mich in Ruhe.«
»Nichts da. Sie haben sich schon letzten Monat vor dem gemeinschaftlichen Anstreichen des Jugendzentrums gedrückt. Da möchte ich Ihnen die Gelegenheit, einen Überlaufkanal zu graben, nur ungern nehmen.«
In Vientiane war der Gemeinschaftsdienst keine Strafe; er war vielmehr eine Belohnung für brave Bürger. Ein Geschenk des Staates an das Volk. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind sollte den Stolz empfinden dürfen, der einem beim Asphaltieren einer Straße oder dem Ausbaggern eines Baches die sprichwörtliche Brust schwellen ließ. Die Regierung wusste, dass die Menschen für dieses Vergnügen mit Freuden auf ihren einzigen freien Tag verzichteten.
»Ich bin erkältet«, sagte er und zog sich die Decke über den Kopf. Er hörte, wie sich ein Kessel plätschernd mit Wasser füllte und das Fauchen der Gasflamme. Er spürte einen Luftzug und hörte das Rascheln des Moskitonetzes, das am Wandhaken befestigt wurde. Er hörte, wie der Strohbesen über den Fußboden glitt.
»Darum braue ich Ihnen jetzt eine kräftige Tasse Tee mit einem Schuss...«
»Ich mag keinen Tee.«
»Unsinn.«
Er lachte. »Ich dachte, nach zweiundsiebzig Lebensjahren wüsste ich, was ich mag und was nicht.«
»Sie müssen sich für den Arbeitseinsatz stärken.«
»Gibt es eigentlich keine Strafgefangenen mehr? Früher waren die für so etwas zuständig. Gräben ausheben, Abwasserkanäle reinigen.«
»Ich muss mich doch sehr wundern, Dr. Siri. Manchmal frage ich mich, ob Sie wirklich für die Revolution gekämpft haben. Es gibt keine Entschuldigung mehr dafür, unsere Drecksarbeit von den Ungebildeten und Unwissenden erledigen zu lassen. Eine Spitzhacke oder Axt schwingen kann schließlich jeder.«
»Und eine krebskranke Leber sezieren?«, murmelte er unter der Decke.
»Ist ein Genosse auf kriminelle Abwege geraten, wird er zur Umerziehung auf die Inseln geschickt. Das wissen Sie doch. Also. Stehen Sie freiwillig auf, oder muss ich Gewalt anwenden?«
Er beschloss, sie für ihre unangemessene Vertraulichkeit zu bestrafen.
»Nein. Ich stehe auf. Aber ich muss Sie warnen, ich bin nackt und habe eine Morgenerektion. Das hat nichts mit Sex zu tun. Die Blase drückt auf...«
Ein leises Klicken war zu hören, gefolgt vom Poltern der losen Dielen auf der Galerie. Er schlug die Decke zurück und blickte sich triumphierend im leeren Zimmer um.
Als er nach unten ging, standen dort zwei Lastwagen, beladen mit ebenso verschlafenen wie schweigsamen Nachbarn, die sich vor Begeisterung fast überschlugen. Der Bereich 29C stellte die Arbeitskräfte für die Bewässerungskanalsektion 189. Der Einsatz würde fast den ganzen Tag in Anspruch nehmen, dafür gab es ein kostenloses Mittagessen, bestehend aus Klebreis, Salzfisch und Tamnin-Efeu.
Er wehrte Saloops lethargische Attacke ab und kletterte auf den hinteren Laster. Er hatte Fräulein Vong auf dem vorderen Wagen entdeckt, wo sie dem jungen Pärchen aus dem Zimmer gegenüber eine Gardinenpredigt hielt. Er nickte und scherzte mit seinen Nachbarn, als sich der Konvoi in Bewegung setzte. Sie nickten und scherzten zurück. Aber echt war diese gute Laune nicht.
Obwohl er sich der Kommunistischen Partei aus höchst zweifelhaften Gründen angeschlossen hatte, war Siri seit siebenundvierzig Jahren zahlendes Mitglied. Dabei war er ein zutiefst ungläubiger Kommunist. Er vertrat vielmehr zwei widersprüchliche Theorien: dass der Kommunismus die einzige Lebensform sei, die dem Menschen Glück und Zufriedenheit verschaffe; und dass der Mensch den Kommunismus auf Grund seiner egoistischen Natur nie mit Erfolg würde praktizieren können. Woraus logischerweise folgte, dass der Mensch nie glücklich und zufrieden werden konnte. Die Geschichte, und mit ihr eine schier endlose Reihe verbitterter politischer Idealisten, schien ihm recht zu geben.
Nach einem langen und beschwerlichen Weg durch das französische Bildungssystem, ein wild wucherndes Dickicht von Restriktionen gegen die Armen, hatte er schließlich und endlich den Beweis erbracht, dass es auch ein armer Junge vom Land zu etwas bringen konnte. Nach ausgiebiger Suche fand er einen solventen französischen Gönner, der ihn nach Paris schickte. Dort wurde er ein zwar kompetenter, aber keineswegs brillanter Medizinstudent. Frankreich war nicht eben berühmt dafür, jenen bedauernswerten Kreaturen, die außerhalb der Landesgrenzen zur Welt gekommen waren, das Leben zu erleichtern. Hier war jeder homme auf sich selbst gestellt.
Aber Siri war ein geübter Kämpfer. Da er sich durch nichts ablenken ließ, gehörte er in seinen ersten beiden Jahren in Ancienne zum oberen Drittel seines Jahrgangs. Seine Dozenten waren sich einig, dass er vielversprechende Ansätze zeige – »für einen Asiaten«. Doch dann erkannte er, wie schon manch anderer brave Mann vor ihm, dass alles Potential der Welt buchstäblich nichts war gegen schöne Brüste. Im dritten Jahr saß er im Pathologiekurs und konzentrierte sich nicht etwa auf die riesige, mit Zeichnungen und Diagrammen bedeckte Tafel, sondern auf die Wölbungen unter Bouas Pullover. Boua war eine rotwangige laotische Pflegeschülerin, die bei jedem Wetter am Fenster saß. An ihrem Pullover ließ sich hervorragend ablesen, wie kalt es draußen war. Im Sommer wölbte sich statt seiner eine Bluse, an der eindeutig mehr Knöpfe als nötig offen standen. Siri schaffte es mit Ach und Krach durch die Pathologie und stürzte vom oberen Drittel ins untere Fünftel ab.
Im vierten Jahr waren Boua und er verlobt und teilten sich ein Zimmer, das so klein war, dass sie das Bett hatten absägen müssen, weil sich die Tür sonst nicht öffnen ließ. Sie war eine kerngesunde, kurvenreiche junge Frau aus Laos’ alter Kaiserstadt Luang Prabang und entstammte einer Familie, die dem Königshaus seit Generationen treu ergeben war. Doch während ihre Eltern vor dem König auf die Knie fielen, sich verbeugten und ihm Orchideenblätter vor die Füße streuten, plante sie in ihrem Zimmer seinen Sturz.
Von der Kommunistischen Partei Frankreichs hatte sie durch ihren ersten Geliebten erfahren, einen dürren jungen Dozenten aus Lyon. Bei der ersten besten Gelegenheit war sie in ihr Mekka aufgebrochen. Während Siri nach Paris gekommen war, um Arzt zu werden, diente Boua ihre Ausbildung zur Krankenpflegerin als Vorwand: Sie war nach Paris gekommen, um eine möglichst gute Kommunistin zu werden und die unterdrückten Massen in ihrem Heimatland vom Joch der Knechtschaft zu befreien.
Eines machte sie Siri unmissverständlich klar: Wenn er ihre Hand wolle, müsse er auch der Roten Fahne ewige Treue schwören. Er wollte nicht nur ihre Hand, sondern auch den Rest ihres wunderschönen Körpers, und dafür schienen ihm vier Abende die Woche, jeder zweite Sonntag und fünf Francs im Monat ein mehr als angemessener Preis. Anfangs war es ihm unangenehm, sich mit Leuten zu treffen, die voller Inbrunst den Sturz des großen kapitalistischen Imperiums propagierten. Er mochte die Musik des Kapitalismus und hatte die feste Absicht, dazu zu tanzen, sobald sich die Gelegenheit ergab. Er war sein Leben lang arm gewesen, ein Leiden, das er als Arzt rasch zu kurieren hoffte. Aber schließlich gewann sein schlechtes Gewissen die Oberhand.
Boua und der Kommunismus verschworen sich gegen ihn und machten seine Träume und Hoffnungen zunichte. Je stärker er sich zu seiner Verlobten und der Roten Fahne hingezogen fühlte, desto reizloser erschien ihm die Medizin. Sein fünftes Jahr bestand er nur dank diverser Nachprüfungen. Bei Antritt seines Praktikums prangten auf dem Deckel seiner Personalakte zwei schwarze Sterne. Sie zeigten an, dass der betreffende Student sich als erstklassiger Assistenzarzt würde erweisen müssen, wollte er nicht vorzeitig in eine Aéropostale-Maschine verfrachtet werden und der finanziellen Unterstützung seines Gönners verlustig gehen.
Zum Glück war Siri geborener Arzt. Die Patienten beteten ihn an, und das Personal im Hôtel-Dieu hatte eine so hohe Meinung von ihm, dass die Verwaltung ihn förmlich bekniete, doch in Frankreich zu bleiben, und ihm eine volle Stelle anbot. Aber sein Herz gehörte Boua, und als sie in ihre Heimat zurückkehrte, um dort für »die Sache« zu kämpfen, war er an ihrer Seite.
Am Montag ging Siri zum Mekong hinunter und schaute aufs Wasser hinaus. Die Regenzeit hatte sich dieses Jahr besonders hartnäckig gehalten, dafür hatten sie jetzt mindestens fünf Monate Ruhe. Es war ein frischer Novembermorgen, und die Sonne war noch nicht heiß genug, um das Gras am Flussufer zu trocknen. Der kühle Tau benetzte Siris Füße, und er fragte sich, ob die glänzenden Plastikschuhe der Partei die nächste Regenzeit wohl überstehen würden.
Widerstrebend setzte er einen Fuß vor den anderen. Der Duft der Krähenscheiße, die an der Uferböschung blühte, stieg ihm in die Nase. Von drüben starrte ihn Thailand feindselig an, die Boote der Armee trieben in Ufernähe. Der Fluss, der die beiden Länder einst verbunden hatte, trennte sie jetzt.
Vor der Mahosot-Klinik setzte er sich auf einen wackligen Hocker am Straßenrand und aß fade Fö-Nudeln, die er an einem Imbisskarren erstanden hatte. Nichts schmeckte mehr wirklich frisch. Aber nach all den Krankheiten, denen er im Lauf der Jahre ausgesetzt gewesen war, konnte das seiner Gesundheit wenig anhaben. Hätte er sich Salmonellen gespritzt, wären sie vermutlich ohne jede Wirkung geblieben.
Da ihm keine passende Ausrede einfiel, um der Arbeit weiter fernzubleiben, ging er zwischen den kastenförmigen Gebäuden hindurch zu seinem Büro. Beim Bau der Klinik hatten die Franzosen auf Stil und Eleganz bewusst verzichtet: Sie bestand im Wesentlichen aus einer Ansammlung von schmucklosen Betonbungalows. Vor seinem Bungalow angekommen, zögerte er kurz, bevor er eintrat. Auf dem Schild über der Tür stand, auf Französisch, MORGUE. Auf der Fußmatte darunter – eine persönliche Note – stand, auf Englisch, WELCOME.
Nur zwei Räume im Bungalow hatten Fenster. Sein Büro war einer davon. Er teilte es mit seinen beiden Mitarbeitern, die Richter Haeng verächtlich »die Anderthalb« zu nennen pflegte.
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel »The Coroner’s Lunch« bei Soho Press, New York
Verlagsgruppe Random House
Manhattan Bücher erscheinen im Wilhelm Goldmann Verlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2004 by Colin Cotterill
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2008 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Published in agreement with the author, c/o Baror International Inc., Armonk, New York, U.S.A. Die Nutzung des Labels Manhattan erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Hans-im-Glück-Verlags, München
eISBN : 978-3-641-02504-5
www.manhattan-verlag.de
www.randomhouse.de