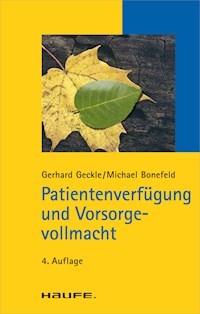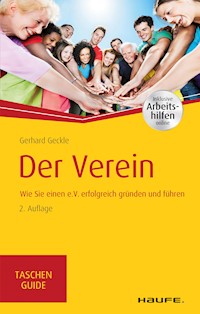
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe TaschenGuide
- Sprache: Deutsch
Vereinsgründungen sind in Deutschland an der Tagesordnung. Um die Vorteile dieser Rechtsform vollständig auszunutzen, müssen ehrenamtlich Engagierte einige wichtige Regeln beachten. Das betrifft nicht nur die Gründungsphase, sondern auch die spätere Vereinsführung. Inhalte: - Bei der Gründung alles richtig machen: Satzung, Gründungsversammlung und Eintragung im Vereinsregister - Der nicht einfache Weg in die Gemeinnützigkeit und die damit verbundenen finanziellen Vorteile - Organisation des Tagesgeschäfts: Vorstandsarbeit, Mitgliederversammlung und Beschäftigung von Mitarbeitern - Saubere Finanzierung: Steuerfallen bei Sponsoring und Werbung vermeiden, Spenden korrekt behandeln - Steuervorteile ausnutzen: Welche Besteuerungsfreigrenzen gelten für Vereine? Wie nutzt man den Übungsleiter- und Ehrenamtsfreibetrag?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
[2]Inhalt
Hinweis zum UrheberrechtImpressumVorwortWie ein Verein entstehtEingetragener oder nicht rechtsfähiger Verein?In zehn Schritten zum e. V.Die GründungsmitgliederDie SatzungDie GründungsversammlungDie Anmeldung zum VereinsregisterExkurs: Die VereinshomepageWie ein Verein funktioniertManager des Vereins: der VorstandOhne sie geht es nicht: die VereinsmitgliederDie Aufgabe des KassenprüfersTrainer, Platzwart & Co.: die Mitarbeiter des VereinsSteuerprivilegien für VereinsmitarbeiterWie ein Verein finanziert werden kannMitgliedsbeiträgeSponsoring und WerbungSpendenÖffentliche ZuschüsseDer FördervereinWie ein Verein besteuert wirdDer Hebel für Steuervorteile: GemeinnützigkeitDie wichtigsten SteuervorteileKleines Steuer-ABC für VereineUmgang mit behördlichen EntscheidungenStichwortverzeichnisDer AutorHinweis zum Urheberrecht
Haufe Lexware GmbH & Co KG
[126]Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.dnb.de abrufbar.
Gerhard Geckle
Der Verein – Wie Sie einen e. V. erfolgreich gründen und führen
2. Auflage 2019
© 2019, Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg
Redaktionsanschrift: Fraunhoferstraße 5, 82152 Planegg/München
Internet: www.haufe.de
E-Mail: [email protected]
Redaktion: Jürgen Fischer
Redaktionsassistenz: Christine Rüber
Satz: Reemers Publishing Services GmbH, Krefeld
Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten.
[4]Vorwort
In Deutschland gibt es über 620.000 eingetragene Vereine und ständig kommen neue hinzu. Wer sich gemeinsam mit weiteren interessierten Mitbürgern in einem Verein engagieren will, hat neben seinem Berufs- und Familienleben meist wenig Zeit, dafür aber umso mehr Fragen: Wie gründe ich einen Verein als e. V.? Welche Behörden sind einzuschalten? Zu welchen steuerlichen Konsequenzen führen die Gründung eines Vereins und die später folgenden Aktivitäten? Wie wird man gemeinnützig, mit welchen Vorteilen? Wie führt man einen Verein, was ist für eine ordnungsgemäße Geschäftsführung wichtig? Gerade neue rechtliche Vorgaben wie die EU-Datenschutz-Grundverordnung haben erhebliche Auswirkungen auch im Vereinsbereich.
Wächst und gedeiht der Verein, kommen unzählige neue Fragestellungen hinzu, so z. B.: Was ist zu beachten, wenn der Verein Personal funktionsunabhängig beschäftigt? Wie füllt man die knappen Vereinskassen? Wie geht man mit Spenden oder den Einnahmen aus dem Sponsoring um? Wo lauern Steuerfallen? Wo bestehen sozialversicherungsrechtliche Risiken?
Auf all diese Fragen und viele mehr hat dieser TaschenGuide Antworten und Orientierungshilfen parat. Er begleitet Sie bei der Vereinsgründung, unterstützt Sie bei der nachfolgenden Organisation Ihres Vereins und erklärt leicht verständlich die wichtigsten rechtlichen Aspekte, die es zu beachten gilt. Zahlreiche Beispiele und Checklisten vermitteln Ihnen das Praxiswissen, das Sie für Ihr ehrenamtliches Engagement im Vereinsinteresse benötigen.
Viel Erfolg mit Ihrem Verein wünscht Ihnen Ihr
Prof. Gerhard Geckle
[5]Wie ein Verein entsteht
Deutschland ist das Land der Vereine – nirgendwo sonst gibt es so viele Zusammenschlüsse dieser Art. Ob Elterninitiative, Sportverein oder Chor: Wollen auch Sie sich mit Gleichgesinnten zusammentun, um einen gemeinsamen Zweck auch langfristig zu verfolgen, dann ist ein eingetragener Verein vielleicht genau die richtige Form dafür.
In diesem Kapitel erfahren Sie u. a.,
was die Vorteile eines eingetragenen Vereins sind,wie Sie einen Verein gründen,warum die Vereinssatzung so wichtig ist,wie Sie einen Verein zum Vereinsregister anmelden.[6]Eingetragener oder nicht rechtsfähiger Verein?
Ob zum gemeinsamen Musizieren, zur Sportausübung oder als Zusammenschluss zur koordinierten Verfolgung gemeinsamer Ziele – die Deutschen lieben ihr Vereinsleben. Derzeit gibt es weit über 620.000 eingetragene Vereine, kurz: e. V., mit weit über 45 Millionen Mitgliedern. Wie der Name es schon vermuten lässt, ist ein e. V. ein Verein, der als besondere Gesellschaftsform in das sog. Vereinsregister eingetragen wurde. Daneben führen unzählige Musik- oder auch Sportvereine, Kegelclubs, Bürgerinitiativen bis hin zu Interessengemeinschaften bereits seit Jahrzehnten gerade in kleineren Gemeinden ein reges Vereinsleben, und das ganz ohne die Eintragung im Vereinsregister.
Doch was genau sind die Vorteile eines eingetragenen Vereins? Mit der Eintragung ins Vereinsregister gilt ein Verein als rechtsfähig. Und genau diese Rechtsfähigkeit ist – zumindest in juristischer Hinsicht – das entscheidende Abgrenzungsmerkmal zum nicht eingetragenen Verein.
Dieser TaschenGuide beschäftigt sich mit den sog. Idealvereinen. Das sind Vereine, die, unabhängig davon, ob sie rechtsfähig sind oder nicht, überwiegend ideelle Zwecke verfolgen. Der Gegensatz dazu sind wirtschaftliche Vereine, die allein aus dem Grund existieren, finanziell das Beste für ihre Mitglieder herauszuholen. Beide Kernregelungen zum deutschen Vereinsrecht findet man im Bürgerlichen Gesetzbuch (§§ 21, 22 BGB). Das BGB enthält daher über relativ wenige Paragrafen nachvollziehbare Regelungen zum geltenden deutschen Vereinsrecht.
[7]Die Vorteile eines eingetragenen Vereins
Ist ein Verein rechtsfähig, gilt er als juristische Person, und als solche kann er Träger von Rechten und Pflichten sein. Genau diese Eigenschaft hat viele Vorteile:
Er kann selbst Vermögen bilden, das ihm und nicht den Mitgliedern zugerechnet wird.Das einzelne Mitglied haftet grundsätzlich nicht für etwaige Vereinsschulden. Haftungsgrundlage ist stets das vorhandene Vereinsvermögen.Hat der e. V. ein Grundstück im Vereinsvermögen, wird der Verein als Eigentümer im Grundbuch eingetragen. Auch hier haftet der e. V. nur mit seinem Vereinsvermögen für Verbindlichkeiten (z. B. für Baukredite, Instandhaltung), die in seinem Namen als Schuldner eingetragen werden.Ein Verein kann Vormund bzw. Betreuer werden; das ist wichtig für die sog. Betreuungsvereine.Er kann als Testamentsvollstrecker eingesetzt werden.Fördermittel und Zuschüsse von Verbänden, Kommunen etc. werden fast nur noch eingetragenen Vereinen gewährt.Einfacher wird es auch bei Kontoeröffnungen, im Bank- und Behördenverkehr.Ein e. V. kann im eigenen Namen problemlos prozessieren, d. h. klagen und selbst auch verklagt werden.Mit einem Blick in das bundesweit elektronisch geführte Zentrale Vereinsregister wird sofort deutlich, wer die verantwort[8]lichen, vertretungsberechtigten Vereinsvorstände sind und ob Vertretungsbeschränkungen bestehen. Das gibt mehr Rechtssicherheit bei Vertragsabschlüssen.Der nicht rechtsfähige Verein
Diese Vorteile kann der nicht rechtsfähige Verein nur bedingt für sich in Anspruch nehmen. Aber auch er hat im Vergleich Positives vorzuweisen. Ein nicht eingetragener Verein lässt sich leichter gründen und ist sicherlich dann interessant, wenn man sich kurzfristig oder nur für eine begrenzte Zeit zusammenschließen will. Zudem fallen die mit dem Vereinsregister zusammenhängenden Pflichten nicht an (siehe hierzu das Kapitel »Die Anmeldung zum Vereinsregister«).
Für die Gründung genügen an sich bereits zwei Gründungsmitglieder – im Gegensatz zum e. V., der mindestens sieben Mitglieder benötigt. Und auch sonst sind weniger Formalien zu beachten als beim e. V. Es ist ausreichend, wenn folgende Grundvoraussetzungen vorliegen.
Nicht rechtsfähiger Verein: KriterienEs ist eine deutlich erkennbare organschaftliche Struktur vorhanden, z. B. Mitgliederversammlung, Vorstand.Es gibt einen größeren, in der Regel offenen Mitgliederkreis.Ein Mitgliederwechsel bleibt ohne Einfluss auf den Bestand des Vereins.Die direkte Beteiligung der Mitglieder am Vereinsvermögen ist ausgeschlossen, insbesondere beim Ausscheiden eines Mitglieds.Es gibt einen Vereinsnamen, um die Einheit der Vereinigung zu kennzeichnen.[9]Allerdings hat die fehlende Rechtsfähigkeit auch Folgen, die sich als Risiken oder als Nachteile auswirken können, wenn sie nicht bereits bei der Gründung des Vereins im Voraus bedacht und verhindert werden.
Das Vermögen gehört nicht dem Verein an sich, sondern es steht den Mitgliedern nur als sog. Gesamthandsgemeinschaft zu. Diese Tatsache berechtigt jedoch das einzelne Mitglied nicht etwa dazu, über seinen Anteil zu verfügen. Wenn ein Mitglied aus dem Verein ausscheidet, hat es daher auch keinen Anspruch auf ein Auseinandersetzungsguthaben. Sein Anteil wächst vielmehr den verbleibenden Vereinsmitgliedern zu.Um jegliche Streitigkeiten mit Mitgliedern zu vermeiden, sollte beim nicht rechtsfähigen Verein unbedingt von Anfang an eine schriftliche Satzung beschlossen werden. Diese sollte auch klare Vorgaben zum Vereinsvermögen enthalten, so z. B. dass ein Abfindungsanspruch beim Ausscheiden eines Mitglieds grundsätzlich ausgeschlossen ist.
In zehn Schritten zum e. V.
Einen Verein zu gründen ist einfach. Es gibt nur wenige Pflichtvorschriften, die es zu beachten gilt. Hier ein Überblick über die wichtigsten Schritte, die man bei der Gründung eines Vereins gehen muss.
[11]Die zehn wichtigsten Schritte zur VereinsgründungSchritt1Finden Sie mindestens sieben Gleichgesinnte, die mit Ihnen zusammen einen e. V. gründen wollen.Schritt2Erstellen Sie den Entwurf einer Vereinssatzung.Schritt3Lassen Sie den Satzungsentwurf inhaltlich vom Vereinsregister überprüfen.Schritt4Überlegen Sie, ob Sie für den Verein gleich die Gemeinnützigkeit beantragen wollen. Kommt das in Betracht, dann legen Sie zeitgleich den Satzungsentwurf dem Finanzamt vor Ort zur gemeinnützigkeitsrechtlichen Beurteilung vor.Schritt5Einigen Sie sich, wer künftig welches Amt übernimmt und klären Sie neben den wichtigen Zielen und dem Vereinszweck anstehende Beitrags- und Finanzierungsfragen bzw. sonstige organisatorische Fragen.Schritt6Laden Sie zur Gründungsversammlung ein.Schritt7Führen Sie die Gründungsversammlung durch, in der Sie die Gründung des e. V. und die Satzung beschließen, die ersten Wahlen abhalten und die Satzung von den Vereinsgründern unterzeichnen lassen. Erstellen Sie ein Protokoll zur Gründungsversammlung.Schritt8Lassen Sie die Unterschriften der vertretungsberechtigten Vorstände unter dem vorbereiteten Anmeldeschreiben für das örtlich zuständige Vereinsregister beim Amtsgericht von einem Notar beglaubigen.Schritt9Melden Sie Ihren Verein beim Vereinsregister an.Schritt10Beantragen Sie die Gemeinnützigkeit beim zuständigen Finanzamt.Die Gründungsmitglieder
Ein Verein ist ein Zusammenschluss von mehreren Personen, um einen gemeinsamen Zweck zu erreichen. Nach dem Gesetz [12]müssen es für einen e. V. mindestens sieben Gründungsmitglieder sein. Jeder kann Gründungsmitglied sein, sofern er geschäftsfähig ist. Kinder bis 7 Jahre sind das nicht. Minderjährige im Alter zwischen 7 und 17 Jahren gelten als beschränkt geschäftsfähig. Sie können einen Verein gründen, wenn sie dafür die Einwilligung ihrer Eltern bzw. ihrer Erziehungsberechtigten haben. Gründungsmitglied kann auch eine sog. juristische Person sein, also z. B. eine GmbH. Der für die Gesellschaft handelnde Geschäftsführer muss dann aber rechtzeitig zum Gründungsakt sein Vertretungsrecht nachweisen können.
Achten Sie darauf, dass Sie in der Gründungsphase keine unternehmerischen, wirtschaftlich geprägten Aktivitäten für den Verein entfalten. Sie laufen sonst Gefahr, dass ein Wirtschaftsverein unterstellt wird mit der Folge, dass die Gründungsmitglieder gesamtschuldnerisch zusammen wie in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts haften können. Scheitert das Vorhaben, einen Verein zu gründen, müssen Sie bzw. Ihre Mitinitiatoren für Kosten, die bisher angefallen sind, so z. B. den Druck von Briefpapier oder angefallene Beratungskosten, selbst aufkommen.
Die Satzung
Jeder Verein braucht eine schriftliche Satzung. Sie bildet den Rahmen, innerhalb dessen sich das Vereinsleben künftig abspielt. Dieses Regelwerk sollte bereits vor der Gründungsversammlung erarbeitet werden, damit die Vereinsgründer dort dann darüber diskutieren und am besten auch gleich abstimmen können.
[13]Der erste Entwurf
Sie müssen keinen Notar oder Anwalt einschalten, um eine Satzung zu entwerfen. Zunächst können Sie sich – zumindest für den groben Aufbau – an anderen Satzungen bestehender Vereine orientieren.
Über die verschiedensten Quellen und natürlich auch im Internet lassen sich u. a. Mustersatzungen, mit vergleichbarer Zielsetzung und Zweckverfolgung als Orientierungshilfen für den ersten Satzungsentwurf ersehen.
Checkliste: Wichtige Informationsquellen für SatzungenSuchen Sie nach Mustersatzungen in Publikationen oder im Internet, z. B. auf den Websites anderer Vereine mit vergleichbarer Zielsetzung.Soll Ihr Verein später einem Verband angehören, können Sie auch bei diesem nach Mustern fragen.Bitten Sie einen in der Zielsetzung vergleichbaren, bereits aktiven Verein, Ihnen seine Satzung als Vorlage zu überlassen.Als Vereinsgründer können Sie beim Registergericht Einsicht in die dort bereits registrierten Satzungen der örtlich eingetragenen Vereine nehmen. Das Vereinsregister ist bei dem für Sie zuständigen Amtsgericht angesiedelt. Sie können es über diesen Link ermitteln: www.justiz.de/OrtsGerichtsverzeichnis/index.php.Über die Seite www.handelsregister.de (Reiter: Erweiterte Suche, Auswahl: VR) können Sie auf das elektronische Zentrale Vereinsregister zugreifen, um dort bundesweit registrierte Satzungen einzusehen.Nur ganz selten gelingt es, im ersten Wurf eine Satzung zu erstellen, die auch gleich die Zustimmung aller Beteiligten in der Gründungsversammlung findet. Erstellen Sie den Erstentwurf [14]daher am besten am PC und nehmen Sie zur Gründungsversammlung ein Laptop mit. So kann der Protokollführer Änderungen direkt in die Datei einarbeiten.
Was muss auf jeden Fall in die Satzung?
Das Gesetz schreibt im Bürgerlichen Gesetzbuch für Vereins-Satzungen, die übrigens immer schriftlich in deutscher Sprache verfasst sein müssen, bestimmte Mindestinhalte vor. Sind diese nicht vorhanden, wird die Satzung schon nach erster Durchsicht beim Vereinsregister beanstandet.
Checkliste: Diese Angaben sind PflichtVereinsnameVereinszweckSitz des VereinsBeschluss zur Gründung des Vereins und Angabe, dass der Verein zur Erreichung der Rechtsfähigkeit ins Vereinsregister eingetragen wirdRegelungen zum Ein- und Austritt von MitgliedernPflicht zur Leistung von BeiträgenBestimmungen zur Bildung des VereinsvorstandsVoraussetzungen zur Einberufung der Mitgliederversammlung, zur Form der Beschlussfassung und Vorgaben zur Protokollierung von BeschlüssenAngabe des Tages der VereinsgründungDer Name
Achten Sie darauf, dass sich der Vereinsname von den Namen der am selben Ort oder in derselben Gemeinde bereits [15]