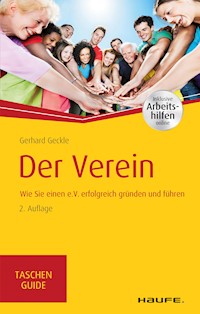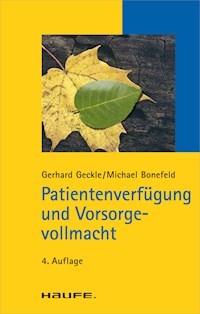28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe Fachbuch
- Sprache: Deutsch
Wie verhält es sich mit dem Mindestlohn? Was ist bei Urlaubsansprüchen zu berücksichtigen? Die Autoren sind Experten im Arbeitsrecht und geben einen fundierten Überblick für Personalverantwortliche im Verein. Dabei gehen sie auf einzelne arbeitsrechtliche Merkmale ein und zeigen gezielt, worauf es bei Vereinen als Arbeitgeber ankommt. So sind Sie auf der sicheren Seite und schützen sich vor folgenschweren Fehlern. Inhalte: - Stellenausschreibung im Verein - Einstellung, Arbeitsvertrag, geringfügig und kurzfristig Beschäftigte, Befristung - Arbeitszeit, Arbeit auf Abruf - Entlohnung, Mindestlohnproblematik - Besondere Schutzgesetze (AGG, MuSchG, BEEG, SGB IX) - Überblick Arten der bezahlten Beschäftigung, geringfügig, kurzfristig; Mini- oder Midijob, Teilbeschäftigung - Entgelt ohne Arbeit: Krankheit, Urlaub, Feiertag, Freistellung - Arbeitgeberpflichten des Vereins - Beendigung des Arbeitsverhältnisses: Kündigung, Abmahnung, Aufhebungsvertrag, Rentenabgang - Ehrenamt und Verein - Übungsleiter-, Ehrenamtsfreibetrag - Sozialversicherungsprüfung, Lohnsteuerprüfung Digitale Extras: - Verträge - Checklisten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
[7]Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum UrheberrechtImpressumTeil 1: Der Verein als Arbeitgeber – Die arbeitsrechtlichen Grundlagen1 Einleitung1.1 Das Arbeitsverhältnis1.2 Inhalt des Arbeitsverhältnisses2 Die Einstellung und der Arbeitsvertrag2.1 Die Stellenanzeige2.2 Die Bewerberauswahl 2.3 Die Absage einer Bewerbung2.4 Der Arbeitsvertrag2.4.1 Form und Inhalt von Arbeitsverträgen2.4.2 Der befristete Arbeitsvertrag2.4.3 Der unbefristete Arbeitsvertrag2.4.4 Arbeit auf Abruf2.4.5 Die geringfügige Beschäftigung2.5 Rechte und Pflichten der Arbeitsvertragsparteien2.5.1 Die Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis2.5.2 Die Nebenpflichten aus dem Arbeitsverhältnis3 Die Arbeitszeit3.1 Die regelmäßige Arbeitszeit3.2 Die Ruhepausen3.3 Die Ruhezeit3.4 Die Nachtarbeitszeit3.5 Die Sonn- und Feiertagsarbeit 3.6 Flexible Arbeitszeitmodelle3.7 Rechtsfolgen beim Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz4 Die Entlohnung der Beschäftigten4.1 Die Höhe der Vergütung4.2 Der Mindestlohn4.3 Die Abrechnung der Vergütung5 Entgelt ohne Arbeit5.1 Der Erholungsurlaub5.1.1 Der Urlaubsanspruch5.1.2 Die zeitliche Festlegung des Urlaubs5.1.3 Die Übertragung des Urlaubs in das nächste Kalenderjahr5.1.4 Urlaub und Arbeitsunfähigkeit5.1.5 Die Urlaubsvergütung5.1.6 Die Urlaubsabgeltung5.1.7 Zu viel gewährter Urlaub5.2 Die Feiertage5.3 Die Arbeitsunfähigkeit5.3.1 Der Begriff der Arbeitsunfähigkeit5.3.2 Die Dauer des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung 5.3.3 Die Anzeige- und Nachweispflicht des Arbeitnehmers5.4 Die Arbeitsverhinderung5.4.1 Die persönlichen Gründe5.4.2 Die Länge der Ausfallzeit5.4.3 Unverschuldete Verhinderung5.4.4 Die Höhe des Anspruchs auf Vergütungsfortzahlung6 Besondere Schutzgesetze6.1 Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz6.2 Das Jugendarbeitsschutzgesetz6.3 Der Teilzeitanspruch der Beschäftigten6.4 Das Mutterschutzgesetz6.5 Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz6.6 Das Schwerbehindertenrecht 7 Das Direktionsrecht des Vereins und die Versetzung7.1 Das Direktionsrecht7.2 Die Versetzung7.2.1 Die Versetzung als längerfristige Maßnahme7.2.2 Kurzfristige Zuweisung eines anderen Arbeitsbereichs8 Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses8.1 Der Ablauf der Befristung 8.2 Die Beendigung wegen Erreichens der Altersgrenze8.3 Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer8.4 Die Kündigung durch den Verein8.4.1 Die personenbedingte Kündigung8.4.2 Die verhaltensbedingte Kündigung8.4.3 Die betriebsbedingte Kündigung8.4.4 Die Änderungskündigung8.4.5 Die außerordentliche Kündigung8.5 Der Aufhebungs- oder Abwicklungsvertrag8.6 Das Arbeitszeugnis9 Der Verein als Ausbildungsbetrieb9.1 Voraussetzungen für die Ausbildungsmöglichkeit9.2 Rechte und Pflichten des Ausbildungsbetriebs9.2.1 Die allgemeinen Aufgaben und Pflichten9.2.2 Die besonderen Aufgaben und Pflichten9.3 Die Aufgaben und Pflichten des Auszubildenden9.3.1 Die allgemeinen Aufgaben und Pflichten9.3.2 Die besonderen Aufgaben und Pflichten9.4 Dauer und Ende des Ausbildungsverhältnisses9.5 Die Weiterbeschäftigung nach Ende des Ausbildungsverhältnisses10 Der Betriebsrat im Verein10.1 Die Arten der Beteiligung10.2 Die Mitwirkungsrechte10.3 Die Mitbestimmungsrechte10.3.1 Das Initiativrecht des Betriebsrats in sozialen Angelegenheiten10.3.2 Die Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten10.3.3 Mitwirkung und Mitbestimmung in wirtschaftlichen AngelegenheitenTeil 2: Übungsleiterverhältnisse richtig regeln und abrechnen1 Die steuerliche Beurteilung von vergüteten Nebentätigkeiten1.1 Anhebung des Ehrenamts- und Übungsleiterfreibetrags ab 20211.2 Voraussetzungen für die steuerliche Begünstigung1.3 Besonderheiten für rein ehrenamtlich tätige Übungsleiter1.4 Für welche Tätigkeitsbereiche lässt sich der Übungsleiterfreibetrag nutzen?1.5 Welche Tätigkeiten sind grundsätzlich nicht begünstigt?1.6 Begünstigung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts1.7 Ergänzende Hinweise für den Sportbereich1.8 Dokumentationspflicht für begünstigte Nebentätigkeiten2 Nebenberufliche Tätigkeiten für Vereine und Verbände2.1 Wann liegt eine begünstigte Nebentätigkeit vor?2.2 Abgrenzung zwischen Haupt- und Nebentätigkeit2.3 Checkliste: Liegt eine nebenberufliche selbstständige Tätigkeit vor?2.4 Nebenberufliche Tätigkeit im Verein – die fünf häufigsten Fallen3 Die Abrechnung von Übungsleitertätigkeiten3.1 Wann können Entgelte an Übungsleiter steuerfrei bleiben?3.2 Wie werden die Vergünstigungen bei einem nebenberuflichen Anstellungsverhältnis umgesetzt?3.3 Welche Aufwendungen und Pauschbeträge kann der Verein ersetzen?3.3.1 Erstattung von Reisekosten und Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte3.3.2 Regelungen zum Aufwandsersatz3.4 Wann tritt eine Sozialversicherungspflicht ein?4 Die Übungsleitertätigkeit in Verbindung mit Mini- und Midijobs 4.1 Kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse4.2 Minijob und Mindestlohn4.3 Sonderregelung für den Sport4.4 Vorgaben der Verwaltungsberufsgenossenschaft4.5 Das Schwerbehindertenrecht 4.6 Verluste aus der Übungsleitertätigkeit5 Betriebsprüfungen im Verein5.1 Die Lohnsteuerprüfung5.2 Die Sozialversicherungsprüfung5.3 Weitere Prüfungshinweise und Tipps5.4 Das Statusfeststellungsverfahren5.5 Die Künstlersozialversicherung6 Aufwandsspenden und RückspendenAusblick: Neuvorgaben für Beschäftigungsverhältnisse im VereinStichwortverzeichnisDie AutorenDigital ExtrasHinweis zum Urheberrecht:
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Haufe Lexware GmbH & Co KG
[6]Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de/ abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-648-13646-1
Bestell-Nr. 17024-0001
ePub:
ISBN 978-3-648-13647-8
Bestell-Nr. 17024-0100
ePDF:
ISBN 978-3-648-13648-5
Bestell-Nr. 17024-0150
Gerhard Geckle, Amelie Rothe, Stephan Wilcken
Vereine als Arbeitgeber
1. Auflage, Juni 2022
© 2022 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg
haufe.de
Bildnachweis (Cover): © oxinoxi, Adobe Stock
Produktmanagement: Annette Ziegler
Lektorat: Peter Böke
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/ Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
[13]Teil 1: Der Verein als Arbeitgeber – Die arbeitsrechtlichen Grundlagen
[15]1Einleitung
Der Verein als Arbeitgeber wird immer wieder mit Fragestellungen zum Thema der Beschäftigung von Personen im und für den Verein konfrontiert sein. Dabei geht es zum einen darum, ob überhaupt ein Arbeitsverhältnis vorliegt, welche Vorschriften bei der Einstellung, dem Verlauf und dann bei der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses einzuhalten sind.
Zum anderen geht es auch darum, welche Rechte und welche Pflichten der Verein als Arbeitgeber zu erfüllen hat, aber auch welche Rechte und Pflichten die Beschäftigten gegenüber dem Verein als Arbeitgeber haben.
Besteht im Verein ein Betriebsrat, sind die entsprechenden Vorschriften des Betriebsverfassungsrechts zu beachten (vgl. Teil 1, Kapitel 10) und die einzelnen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte zu wahren.
Für ein Ausbildungsverhältnis gelten wiederum Besonderheiten, die zu berücksichtigen sind. Auch hierauf wird ausführlich in Kapitel 9 eingegangen.
1.1Das Arbeitsverhältnis
Als Arbeitsverhältnis wird ein sogenanntes privatrechtliches Vertragsverhältnis angesehen, mit dem der Arbeitnehmer seine Arbeitskraft dem Verein gegen ein bestimmtes Entgelt anbietet.
Es kommt bei der Frage nach dem Bestehen eines Arbeitsverhältnisses darauf an, ob die Person »nur« eine Arbeitsleistung schuldet oder ob es alleine um ein Arbeitsergebnis ohne nähere Beschreibung bezüglich der Art und Dauer bis zum Erreichen eben dieses Ergebnisses geht.
Wird ein Arbeitsergebnis geschuldet und nur dieses dann auch vergütet, wird es sich regelmäßig bei einer solchen Vertragsgestaltung nicht um ein Arbeitsverhältnis handeln, sondern um einen sogenannten Werkvertrag; hier kommt es auf das richtige Erstellen des Werkes an.
[16]Beispiel: Renovierung der Vereinsräume
Beauftragt der Verein eine Person, bestimmte Räume des Vereins zu renovieren und gibt er nur vor, wie das Ergebnis auszusehen hat und wann die Fertigstellung erfolgt sein muss, dann liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Werkvertrag, aber kein Arbeitsverhältnis vor. Oder: Beauftragt der Verein einen Softwaretechniker, eine bestimmte Software auf den Rechnern des Vereins bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu installieren, liegt ein Dienstvertrag, aber kein Arbeitsverhältnis vor.
Das Arbeitsverhältnis unterscheidet sich auch von der ehrenamtlichen Tätigkeit im Verein. Es gibt keine gesetzliche Definition des Ehrenamts oder der ehrenamtlichen Tätigkeit. Der Bundesfinanzhof (BFH) stellt als wesentlich für das Ehrenamt ab auf
das Fehlen eines eigennützigen Erwerbsstrebens,die fehlende Hauptberuflichkeit,den Einsatz für eine fremdnützig bestimmte Einrichtung.Es ist in der Praxis entscheidend, wie der Einsatz gesamthaft zu betrachten ist. Geht es der Person, die die Tätigkeit im Verein ausführt, nicht um die Erwerbstätigkeit, sondern »nur« um das Erbringen ihrer Leistung, erwirtschaftet sie anderweitig ihren Lebensunterhalt, dann kann man meist von einem Ehrenamt ausgehen. Ist bewusst eine Vergütung nicht vereinbart, sondern ausschließlich der Einsatz für den Verein, dann wird in vielen Fällen ebenfalls kein Arbeitsverhältnis vorliegen. Nähere Ausführungen zum Thema Ehrenamt finden Sie in Teil 2 dieses Buches.
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) beschreibt das Arbeitsverhältnis als einen privatrechtlichen Vertrag, mit dem der Beschäftigte weisungsgebundene Arbeitsleistung erbringt und in persönlicher Abhängigkeit in eine fremde Arbeitsorganisation eingegliedert ist. Der Arbeitgeber hat ein Weisungsrecht hinsichtlich der Arbeitsleistung nach § 106 der Gewerbeordnung (GewO); er ist verpflichtet, diese Arbeitsleistung auch entsprechend zu vergüten.
1.2Inhalt des Arbeitsverhältnisses
Das Arbeitsverhältnis wird zunächst als sogenanntes Austauschverhältnis angesehen. Der Arbeitnehmer erbringt die Arbeitsleistung, der Verein als Arbeitgeber leistet dafür die entsprechende Vergütung. Dies sind auch die sogenannten Hauptpflichten: zum einen die Arbeitsleistung, zum anderen die Entgeltzahlung.
[17]Daneben gibt es eine Vielzahl von Nebenpflichten. Auf Arbeitgeberseite kann man diese schlagwortartig als Fürsorgepflichten bezeichnen. Es sind Arbeitnehmerschutzgesetze einzuhalten, die unten in Teil 1, Kapitel 6 näher beschrieben werden.
Auf Arbeitnehmerseite aber gibt es ebenfalls entsprechende »Fürsorgepflichten« gegenüber dem Verein als Arbeitgeber. Sie werden meist als sogenannte Treuepflichten bezeichnet.
Auf diese Pflichten wird im Detail in Teil 1, Kapitel 2.5.2 eingegangen.
[19]2Die Einstellung und der Arbeitsvertrag
Bei der Einstellung von Arbeitnehmern ist zum einen entscheidend, dass möglichst die richtige Personalauswahl getroffen wurde, also der richtige Bewerber für die richtige Arbeitsaufgabe ausgesucht wurde; zum anderen ist darauf zu achten, dass der richtige Vertragstyp gewählt wird. Dies betrifft z. B. die Frage, ob das Arbeitsverhältnis befristet oder unbefristet abgeschlossen werden soll, ob es sich um ein Teilzeit- oder Vollzeitarbeitsverhältnis handeln soll.
Wenn dann der Arbeitnehmer eingestellt wurde, hat der Verein als Arbeitgeber bestimmte Informations- und Belehrungspflichten gegenüber dem Arbeitnehmer, um diesen in seine Arbeitsaufgabe richtig einzuführen.
2.1Die Stellenanzeige
Bei der Anwerbung von Arbeitnehmern über außerbetrieblichen Stellenanzeigen (z. B. in der Presse oder im Internet) oder innerbetrieblichen Stellenausschreibungen (z. B. am Schwarzen Brett, im Intranet, per Rundmail etc.) hat der Verein als Arbeitgeber bestimmte rechtliche Vorgaben zu beachten.
Beachten Sie
Wann muss eine Stellenausschreibung innerbetrieblich erfolgen? Eine innerbetriebliche Stellenausschreibung ist nur dann zwingend notwendig, wenn dies der Betriebsrat zuvor verlangt hat (§ 93 BetrVG).
Insbesondere sind gemäß §§ 11 und 7 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) Stellenausschreibungen diskriminierungsfrei zu formulieren. Es ist also darauf zu achten, dass in den Stellenanzeigen keine Formulierungen gewählt werden, die sich auf ein Diskriminierungsmerkmal nach § 1 AGG beziehen. Zu den Diskriminierungsmerkmalen wird unten in Teil 1, Kapitel 6.1 näher eingegangen.
In der Praxis sind insbesondere die Merkmale Alter, Geschlecht, Behinderung und Herkunft relevant.
[20]Seit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) im Oktober 2017 und einer darauffolgenden Änderung des Personenstandgesetzes ist darauf zu achten, dass sich das Stellenangebot nicht nur an Frauen und Männer wendet, sondern auch an Angehörige des dritten Geschlechts richtet.1 Ein einheitlicher Standard hat sich hierbei bisher nicht etabliert. Gängige Zusätze sind (m/w/d) oder (m/w/x). Es ist aber auch möglich, eine geschlechtsneutrale Terminologie zu verwenden.
Praxistipp: So formulieren Sie eine Stellenausschreibung geschlechtsneutral
Schreibkraft gesucht
oder
Wir suchen eine Fachkraft für den Bereich Buchhaltung.
In diesem Fall formulieren Sie weiter die Voraussetzungen, die eine Bewerberin oder ein Bewerber besitzen sollte, in der direkten Rede.
Des Weiteren sollten Formulierungen wie »unser junges, dynamisches Team« unterlassen werden, da diese eine Diskriminierung wegen Alters nahelegen. Auch das Erfordernis »deutsche(r) Muttersprachler(in)« führt zu einer Benachteiligung wegen der ethnischen Herkunft und sollte daher unbedingt vermieden werden.
§ 15 Abs. 2 Satz 2 AGG gibt abgelehnten Bewerbern einen Schadenersatzanspruch in Höhe von bis zu drei Monatseinkommen der ausgeschriebenen Position, wenn der Arbeitsplatz diskriminierend ausgeschrieben wurde und der Verein nicht nachweisen kann, dass der Bewerber oder die Bewerberin auch ohne die behauptete Diskriminierung aus fachlichen, sachlichen Gründen nicht in die engere Auswahl unter den Bewerbern gekommen wäre.
2.2Die Bewerberauswahl
Auch im Bewerbungsverfahren und der Bewerberauswahl ist das AGG zu berücksichtigen.
Insbesondere bei der Verwendung von Bewerbungsfragebögen, aber auch im Vorstellungsgespräch ist darauf zu achten, dass der Verein nur solche Fragen stellt, die [21]für den angestrebten Arbeitsplatz und der zu verrichtenden Tätigkeit auch tatsächlich von Bedeutung sind.
Beachten Sie
Der Betriebsrat ist zu beteiligen. Existiert im Verein ein Betriebsrat, darf der Verein einen solchen Einstellungsfragebogen nur dann verwenden, wenn der Betriebsrat den einzelnen Fragen jeweils zugestimmt hat (§ 94 BetrVG). Es handelt sich um einen sogenannten Personalfragebogen im Sinne dieser Vorschrift.
Das BAG vertritt die Auffassung, dass der Arbeitgeber nur die Fragen stellen darf, an deren richtiger Beantwortung er ein berechtigtes, billigenswertes und schutzwürdiges Interesse im Hinblick auf das spezifische Arbeitsverhältnis hat. Deshalb hängt es bei den einzelnen Fragen, die in dem Einstellungsfragebogen formularmäßig verwendet werden, von der Arbeitsaufgabe und der Position ab, auf die der Bewerber eingestellt werden soll, ob bestimmte Fragen zulässigerweise gestellt werden dürfen und welche Folge eine falsche Antwort haben kann.
Dabei ist darauf abzustellen,
dass die abgefragten Tatsachen in erkennbarem Zusammenhang mit der in Aussicht genommenen Beschäftigung stehen,dass die abgefragten Tatsachen objektiv geeignet sein können, das für den Verein in einem Arbeitsvertrag liegende Risiko zu betreffen und zu beeinflussen.Umgekehrt muss im Interesse des Bewerbers dessen Persönlichkeitsrecht beachtet werden. Es darf durch die Fragestellung nicht unverhältnismäßig in die Privatsphäre des Bewerbers eingedrungen werden, bestimmte Personengruppen dürfen nicht diskriminiert werden.
Berufliche Vergangenheit
Soweit die berufliche Vergangenheit des Bewerbers für den in Aussicht genommenen Arbeitsplatz von Bedeutung ist, darf der Verein als potenzieller neuer Arbeitgeber entsprechende Fragen nach Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen stellen, nach früheren Arbeitgebern sowie nach der Dauer der jeweiligen Beschäftigung. Hier kommt es aber auch darauf an, welcher Arbeitsplatz mit dem Bewerber zu besetzen ist. Nur Fragen zu seinem beruflichen Werdegang sind zulässig.
[22]Nachvertragliches Wettbewerbsverbot
Selbstverständlich darf der Verein nach einem rechtswirksamen nachvertraglichen Wettbewerbsverbot mit dem früheren Arbeitgeber fragen. Der frühere Arbeitgeber kann nämlich ein etwaiges nachvertragliches Wettbewerbsverbot gerichtlich durchsetzen mit der Folge, dass der Arbeitnehmer bei seinem neuen Arbeitgeber nicht mehr zur vertragsgemäßen Tätigkeit zur Verfügung steht, wenn diese das nachvertragliche Wettbewerbsverbot betrifft.
Gesundheitszustand
Die Fragen nach dem Gesundheitszustand sind jedenfalls dann zulässig und damit wahrheitsgemäß vom Bewerber zu beantworten, wenn herausgefunden werden soll, ob eine gesundheitliche Beeinträchtigung vorliegt, die die Eignung für die konkret vorgesehene Tätigkeit dauerhaft oder regelmäßig wiederkehrend einschränkt, ob zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme bzw. in absehbarer Zeit mit einer längeren Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit, Operation oder Kur zu rechnen ist und ob eine ansteckende Krankheit vorliegt, die möglicherweise nicht den Mitarbeiter selbst, jedoch Arbeitskollegen oder dritte Personen gefährden könnte.
Beispiel: Auskunft über den Gesundheitszustand
In bestimmten Fällen muss der Bewerber über seinen Gesundheitszustand Auskunft geben. So muss ein Bewerber für einen Lagerarbeitsplatz angeben, wenn er eine Rückenerkrankung hat, da diese sich erheblich auf die geplante Tätigkeit auswirken kann.
Ist in dem obigen Beispiel der Bewerber aber für eine kaufmännische Tätigkeit vorgesehen, dann wird eine Rückenproblematik sich in vielen Fällen nicht auf die Leistungserbringung auswirken, die Frage wäre hier unzulässig.
Die Frage nach einer bestehenden HIV-Infektion ist allgemein unzulässig, es sei denn, der Bewerber soll mit infektionsgefährdenden Tätigkeiten betraut werden. Die Frage nach einer akuten Aids-Erkrankung ist zulässig, da in Anbetracht der Krankheit in absehbarer Zeit mit erheblichen Arbeitsausfällen zu rechnen ist.
Konfession
Die Frage nach der Konfession ist grundsätzlich unzulässig, es sei denn, dass die Tätigkeit gegen bestimmte religiöse Grundsätze verstoßen könnte.
[23]Beispiel: Frage nach der Religionszugehörigkeit
Im folgenden Fall darf nach der Religionszugehörigkeit gefragt werden: Der Verein hat eine Stelle zu besetzen, die mit dem Transport und der Ausgabe von alkoholischen Getränken verbunden ist. Hier darf danach gefragt werden, ob die Religion des Bewerbers ihn an der Ausübung dieser Tätigkeit hindern wird.
Es darf zwar nicht nach der konkreten Religionszugehörigkeit gefragt werden. Es darf aber die Frage gestellt werden, ob es dem Bewerber auch aus religiöser Sicht heraus möglich ist, die konkrete Tätigkeit auszuführen.
Schwangerschaft
Die Schwangerschaft einer Bewerberin hat zwar für den Arbeitgeber einen vermutlich längerfristigen Arbeitsausfall zur Folge; jedenfalls wird die schwangere Bewerberin ab einem gewissen Zeitpunkt wahrscheinlich nicht vollumfänglich tätig werden können. Der Arbeitgeber hat also eigentlich ein Interesse an entsprechender Information. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) sieht in der Verweigerung der Einstellung aufgrund einer Schwangerschaft aber immer eine geschlechtsbezogene Diskriminierung. Dieser Rechtsprechung folgend sieht das BAG die Frage nach der Schwangerschaft generell als unzulässig an, selbst wenn die schwangere Bewerberin nicht einen Tag arbeiten kann.
Etwas anderes gilt ausnahmsweise dann, wenn die Bewerberin an einem Arbeitsplatz eingesetzt werden soll, den sie als Schwangere nicht einnehmen darf, weil ein entsprechendes Beschäftigungsverbot bestehen würde, und wenn die Bewerberin zu kurzfristig eingestellt werden soll.
Wenn das Arbeitsverhältnis nur kurz bestehen soll und die Bewerberin objektiv für die Arbeit ungeeignet sein könnte, weil sie in schwangerem Zustand eingestellt wird, ist die Frage nach der Schwangerschaft von der Bewerberin ordnungsgemäß zu beantworten. Dabei kommt es auch auf die Dauer der geplanten Beschäftigung an. Soll eine Mitarbeiterin unbefristet eingestellt werden, wird – so ist jedenfalls die derzeitige Rechtsprechung zu verstehen – die Ausfallzeit durch schwangerschaftsbedingte Arbeitsunfähigkeiten und durch Beschäftigungsverbote vom Arbeitgeber zu verkraften sein und auch akzeptiert werden müssen.
Beispiel: Frage nach einer bestehenden Schwangerschaft
In diesem Fall ist die Frage nach einer bestehenden Schwangerschaft zulässig: Es wird befristet für neun Monate eine Ersatzkraft für die schwangere Röntgenassistentin gesucht.
[24]Schwerbehinderung
Die Anerkennung der Schwerbehinderung beeinflusst das gesamte künftige Arbeitsverhältnis erheblich:
Es besteht für den Schwerbehinderten ein besonderer Kündigungsschutz (§ 168 SGB IX).Der Schwerbehinderte hat einen Anspruch auf Zusatzurlaub in Höhe von fünf Arbeitstagen (§ 208 SGB IX).Bei Kenntnis der Schwerbehinderung seiner Mitarbeiter erspart sich der Arbeitgeber, eine Ausgleichsabgabe an das Integrationsamt zahlen zu müssen.Dennoch ist die Frage nach einer Behinderung bzw. Schwerbehinderung in der Phase der Vertragsanbahnung sowie in den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses unzulässig, soweit sie für die Ausübung der vorgesehenen Tätigkeit nicht von Bedeutung ist. Sie kann jedoch gerechtfertigt sein, wenn die Behinderung die vertragsmäßig geschuldete Tätigkeit dauerhaft unmöglich macht und ihr Nichtvorliegen daher eine »wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung« im Sinne des § 8 Abs. 1 AGG ist.
Beachten Sie
Im bestehenden Arbeitsverhältnis hat der schwerbehinderte Arbeitnehmer eine Offenbarungspflicht. Der Verein als Arbeitgeber darf erst nach den ersten sechs Monaten eines ununterbrochenen Arbeitsverhältnisses zulässigerweise nach dem Vorliegen einer Schwerbehinderteneigenschaft fragen.
Hintergrund dieser Regelung ist, dass erst nach einer Betriebszugehörigkeit von sechs Monaten ein allgemeiner Kündigungsschutz besteht und der Arbeitgeber dann die konkreten Kündigungsgründe nennen muss, zuvor aber nicht (§ 1 Abs. 1 KSchG). Dadurch wird vermieden, dass durch eine Kündigung, die der Arbeitgeber nicht konkret begründen muss, eine Schwerbehinderung mittelbar und nicht erkennbar zur arbeitgeberseitigen Kündigung herangezogen wird.
Urlaub
Der Verein als neuer Arbeitgeber ist immer berechtigt, den Bewerber danach zu fragen, wie viel Urlaub im aktuellen Jahr er bei seinem bisherigen Arbeitgeber bekommen hat. Diese Frage muss wahrheitsgemäß beantwortet werden.
[25]Denn gemäß § 6 Abs. 1 BUrlG kann der neue Arbeitgeber den Urlaubsanspruch des eintretenden Arbeitnehmers entsprechend kürzen, wenn der Bewerber bei seinem bisherigen Arbeitgeber mehr Urlaub erhalten hat, als ihm dort zustand.
Beispiel: Anrechnung des Urlaubs
So wird der Urlaub beim ehemaligen Arbeitgeber angerechnet: Der Bewerber ist bei seinem bisherigen Arbeitgeber zum 30. Juni eines Jahres ausgeschieden. Dort hatte er einen Jahresurlaubsanspruch von 30 Tagen, ihm stand aber, da er im ersten Kalenderhalbjahr ausgeschieden ist, nur anteiliger Urlaub von 15 Tagen zu. Tatsächlich hat er aber 20 Tage, also 5 Tage zu viel genommen. Diesen zu viel genommenen Urlaub kann der Verein als neuer Arbeitgeber auf den bei ihm entstehenden Urlaubsanspruch anrechnen.
Schulden
Die Frage nach Schulden, dem Vorliegen von Lohn- und Gehaltspfändungen, nach den allgemeinen Vermögensverhältnissen ist nur dann vom Bewerber richtig zu beantworten, wenn er eine besondere Vertrauensstellung im Unternehmen einnehmen soll, wenn er etwa als Buchhalter oder gar Kassierer beschäftigt werden soll. Die Frage nach Lohnabtretungen sowie dem Vorliegen von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen wird überwiegend als rechtens angesehen, sie muss wahrheitsgemäß beantwortet werden.
Vorstrafen
Die Frage nach Vorstrafen oder Ermittlungs- und Strafverfahren ist nur dann zulässig und muss nur dann ordnungsgemäß vom Bewerber beantwortet werden, wenn diese für die zu besetzende Stelle von Bedeutung ist. Steht etwa ein Ermittlungsverfahren für einen Bewerber an, bei dem die Möglichkeit besteht, dass ihm für längere Zeit die Fahrerlaubnis entzogen wird, muss er eine entsprechende Nachfrage des interessierten Arbeitgebers richtig beantworten, wenn der geplante Arbeitseinsatz mit Fahrtätigkeit verbunden ist.
Deswegen ist die Frage nach anhängigen Strafverfahren dann gerechtfertigt, wenn sich daraus die Befähigung und Zuverlässigkeit des Bewerbers für die konkrete Tätigkeit sowie die mögliche Nichtverfügbarkeit der Arbeitskraft ergibt.
Waren die Fragen des Vereins im Bewerbungsfragebogen bzw. dem Bewerbungsgespräch zulässig und hat der Bewerber falsche Angaben gemacht, kann der Verein [26]den geschlossenen Vertrag gemäß § 119 Abs. 2 BGB anfechten. Das hat zur Folge, dass der Arbeitsvertrag von Anfang an nichtig ist (§ 142 Abs. 1 BGB).
Beachten Sie
Das ist der Vorteil einer Anfechtung des Arbeitsvertrags: Der Verein als Arbeitgeber muss keine Kündigung aussprechen, es muss also weder eine Kündigungsfrist eingehalten werden noch ist ein etwa bestehender Betriebsrat anzuhören.
Allerdings muss der Arbeitgeber nachweisen, dass er den Vertrag berechtigterweise nicht geschlossen hätte, wenn der Bewerber die Fragen richtig beantwortet hätte.
Anhörung des Betriebsrats
Schließlich ist zu beachten, dass vor jeder Einstellung eines Arbeitnehmers – unabhängig davon, ob befristet oder unbefristet – der Verein als Arbeitgeber seinen Betriebsrat anhören muss, wenn ein solcher besteht. Nur wenn dieser der Einstellung zustimmt, darf der Mitarbeiter eingestellt und beschäftigt werden (§ 99 BetrVG). Das Gesetz gibt dem Betriebsrat aber nur die dort genannten Gründe als Widerspruchsgrund; weitere Widerspruchsgründe gibt es nicht.
2.3Die Absage einer Bewerbung
Muss der Verein einer Bewerbung absagen, sollte das Ablehnungsschreiben aus haftungsrechtlichen Gründen möglichst neutral und kurz formuliert werden. Insbesondere sollten spezifische Begründungen jeglicher Art vermieden werden. Das gilt auch bei telefonischen Nachfragen des Bewerbers.
Etwas anderes gilt bei der Absage eines schwerbehinderten Bewerbers. Hier hat der Verein als Arbeitgeber gemäß § 164 SGB IX alle Beteiligten, d. h. den betroffenen Bewerber, die Schwerbehindertenvertretung sowie den Betriebsrat, unter Angabe von Gründen überseine Entscheidung zu unterrichten. Zwar kann diese Unterrichtung auch mündlich erfolgen; die Schriftform ist jedoch aus Beweisgründen zu empfehlen.
Darüber hinaus empfiehlt es sich grundsätzlich, die Gründe für die Ablehnung einer Bewerbung zu dokumentieren. Sollte ein abgelehnter Bewerber nämlich Ansprüche aufgrund einer von ihm behaupteten Diskriminierung geltend machen, können die [27]objektiven Gründe für die Ablehnung auch zu einem späteren Zeitpunkt noch nachvollzogen und vor Gericht belegt und bewiesen werden.
2.4Der Arbeitsvertrag
Das Rechtsverhältnis zwischen dem Verein als Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer wird maßgeblich durch den Arbeitsvertrag bestimmt.
Der Arbeitsvertrag ist eine Sonderform des Dienstvertrags und hat seine gesetzliche Grundlage in § 611 a BGB. Er kann als unbefristeter Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann aber auch ein befristeter Arbeitsvertrag abgeschlossen werden.
Vor jeder Einstellung eines Arbeitnehmers – unabhängig davon, ob befristet oder unbefristet – muss der Verein als Arbeitgeber seinen Betriebsrat anhören, nur wenn dieser der Einstellung zustimmt, darf der Mitarbeiter eingestellt und beschäftigt werden (§ 99 BetrVG).
2.4.1Form und Inhalt von Arbeitsverträgen
Unbefristete Arbeitsverträge
Unbefristete Arbeitsverträge können schriftlich oder mündlich abgeschlossen werden. Dies gilt auch im Hinblick auf das sogenannte Nachweisgesetz (NachwG). Das NachwG schreibt nämlich nicht vor, dass ein schriftlicher Arbeitsvertrag zwischen den Arbeitsvertragsparteien zustande kommen muss. § 2 NachwG sagt lediglich aus, dass der Arbeitgeber spätestens innerhalb eines Monats nach Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, diese zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen hat.
Vertragsbestandteile
Als wesentliche Vertragsbestandteile sind aufzuführen:
Name und Anschrift von Arbeitgeber und Arbeitnehmer,Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses,bei befristeten Arbeitsverhältnissen die vorhersehbare Dauer des Arbeitsverhältnisses.[28]Beachten Sie
Für befristete Arbeitsverhältnisse gilt die Schriftform. Befristete Arbeitsverhältnisse sind in ihrer Zeitdauer, also der Befristung, nur dann zulässig, wenn diese schriftlich vereinbart wurden, hier bedarf es also eines schriftlichen Vertrages.
Das Nachweisgesetz (NachwG) enthält keine Regelung für den Fall, dass der Arbeitgeber diese Bescheinigung nicht ausstellt, insbesondere gibt es hier keine Straf- oder Ordnungswidrigkeitenvorschrift. Das Nichterteilen der geforderten Bescheinigung ist rechtlich also folgenlos.
Befristete Arbeitsverträge
Eine Besonderheit gilt allerdings für befristete Arbeitsverträge: Diese müssen schriftlich abgeschlossen werden (§ 14 Abs. 4 TzBfG). Ein befristeter Arbeitsvertrag ist nur dann – in seiner Befristung – gültig, wenn er schriftlich vereinbart wurde. Dies muss vor Arbeitsaufnahme geschehen sein. Zu diesem Zeitpunkt müssen beide Arbeitsvertragsparteien den Vertrag auf derselben Urkunde unterzeichnet haben. Dabei gelten strenge Formvorschriften. Eine eingescannte Unterschrift auf einem PDF-File genügt nicht der Schriftform.
Beachten Sie
Fehlt die Schriftform, ist ein unbefristeter Vertrag zustande gekommen. Ist ein befristetes Arbeitsverhältnis nur mündlich zwischen den Arbeitsvertragsparteien vereinbart, ist nur die Befristung unwirksam, der Arbeitsvertrag selbst aber nicht. Es handelt sich dann um einen unbefristeten Arbeitsvertrag (§ 16 TzBfG).
[29]Aufgabenbeschreibung
Wie detailliert die Aufgabenbeschreibung im Arbeitsvertrag ist, ob insbesondere eine exakte Tätigkeitsbeschreibung dem Arbeitsvertrag beigefügt oder in ihm enthalten sein soll, hängt von den Umständen im Einzelfall ab. Eine gesetzliche Vorgabe hierzu gibt es nicht. Der Vorteil einer genauen und konkreten Tätigkeitsbeschreibung, gegebenenfalls mit Stellenbeschreibung, liegt darin, dass beide Parteien den exakten Vertragsgegenstand kennen. Die Frage der Eingruppierung oder Bewertung der Arbeitsleistung, des Arbeitsplatzes, die Details der Arbeitsaufgabe kann damit geklärt sein. Je genauer die Tätigkeit im Arbeitsvertrag beschrieben ist, desto schwieriger ist es dann aber, dem Arbeitnehmer andere Tätigkeiten zuzuweisen. Der Beschäftigte ist nur zur vertraglich fixierten Arbeit verpflichtet. Deshalb wird regelmäßig ein sogenannter Änderungsvorbehalt, eine sogenannte Versetzungsklausel in den Arbeitsvertrag aufgenommen.
Der Verein als Arbeitgeber hat mit einer solchen Vereinbarung die Möglichkeit, die Tätigkeiten des einzelnen Arbeitnehmers dem Arbeitsbedarf und der jeweils erforderlichen Organisation und ihrer Weiterentwicklung anzupassen. Eine Versetzungsklausel bedarf nach der Rechtsprechung jedoch der Klarstellung, dass nur gleichwertige Tätigkeiten zugewiesen werden können. Fehlt dieser Hinweis, so ist die Versetzungsklausel insgesamt unwirksam.
Allerdings kann sich das Arbeitsverhältnis auch durch praktische Handhabung über einen gewissen Zeitraum derart konkretisieren, dass dem Arbeitgeber die Möglichkeit genommen ist, dem Arbeitnehmer eine andere vergleichbare Tätigkeit zuzuweisen. Nach der Rechtsprechung müssen jedoch für eine derartige Einschränkung des Direktionsrechts des Arbeitgebers noch weitere besondere Umstände neben den reinen Zeitablauf treten. Dies können Ausbildung, Beförderung oder Gewöhnung an bestimmte Führungsaufgaben sein.
Der Nachteil einer offenen Regelung des Tätigkeitsgebietes für den Verein als Arbeitgeber und damit der Vorteil für den Arbeitnehmer besteht dann im Fall einer betriebsbedingten Kündigung.
Bei der betriebsbedingten Kündigung ist eine Sozialauswahl unter vergleichbaren Arbeitnehmern durchzuführen (vgl. Teil 1, Kapitel 8.4.3). Diese Vergleichbarkeit ist dann gegeben, wenn der Arbeitgeber aufgrund seines Direktionsrechts und den ver[30]traglich vorgegebenen Tätigkeitsinhalten Mitarbeiter im Hinblick auf den konkreten Arbeitsplatz austauschen kann.
Das Direktionsrecht des Arbeitgebers besagt, dass der Arbeitgeber die jeweils konkret zu leistende Arbeit und die Art und Weise sowie Ort und Zeit ihrer Erbringung festlegen kann. Grenzen dieses Leistungsbestimmungsrechtes des Arbeitgebers sind ausdrückliche vertragliche Vereinbarungen, Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates, tarifvertragliche und gesetzliche Vorschriften. In diesen Grenzen hat der Arbeitgeber eine arbeitsrechtliche Leitungsmacht, die sich auf die Ausführung der Arbeit selbst und den Arbeitsvollzug bezieht.
Will der Arbeitgeber hingegen arbeitsvertraglich ausdrücklich Geregeltes verändern, so steht ihm nur das Mittel der Änderungskündigung zu.
Zum Inhalt eines Arbeitsvertrages gibt es weder einen Informations- noch einen Mitwirkungsanspruch eines etwaig bestehenden Betriebsrats.
2.4.2Der befristete Arbeitsvertrag
Das BGB enthält kein Verbot von befristeten Arbeitsverträgen; vielmehr ist auch die Möglichkeit einer Befristung gesetzlich ausdrücklich angesprochen und vorgesehen.
Bei Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrages endet das Arbeitsverhältnis regelmäßig mit dem Zeitpunkt, zu dem die Frist abläuft oder der Zweck erfüllt ist. Es muss also gerade keine Kündigung ausgesprochen werden. Deshalb steht dem Arbeitnehmer bei der Beendigung eines befristeten Arbeitsverhältnisses auch nicht das Kündigungsschutzgesetz zur Seite. Es kann also durch das Arbeitsgericht keine Kündigung daraufhin überprüft werden, ob sie sozial gerechtfertigt ist.
Damit aber die Arbeitnehmer vor ungerechtfertigten Befristungen und damit ungerechtfertigter Beendigung des Arbeitsverhältnisses geschützt sind, hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) schon seit Jahrzehnten die Befristung nur sehr eingeschränkt zugelassen. Diese Einschränkungen sind im Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) geregelt. Dabei ist grundlegende Voraussetzung für die Wirksamkeit der Befristung des Arbeitsvertrages, dass dieser schriftlich abgeschlossen wurde (§ 14 Abs. 4 TzBfG). Ist der befristete Vertrag nur mündlich oder in anderer Form als der Schrift[31]form abgeschlossen, ist zwar der Arbeitsvertrag selbst wirksam, aber nicht die Zeitdauer, die Befristung.
Grundsätzlich ist eine Befristung nur dann zulässig, wenn es dafür einen sogenannten sachlichen Grund gibt. Beispiele für solche sachlichen Gründe sind im TzBfG genannt; die dortige Aufzählung ist aber nicht abschließend.
Ein solcher sachlicher Grund ist z. B. gegeben, wenn für einen Arbeitnehmer, der sich in Elternzeit befindet oder aus anderen Gründen längerfristig ausfällt, eine Ersatzkraft eingestellt werden soll. Die Dauer der Befristung muss sich dann an der »Abwesenheit« des vertretenen Mitarbeiters orientieren.
Beispiel: Sachgrund für eine Befristung
Eine Mitarbeiterin der Stammbelegschaft geht für zwei Jahre in Elternzeit. Da deren Arbeitsplatz für die Dauer der Elternzeit anderweitig besetzt werden soll, nach deren Ende die Mitarbeiterin wahrscheinlich aber wieder zurückkehren wird, kann die Ersatzkraft zulässigerweise befristet für die Dauer der Elternzeit eingestellt werden. In diesem Fall liegt also ein Sachgrund vor.
Die Aufzählung in § 14 Abs. 1 TzBfG ist nur beispielhaft:
Befristung aufgrund nur vorübergehenden Bedarfs der Arbeitsleistung (saisonaler Arbeitsanfall in Bewirtungs- und Hotelgewerbe in Urlaubsgebieten, absehbar auslaufender Personalbedarf etwa wegen geplanter Verlagerung von Arbeitsplätzen),Befristung im Anschluss an eine Ausbildung, um den Übergang in eine Anschlussbeschäftigung zu ermöglichen,Befristung zur Aushilfe oder Vertretung abwesender Beschäftigter (Elternzeit, Fortbildung, längere Krankheit),Befristung aufgrund der Eigenart der Arbeitsleistung (einmaliges Projekt wie Einführung eines neuen EDV-Systems oder eines neuen Entgeltsystems),Befristung zur Erprobung des Mitarbeiters, wenn es sachliche Gründe dafür gibt, dass in den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses die Erprobung nicht abgeschlossen werden kann (die ersten sechs Monate eines Arbeitsverhältnisses gelten als sogenannte gesetzliche Probe- oder Wartezeit),Befristung aus Gründen, die in der Person des Arbeitnehmers liegen (der Mitarbeiter will eine Wartezeit bis zur Aufnahme einer Weiterbildung durch die Tätigkeit überbrücken),Befristung aufgrund eines gerichtlichen Vergleichs.[32]Daneben gilt auch die Rechtsprechung des BAG aus der Zeit vor Inkrafttreten des Teilzeit- und Befristungsgesetzesweiter, die darüber hinaus folgende Gründe als sachlich gerechtfertigt angesehen hat:
Befristung auf den Zeitpunkt der erstmaligen Bezugsmöglichkeit ungekürzter Altersrente (aktuell 67. Lebensjahr),Befristung aufgrund eines absehbar auslaufenden Personalbedarfs (konkret geplante Verlagerung eines bestimmten Betriebsteils),Befristung mit Studierenden, um die Kenntnisse aus dem Studium durch praktische Tätigkeit zu erweitern.Zweckbefristung
Eine Zweckbefristung, bei der der Beendigungstermin nicht durch Zeitablauf, sondern durch Eintritt eines Ereignisses bestimmt ist, setzt neben einem sachlichen Grund voraus, dass der Zeitpunkt der Zweckerreichung bei Vertragsschluss für den Arbeitnehmer voraussehbar ist. Es muss also dem Arbeitnehmer mitgeteilt werden, wann der Zweck der Befristung erreicht sein und das Arbeitsverhältnis enden wird.
Das Teilzeit- und Befristungsgesetz lässt unter bestimmten Voraussetzungen eine Befristung auch ohne Sachgrund zu. Dabei gibt es tatbestandliche Einschränkungen.
Zum einen muss es sich bei dem Mitarbeiter um eine Neueinstellung handeln; der Mitarbeiter darf in der Vergangenheit noch nie Arbeitnehmer des Vereins gewesen sein.
Diese Arten der Vorbeschäftigungen sind unproblematisch:
War der Arbeitnehmer zuvor Auszubildender des Vereins, ist eine sachgrundlose Befristung möglich; als Auszubildender war er kein Arbeitnehmer.Gleiches gilt, wenn der Arbeitnehmer zuvor als Leih- oder Zeitarbeitnehmer im Verein tätig war. In diesem Fall war er nicht Arbeitnehmer des Vereins, sondern des Zeitarbeitsunternehmens.Zum anderen ist eine Befristung ohne Sachgrund zeitlich auf höchstens 24 Monate begrenzt. Eine längere sachgrundlose Befristung ist nicht zulässig.
Ist die erste Befristung kürzer als 24 Monate, kann sie maximal dreimalig verlängert werden, es ist aber immer die Grenze von 24 Monaten einzuhalten. Weiterhin muss darauf geachtet werden, dass
[33] auch die Verlängerung schriftlich vereinbart wird, da es sich ja hierbei auch um eine – weitere – Befristung handelt,die Verlängerung vor Auslaufen des ursprünglichen Vertrages vereinbart wird,die Verlängerung nahtlos an das ursprüngliche Arbeitsverhältnis anschließt.Beispiel: Verlängerung eines befristeten Arbeitsvertrags
So kann ein befristeter Arbeitsvertrag verlängert werden: Mit einem Mitarbeiter wurde ein befristeter Arbeitsvertrag über sechs Monate abgeschlossen. Dieser Vertrag kann beispielsweise dreimal um jeweils weitere sechs Monate verlängert werden, der 24-Monats-Zeitraum wird eingehalten.
§ 14 Abs. 2 Satz 3 TzBfG enthält eine Tariföffnungsklausel. Durch Tarifvertrag können die Maximaldauer eines sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrages und die Anzahl der Verlängerungen abweichend geregelt werden. Der Gesetzgeber wird dies einschränken wollen.
Beachten Sie
Die obigen Ausführungen entsprechen dem aktuellen Stand der Drucklegung dieses Buches. Es ist geplant, die 24-Monats-Frist auf 18 Monate zu verkürzen. Auch die Verlängerungsmöglichkeiten sollen reduziert werden.
Weiter kann nach § 14 Abs. 3 TzBfG ohne sachlichen Grund befristet werden, wenn der Bewerber bei Beginn des Arbeitsverhältnisses das 52. Lebensjahr vollendet hat und in den letzten vier Monaten zuvor beschäftigungslos war. Diese Befristung darf die Dauer von fünf Jahren nicht überschreiten. Ist die Befristung kürzer als fünf Jahre, darf beliebig oft verlängert werden, bis der Fünf-Jahres-Zeitraum erfüllt ist. Das BAG sieht in dieser gesetzliche Regelung keine Altersdiskriminierung und damit auch keinen Verstoß gegen das AGG und die dem zugrunde liegenden EU-Richtlinien.2
Grundsätzlich enden befristete Arbeitsverträge mit Auslaufen der Frist bzw. mit der entsprechenden Zweckerreichung. Eine vorzeitige Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist hier nur dann zulässig, wenn ein Grund für eine außerordentliche Kündigung vorliegt. Eine ordentliche Kündigung ist nur dann möglich, wenn dies auch ausdrücklich in dem befristeten Arbeitsvertrag vereinbart wurde.
[34]Praxistipp: So formulieren Sie die vorzeitige Kündigungsmöglichkeit
»Vor Ablauf der Befristung kann das Arbeitsverhältnis von beiden Seiten unter Einhaltung der jeweiligen Kündigungsfrist gekündigt werden.«
Fehlt eine solche Vereinbarung, so kann das Arbeitsverhältnis vor dem Ende der vereinbarten Frist nur aus wichtigem Grund, also außerordentlich, gekündigt werden.