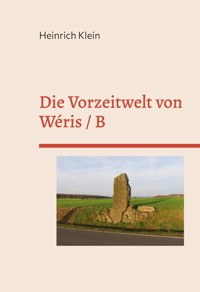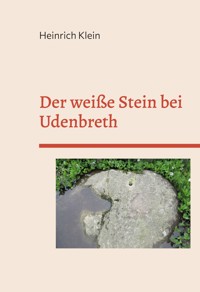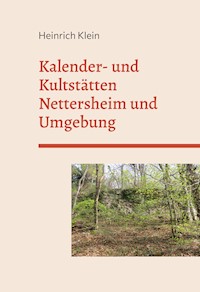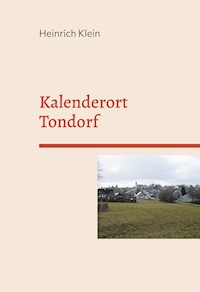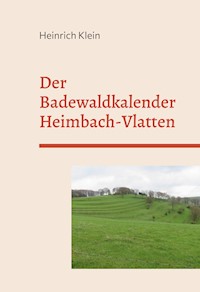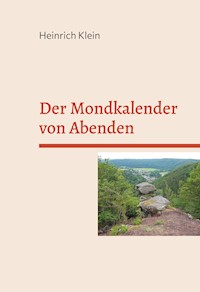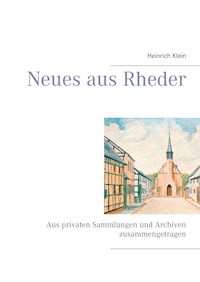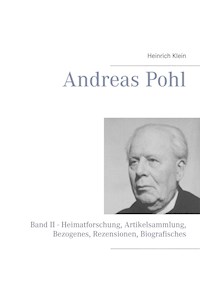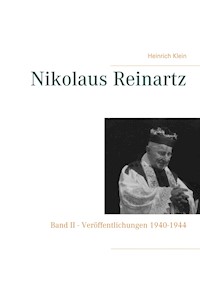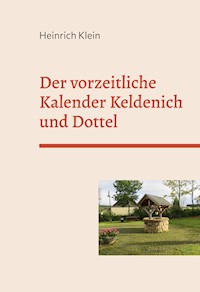
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In der Umgebung von Keldenich und Dottel gibt es Hinweise auf Spuren einer längst vergessenen uralten Kultur. Ein Menhir, mehrere Steinvorkommen und vorzeitlich genutzte Quellen zeugen von der Zeit vor den Römern und davor. Die Lage mehrerer Kultstätten lässt darauf schließen, dass diese Standorte zu Sonnen- und Mondbetrachtungen bereits in der Steinzeit genutzt wurden. Seit etwa 20 Jahren befasst sich der Verfasser mit vorzeitlichen Kalendern, einem Sachgebiet, welches weitgehend unbekannt ist und über keine Terminologie verfügt. Anhand von Azimutbetrachtungen, Höhenanalysen, Auswertungen von Flurausrichtungen und Wegeverläufen, Standortanalysen, Auswertungen von topografischen und historischen Karten, Google-Earth Luftbildern, Begehungen, Kontakten zu Heimatforschern und Vereinen, Internetrecherchen, Dorfchroniken, Heiligenlexikon, Sprachlexikon, sowie Archivarbeit, historischer Schriften und Aufsätze lassen sich Einblicke in unsere Vorzeit gewinnen und unter kalendarischem Gesichtspunkten betrachten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titelbild
Dorfplatz Dottel
Foto
Verfasser, 29.10.2017
Vorzeitkalender.de
Dank an.
Sophie Lange, Nettersheim, Matronenforschung, Heimatforschung.
Reinhold Lück, Hohenpeißenberg, Quellen- und Vorzeitforschung.
Renate und Hermann-Josef Olligschläger, Dottel, Begehungen und Hinweise.
Herr und Frau D. Glauner, Walberberg, Begehungen und Hinweise.
Meine Frau Ellen Klein für ihre Unterstützung.
Ellen und Heinrich Klein, Marpingen.
Inhaltsverzeichnis.
Vorwort
Aus der Dorfchronik Keldenich
Keldenich und Dottel
Der Mondkalender
Kalenderlinien am Friedhof
Keldenicher Heide
Die Eisheiligen
Das Quellheiligtum am Wichelberg
Die Herkunft unseres Wassers
Keldenich
Dottel
Die Antoniuskapelle zu Dottel
Das vorzeitliche Dottel
Die Mondkultstätte Dottel
Der Lützert
Königsfeld
Ein Besuch in Keldenich und Dottel
Ein Besuch am Wichelberg
Ein Besuch am Thönnesbusch
Der Sonnenkalender
Das Kalendermodell
Einzelbeschreibungen
Zusammenfassung
Anhang zum Tanzberg
Radiästhetische Analyse
Kultstättenanalyse Keldenich und Dottel
Quellheiligtümer
Der Lichtertberg
Eine erste Begehung
Mondwende Lichtertberg
Lichtertberg Beschreibung
Eine weitere Begehung
Der "Große Lichtert"
Die Bedeutung des Lichtert
Die Keltengräber von Weyer
Quellheiligtümer Lichtert und Weyer
Anhang 1, Kornelius-Heiligtümer Eifel und Bretagne
Anhang 2, Die Kultstättenlinie Aachen-Keldenich-Engelgau
Anhang 3, Hinweis zum verwendeten Kartenmaterial bei Tim-Online.de
Anhang 4, Zu den Quellenanalysen
Qualität der Mutungen
Hinweise
Wortindex
Abbildungsindex
Veröffentlichungen zur Kalenderforschung
Copyright
Vorwort.
Dieses Buch befasst sich mit vorzeitlichen Stätten rund um Keldenich und Dottel. Der kalendarisch zugehörige Lichtertberg gehört zwar zu den Mechernicher Dörfern Lorbach, Kallmuth und Vollem, konjugiert mit mehreren Höhen der Umgebung an bedeutenden Kalendertagen und ist nur teilweise für das Gebiet um Keldenich relevant.
Die als vorzeitliche Heiligtümer zu bezeichnenden Stätten liegen bei Weyer, Harzheim und Holzheim, und sind in weiteren kleinen Kalendersystemen zusammen mit Herkelstein und Hermesberg eingebettet.
Ursprünglich war dieser Aufsatz dazu gedacht, alle Kalenderstätten rund um den Lichtertberg anzuführen und die kalendarischen Zusammenhänge in einem Buch zu erläutern. Der Übersicht halber stellte es sich jedoch als sinnvoll heraus, die Editionen rund um den Lichtertberg in zwei Bände aufzuteilen.
Am Schluss dieses Buches folgen Randthemen der Kalenderbetrachtung. Eine Leyliniendarstellung von Aachen nach Engelgau berührt die Keldenicher Kirche, sowie einige Stätten um den Kartstein und weiter die Gegend um Engelgau, in dessen Einflussgebiet sich noch einige Kalenderlinien und Kalenderstätten befinden.
Ein besonders interessanter historischer Beitrag von den Steinreihen von Carnac gibt Aufschluss über einen ehemaligen Steinkult, der von den Germanen im Zusammenhang mit der Einführung des Christentums vernichtet wurde, indem man Kultsteine und Menhire zerschlug oder vergrub.
Im Anhang des Buches sind einige Erklärungen zur Radiästhesie erwähnt, die Einblick in vorzeitliche Quellenforschung durch den Radiästheten Reinhold Lück aus Hohenpeißenberg 1 in Bayern gestatten. Im Falle des Nebeneinanderliegens von vermuteten Kalenderstätten mit vorzeitlich genutzten Quellen kommt also eine besondere Betrachtung für die Kultstättenforschung hinzu.
Die Menschen der Vorzeit beobachteten den Stand der Sonne und des Mondes am Horizont und konnten die entsprechende Jahreszeit oder das entsprechende Kalenderereignis bestimmen. Insbesondere Winter- und Sommerbeginn, sowie Beginn der Feldarbeit bzw. Ende des Frostes waren für die Menschen die wichtigen Eckdaten, nach denen sie ihr bäuerliches Leben gestalteten.
Die Kelten und die Menschen davor kannten keine Aufzeichnungen und das Kalenderwissen wurde nur mündlich von Generation zu Generation übertragen. Bäume, Pfosten oder Menhire auf Hügeln markierten den Stand der Sonne und des Mondes zu bestimmten Kalenderereignissen. Selten finden sich heute Runensteine, Rillensteine oder Menhire, die auf solche Markierungen hinweisen. Die letzten Zeugnisse in der Eifel sind der Weiße Stein bei Udenbreth, die Leyfelsen entlang der Rur, Menhirfunde bei Lammersdorf, Heckenausrichtungen, Terrassierungen bei Nideggen, Ringwall bei Kreuzweingarten, Michelskapelle Mahlberg und schließlich die Kirchen von Keldenich, Dottel und Weyer die auf uralten vorzeitlich genutzten Quellen stehen und deren Standorte sich für wichtige Kalenderbeobachtungen eignen.
Die Entdeckung der in diesem Band veröffentlichten Kalendersysteme ging zunächst von Untersuchungen bei Keldenich aus. Es stellte es sich heraus, dass sich an einigen Kalenderstandorten bei Keldenich und Dottel weitere Kultstätten anschlossen, die schließlich zum Lichtertberg und weiter nach Weyer führten, weiterhin ein benachbartes überschaubares Kalendersystem bei Harzheim umfassten und schließlich Rückschlüsse auf die kalendarische Ausrichtung der Keltengräber bei Weyer gestatteten. Hierüber wird in einem Folgeband zu lesen sein. Aufgrund von umfangreichen Quellenanalysen durch den Radiästheten Reinhold Lück 2 aus Hohenpeißenberg konnten weitere Aussagen wie über Alter und Qualität des Wassers gewonnen werden.
Schließlich dehnten sich die Forschungen in Richtung Holzheim aus. Dieser Ort liegt direkt neben dem Herkelstein, ein vom Namen her wohl bedeutsamer Hügel, an dem sich einige Steinformationen finden. Ein entsprechend geeigneter Felsen präsentiert sich als Göttersitz zu dem eine künstlich angelegte Rinne und ein behauener Felsen führen.
Von hier und dem benachbarten Ort Weiler am Berge lassen sich Kalenderbetrachtungen und Fernbetrachtungen durchführen. An geeigneten Stellen der Umgebung bieten sich Blicke auf den Ringwall bei Kreuzweingarten und den Lichtenberg bei Billig, der unweit der römischen Straßensiedlung Belgica Vicus liegt.
1 Reinhold Lück, Hohenpeißenberg, Internetseiten: sonnenheiligtum.de.
Aus der Dorfchronik Keldenich.
Es sollte alles anders geschehen, als es geplant war. Auf den Spuren von Monsignore Jakob Hubert Wolfgarten aus Rheder kam ich seinerzeit nach Keldenich. Msgr. Wolfgarten stammte aus der damaligen Kirchengemeinde Kreuzweingarten – Rheder – Kalkar, in der ich aufwuchs. Auf dem Friedhof von Keldenich finden wir die letzte Ruhestätte von Monsignore Wolfgarten.
Durch einen Besuch beim ehemaligen Küster Josef Hermes im Jahre 2010 erhoffte ich mehr über Monsignore Wolfgarten zu erfahren. Hierbei konnte ich erstmals die Orte Keldenich und später auch Dottel kennen lernen und mich von der Schönheit der Kirchen und Lage der Orte überzeugen. In dieser Zeit entstanden einige Editionen im Rahmen der Dorfchronik Kreuzweingarten-Rheder. Die Ausführungen befinden sich auf den dortigen Internetseiten.
Damals ahnte ich noch nicht, dass Keldenich und Dottel Orte sind, die über weitere Zeugnisse der Geschichte verfügen und zu den wichtigen Orten des Bergbaus in der Eifel zählen. Interessanterweise erfuhr ich auch von Wunderheilungen im Zusammenhang mit einer kleinen Kapelle bei Keldenich und stellte Jahre später fest, dass in der Nähe einige Quellen sind.
Eine weitere Überraschung erlebte ich 7 Jahre später, als ich feststellte, dass Dottel und Keldenich ebenso zu den ganz besonderen Orten neben Weyer, Nettersheim und Nideggen gehört, die Einblicke in die Vorzeit der Eifel geben. Der nahe gelegene Lichtertberg bei Weyer weist neben der Mittelpunktfunktion einiger kleiner regionaler Azimutbetrachtungen durch seine Lage und seine Fernsicht zum Siebengebirge und nach Köln eine Besonderheit auf, die ihn als zentralen eburonischen Ort erscheinen lassen.
Das Heiligtum Keldenich und Dottel basiert auf einigen älteren Quellen. Eine besondere Quelle befindet sich unterhalb der Kirche von Dottel, sie ist durch Überbauung durch die Kirche und eines Vorgängerbaus gestört.
Ich hatte etwa 17 Jahre vorher mit der Kalenderforschung angefangen, beginnend mit einem vermuteten vorzeitlichen Kalender am Kreuzweingartener Ringwall, den ich nicht beweisen konnte, und einigen weiteren geschichtsträchtigen Orten, wie dem Michelsberg bei Bad Münstereifel-Mahlberg zusammen mit Odesheim und seinem Lüfthildiskult, ferner eine frühgermanische oder keltische Festung bei Nideggen am Rödelsberg gelegen, dann Simmerath-Lammersdorf mit uralten Kultfelsen und Steinsetzungen; schließlich noch Untersuchungen am Weißen Stein bei Udenbreth und in Wéris / Belgien mit seinen schönen Dolmen und Menhiren.
Die Heimatforscher von Kall, Keldenich und Dottel mögen mir den Einblick in die örtliche Geschichte und das Wirken von Msgr. Wolfgarten in Keldenich und Dottel nachsehen. Ich versuche, die Darlegungen entsprechend mit Quellenangaben zu unterlegen und die allgemeinen Erläuterungen verständlich zu machen. Leider verfügt die Kalenderforschung in Deutschland nur über wenig Literatur, geschweige denn über eine Terminologie.
Bergheim, den 1. Dezember 2020. 2. Auflage 3. Januar 2023.
Heinrich Klein
2 Reinhold Lück, Hohenpeißenberg, sonnenheiligtum.de.
Keldenich und Dottel.
Aus der historischen Tranchotkarte stammt der folgende Ausschnitt, der die Orte Keldenich, Dottel und die ehemalige Hofstätte Königsfeld (K) zeigt. Letzte als ferme ruinez (gesperrt, zerstört / geschlossen, ruinös) eingezeichnet. Aufgrund einer Quellenanalyse von Reinhold Lück aus Hohenpeißenberg in Bayern, wurden den Ergebnissen einer kalendarischen Auswertung den Orten Keldenich und Dottel aussagekräftige Ergänzungen hinzufügt. Es hatte sich bereits bei Kalenderanlagen im Badewald (Nideggen-Abenden) und bei Simmerath-Lammersdorf herausgestellt, dass viele der wichtigen Kultstätten in der Nähe von Quellen liegen. Diese waren in früheren Zeiten noch genutzt. Erfahrene Radiästheten, besonders im süddeutschen Raum und in Österreich sind in der Lage, anhand von Resonanzkörpern zu bestimmen, ob bestimmte Quellen bereits in der Zeit vor den Kelten genutzt wurden. In der beiliegenden Karte wurden die in Frage kommenden Stätten eingezeichnet und mit Kalender- und Kultstättenanalysen ergänzt.
Diese Untersuchung umfasst nicht die örtlichen Brunnen, die für Privatzwecke und für Zwecke der Erzwäsche genutzt wurden. Weiterhin wurde nicht erfasst, ob es einst noch weitere Wegekreuze, Bilderstöcke oder Kreuze gegeben hat, die irgendwelchen Maßnahmen in der Vergangenheit zum Opfer fielen. Die erarbeitete Auswertungskarte liegt in der Größe von 263 x 135 cm vor. Sie hat mehrere Ebenen und umfasst im PSD-Format (Adobe Photoshop) 165 MB. Auf Anfrage und zu Vollständigkeitszwecken kann diese Interessenten zur Verfügung gestellt werden.
Abb. – Übersichtskarte.
Eine Besprechung im kleinen Kreis ergab mehrere Punkte, die sich zunächst nicht lösen ließen
An der Anhöhe in der Kurve Brigidastraße - Pützberg wird eine ehemalige Versammlungs- oder Gerichtsstätte vermutet. Diese Vermutung ist leider nicht belegbar, zumal 1100 Meter östlich von Keldenich in der topografischen Karte ein Galgenberg eingetragen ist.
Ein im Ehlenbenden gefundener Menhir deutet auf einen ehemaligen Steinkult. Sein ursprünglicher Standort ist möglicherweise der 300 m entfernte Thönnesbusch, auf dem sich eine sogenannte „Blind Spring“ befindet. Es handelt sich hierbei um eine senkrecht stehende Wasserader, die nicht mehr nach oben dringt, also eine versiegte Quelle. Im Gebüsch befindet sich eine brunnenartige Einfassung, nördlich davon weitere Fundsteine und verwachsene Felsen.
Der Menhir wurde beim Untergrundpflügen mehrfach touchiert und später herausgeholt. Er steht nun im Hof eines bäuerlichen Anwesens in Hostel. Am Fundort selbst befindet sich in der Kartenansicht bei Google-Earth vom 4.9.2011 ein kreisförmiger Abdruck. Dieser lässt auf eine ehemalige feuchte Stelle oder ein Maar schließen. Die Flurbezeichnung in der Tranchotkarte (1808-1817) lautet Ellenmaar, als Feuchtwiese nach Westen bzw. Nordwesten verlaufend. Es gibt vereinzelt in der Eifel (beispielsweise Simmerath-Lammersdorf) Steinsetzungen oder Steinfunde an Bächen oder kleinen Wiesenbächen die zu Markierungszwecken an Wasserläufen oder Quellen dienen. Bei Keldenich oder Dottel konnten jedoch keine weiteren Anhaltspunkte für Steinsetzungen solcher Art gefunden werden.
Zum Namen Ehlen fanden sich keine konkreten Hinweise. Am ehesten käme die Erle als Namensgeber in Frage, die in Gesamteuropa feuchte Plätze bevorzugt und sich vielfältig im Holzbau einsetzen lässt. An der Stelle des Ellenmaars befindet sich heute das Industriegebiet Kall, etwa der Siemensring.
Die Straße nach Süden „Auf der Lehmaar“ deutet auf eine Wasserstelle an einem Leyfelsen oder Findling, möglicherweise den Standort eines ehemaligen Menhirs. Dort befindet sich die Flur „Am Güchenkreuz“, die auch auf der Tranchotkarte verzeichnet ist. Zum Namen Güchen oder auch Jüchen fanden sich folgende Hinweise.
Abb. – Menhir von Dottel, eingebaut mit Vogeltränke.
Im Jahre 866 wurde der Abtei Prüm Land in Iuhcgende / Iughgende geschenkt; diese frühe Erwähnung identifizierte man früher mit Jüchen, was heute jedoch abgelehnt wird. 3 Vielleicht ist die südlich von Keldenich liegende Flur als Güchenacker zu verstehen? Es käme eine Bezeichnung aus dem Althochdeutschen namens jühhard oder jüchard für das Landmaß „Morgen“ in Frage. 4 Niederhochdeutsch bedeutet juchum, juchus so viel wie Joch. 2 Bei Landwirten der Eifel war ein Morgen um 1950 im gültigen Gebrauch und wird auch heute noch verwendet. Die Straßenbezeichnung „Auf der Lehmaar“ dürfte auf ein Maar am „Lehen“ hinweisen, welches sich eben am Jochmorgen, Arbeitsmorgen, dem Juch oder Joh (althochdeutsch) 2 befand. 5
Der Ahornweg entlang des Friedhofes verläuft auf einer Tangente zur Sommersonnenwende (50,8 Grad Azimutwert) in Ausrichtung auf die Kirche Keldenich und weiter über den Thönnesbusch bis zum Lützert, einem lang gestreckten konischen Hügel Richtung Kallmuth. Der Name Thönnes deutet auf den Hl. Antonius; dieser gilt als Schutzpatron der Bauern und Schweinehirten, aber auch Bürsten-, Korb- und Handschuhmacher, Ritter, Weber, Metzger, Zuckerbäcker, Totengräber; er wird bei Feuersnot, Wundrosen, Geschwüren, Hautkrankheiten, Kopfschmerzen, Lepra, Pest und Syphilis angerufen. 6 Antonius ist der Schutzpatron der Kirche von Dottel.
Teile der Dechant-Wolfgarten-Straße und „Auf der Lehmaar“ verlaufen in der Nord-Süd-Richtung. Die Abweichung zur Idealausrichtung beträgt etwa 2 Grad, sie lässt sich mit der Schwankung der Erdachse begründen. Am jeweiligen südlichen Ende beider Straßen befinden sich ein Bildstock und ein Wegekreuz.
Ansonsten verfügt die besiedelte Fläche Keldenichs über keine kalendarischen Attribute, wie Wege- oder Flurverläufe auf Kalenderlinien. Die Menschen zur Megalithzeit und der Zeit davor vermieden aus Furcht vor Gottheiten, um nicht gesehen zu werden, die von Göttern einsehbaren Bereiche. Sie legten ihre Siedlungen so an, dass Verbindungswege nicht auf Kalenderlinien lagen. Berührten diese ihre Wege, so überquerten sie sie vornehmlich an günstigen Stellen, wie Tälern, Engpässen oder Bächen. Eigenartigerweise tauchen in Keldenich und Dottel die später bei den Germanen beliebten Wegeausrichtungen auf Sonnen- und Mondwendelinien nicht auf.
Dottel ist vorzeitlich sehr interessant. Die Antoniuskirche steht auf einem so definierten Sonnenheiligtum (14200 Jahre), eine Quelle, die oben speichenradförmig in mehreren Wasseradern verläuft, welche in einen Ringgraben enden. Weiterhin befindet sich dort in unmittelbarer Nähe ein weiteres so definiertes Keltenschanzenphänomen (siehe sonnenheiligtum.de), 16200 Jahre alt, welches über eine Wasserader verfügt, die aus großen Tiefen kommt und kurz unter der Oberfläche in einer Schleife verläuft. Eine weitere Entnahmestelle, die ebenfalls sehr alt ist, liegt an der Kirche. Sie ist als so genannte Venusschwingung definiert. 7 Das vorzeitliche Heiligtum an der Kirche zu Dottel ist durch Überbauung und Abriss von Vorgängerbauten gestört.
Zu