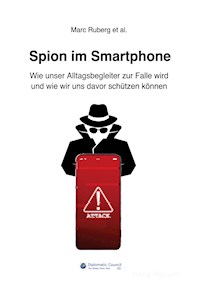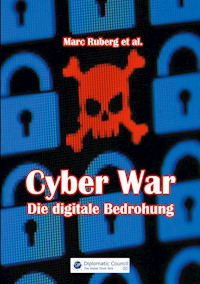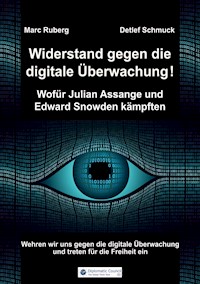Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Datenschutz gehört zu unseren wichtigsten Grundrechten - diesen Eindruck wollen uns weite Teile der Politik immer wieder vermitteln. Mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wurde 2018 ein Bürokratiemonster geschaffen, das uns vor dem Ausspähen unserer Daten schützen soll. Rund vier Jahre später muss man feststellen: Das Monster ist immer noch da, doch unsere Privatsphäre wird stärker mit den Füßen getreten als je zuvor. Die DSGVO hat sich als weitgehend zahnloser Papiertiger entpuppt. Der Schutz unserer Privatsphäre ist ein hohes Gut, doch das geltende Datenschutzrecht steht uns in vielen Fällen mehr im Wege als es uns schützt. Exemplarisch hierfür steht, dass wir seit Inkrafttreten der DSGVO beim Aufruf jeder Webseite stets aufgefordert werden, eine langatmige Datenschutzerklärung des jeweiligen Seitenbetreibers zu akzeptieren. Hand aufs Herz: Wer hat sich jemals diese Rechtsbelehrung durchgelesen geschweige denn verstanden oder gar erwogen? Es ist in der Regel einfach ein Klick mehr auf "akzeptieren" - genau das hat die DSGVO bewirkt, einen Klick mehr, sonst nicht viel. Hingegen steht der geltende Datenschutz neuen Entwicklung von selbstfahrenden Autos über das Internet der Dinge bis zur Künstlichen Intelligenz diametral entgegen. Für alle diese Entwicklungen, häufig als digitale Disruption oder sogar digitale Revolution bezeichnet, werden nicht weniger Daten, sondern immer mehr Daten benötigt. Digitale Daten sind der Rohstoff für unsere digitale Zivilisation. Vor diesem Hintergrund fordert der Autor eine fundamental neue Herangehensweise beim Datenschutz, die unsere Privatsphäre wirklich schützt. Dies ist sinnvoller als uns weiterhin mit einem Rechtsungetüm zu belästigen, da kaum jemandem nutzt, aber dem Fortschritt der Digitalisierung wie eine Monstranz entgegensteht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Bürokratiemonster DSGVO
Gefahr des Scheiterns beim Datenschutz
Unsere Zukunft: Mehr Daten – mehr Schutz!
Ein Plädoyer für den Datenschutz
Prolog
Die Weihnachtsgeschichte als größte Volkszählung
Die Herrscher lassen zählen
Volkszählungen im Römischen Reich
Die ersten Datenschützer waren die Adeligen
Erste Volkszählung in Deutschland
Volkszählung 1987
Ausspähen ist strafbar
Datenschutz – was ist das?
Datenschutz beginnt in den USA
Passender Begriff gesucht
Hessen schreitet voran
Mehr Daten als je zuvor
Grundrecht auf eigene Persönlichkeit
UNO: Datenschutz ist Menschenrecht
Europäische Menschenrechtskonvention
Grundgesetz ohne Privatleben
Bundesverfassungsgericht schreitet ein
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung
Das Phänomen des Michel Foucault
Es gibt kein belangloses Datum
Wie eine endlose Datenspirale
Vom Verbraucher zum Prosumer
Datenschutz-Grundverordnung
Die Visitenkartenfalle
Lizenz gelesen – wirklich?
Umfassendster Datenschutz der Menschheit
Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht
Facebook erdreistet sich
Mittelstand und Vereine lahmgelegt
Visitenkarte als Rechtsverletzung
Gesetzes-Ungetüm irrsinnig in der Praxis
20 Jahre altes Verständnis von Datenschutz
Hohe Geldbußen bei Verstößen
E-Privacy Verordnung
Toaster mit Privatsphäre
Das Verhältnis zwischen DSGVO und e-Privacy-VO
Worum geht es bei e-Privacy?
Wann kommt das e-Privacy-Chaos?
Die Mär vom globalen Datenschutz
Safe Harbor – der unsichere Hafen
Fünf Jahre Naivität
Edward Snowden hat der Welt die Augen geöffnet
Neue Regeln für den Datenaustausch
Unwirksamer Schutzschild der Privatsphäre
Zum zweiten Mal ist die EU naiv
Der Europäische Gerichtshof schreitet ein
Der Staat bespitzelt uns
Der Große Lauschangriff
Globaler Lauschangriff auf die ganze Welt
Richterliche Überprüfung auf wackeligen Füßen
Digitale Speicher für die Weltbevölkerung
Charta der digitalen Grundrechte
Geheimdienste außer Kontrolle
Land unter Kontrolle
Spuren im Netz
Daten als Rohstoff der digitalen Welt
Nichts geht verloren
Zweckentfremdung vorprogrammiert
Facebook schlimmer als Google
Spionage als Geschäftsmodell
Wir werden verfolgt
Vom Verbrecher zum Normalbürger
Unsere Fingerabdrücke sind gefragt
Sieg der Bequemlichkeit
Missbrauch biometrischer Daten
Automatische Gesichtserkennung
Wie wir fühlen, was wir denken, wie wir reagieren
1984 wird Realität
Gesichtserkennung überall
Neuregelung der Digitalwirtschaft
USA gegen Facebook und Konsorten
Epic versus Apple
Angriff auf Google
Europa macht Ernst: DSA und DMA
China gegen Alibaba
Ausblick
Tipps zum Abschluss
Über die Autoren
Bücher im DC Verlag
Über das Diplomatic Council
Quellenangaben und Anmerkungen
Vorwort
Der Datenschutz gehört zu unseren wichtigsten Grundrechten – diesen Eindruck wollen weite Teile der Politik uns immer wieder vermitteln – und das zu Recht! Die Wahrung unserer Privatsphäre gehört in einer zunehmend digitalen Welt zu den größten Herausforderungen. Wir alle wollen keine gläsernen Bürger sein und keine transparenten Verbraucher. Privatheit ist ein urmenschliches Bedürfnis, genauso wie Gesellschaft – aber wir möchten selbst bestimmen, wann wir für uns sein und wann und was wir anderen mitteilen wollen.
Bürokratiemonster DSGVO
Mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wurde 2018 ein Bürokratiemonster geschaffen, das uns vor dem Ausspähen unserer Daten schützen soll. Mehr al sdrei Jahre später muss man wohl feststellen: Das Monster ist immer noch da, doch unsere Privatsphäre wird stärker mit den Füßen getreten als je zuvor. Die DSGVO hat sich als weitgehend zahnloser Tiger entpuppt.
Das hat zwei wesentliche Gründe Erstens gehört der Staat selbst zu den eifrigsten Datensammlern. Dazu nur ein Beispiel: Wer einen Personalausweis beantragt, wird gezwungen, den Behörden ein biometrisches Porträtfoto von sich zu überlassen. Es gibt kaum etwas Privateres, denn ein biometrisches Foto kann von Computern automatisch erkannt werden. Damit ist einer Überwachung Tür und Tor geöffnet – auf staatliche Anordnung hin. Zweitens ist es der DSGVO in keiner Weise gelungen, die Datensammelwut der großen Digitalkonzerne wie Google oder Facebook ernsthaft in die Schranken zu weisen. Seit 2020 versucht die Europäische Union mit neuen Gesetzen, allen voran dem Digital Services Act (DSA) und dem Digital Markets Act (DMA), auf diesem Gebiet nachzubessern. Parallel dazu wird seit Jahren die e-Privacy Verordnung vorbereitet, die uns alle noch besser schützen soll. Hoffentlich gelingt das!
Gefahr des Scheiterns beim Datenschutz
Doch es besteht die Gefahr, dass der Datenschutz im europäischen Verständnis scheitern wird. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Erstens wird der Staat selbst auch weiterhin daran interessiert sein, so viele Daten wie möglich zu erheben – und zwar nicht für statistische Zwecke, sondern in Echtzeit, zur fortlaufenden Überwachung. Zweitens funktionieren neue Technologien wie Künstliche Intelligenz oder selbstfahrende Automobile nur auf Basis einer möglichst breiten Datenbasis. Und die Europäische Union und allen voran Deutschland strebt auf eben diesen Gebieten eine Führungsposition an. Die digitale Souveränität stellt ein erklärtes hohes politisches Ziel in Europa und in Deutschland dar.
Die Pandemiejahre 2020/21 haben überdeutlich gezeigt, wie wichtig ein hohes Maß an Autarkie ist. Die Corona-Warnapp wäre niemals in Funktion getreten, wenn die US-Konzerne Apple und Google nicht die technische Basis dafür geschaffen hätten. Geradezu beispielhaft für die mangelhafte Digitalisierung Deutschlands stand der Datenaustausch der Gesundheitsbehörden untereinander per Fax statt auf digitalen Wegen.
Die Chipknappheit 2021/22 hat klargemacht, dass ganze Industriezweige wie die Automobilbranche weitgehend lahmgelegt sind, wenn die technischen Grundlagen der Digitalisierung fehlen. Die fortlaufenden Angriffe von Computerhackern auf unsere digitale Zivilisation haben deutlich gemacht, dass eine strengere Überwachung vor allem der kritischen Infrastrukturen wie der Strom-, Wasser- und Gasversorgung unerlässlich ist.
Hinzu kommen neue Trends wie das Internet der Dinge, also die digitale Vernetzung praktisch aller Alltagsgegenstände, und natürlich die Künstliche Intelligenz, also die teilweise Übernahme des menschlichen Denkens durch Computerprogramme.
Unsere Zukunft: Mehr Daten – mehr Schutz!
Für alle diese Entwicklungen, gelegentlich als digitale Disruption oder sogar digitale Revolution bezeichnet, werden nicht weniger Daten, sondern immer mehr Daten benötigt. Digitale Daten sind nicht nur der Rohstoff für das schier unaufhaltsame Wachstum der Digitalkonzerne, sondern auch für unsere gesamte digitale Zivilisation.
Der Datenschutz steht allen diesen Entwicklungen diametral entgegen. Deshalb läuft er Gefahr, seine Schutzfunktion zu verlieren. Das wäre tragisch, denn wir benötigen mehr Schutz, nicht weniger! Aber zur Realität gehört eben auch, dass uns die heutige Gesetzeslage in vielen Fällen deutlich mehr im Wege steht als uns zu schützen. Exemplarisch hierfür steht, dass wir seit Inkrafttreten der DSGVO beim Aufruf jeder Webseite stets aufgefordert werden, eine langatmige Datenschutzerklärung des jeweiligen Seitenbetreibers zu akzeptieren. Hand aufs Herz: Wer hat sich jemals diese Rechtsbelehrung durchgelesen geschweige denn verstanden oder gar erwogen? Es ist in der Regel einfach ein Klick mehr auf „akzeptieren“ – genau das hat die DSGVO bewirkt, einen Klick mehr, sonst nicht viel.
Dabei stellt der Schutz der Privatsphäre ein hohes Gut dar, um dass es sich zu kämpfen lohnt. Doch in einer Zeit, in der ein Großteil der Weltbevölkerung seine geheimsten Wünsche an Google verrät, sich Mikrofone und Kameras freiwillig ins Smart Home holt und sein Privatleben bis ins kleinste Detail in den sozialen Netzen verbreitet, scheint der Einsatz für den Datenschutz zuweilen dem Kampf gegen Windmühlen zu gleichen. Die staatliche Erfassung biometrischer Daten, also beispielsweise eines computerlesbaren Porträtfotos bei der Beantragung eines Personalausweises, macht die Sache nicht besser, sondern steht ganz im Gegenteil als Beweis dafür, dass der Staat gar kein ernsthaftes Interesse hat, die Daten seiner Bürger zu schützen, jedenfalls nicht vor sich selbst.
Ein Plädoyer für den Datenschutz
Dieses Buch versteht als ein Plädoyer für den Datenschutz. Zugleich zeigt es aber auch die Abstrusitäten und Kuriositäten auf, die sich aus der Datenschutz-Grundverordnung und anderen gesetzgeberischen entwickelt haben, und die dazu führen, dass wir in vielen Fällen heute nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil weniger Datenschutz erleben. Diesen fatalen Trend gilt es zu stoppen und für einen modernen Datenschutz zu sorgen, bei dem einerseits unsere Privatsphäre besser geschützt ist als heute, und der uns andererseits nicht ständig bürokratische Hürden in den Weg legt auf dem Weg in die Zukunft.
Für dieses Ziel lohnt es sich zu kämpfen, meine ich!
Marc Ruberg et al.
An diesem Werk haben zahlreiche namhafte Mitglieder der UNO-Denkfabrik Diplomatic Council mitgewirkt, vornehmlich durch fachliche, technische, visionäre, wissenschaftliche, gesellschaftliche und politische Beiträge. Das vorliegende Buch stellt in diesem Sinne ein Gemeinschaftswerk „et alii“ bzw. „et aliae“ dar. Diesen Gemeinsinn wollen die Autoren mit dem bibliografischen Kürzel „et al.“, also „und andere“, ausdrücken.
Prolog
„Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe: Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.“
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!“ Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war.
Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott und alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.“ (Lukas 2, 1-20)1
Die Weihnachtsgeschichte als größte Volkszählung
Die Weihnachtsgeschichte schildert nicht nur die Geburt des Christentums, der mit 2,26 Milliarden Anhängern am weitesten verbreiteten Religion weltweit, sondern berichtet ganz nebenbei auch von der bis dato größten Volkszählung aller Zeiten, oder modern ausgedrückt: von der ersten Erhebung persönlicher Daten im großen Stil. Allerdings nicht von der ersten Zählung.2
Die Herrscher lassen zählen
Ermittlungen von Bevölkerungszahlen lassen sich bereits um 2700 v. Chr. in Ägypten nachweisen. Auch den Zweck hat die Altertumsforschung zutage befördert: Es ging darum, Steuern einzutreiben. Der Wunsch der herrschenden Klasse, seine Untertanen zu kennen und daraus seinen Nutzen zu ziehen, ist also nicht – oder jedenfalls nicht nachweislich – so alt wie die Menschheit, aber immerhin bis zu den „Alten Ägyptern“ zurückzuverfolgen. Anhand von Tonscherben lässt sich auch für die Zeit um 1700 v. Chr. eine lokale Volkszählung in Mesopotamien für militärische Zwecke belegen. Aus den früheren Epo-chen sind ferner Zählungen in China (2 n. Chr.) sowie in Persien und Griechenland bekannt. Bemerkenswert ist in Ägypten unter Amasis (569 v. Chr.) und in Israel unter König David (1000 v. Chr.) ein Dekret über die Erfassung der Einkommen. Man beschränkte sich dabei oft auf die Erfassung der waffenfähigen Männer. Mit anderen Worten: Für die frühen Herrscher ging es bei Volkszählungen, also der staatlichen Erfassung personenbezogener Daten, entweder um Geld oder um die Kampfstärke der Bevölkerung.
Volkszählungen im Römischen Reich
Im Römischen Reich gab es seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. alle fünf Jahre Volkszählungen und Erhebungen über die Einkünfte der römischen Bürger. Für den Zensus (Anmerkung: Der Fachbegriff für „Volkszählung“) und die Steuerschätzungen war der Censor, ein altrömischer Beamter, verantwortlich. Er legte die Höhe der Steuer fest, die jeder Bürger zu zahlen hatte und war dem Senat verantwortlich. Die Censoren waren sehr einflussreich und genossen hohes Ansehen.
Im Mittelalter gab es in Europa nur wenige Volkszählungen; meist wurden die Feuerstellen registriert, doch waren die erhobenen Daten oft ungenau, sodass Angaben zur Bevölkerung in der Regel nur Hochrechnungen darstellten. Von Bedeutung bei der Erfassung der Bevölkerung waren kirchliche Aufzeichnungen der Pfarren, weil die Pastoren Bücher über die „Seelen“ führen mussten.
Die ersten Datenschützer waren die Adeligen
Die ersten „Datenschützer“ waren die Adeligen Europas. Der Adel wehrte sich übrigens stets gegen Aufstellungen seiner Leibeigenen, denn er betrachtete sie als eine reine Privatangelegenheit, im Besonderen, solange sie von der Besteuerung befreit waren. Aus diesem Grund wurden Leibeigene für gewöhnlich auch nicht statistisch erfasst.
Bemerkenswert ist auch eine Episode aus dem Jahre 1753: Damals lehnte das britische Parlament eine Volkszählung ab mit der Begründung sie „würde Englands Feinden dessen Schwächen“ bloßstellen. Ein Abgeordneter betonte im Parlament, er sei befremdet, „dass es menschliche Wesen gäbe, die so frech und schamlos seien“, derartiges vorzuschlagen.3
Erste Volkszählung in Deutschland
Die erste Volkszählung in Deutschland fand 1816 im Königreich Preußen statt. Zwischen 1834 und 1867 führte der Deutsche Zollverein regelmäßig alle drei Jahre Volkszählungen in den Mitgliedsländern durch.4 Ermittelt wurde die sogenannte „Zollabrechnungsbevölkerung“. Zur Durchführung wurde ein Zeitpunkt gewählt, zu dem zu erwarten war, dass sich der größte Teil der Bevölkerung zu Hause aufhalten würde. Der Zollverein legte den 3. Dezember als Datum fest.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden im Dezember 1945 in der sowjetischen Besatzungszone, im Januar 1946 in der französischen Besatzungszone und im Oktober 1946 in allen vier Besatzungszonen Deutschlands unter Verantwortung der Besatzungsmächte Volks- und Berufszählungen durchgeführt. Dies geschah insbesondere, um die Kriegsverluste und die zahlreichen Ströme von Flüchtlingen, Umsiedlern und Heimatvertriebenen zu erfassen. Nach Gründung der beiden deutschen Staaten im Jahre 1949 fanden jeweils mehrere Volkszählungen statt.5