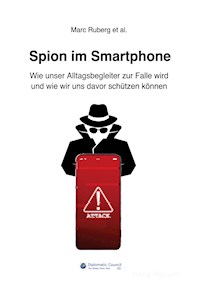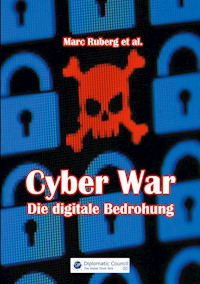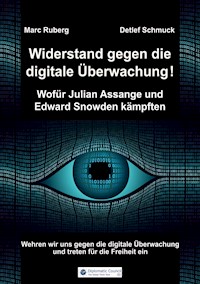
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die digitale Überwachung schreitet mit großen Schritten voran. Wir werden immer gläserner. Wenn sich diese Entwicklung ungehemmt fortsetzt, verschwindet unsere Privatsphäre auf Nimmerwiedersehen. In diesem Buch beschreiben die beiden Autoren, wie sehr wir heute schon digital bespitzelt werden, welche Rolle die Staaten, die Digitalwirtschaft und die Hacker dabei spielen und wie real die Gefahr wirklich ist, wenn wir uns nicht wehren. Seite für Seite decken sie auf, wie Behörden und Digitalkonzerne in unsere Privatsphäre eindringen. Schonungslos rechnen sie mit einer Politik ab, die den gläsernen Bürger zum Ziel hat. Julian Assange und Edward Snowden haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um uns aufzuwecken. Werden wir wach und wehren uns. Zahlreiche praxisnahe Hinweise, wie man sich gegen die digitale Bespitzelung wehren kann, finden sich im Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Dieses Buch ist Julian Assange und Edward Snowden gewidmet. Beide haben auf ihre Art die Gefahren eines Überwachungsstaates erkannt, aufgedeckt und dagegen gekämpft.
Inhalt
Vorwort
Helden der digitalen Welt
Julian Assange erleidet ein schweres Schicksal
Edward Snowden flieht nach Russland
Volkszählungen und Datenschützer
Die ersten Datenschützer
Die erste Volkszählung in Deutschland
Volkszählung 1987: Widerstand regt sich
Adel, FDP, Grüne und das Bundesverfassungsgericht
Ausspähen ist strafbar
Datenschutz – was ist das?
Widerstand gegen John F. Kennedy
Das erste Datenschutzgesetz 1970
Grundrecht auf eigene Persönlichkeit
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung
Panoptimus: Ein Leben im eigenen Gefängnis
Es gibt kein belangloses Datum
Immer mehr Daten von immer mehr Menschen
Der große Lauschangriff
Edward Snowden deckt auf
Handy-Zugriff bei Brieftaschenraub
Datenspeicher für die Weltbevölkerung
Geheimgerichte in den USA
Land unter Kontrolle
Die Konvention 108 plus
USA: Die Datenwelt gehört uns
Kampf um die Daten
Das Internet wurde 1968 geboren
Internet gehört uns allen
Wer im Internet etwas zu sagen hat
Die USA schenkten der Welt das Internet
Deutschland im Fokus der NSA
Zweckentfremdung vorprogrammiert
Facebook schlimmer als Google
Meta ist mehr als Facebook
Spionage als Geschäftsmodell
Die WikiLeaks-Protokolle
Chelsea Manning mit 400.000 Geheimdokumenten
Die Brisanz diplomatischer Depeschen
Biometrische Daten aus Afrika
China spielt in 3.297 Dokumenten eine Rolle
Informationen aus Deutschland
Windstelle in Österreich
Brisantes aus der Schweiz
Über 11.000 Depeschen aus der Türkei
Nachrichten aus den USA
EU, UNO, NATO und die Katholische Kirche
Knallharte US-Diplomatie
35 Jahre Freiheitsstrafe
Julian Assange – eine Tragödie
Die gefährlichste Website der Welt
Edward Snowden im Interview
Edward Snowden in Hongkong
Verteilung der Dokumente in verschiedene Länder
Das letzte Jahr
Das Leben bei der NSA
Die Stasi
Die NSA und die TK-/Internetfirmen
Warum Regierungen Verschlüsselung nicht mögen
Metadaten
Edward Snowden über Deutschland
Gefährdung der Sicherheit des ganzen Netzes
Privatsphäre
Ob Technologie sich mit Privatsphäre verträgt
Politik und die Kontrolle der Geheimdienste
Sein Leben in Russland
Unter Beobachtung stehen
Sollten wir Google mehr trauen als dem Staat?
Kritik wegen des Schadens, den er angerichtet habe
Vorwürfe, Snowden schwäche die Demokratie
Kritik, Snowden sei heuchlerisch und empöre sich selektiv
Kritik an seinen Verbindungen zu Russland
Warum so viele Dokumente
Die Pflicht, andere digitale Wege zu gehen
Die Zukunft der Geheimdienste
Deutschland: Wir werden bespitzelt
Staatstrojaner überwachen uns
Die Polizei, dein Freund und Hacker
Überwachung direkt an der Quelle
Der Chaos Computer Club deckt auf
Deutschland legt sich eine Cyber-Armee zu
Beschleunigungsfaktor Corona
Gewaltigstes Überwachungssystem der Welt
Apple und Google gegen die Bundesregierung
Heimlicher Eingriff in die Privatsphäre
Daten auf Vorrat: Die Mutter der Überwachung
Unsere Daten sind nicht sicher
Hacker greifen unsere Daten an
Der größte Datendiebstahl der Geschichte
Der GAU ist längst eingetreten
WannaCry – Warnung für die Digitalgesellschaft
Größer Hackerangriff auf die USA in der Krise 2020
Angriff auf die Impfstoffe
Hacker greifen Putin an
Unsere digitale Zukunft
Verharmlosung der Digitaltechnik
Exponentielle Entwicklung voraus
Digitalkonzerne gegen Staatsmacht
Tipps zum Abschluss
Über die Autoren
Marc Ruberg
Detlef Schmuck
Bücher im DC Verlag
Über das Diplomatic Council
Quellenangaben und Anmerkungen
Vorwort
Julian Assange und Edward Snowden haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um aufzudecken, wie die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika nicht nur die eigene Bevölkerung, sondern mehr oder minder die ganze Welt bespitzelt. Julian Assange ist aus diesem ungleichen Kampf mit der Staatsmacht USA als gebrochener Mann hervorgegangen, Edward Snowden konnte sich in Russland in Sicherheit bringen. Beide haben ihre Existenz dafür hingegeben, das Eindringen der US-Geheimdienste in die Privatsphäre unbescholtener Bürger und in die Geheimnisse anderer Staaten und internationaler Organisationen an das Licht der Öffentlichkeit zu bringen.
Die digitale Überwachung ist indes nicht auf die USA beschränkt, auch in vielen anderen Ländern gibt es immer und immer wieder den Versuch der Regierungen, ihrer Bevölkerung auf die digitalen Finger zu sehen. Die Europäische Union und die Bundesrepublik Deutschland stellen keine Ausnahmen dar.
Mit dem vorliegenden Buch wollen wir klarstellen, wofür Julian Assange und Edward Snowden gekämpft haben und warum es richtig und wichtig ist, dass wir alle diesen Kampf weiter fortsetzen. Sicherlich werden die meisten von uns nicht zu derart drastischen Mitteln greifen wie Assange und Snowden, allein schon, um die eigene Existenz nicht zu gefährden. Aber es gibt viele Wege, den Schutz der Privatsphäre gegen die Angriffe von Geheimdiensten und Regierungen, den maßlosen Datenhunger der Digitalkonzerne und nicht zuletzt das skrupellose Vorgehen krimineller Hacker zu verteidigen.
Dabei war es uns besonders wichtig, die Verquickungen dieser unterschiedlichen Angriffsformen auf unsere Privatsphäre aufzudecken. Der Staat verlangt von uns immer mehr Daten mit dem Versprechen, dadurch seine hoheitlichen Aufgaben besser erfüllen zu können und uns eine höhere Sicherheit zu gewährleisten. Die Unternehmen ermuntern uns, ihnen möglichst viele Daten anzuvertrauen, um uns dadurch vermeintlich bessere Dienstleistungen anbieten zu können. Doch je mehr wir über uns verraten, gleichgültig, ob es an staatlichen Stellen oder in den Datensilos der Firmen gespeichert wird, desto gläserner und desto angreifbarer sind wir.
Das vorliegende Buch stellt einen Aufruf dar, gegen diese zunehmende Bedrohung unserer Privatsphäre Widerstand zu leisten. Der Datenschutz erscheint manchmal lästig, häufig bürokratisch, gelegentlich in seinen Auswirkungen geradezu absurd. Aber machen wir uns klar: In einer digitalen Welt, in der unsere persönlichen Daten ungeschützt und unsere Privatsphäre bedeutungslos wären, wollen die meisten von uns vermutlich nicht leben. Wir, die Autoren, jedenfalls nicht!
Marc Ruberg, Detlef Schmuck
Helden der digitalen Welt
Julian Assange und Edward Snowden sind Helden der digitalen Welt, weil sie das Gebaren der Geheimdienste, insbesondere der National Security Agency (NSA) der Vereinigten Staaten von Amerika öffentlich gemacht haben. Beide haben der Politik und der Zivilgesellschaft rund um den Globus die Augen für eine der größten Gefahren der allgegenwärtigen Digitalisierung ein Stück weit geöffnet: den Verlust unserer Privatsphäre und damit dem Ende der Vertraulichkeit. Man ahnte sicherlich schon zuvor, dass es Bespitzelungen gibt, aber das ungeheure Ausmaß der systematischen digitalen Überwachung wurde erst durch Julian Assange und Edward Snowden offensichtlich. Es ging nicht um Ausnahmen und Einzelfälle, sondern um eine permanente und lückenlose Bespitzelung. Und sie war und ist keineswegs auf die USA begrenzt, China, Russland und auch Deutschland sowie sicherlich zahlreiche weitere Länder spielen ebenfalls mit.
Ohne Julian Assange und Edward Snowden wüssten wir nicht, zu welchen Mitteln die Staatsmacht tatsächlich greift, wenn ihre Geheimnisse aus den Datensilos ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden. Wir hätten keine Beweise, welchen ungeheuren Druck die USA in einem solchen Fall auf verbündete Staaten ausüben, bis hin zu einem laut unabhängiger Bewertung der UNO konstruierten Vergewaltigungsvorwurf, um einen Mann, der im Sinne eines investigativen Journalisten Kriegsverbrechen aufdeckt, zu diskreditieren und dadurch einen internationalen Haftbefehl auszulösen.
Julian Assange und Edward Snowden haben einen hohen Preis für ihr Engagement gezahlt. Es mag sein, dass sie nach US-amerikanischem Recht als Schwerverbrecher wegen Hochverrats gelten, aber für viele Menschen rund um den Globus sind die beiden mutigen Männer vielmehr Helden der digitalen Welt, vergleichbar mit dem fiktiven Freiheitskämpfer Winston Smith in George Orwells dystopischen Roman 1984. Wir erinnern uns: Will Smith leistet Widerstand gegen einen totalitären Überwachungsstaat. Der allgegenwärtigen Überwachung zum Trotz will Smith seine Privatsphäre sichern und etwas über die real geschehene Vergangenheit erfahren, die vom Staat durch umfangreiche Geschichtsfälschung verheimlicht wird. Dadurch gerät er mit dem System in Konflikt, das ihn gefangen nimmt, foltert und einer Gehirnwäsche unterzieht. 1 Die Biografien von Julian Assange und Edward Snowden sind ähnlich dramatisch.
Julian Assange erleidet ein schweres Schicksal
Julian Paul Assange, 1971 in Australien geboren, wird je nach Quelle als Computerhacker, Programmierer, investigativer Journalist oder Politikaktivist eingestuft. Er war Gründer und Sprecher der 2006 ins Leben gerufenen Enthüllungsplattform WikiLeaks. Auf dieser Online-Plattform konnten Dokumente anonym veröffentlicht werden, die als geheime Verschlusssache deklariert waren oder einer sonstigen besonderen Vertraulichkeit unterlagen, so dass sie für die Öffentlichkeit nicht zugänglich waren. Als WikiLeaks an den Start ging, wurde die Plattform als eine neue Form des investigativen Journalismus gefeiert, weil WikiLeaks für Personen aus Organisationen, die an Geheiminformationen herankamen, erstmals die Möglichkeit bot, diese Informationen öffentlich zu machen. WikiLeaks veröffentlichte zahlreiche interne Dokumente, unter anderem von US-Streitkräften und US-Behörden, zum Beispiel Kriegstagebücher über die Kriege in Afghanistan und im Irak. Der UNO-Sonderberichterstatter Nils Melzer, ein Rechtsprofessor aus der Schweiz und bei den Vereinten Nationen verantwortlich für die Aufdeckung von Folter, kam zu dem Schluss, dass über Wiki-Leaks unter anderem „mutmaßliche Kriegsverbrechen und Korruption“ aufgedeckt wurden.2
Für die USA erwiesen sich die Veröffentlichungen als eine Art nationale Katastrophe und die Verfolgung von Julian Assange begann. Nachdem Schweden im Jahr 2010 wegen Vorwürfen einer „minderschweren Vergewaltigung“ und sexueller Nötigung einen internationalen Haftbefehl gegen Julian Assange ausgestellt hatte, bereitete sich Großbritannien, wo er lebte, auf eine mögliche Überstellung vor. Er wurde indes auf Kaution freigelassen und das Land Ecuador gewährte ihm 2012 politisches Asyl. Die nächsten sieben Jahre lebte er als politischer Flüchtling in Ecuadors Botschaft in London. Er erhielt sogar die Staatsbürgerschaft Ecuadors. Doch im April 2019 entzog ihm der neu gewählte ecuadorianische Präsident Lenín Moreno sowohl das Asylrecht als auch die Staatsbürgerschaft. Im gleichen Monat wurde Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft von der britischen Polizei festgenommen und zu einer Haftstrafe von 50 Wochen verurteilt, da er sich durch seine Flucht in die Botschaft der Justiz entzogen hatte. Die USA nutzten ihre Chance und ersuchten Großbritannien um Auslieferung. Nahm man alle zu diesem Zweck eingereichten Punkte der US-Anklageschrift zusammen, so drohten Julian Assange bis zu 175 Jahren Haft, schlimmstenfalls sogar die Todesstrafe.3
40 Menschenrechtsorganisationen forderten daraufhin die britische Regierung auf, Assange unverzüglich freizulassen und seine Auslieferung an die USA zu verhindern.4 Im Dezember 2020 äußerte die deutsche Menschenrechtskommissarin Bärbel Kofler (die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe) Besorgnis über das Auslieferungsverfahren und drängte Großbritannien dazu, bei der Entscheidung über eine Auslieferung Assanges physische und psychische Gesundheit zu berücksichtigen.5 Am 4. Januar 2021 entschied ein Londoner Gericht, dass Assange wegen der zu erwartenden Haftbedingungen und bestehender Suizidgefahr nicht an die USA ausgeliefert werde; prompt legten die USA Berufung ein.6 Am 10. Dezember 2021 hob ein Berufungsgericht in London das Auslieferungsverbot auf. Die Begründung: Die USA hatten humane Haftbedingungen für Julian Assange zugesichert.7
Der bereits erwähnte Schweizer Rechtsprofessor und UNO-Sonderberichterstatter Nils Melzer warf daraufhin den Behörden in Schweden, Großbritannien und den USA eine „zutiefst willkürliche Prozessführung“ vor. Er sah die Pressefreiheit im Kern bedroht und sprach von konstruierter Vergewaltigung und manipulierten Beweisen. Melzer sagte über sein Mandat als UNO-Sonderberichterstatter über Folter wie folgt: „Der Fall berührt mein Mandat in dreifacher Hinsicht. Erstens: Der Mann hat Beweise für systematische Folter veröffentlicht. Statt der Folterer wird nun aber er verfolgt. Zweitens wird er selber so misshandelt, dass er heute selbst Symptome von psychologischer Folter aufzeigt. Und drittens soll er ausgeliefert werden an einen Staat, der Menschen wie ihn unter Haftbedingungen hält, die von Amnesty International als Folter bezeichnet werden. Zusammengefasst: Julian Assange hat Folter aufgedeckt, er wurde selber gefoltert und könnte in den USA zu Tode gefoltert werden. Und so etwas soll nicht in meinen Zuständigkeitsbereich fallen? Zudem ist der Fall von emblematischer Bedeutung, er ist für jeden Bürger in einem demokratischen Staat von Bedeutung.“ 8
Die Journalisten Daniel Ryser und Yves Bachmann haben im Januar 2020 ein ausführliches Interview mit dem zuständigen UNO-Sonderberichterstatter Nils Melzer geführt, das im folgenden auszugsweise wiedergegeben wird, weil die Bewertung der Sachlage aus dem neutralen Blickwinkel der Vereinten Nationen sicherlich zur Aufhellung beiträgt. Vor allem zeigt die Sichtweise der UNO erschreckend deutlich, zu welchen Mitteln die Staatsmacht greift, wenn ihre Geheimnisse aus den Datensilos öffentlich gemacht werden. Nils Melzer im Interview:
Wie sind Sie zu dem Fall gekommen?
Im Dezember 2018 wurde ich erstmals von seinen Anwälten um eine Intervention gebeten. Zunächst sagte ich ab. Ich war mit anderen Gesuchen überlastet und kannte den Fall nicht wirklich. In meiner von den Medien geprägten Wahrnehmung hatte auch ich das Vorurteil, dass Julian Assange irgendwie schuldig ist und ja, dass er mich manipulieren will. Im März 2019 kamen die Anwälte ein zweites Mal auf mich zu, da sich die Anzeichen verdichteten, dass Assange bald aus der ecuadorianischen Botschaft ausgewiesen werden könnte. Sie schickten mir einige Schlüsseldokumente und eine Zusammenfassung des Falls. Und da dachte ich, dass ich es meiner professionellen Integrität schuldig bin, mir das zumindest einmal anzuschauen.
Und dann?
Schnell wurde mir klar, dass hier etwas nicht stimmt. Dass es einen Widerspruch gibt, der sich mir mit meiner ganzen juristischen Erfahrung nicht erschliesst: Warum befindet sich ein Mensch neun Jahre lang in einer strafrechtlichen Voruntersuchung zu einer Vergewaltigung, ohne dass es je zur Anklage kommt?
Ist das aussergewöhnlich?
Ich habe noch nie einen vergleichbaren Fall gesehen. Jeder kann gegen jeden eine Voruntersuchung auslösen, indem er zur Polizei geht und die andere Person beschuldigt. Die schwedischen Behörden wiederum waren an der Aussage von Assange nie interessiert. Sie liessen ihn ganz gezielt ständig in der Schwebe. Stellen Sie sich vor, Sie werden neuneinhalb Jahre lang von einem ganzen Staatsapparat und von den Medien mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert, können sich aber nicht verteidigen, weil es gar nie zur Anklage kommt.
Sie sagen: Die schwedischen Behörden waren an der Aussage von Assange nicht interessiert. Medien und Behörden zeichneten in den vergangenen Jahren ein gegenteiliges Bild: Julian Assange sei vor der schwedischen Justiz geflüchtet, um sich der Verantwortung zu entziehen.
Das dachte ich auch immer, bis ich zu recherchieren begann. Das Gegenteil ist der Fall. Assange hat sich mehrfach bei den schwedischen Behörden gemeldet, weil er zu den Vorwürfen Stellung nehmen wollte. Die Behörden wiegelten ab.
Was heißt das: Die Behörden wiegelten ab?
Darf ich von vorn beginnen? Ich spreche fließend Schwedisch und konnte deshalb alle Originaldokumente lesen. Ich traute meinen Augen nicht: Nach Aussagen der betroffenen Frau selber hat es nie eine Vergewaltigung gegeben. Und nicht nur das: Die Aussage dieser Frau wurde im Nachhinein ohne ihre Mitwirkung von der Stockholmer Polizei umgeschrieben, um irgendwie einen Vergewaltigungsverdacht herbeibiegen zu können. Mir liegen die Dokumente alle vor, die Mails, die SMS.
„Die Aussage der Frau wurde von der Polizei umgeschrieben“ – wovon reden Sie?
Am 20. August 2010 betritt eine Frau namens S. W. in Begleitung einer zweiten Frau namens A. A. einen Polizeiposten in Stockholm. S. W. sagt, sie habe mit Julian Assange einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehabt. Allerdings ohne Kondom. Jetzt habe sie Angst, dass sie sich mit HIV infiziert haben könnte, und wolle wissen, ob sie Assange dazu verpflichten könne, einen HIV-Test zu machen. Sie sei in großer Sorge. Die Polizei schreibt ihre Aussage auf und informiert sofort die Staatsanwaltschaft. Noch bevor die Einvernahme überhaupt abgeschlossen werden kann, informiert man S. W. darüber, dass man Assange festnehmen werde wegen Verdachts auf Vergewaltigung. S. W. ist schockiert und weigert sich, die Befragung weiterzuführen. Noch aus der Polizeistation schreibt sie einer Freundin eine SMS und sagt, sie wolle Assange gar nicht beschuldigen, sondern wolle nur, dass er einen HIV-Test mache, aber die Polizei wolle ihn ganz offensichtlich „in die Finger kriegen“.
Was bedeutet das?
S. W. hat Julian Assange gar nicht der Vergewaltigung bezichtigt. Sie weigert sich, die Einvernahme weiterzuführen, und fährt nach Hause. Trotzdem erscheint zwei Stunden später im „Expressen“, einer schwedischen Boulevardzeitung, die Titel-Schlagzeile: Julian Assange werde der doppelten Vergewaltigung verdächtigt.
Der doppelten Vergewaltigung?
Ja, denn es gibt ja noch eine zweite Frau, A. A. Auch sie wollte keine Anzeige erstatten, sondern hat lediglich S. W. auf den Polizeiposten begleitet. Sie wurde an dem Tag noch gar nicht einvernommen. Später sagte sie dann aber, Assange habe sie sexuell belästigt. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das wahr ist oder nicht. Ich beobachte einfach den Ablauf: Eine Frau betritt einen Polizeiposten. Sie will keine Anzeige machen, aber einen HIV-Test einfordern. Die Polizei kommt auf die Idee, dass dies eine Vergewaltigung sein könnte und erklärt die Sache zum Offizialdelikt. Die Frau weigert sich, das zu unterschreiben, geht nach Hause, schreibt einer Freundin, sie wolle das nicht, aber die Polizei wolle Assange „in die Finger kriegen“. Zwei Stunden später steht es in der Zeitung. Wie wir heute wissen, hat die Staatsanwaltschaft es der Presse gesteckt. Und zwar ohne Assange überhaupt zu einer Stellungnahme einzuladen. Und die zweite Frau, die laut Schlagzeile vom 20. August ebenfalls vergewaltigt worden sein soll, wurde erst am 21. August überhaupt einvernommen.
Was hat die zweite Frau später ausgesagt?
Sie sagte aus, sie habe Assange, der für eine Konferenz nach Schweden gekommen war, ihre Wohnung zur Verfügung gestellt. Eine kleine Einzimmerwohnung. Als Assange in der Wohnung ist, kommt sie früher als geplant nach Hause. Sie sagt, das sei kein Problem. Er könne mit ihr in ihrem Bett schlafen. In jener Nacht sei es zum einvernehmlichen Sex gekommen. Mit Kondom. Sie sagt aber, Assange habe während des Geschlechtsverkehrs das Kondom absichtlich kaputtgemacht. Wenn dem so ist, ist das natürlich ein Sexualdelikt, sogenanntes stealthing. Die Frau sagt aber auch: Sie habe erst im Nachhinein gemerkt, dass das Kondom kaputt ist. Das ist ein Widerspruch, der unbedingt hätte geklärt werden müssen: Wenn ich es nicht merke, kann ich nicht wissen, ob der andere es absichtlich getan hat. Auf dem als Beweismittel eingereichten Kondom konnte keine DNA von Assange oder A. A. nachgewiesen werden.
Woher kannten sich die beiden Frauen?
Sie kannten sich nicht wirklich. A. A., die Assange beherbergte und als seine Pressesekretärin fungierte, hatte S. W. an einem Anlass kennengelernt, an dem sie einen rosa Kaschmirpullover getragen hatte. Sie wusste offenbar von Assange, dass er auch mit S. W. ein sexuelles Abenteuer anstrebte. Denn eines Abends erhielt sie von einem Bekannten eine SMS: Assange wohne doch bei ihr, er möchte ihn gerne kontaktieren. A. A. antwortet ihm: Assange schlafe im Moment wohl gerade mit dem „Kashmir-Girl“. Am nächsten Morgen telefoniert S. W. mit A. A. und sagt, sie habe tatsächlich ebenfalls mit Assange geschlafen und habe nun Angst, sich mit HIV infiziert zu haben. Diese Angst ist offenbar echt, denn S. W. hat sogar eine Klinik aufgesucht, um sich beraten zu lassen. Darauf schlägt ihr A. A. vor: Lass uns zur Polizei gehen, die können Assange zwingen, einen HIV-Test zu machen. Die beiden Frauen gehen allerdings nicht zur nächstgelegenen Polizeistation, sondern zu einer weit entfernten, wo eine Freundin von A. A. als Polizistin arbeitet, die dann auch noch gerade die Einvernahme macht; und zwar anfänglich in Anwesenheit ihrer Freundin A. A., was alles nicht korrekt ist. Bis hierhin könnte man allenfalls noch von mangelnder Professionalität sprechen. Die bewusste Böswilligkeit der Behörden wurde aber spätestens dann offensichtlich, als sie die sofortige Verbreitung des Vergewaltigungsverdachts über die Tabloidpresse forcierten, und zwar ohne Befragung von A. A. und im Widerspruch zu den Aussagen von S. W.; und auch im Widerspruch zum klaren Verbot im schwedischen Gesetz, die Namen von mutmasslichen Opfern oder Verdächtigen in einem Sexualstrafverfahren zu veröffentlichen. Jetzt wird die vorgesetzte Hauptstaatsanwältin auf den Fall aufmerksam und schliesst die Vergewaltigungsuntersuchung einige Tage später mit der Feststellung, die Aussagen von S. W. seien zwar glaubwürdig, doch gäben sie keinerlei Hinweise auf ein Delikt.
Aber dann ging die Sache erst richtig los. Warum?
Nun schreibt der Vorgesetzte der einvernehmenden Polizistin eine Mail: Sie solle die Aussage von S. W. umschreiben.
Was hat die Polizistin umgeschrieben?
Das weiss man nicht. Denn die erste Befragung wurde im Computerprogramm direkt überschrieben und existiert nicht mehr. Wir wissen nur, dass die ursprüngliche Aussage gemäss Hauptstaatsanwältin offenbar keinerlei Hinweise auf ein Delikt beinhaltete. In der revidierten Form steht, es sei zu mehrmaligem Geschlechtsverkehr gekommen. Einvernehmlich und mit Kondom. Aber am Morgen sei die Frau dann aufgewacht, weil er versucht habe, ohne Kondom in sie einzudringen. Sie fragt: „Trägst du ein Kondom?“ Er sagt: „Nein.“ Da sagt sie: „You better not have HIV“, und lässt ihn weitermachen. Diese Aussage wurde ohne Mitwirkung der betroffenen Frau redigiert und auch nicht von ihr unterschrieben. Es ist ein manipuliertes Beweismittel, aus dem die schwedischen Behörden dann eine Vergewaltigung konstruiert haben.
Warum sollten die schwedischen Behörden das tun?
Der zeitliche Kontext ist entscheidend: Ende Juli veröffentlicht Wikileaks in Zusammenarbeit mit der „New York Times“, dem „Guardian“ und dem „Spiegel“ das sogenannte „Afghan War Diary“. Es ist eines der größten Leaks in der Geschichte des US-Militärs. Die USA fordern ihre Alliierten umgehend dazu auf, Assange mit Strafverfahren zu überziehen. Wir kennen nicht die ganze Korrespondenz. Aber Stratfor, eine für die US-Regierung tätige Sicherheitsberatungsfirma, rät der amerikanischen Regierung offenbar, Assange die nächsten 25 Jahre mit allen möglichen Strafverfahren zu überziehen.
Warum hat sich Assange damals nicht der Polizei gestellt?
Das hat er ja eben. Ich habe es bereits angetönt.
Dann führen Sie es jetzt bitte aus.
Assange erfährt aus der Presse von dem Vergewaltigungsvorwurf. Er nimmt Kontakt mit der Polizei auf, um Stellung nehmen zu können. Trotz des publizierten Skandals wird ihm dies erst neun Tage später zugestanden als der Vorwurf der Vergewaltigung von S. W. bereits wieder vom Tisch war. Das Verfahren wegen sexueller Belästigung von A. A. lief aber noch. Am 30. August 2010 erscheint Assange auf dem Polizeiposten, um auszusagen. Er wird von jenem Polizisten befragt, der in der Zwischenzeit die Anweisung gegeben hatte, die Aussage von S. W. umzuschreiben. Zu Beginn des Gesprächs sagt Assange, er sei bereit auszusagen. Er wolle aber den Inhalt nicht wieder in der Presse lesen. Dies ist sein Recht, und es wird ihm zugesichert. Am selben Abend steht wieder alles in der Zeitung. Das kann nur von Behörden gekommen sein, denn sonst war ja niemand beim Verhör anwesend. Es ging also offensichtlich darum, seinen Namen gezielt kaputtzumachen.
Wie ist diese Geschichte denn überhaupt entstanden, dass sich Assange der schwedischen Justiz entzogen habe?
Diese Darstellung wurde konstruiert, entspricht aber nicht den Tatsachen. Hätte er sich entzogen, wäre er nicht freiwillig auf dem Posten erschienen. Auf der Grundlage der umgeschriebenen Aussage von S. W. wird gegen die Einstellungsverfügung der Staatsanwältin Berufung eingelegt und am 2. September 2010 das Vergewaltigungsverfahren wieder aufgenommen. Den beiden Frauen wird auf Staatskosten ein Rechtsvertreter ernannt namens Claes Borgström. Der Mann war Kanzleipartner des vorherigen Justizministers Thomas Bodström, unter dessen Ägide die schwedische Sicherheitspolizei von den USA verdächtigte Menschen mitten in Stockholm ohne jedes Verfahren verschleppt und an die CIA übergeben hatte, welche diese Menschen dann folterte. Damit werden die transatlantischen Hintergründe der Angelegenheit deutlicher. Nach Wiederaufnahme der Vergewaltigungsvorwürfe lässt Assange wiederholt durch seinen Anwalt ausrichten, dass er dazu Stellung nehmen will. Die zuständige Staatsanwältin wiegelt ab. Mal passt es der Staatsanwältin nicht, mal ist der zuständige Polizist krank. Bis sein Anwalt drei Wochen später schreibt: Assange müsse nun wirklich zu einer Konferenz nach Berlin. Ob er das Land verlassen dürfe? Die Staatsanwaltschaft willigt schriftlich ein. Er dürfe Schweden für kurzfristige Abwesenheiten verlassen.