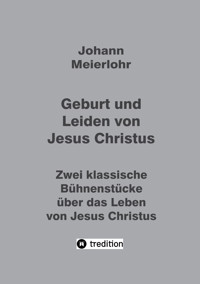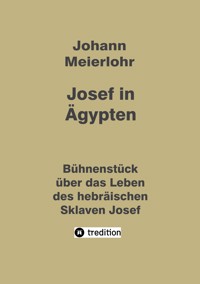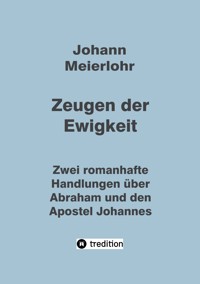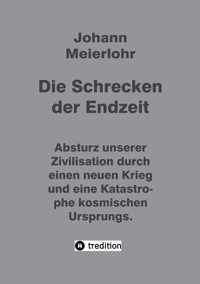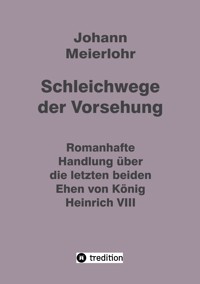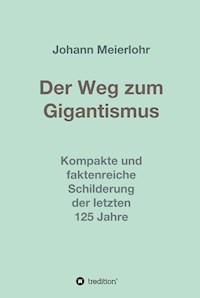
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch schildert in kompakter Form die politischen und militärischen Ereignisse vom Kaiserreich bis heute auf leicht verständliche Weise. Es besteht kein Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Zielgruppe sind Leser ohne Vorkenntnisse und hohe Ansprüche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Der Weg zum Gigantismus
Johann Meierlohr
Der Weg zum Gigantismus
Kompakte und faktenreiche Schilderung der letzten 125 Jahre
Zweite Auflage 2021
Copyright © by
Johann Meierlohr
Alle Rechte vorbehalten!
Jede Art der Verbreitung und
Verwertung bedarf der schriftlichen
Zustimmung des Autors!
ISBN: 978-3-347-24639-3 (Paperback)
ISBN: 978-3-347-24640-9 (e-Book)
Verlag und Druck: tredition GmbH,
Halenreie 42, 22359 Hamburg
Inhalt
Vorwort
Das Deutsche Reich
„Großpreußen“ wird eingekreist
Sieg der Dummheit
Sinnlose Selbstzerfleischung
Hinterlistiger Friede
Findelkind Weimarer Republik
Internationale Veränderungen
Machtwechsel in Deutschland
Die ersten Jahre der Nazi-Herrschaft
Hitler wird aggressiv
Stolperstein für den Krieg
Der kleine Krieg
Der kurze Krieg
Unternehmen Barbarossa
Ausweitung zum Weltkrieg
Knochenmühle Ostfront
Die Westmächte werden aktiv
Der trojanische Untergang
Potsdam und die Konferenzen vorher
Militärherrschaft
Der neue deutsche Staat
Weltpolitik von 1945 bis 1970
Deutschland von 1970 bis 1990
Weltpolitik von 1970 bis 1990
Weltgeschehen von 1990 bis 2020
Deutschland von 1990 bis 2020
Nachwort
Der Hobby-Autor Johann Meierlohr kam in Mai 1941 in einem Dorf des unteren Isartales zur Welt auf einem kleinen bäuerlichen Anwesen, welches seine Eltern ein Jahr vorher erworben hatten. Seine Kindheit verlief eher beschaulich und in Armut. Der Vater hatte große Mühe, die sechsköpfige Familie zu ernähren. Er suchte deshalb einen Nebenerwerb, aus dem später unter der Führung zweier Söhne ein stattliches Unternehmen wurde. Der älteste Nachkomme entschied sich für eine akademische Laufbahn und verbrachte ein knappes Jahrzehnt in Internaten, um die Hochschulreife zu erlangen. Das Studium der Elektrotechnik mit Schwerpunkt Schwachstromtechnik endete 1969.
Seine Berufstätigkeit in einem weltberühmten Unternehmen hing mit der heute selbstverständlichen Digitalisierung zusammen. Deren Probleme wurden damals unterschätzt. Es vergingen mehrere Jahrzehnte, ehe die Umstellung des Telefonverkehrs auf digitale Netze den Durchbruch schaffte. Doch dann verlor der Arbeitgeber aus unerfindlichen Gründen das Interesse an diesem Geschäftszweig. Dank seines günstigen Alters konnte sich der spätere Autor in den vorzeitigen Ruhestand flüchten.
Er nutzte die ersten vier Winter für die Textlegung eines Buches zu einem „spröden“ und undurchsichtigen Thema, für das sich kein Verlag interessierte. Erst nach mehr als sieben Jahren nahm der enttäuschte Autor einen neuen literarischen Anlauf und verfasste ein langatmiges Bühnenstück über eine bekannte Person des Alten Testaments, das auf eigene Kosten in Druck ging. Es folgte die Drucklegung von fünf weiteren Werken mit unterschiedlichen Themen, die nicht im öffentlichen Buchmarkt erschienen.
Vorwort
Wir leben im Jahr 2021. Vor gut hundert Jahren ging der Erste Weltkrieg zu Ende, den der damalige Pontifex Benedikt XV. treffend als Selbstmord Europas bezeichnete. Über die Ursachen und Hintergründe dieser „Urkatastrophe“ wird teilweise noch immer gerätselt. An Rückblicken herrschte kein Mangel. Sie waren hier in Deutschland meist von der oberflächlichen Art. Adenauer und Kohl haben angeblich den Politikern in Washington versprochen, an deren Sichtweise nicht zu rütteln. Dieses Versprechen wird mit Eifer eingelöst, geht es den Deutschen im Windschatten des Dollars doch recht gut. Weltpolitische Ambitionen haben sie ohnehin nicht. Hauptsache, die Wirtschaft brummt und der Export stößt auf keine Schranken!
Weltpolitischen Ehrgeiz hatten die Regimes zwischen 1871 und 1945 wahrscheinlich auch nicht, auch wenn das von der gegnerischen Kriegspropaganda zeitweise behauptet wurde, wohl aber eine infantile Vorstellung von Diplomatie. Die Nomenklaturen in Berlin wechselten mehrmals, begriffen aber nie die Mechanik der Weltpolitik, besser gesagt, jene des Imperialismus und der Herrschsucht. Daher hätten sie besser die Hände von der Weltpolitik lassen und sich mit der Aufrechterhaltung des Wohlstandes und der wirtschaftlichen Fähigkeiten begnügen sollen.
In diesem Buch werden die Ereignisse der letzten 125 Jahre beschrieben. Es ist als Informationsquelle zu betrachten und erhebt keinerlei Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Deshalb wurde auf einen Quellennachweis verzichtet. Der Verfasser hält nicht viel von der Plagiatshysterie, wie sie neuerdings im Gange ist. Sie dürfte sich eher lähmend auf die geistige Tätigkeit und Kreativität auswirken. Der Grundsatz der Meinungsfreiheit wird auf diese Weise beschnitten und ausgehöhlt. Gar so freiheitlich sollen die neugierigen Bürger ohnehin nicht denken, jedenfalls nicht über die herrschende Klasse. Mancherorts ist dieser Trend unübersehbar vorhanden.
Der Verfasser war redlich bemüht, die Neutralität in der Darstellung der Ereignisse und ihrer Hintergründe zu wahren, was wegen der Vielfalt der Meinungen und Überzeugungen nicht einfach ist. Patriotisch gefärbte Sichtweisen sind noch immer verbreitet. Die „Argumentation“ bezüglich der Abläufe im Vorfeld der beiden Weltkriege folgt sehr stark den Ausführungen von Patrick Buchanan, wie sie im Buch „Churchill, Hitler und der unnötige Krieg“ dargelegt sind. Sie sind für einen Amerikaner erstaunlich objektiv und gründlich, hält sich doch jenseits des Atlantiks das Wissen über die Vielfalt europäischen Treibens meist in engen Grenzen. Buchanan schreibt aber nichts über den Verlauf der Kriege. Er geißelt unmissverständlich die Dummheit der europäischen Eliten, soweit sie sich aktiv mit der Politik beschäftigten. Mitunter geht das Wenn und Aber in seinem Buch etwas zu weit. Das gilt aber auch für andere Werke, die sich intensiv mit den Irrungen und Wirrungen der Weltpolitik beschäftigen. Natürlich werden in diesem Buch auch die Nachkriegsereignisse geschildert.
Dieses Werk verfolgt den Zweck, dem Leser in relativ kurzer Zeit einen Überblick zu geben über die Ereignisse und Veränderungen der letzten 125 Jahre, ohne sich in Details zu verlieren, die meistens recht schnell vergessen werden. Es geht wirklich nur um einen Überblick und nicht um wissenschaftliche Recherchen oder gar Beweise. Dergleichen ist in Zeitungen und Zeitschriften ja auch nicht üblich und niemand regt sich darüber auf. Dieses Buch gibt mitunter die Meinung des Verfassers wider. Die ist auf keinen Fall sakrosankt und will Feindseligkeiten vermeiden.
Der Autor betrachtet seine literarischen Anstrengungen als Hobby und Zeitvertreib. Die vorherrschenden geistigen Tendenzen will er nicht beeinflussen. Es sollte sich ohnehin jeder ein eigenes Bild von den Dingen machen, was jedoch ein Mindestmaß an Wissen voraussetzt. Möglicherweise können die Ausführungen in diesem Buch dazu einen Beitrag leisten. Der Normalbürger hat meistens nicht die Zeit, eigene Quellen zu erschließen. Das sollte man jenen überlassen, die sich hauptberuflich mit geschichtlichen Abläufen befassen. Vermutlich sind die englischen Historiker derzeit führend, nachdem sie die propagandistischen Scheuklappen einigermaßen abgelegt haben. Die Schlussfolgerungen derselben sind alles andere als einheitlich, was bei der Komplexität der Materie aber nicht überraschen kann.
Noch ein Wort zur Plagiatshysterie und den mittlerweile überzogenen Vorstellungen in Sachen Quellennachweis. Alle Sätze in diesem Buch sind vom Autor selber formuliert worden. Deshalb wurde auf Zitate fast gänzlich verzichtet. Eine wörtliche Übereinstimmung mit den Ausführungen in anderen Büchern wäre Zufall. Die Nörgler auf diesem Gebiet sollten den Meinungsfluss nicht gar so stark gängeln oder beschränken wollen. Das Denken der Menschen ist dynamischen Einflüssen unterworfen und lässt sich ohnehin nicht dauerhaft behindern. Das zeigen die Ereignisse der letzten Jahre überdeutlich.
Das Deutsche Reich
Kaiser Karl der Große brachte nach vielen Kämpfen und Kriegen große Teile Mitteleuropas unter seine Kontrolle. Dieses imposante Reich zerfiel jedoch schon bald nach seinem Tod in drei Teile. Aus dem westlichen Teil wurde später Frankreich, aus dem östlichen Deutschland. Das Mittlere ist nach und nach zerfallen in die Schweiz, Belgien, Holland sowie Elsass-Lothringen, das heute zu Frankreich gehört. Das Deutsche Reich kam unter den drei ottonischen Kaisern besser aus den Startlöchern als das spätere Frankreich. Die Regenten dieser beiden Reiche konkurrierten Jahrhunderte lang um die Kaiserkrone, über deren Vergabe der Papst entschied. Die französischen Herrscher zogen fast immer den Kürzeren, was diese erboste. Deutschlands Führungsrolle kam erst durch den Dreißigjährigen Krieg ins Wanken, der die Folge der religiösen Spaltung in Katholiken und Protestanten war. Martin Luther ärgerte sich über die moralischen Missstände in der katholischen Kirche und vor allem in Rom. Dort hatte kurze Zeit vorher der größte Skandalpriester der Christenheit das Leben ausgehaucht. Größtes Ärgernis war der Ablasshandel, mit dem die Päpste ihren feudalen Lebensstil finanzierten und die übertrieben prunkvollen Bauten, die man noch heute sehen kann. Luther geißelte diese Praxis und fand in Deutschland schnell Gehör, da hier das Münzgeld knapp wurde und deshalb die Wirtschaft lahmte. Als sich immer mehr Fürsten auf seine Seite schlugen, kam es zum Bruch mit Rom und zur religiösen Spaltung, die bis heute anhält. Kaiser Karl V. konnte den Streit nicht schlichten.
Ein harmloser Vorfall lieferte den Anlass für einen mörderischen Bruderkrieg. Beim Prager Fenstersturz wurden zwei kaiserliche Beamte vom wütenden Mob aus dem Fenster ihrer Kanzlei geworfen und landeten auf einem Misthaufen. Der militärisch unbegabte Kaiser in Wien beauftragte Wallenstein mit der Kriegführung. Der eroberte in wenigen Jahren den ganzen protestantischen Norden Deutschlands.
Der schwedische König Gustav Adolf sah sich berufen, den gleichgesinnten Protestanten aus der Patsche zu helfen. Er landete mit einem schlagkräftigen Heer an der Ostseeküste. Im Raum Nürnberg kam es zur ersten Kraftprobe zwischen den kaiserlichen und schwedischen Truppen, die unentschieden endete. Die nächste Schlacht fand im Spätherbst 1631 bei Lützen statt. Der schwedische König verlor im Nebel die Übersicht und den Kontakt zum eigenen Heer. Ein kleiner Trupp Wallensteins stieß auf den herumirrenden Heerführer und tötete ihn mit einem Pistolenschuss. Das schwedische Heer gab die Schlacht verloren.
Wallenstein zog sich ins Winterquartier zurück und verlangte vom Kaiser Friedensverhandlungen, damit Deutschland nicht vollends ausblute. Er sah keine echte Chance für einen endgültigen Sieg einer der beiden Seiten. Der Kaiser in Wien interessierte sich nur für seine Habsburger Erblande und ließ sich von seinem Beichtvater zur Fortsetzung des Krieges überreden. Das Schicksal des leidgeprüften Volkes ließ ihn kalt. Er ließ Wallenstein durch ein Mordkommando liquidieren. Danach versank das Deutsche Reich im Chaos. Marodierende Söldner aus mehreren Ländern plünderten und mordeten nach Belieben die wehrlose Bevölkerung mehr als fünfzehn Jahre lang, ehe 1648 der Westfälische Friede geschlossen wurde. Frankreich war nun die führende Macht in Europa. Seine Bevölkerung war doppelt so groß und die Wirtschaft florierte.
Das Deutsche Reich existierte nur noch auf dem Papier. Real war es in Hunderte Fürstentümer und Grafschaften zersplittert, die sich einer selbstsüchtigen Kirchturmpolitik widmeten. Die Wirtschaft lahmte und konnte sich wegen der vielen Zollschranken nicht erholen. Das Selbstbewusstsein der Grande Nation erreichte unter dem Sonnenkönig Ludwig XIV. den Höhepunkt. Dieser ruinierte mit seinem luxuriösen Lebensstil und fragwürdigen militärischen Unternehmungen die Staatsfinanzen so gründlich, dass seine Nachfolger diesen Schuldensumpf nicht trocken legen konnten, da der Adel und die Geistlichkeit keine Steuern zu zahlen brauchten.
Nach drei Missernten hintereinander rebellierte die hungernde Bevölkerung gegen seinen untätigen Herrscher. Ludwig XVI. setzte sich mit einer Generalversammlung aller drei Stände eine Laus in den Pelz, die ihm zum Verhängnis wurde. Die Vertreter des Dritten Standes, des Volkes, gewannen schnell die Oberhand dank der radikalen Jakobiner. Diese entmachteten und enteigneten die Adeligen und die Kirche, um so den Staat zu sanieren. Im Windschatten dieser Schreckensherrschaft mit massenhaften Hinrichtungen von Priestern und Adeligen einschließlich des Königspaares begann der Aufstieg Napoleon Bonapartes. Um ihn loszuwerden, schickten ihn die republikanischen Kräfte mit einer Invasionsarmee nach Ägypten. Die britische Flotte folgte ihm und setzte nach dem Landgang der Truppen alle französischen Schiffe in Brand. Napoleons Armee ging schließlich zugrunde. Er selbst konnte auf einem Handelsschiff nach Frankreich zurückkehren. Dort war man der Schreckensherrschaft überdrüssig und sehnte einen starken Mann herbei. Napoleon vertrieb die Generalversammlung samt dem Revolutionsrat. Fortan regierte er als Alleinherrscher das Land. Er brachte einige Reformen zustande, von denen manche noch heute gelten. Aber schon bald verfiel er seinen militaristischen Neigungen und stürzte sich in unnötige Kriege. Er eroberte Spanien und vereinigte die Flotte dieses Landes mit der französischen. Sie war nun die Stärkste auf den Weltmeeren.
Das rief die aufstrebende Seemacht England auf den Plan. Admiral Nelson vernichtete die spanisch-französische Flotte 1805 vor Trafalgar. Wellington setzte zu Lande nach und befreite Spanien von der französischen Herrschaft. Napoleons Größenwahn geriet ins Wanken, als sein Russlandfeldzug kläglich scheiterte. Nun endlich taten sich seine kontinentalen Gegner zusammen und besiegten ihn in der Völkerschlacht von Leipzig. Er dankte ab und zog sich auf die Insel Elba zurück. Auf dem Wiener Kongress wurden sich seine Gegner lange Zeit nicht einig. Napoleon nutzte seine Chance und riss noch einmal die Herrschaft in Frankreich an sich. Sie währte nicht lange, da sein Heer bei Waterloo von den Briten und Preußen entscheidend geschlagen wurde. Napoleon fiel in britische Hände und musste seine restlichen Jahre auf einer einsamen Insel im Atlantik verbringen. Frankreichs Vorherrschaft in Europa war damit zu Ende.
In Deutschland gab es noch immer Hunderte von Grafschaften. Der Habsburger Monarchie erwuchs nach und nach in Preußen eine immer größere Konkurrenz. Mitte des 19. Jahrhunderts erwachte im deutschen Bürgertum die Sehnsucht nach einem Nationalstaat. Der Versuch scheiterte, durch Vertreter aller Gaue in einer Nationalversammlung, welche in Frankfurt tagte, die Zersplitterung zu überwinden. Bismarck schaltete den Einfluss Österreich-Ungarns in Deutschland weitgehend aus. Er strebte nach einem deutschen Staat unter Preußens Führung. Dieses Ziel erreichte er erst nach mehreren Kriegen, deren letzter gegen Frankreich gerichtet war. Napoleon III. ließ sich von Bismarck provozieren und zog gegen das Königreich Preußen zu Felde. Seine Armee musste vor dem preußischen Heer kapitulieren, das erstmals in der Militärgeschichte Sprenggranaten und Stahlgeschütze bei der Artillerie einsetze. Dann wurde Paris erfolgreich belagert. In Versailles rief Bismarck das neue Deutsche Kaiserreich aus, dem sich auch der bayerische König Ludwig II. anschloss, um einen weiteren Waffengang mit den übermächtigen Landsleuten im Norden zu vermeiden. Frankreich musste hohe Reparationszahlungen leisten, welche den wirtschaftlichen Aufschwung des ungeliebten Nachbarlandes beflügelten. Das überrundete nach und nach Frankreich auch noch in der Einwohnerzahl, was für die militärische Schlagkraft von großer Bedeutung war, da die Wehrpflicht zum Standard wurde. Frankreich war isoliert und kümmerte sich fortan um seine Kolonien. Das tat nun auch England, dessen Stolz das Empire mit einem Viertel der weltweiten Landfläche und ebenso einem Viertel aller Erdbewohner umfasste. Seine Flotte beherrschte unangefochten die Weltmeere nach dem Motto: Britania rules the waves.
Das weckte den Neid allzu ehrgeiziger Bürger in Deutschland. Gegen den Willen Bismarcks eignete sich das Kaiserreich etliche Kolonien an, die wirtschaftlich keine ernsthafte Bedeutung hatten und ein Verlustgeschäft waren. Bismarcks Losung lautete, Deutschland sei saturiert. Er handelte mit dem britischen Regierungschef eine Friedensordnung für den Balkan aus, die aber nicht lange Bestand hatte. Außerdem versicherte er sich der Rückendeckung durch Russland, da sich Frankreich nicht mit dem Verlust von Elsass-Lothringen abfinden wollte, das der Kaiser auf Drängen des Militärs annektiert hatte. Die Grande Nation trauerte noch mehr der Führungsrolle auf dem Kontinent nach.
1888 verstarben kurz hintereinander zwei deutsche Kaiser. Wilhelm II. übernahm die Regierungsgeschäfte. Ihm fehlte jegliche Erfahrung in Staatsgeschäften, strotze aber vor Selbstbewusstsein und Tatendrang. Das konnte nichts Gutes bedeuten, war er doch geistig behindert. Nach seiner Geburt setzte nämlich die Atmung erst etliche Minuten später ein, was einen massiven Sauerstoffmangel im Gehirn zur Folge hatte mit den in solchen Fällen üblichen Einschränkungen der geistigen Fähigkeiten. Er ließ sich vom übermäßigen Patriotismus anstecken, der sich in preußischen Landen breitgemacht hatte. Bismarck wurde als Reichskanzler entlassen. Verbittert zog er sich auf sein Landgut zurück und erkannte bald, dass der neue deutsche Staat in gefährliches Fahrwasser geriet. Er sah den Untergang des Kaiserreiches voraus, weil es sich unbedacht in internationale Händel verstrickte. Solange England die Neutralität wahrte, hielt sich diese Gefahr in Grenzen. Es sollten weniger als zwei Jahrzehnte im beginnenden 20. Jahrhundert vergehen, bis dieses neumodische Staatswesen mit dem Namen Deutschland, eigentlich sollte man sagen „Großpreußen“, am Boden lag. Es sollte bald danach noch schlimmer kommen. Großpreußen erwies sich als einer der größten Denkfehler in der neueren europäischen Geschichte, für den vor allem Bismarck verantwortlich zeichnet. Die anderen Regionen dieses neuen Staates wurden vorher und nachher nicht gefragt.
„Großpreußen“ wird eingekreist
Der Höhenflug des preußisch dominierten deutschen Staates dauerte nicht lange. Kaum war der unerfahrene Grünschnabel namens Kaiser Wilhelm II. an der Macht, begann auch schon eine Serie von Denkfehlern in der Außenpolitik. Der erste Schnitzer war dem frisch gekrönten Kaiser vorbehalten. Dem war Bismarck zu geistreich. Deshalb wurde er kurzerhand entlassen. Dessen wichtigster Verbündeter, Zar Nikolaus von Russland, wurde hellhörig. Er wollte wissen, was aus dem Bündnis wird, das Bismarck mit ihm geschlossen hatte. Der Zar wollte es erneuern zum Vorteil beider Staaten. Russland hatte Ruhe an seiner Westgrenze und Deutschland brauchte Frankreich nicht zu fürchten, das noch immer grollte. Doch so viel Einsicht überforderte die vorgeschädigte Gehirnsubstanz des neuen Staatsoberhauptes in Berlin. Der Zar bekam einen Korb. In Paris witterte man Morgenluft. Die französische Diplomatie umwarb mit Erfolg den Zaren und konnte einen Beistandspakt mit ihm schließen. Nun sah sich Kaiser Wilhelm in Berlin in der Zwickmühle. Er gewann Österreich-Ungarn und Italien als Verbündete. Primitiv betrachtet stand es nun drei zu zwei zu seinen Gunsten. England wollte sich keinem dieser Bündnisse anschließen. Es hatte ja genug damit zu tun, die vielen Kolonien in Schach und bei Laune zu halten, die es im Laufe der letzten Jahrhunderte angesammelt hatte, und von denen es sich gut leben ließ. Der umsichtige Regierungschef Salisbury hatte eine schier unüberwindliche Abneigung gegen die Fußangeln der europäischen Kontinentalpolitik, die nie wirklich zur Ruhe kam. In seiner dritten Amtszeit kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts musste er allerdings umdenken. Die Herren des Empires sahen sich neuen Herausforderungen gegenüber, die dem einflussreichen König des Landes auf das Gemüt schlugen. Die Japaner begannen mit dem Aufbau einer Flotte. Da sie sich auf ein Bündnis mit England einließen und sich strikt an die Abmachungen hielten, konnte das Mutterland mit der imposanten Flotte aufatmen, da seine Interessen im Pazifik nicht berührt wurden.
Anders war es mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA waren mittlerweile die stärkste Wirtschaftsmacht der Erde, besaßen aber keine Flotte von internationalem Rang. Das tat deren Selbstbewusstsein jedoch keinen Abbruch. Als es zwischen Venezuela und British Guyana, der einzigen britischen Kolonie in Südamerika, zur diplomatischen Auseinandersetzung um einen reichlich nutzlosen Streifen im Dschungel kam, wollte Washington den Streit schlichten. Als sich London widersetzte, drohte die US-Regierung gar mit militärischen Konsequenzen. Der Klügere gibt nach, sagte sich Salisbury, und fügte sich in das Schicksal, da es eigentlich um nichts ging. Das irritierte jedoch den König, da Britannien fast zwanzig Mal mehr Schlachtschiffe besaß als die selbstherrlichen Yankees.
Mehr Ärger und Sorgen bereiteten die Buren. Dieser Bevölkerungsteil holländischer Abstammung in Südafrika widersetzte sich der britischen Besatzung. Kaiser Wilhelm II. bejubelte die Anfangserfolge der Aufständischen, was die Briten als Einmischung deuteten. Der König im Buckingham Palast forderte ein Ende der „herrlichen Isolation“. Britannien brauche Freunde, damit das Empire nicht ins Wanken geriet. Für den nächsten Kummer sorgte der deutsche Kaiser, der sich ohne jede Notwendigkeit in die kolonialen Händel zwischen England und Frankreich in Nordafrika einmischte. Die beiden bisher unversöhnlichen Rivalen einigten sich auf eine einträchtige Lösung. England sollte in Zukunft die Kontrolle über Ägypten ausüben und damit auch über den Suezkanal, den der Franzose Gustave Eiffel erbaut hatte. Marokko überließ man den Franzosen. In Berlin war man über den Plan der Royal Navy verwundert, über Dänemark die deutsche Nordgrenze anzugreifen oder die Küstenschifffahrt lahmzulegen.
Kaiser Wilhelm II. war von den großen Kriegsschiffen der Briten angetan. Sie suchten ihresgleichen. Er forderte vom Parlament ähnliche Schiffe und bekam auch das nötige Geld dafür. Den deutschen Werften fehlte aber das notwendige Wissen und so blieben die Schlachtschiffe der Helgolandklasse hinter dem Standard der Dreadnoughts zurück. Sie hätten für den Schutz der deutschen Nordseeküste gereicht, nicht aber für erfolgreiche Operationen auf den Weltmeeren. Die Kolbendampfmaschinen hatten zu wenig Leistung und den Kanonen fehlte es an Reichweite und Durchschlagskraft. Der frustrierte Kaiser forderte eine Nachrüstung mit gleichwertigen Schlachtschiffen. Der neue Schiffstyp machte die Briten nervös. Sie wollten deshalb noch leistungsfähigere Schlachtschiffe bauen, was zu enormen Ausgaben führte. Die Super-Dreadnoughts waren ultimative Kampfmaschinen, denen so gut wie nichts mehr widerstehen konnte. Trotzdem sahen die Briten in der preußisch-deutschen Hochseeflotte, wie sie das Reich hochtrabend nannte, die größte Herausforderung für die Royal Navy. Der „böse Feind“ war nämlich einfallsreich. Er erfand den Torpedo, der unter Wasser die Kriegsschiffe angreifen konnte. Gegen sie waren die Dreadnoughts sehr empfindlich. Doch die Torpedoboote mussten ihre tödlichen Waffen aus relativ kurzer Entfernung zum Einsatz bringen. Deshalb wurde eine mittlere Artillerie auf den Schiffen installiert mit doppelt so hoher Schussfolge. Nur war diese Maßnahme bald wirkungslos, da nun Unterwasserboote dem Stolz der Royal Navy auflauerten.
Gleich zu Beginn des 20. Jahrhunderts gerieten Japaner und Russen aneinander. Das fernöstliche Inselvolk provozierte den Zaren, Inhaber der zahlenmäßig größten, aber veralteten Flotte durch einen zynischen Überfall auf die russische Pazifikflotte im Hafen. Die Ostseeflotte wurde zu ihrer Verstärkung in den Fernen Osten geschickt. Es kam zur Entscheidungsschlacht zwischen den beiden Seemächten, welche die Japaner eindeutig zu ihren Gunsten entschieden. London war beeindruckt und wertete das Bündnis mit den Japanern auf. Die Sorgen um die Seeherrschaft auf dem Atlantik blieben trotzdem, denn auch Frankreich strebte nach mehr Einfluss in Afrika und Asien. Deshalb entschloss sich der britische Regierungschef, um die Gunst Deutschlands und der Donaumonarchie zu werben, da von diesen beiden Staaten keine Gefahr für das Empire ausging. England, Deutschland und die USA sollten sich zusammen schließen, dann wäre man unantastbar. England hatte ja schließlich die stärkste Flotte, Deutschland die besten Landstreitkräfte und die USA das größte industrielle Potenzial. Der ebenso prahlerische wie dümmliche Kaiser in Berlin lehnte ab, auch dann noch, als England drohte, sich andere Verbündete zu suchen. Die französische Regierung nutzte diese Dummheit und warb in London mit dem Schlagwort der Entente cordiale. Über die Interessen beider Länder in Nordafrika wurde man sich einig. Die Stimmung in England gegenüber Deutschland verschlechterte sich, je mehr Kriegsschiffe Kaiser Wilhelm II. in Dienst stellte. Der Grundsatz der Royal Navy kam ins Wanken, mehr Kriegsschiffe zu besitzen als die Konkurrenten, da auch Franzosen und Italiener zur See aufrüsteten. London wollte sich nicht mit dem Schwinden seiner Herrschaft auf den Weltmeeren abfinden. Die Franzosen reagierten mit einem klugen Schachzug. Sie verlegten ihre Kriegsschiffe ins Mittelmeer.
Auch der preußische Generalstab gab sich Sorgen hin. Das Bündnis zwischen Frankreich und Russland musste zwangsläufig zu einem Zweifrontenkrieg im Ernstfall führen. Moltke wollte deshalb die Grenze zu Frankreich nur verteidigen, da die Vogesen ein natürliches Hindernis bei einem Angriff aus dem Westen darstellten, und weiter nördlich das neutrale Belgien Schutz bot. Die Hauptstreitmacht sollte die Russen nieder zwingen. Als Schliefen zum Generalstabschef ernannt wurde, drehte dieser die Prioritäten um. Er wollte erst Frankreich niederwerfen und sich dann den Russen widmen. Dieser Plan war nur zu realisieren, wenn der Vorstoß durch das neutrale Belgien gegen die Hauptstadt Paris vorgetragen wurde. Er konnte diesen flagranten Bruch des Völkerrechts dem Kaiser schmackhaft machen. Das sollte sich schließlich rächen.
Die deutsche Hochseeflotte war ein Ärgernis, aber nicht der Hauptgrund für das Zerwürfnis mit den Briten. London bangte um die industrielle Vormachtstellung in Europa. Deutsche Firmen hielten die Mehrzahl der Basispatente des industriellen Zeitalters inne. Die Briten investierten zu viel Geld in den Kolonien und vernachlässigten die Betriebe in der Heimat, wo gern gestreikt wurde. Deshalb bildete sich hinter dem Rücken von Parlament und Kabinett eine Kriegspartei, welche dieses Problem militärisch lösen wollte. Da eine schlagkräftige Armee fehlte, sollten Russland und Frankreich den Rivalen in die Knie zwingen. Der Kriegspartei in Paris gefiel dieser Plan. Aber das Zarenreich musste nach der Niederlage gegen Japan erst mittels großzügiger Kredite aufgerüstet werden. Dies geschah nur unzureichend.
Sieg der Dummheit
Im Sommer 1914 trafen sich die Schiffe und Matrosen aus ganz Europa zur berühmten Regatta in der Kieler Bucht. Die Royal Navy schickte sogar ihr neuestes Schlachtschiff mit acht Kanonen des Kalibers 38 Zentimeter und 16 weiteren Kanonen vom Kaliber 15 Zentimeter, die allein an die hundert Granaten in der Minute gegen angreifende Torpedoboote schleudern konnten. Da gingen sogar dem deutschen Kaiser die Augen über. Es wurde ohne Vorbehalte gefeiert und getrunken, bis die Nachricht vom Attentat auf den österreichischen Thronfolger eintraf. Mit einem Mal war es mit dem allgemeinen Jubel vorbei. Kaiser Wilhelm II. versicherte Wien seine Loyalität ohne jede Einschränkung oder Bedingung. Dann fuhr er mit seiner Jacht in den Urlaub nach Norwegen wie in den Jahren davor. Seine Sorglosigkeit sollte sich bitter rächen.
Die Attentäter stammten aus Serbien, das ohnehin ein gespanntes Verhältnis zur Donaumonarchie hatte. Wien forderte von Belgrad ultimativ die Erfüllung von zehn Bedingungen, die allgemein als übertrieben empfunden wurden. Das empörte den Zaren in Petersburg, der vom Besitz der Meerengen der Dardanellen und dem Bosporus träumte. Er erklärte sich mit den Serben solidarisch und bot dem bedrängten Land seinen Schutz an. Nun reichte ein Funke, um das Pulverfass Europa zur Explosion zu bringen aufgrund der diversen Bündnisse zwischen den Großstaaten auf dem Kontinent. Wie würde sich die serbische Regierung verhalten?
Das beschäftigte auch die Regierung in London. Es gab zwar keine schriftlichen Verpflichtungen, in einen möglichen Krieg einzugreifen, aber doch mündliche Absprachen mit Frankreich durch hochrangige Politiker wie Außenminister Grey. Die Mehrheit im Kabinett Asquith war gegen einen Kriegseintritt. Nur Winston Churchill fiel mit seinen militaristischen Reden aus der Rolle und brachte den Außenminister in Verlegenheit. Der hatte heimlich mit dem französischen und belgischen Kollegen Absprachen für den Kriegsfall getroffen, von denen Regierung und Parlament nichts wussten. Um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, schlug er eine diplomatische Initiative vor. Die Vertreter Englands, Frankreichs, Deutschlands, Österreichs, Russlands, Italiens und Serbiens sollten in einer Konferenz nach einer Lösung des Problems Ausschau halten. Sie kam nicht zustande, weil die Regierung in Berlin in Abwesenheit des Kaisers diesen gut gemeinten Vorschlag ablehnte. Auch der Kaiserhof in Wien wollte sich nicht dreinreden lassen. Das Verhängnis eines großen Krieges war kaum noch zu stoppen.
Hoffnung keimte auf, als sich Serbien bereit erklärte, neun der zehn Bedingungen zu erfüllen, was viele Zeitgenossen überraschte. Die Forderung, österreichische Ermittler sollten nach den Hintermännern in Serbien forschen und diese vor ein Gericht in Wien stellen dürfen, lehnte Belgrad ab und machte den Vorschlag, der Internationale Gerichtshof sollte diese Aufgabe übernehmen. Die Scharfmacher in Wien überredeten Kaiser Franz Josef II., ein Tattergreis von mehr als 80 Jahren, hart zu bleiben. Schließlich brachte der Außenminister den zögernden Regenten mit fragwürdigen Aussagen dazu, Serbien den Kriegs zu erklären, und so das Karussell des Verderbens in Gang zu setzen. Russland reagierte auf Drängen Frankreichs mit der Mobilmachung. Inzwischen war Kaiser Wilhelm II. aus dem Urlaub nach Berlin zurückgekehrt. Entsetzt erkannte er die aussichtslose Situation. Er forderte den Zaren und die britische Regierung zu Verhandlungen auf. Doch dafür war es schon zu spät. In England war innerhalb weniger Tage die öffentliche Meinung umgeschlagen. Regierungschef Asquith konnte nur mit Mühe sein Kabinett zusammenhalten. Die Frage der Neutralität Belgiens beschäftigte immer mehr Regierung und Volk. Sie sollte schließlich für den Kriegseintritt Englands entscheidend sein.
Da seine Verhandlungsvorschläge auf taube Ohren stießen, forderte Kaiser Wilhelm II. den Zaren auf, die Mobilmachung zu stoppen, andernfalls werde er Russland den Krieg erklären. Dieser konnte sich gegen den Generalstab nicht durchsetzen.
Als das Ultimatum ablief, folgte die Kriegserklärung. Auch in Frankreich wurde mobilgemacht. Der deutsche Kaiser erklärte diesem Gegner zwei Tage später ebenfalls den Krieg. Er erlebte schnell die erste Enttäuschung. Italien verhielt sich neutral trotz des Bündnisvertrages mit Deutschland und Österreich-Ungarn. Die preußischen Truppen drangen in Belgien ein. Ein zeitlich sehr knapp bemessenes Ultimatum der britischen Regierung verstrich ohne den geforderten Rückzug aus dem überfallenen Land. Es folgte die Kriegserklärung an Deutschland nur wenige Tage nach Beginn der Kampfhandlungen auf dem Kontinent.
Sinnlose Selbstzerfleischung
Alle Kriegsteilnehmer mussten schon früh erkennen, dass ihre Überlegungen über den Kriegsverlauf zerrannen. Die Preußen setzten auf ihre Tapferkeit und Schlagkraft und unterschätzten jene der Gegner. Frankreich hoffte auf die zermürbende Wirkung des Zweifrontenkrieges. An Russlands Weite und Klima war schon Napoleon gescheitert. Besonders optimistisch war Winston Churchill. Er verhängte als neuer Marineminister eine Blockade über Deutschland. Damals war alle Welt auf die Salpetervorkommen in Chile angewiesen, um Schießpulver und Sprengstoff herzustellen. Dem Deutschen Reich würde bald die Munition ausgehen. Dann musste es verhandeln oder gar kapitulieren. Churchills Rechnung ging nicht auf und noch etliche andere, die er später anstellte. Nur drei Wochen nach Kriegsbeginn hatten deutsche Chemiker zwei Verfahren zur Ammoniaksynthese entwickelt, um Salpetersäure aus dem Stickstoff der Luft zu erzeugen. Das Kaiserreich war nun vom Chilesalpeter unabhängig und konnte jahrelang Krieg führen.