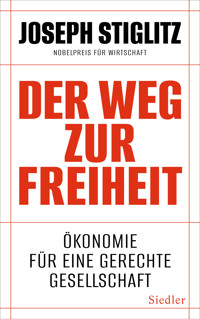
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Gegen die Freiheit des Raubtierkapitalismus: Warum unsere Gesellschaft eine neue Wirtschaftspolitik braucht, um zukunftsfähig und gerechter zu werden
Unter Donald Trump und Elon Musk greift ein Kult der Freiheit um sich. Doch die Wahl- und Meinungsfreiheit, die J.D. Vance & Co. zu einem Fetisch erhoben haben, geht immer auf Kosten der Freiheit anderer. Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger und einer der schärfsten Kritiker Donald Trumps, zeigt, wer die Opfer der neuen Meritokratie sind – und wie der Abbau von Bürokratie sowie unregulierte Märkte Wachstum bremsen und unsere Gesellschaften ärmer machen. Doch Stiglitz bleibt nicht bei der Analyse stehen, sondern weist uns den Weg, wie wir das Konzept der Freiheit zurückerobern können. Ein leidenschaftliches Plädoyer für eine gleichermaßen gerechtere wie freiere Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gegen die Freiheit des Raubtierkapitalismus: Warum unsere Gesellschaft eine neue Wirtschaftspolitik braucht, um zukunftsfähig und gerechter zu werden
Unter Donald Trump und Elon Musk greift ein Kult der Freiheit um sich. Doch die Wahl- und Meinungsfreiheit, die J.D. Vance & Co. zu einem Fetisch erhoben haben, geht immer auf Kosten der Freiheit anderer. Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger und einer der schärfsten Kritiker Donald Trumps, zeigt, wer die Opfer der neuen Meritokratie sind – und wie der Abbau von Bürokratie sowie unregulierte Märkte Wachstum bremsen und unsere Gesellschaften ärmer machen. Doch Stiglitz bleibt nicht bei der Analyse stehen, sondern weist uns den Weg, wie wir das Konzept der Freiheit zurückerobern können. Ein leidenschaftliches Plädoyer für eine gleichermaßen gerechtere wie freiere Welt.
Joseph Stiglitz, geboren 1943, war Professor für Volkswirtschaft in Yale, Princeton, Oxford und Stanford, bevor er 1993 zu einem Wirtschaftsberater der Clinton-Regierung wurde. Anschließend ging er als Chefvolkswirt zur Weltbank und wurde 2001 mit dem Nobelpreis für Wirtschaft ausgezeichnet. Heute lehrt Stiglitz an der Columbia University in New York und ist ein weltweit geschätzter Experte zu Fragen von Ökonomie, Politik und Gesellschaft. Gemeinsam mit 22 weiteren Trägern des Wirtschaftsnobelpreises sprach er sich öffentlich gegen eine zweite Amtszeit von Donald Trump aus und bezeichnete dessen Wiederwahl als »Desaster« und »Ende des Fortschritts«. Er ist ein scharfer Kritiker von Trumps Strafzoll-Politik und warnt eindringlich vor den Gefahren einer Trump-Musk-Ökonomie für die USA und den Rest der Welt sowie dadurch entfachten Handelskriegen. Bei Siedler erschienen unter anderem seine Bestseller Die Schatten der Globalisierung (2002), Die Chancen der Globalisierung (2006), Im freien Fall (2010), Der Preis der Ungleichheit (2012), Reich und Arm (2015) und zuletzt Der Preis des Profits (2020).
Besuchen Sie uns auf www.siedler-verlag.de
JOSEPH STIGLITZ
DER WEG ZUR FREIHEIT
ÖKONOMIE FÜR EINE GERECHTE GESELLSCHAFT
Aus dem Englischen von Thorsten Schmidt
Siedler
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel The Road to Freedom: Economics and the Good Society bei W.W. Norton (New York).
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 by Joseph E. Stiglitz
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025 by Siedler Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Fabian Bergmann
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-32678-4V001
www.siedler-verlag.de
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1 Einleitung: Gefährdete Freiheit
Die Vielschichtigkeit des Freiheitsbegriffs am Beispiel der USA
Zentrale Themen und Fragen
Schlüsselprinzipien: Traditionelle Sichtweisen
Schlüsselprinzipien: Weitere traditionelle Sichtweisen
Anwendungen: Die gute Gesellschaft und wie man sie verwirklicht
Kapitel 2 Freiheitskonzeptionen von Wirtschaftswissenschaftlern
Historischer Abriss des ökonomischen Denkens – von Adam Smith bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts
Eine neue ökonomische Ära
Das Scheitern des Neoliberalismus
Jenseits der Effizienz: Die moralischen Argumente für den Neoliberalismus
Jenseits des Neoliberalismus
Teil I Grundprinzipien der Freiheit
Kapitel 3 Die Freiheit des einen ist die Unfreiheit des anderen
Externalitäten sind allgegenwärtig
Die Bewältigung von Externalitäten ist die Grundlage der Zivilisation
Die Beurteilung von Trade-offs und die Absurdität der absolutistischen Position
Externalitäten und die konservative Sichtweise
Die regulatorische Lösung
Kapitel 4 Freiheit durch Zwang: Öffentliche Güter und das Trittbrettfahrerproblem
Öffentliche Investitionen, die unser Leben bereichern
Der Nutzen auf Zwang beruhender Koordinierung
Eigennützigkeit im weitesten Sinne
Globale öffentliche Güter und globale Koordinierung
Kapitel 5 Verträge, der Gesellschaftsvertrag und Freiheit
Das Konzept des Gesellschaftsvertrags
Weitere Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags: Soziale Absicherung und Lebenszeitmanagement
Weitere Elemente bei der Gestaltung des Gesellschaftsvertrags
Abschließende Bemerkungen: Leitlinien für die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags
Kapitel 6 Freiheit, eine Wettbewerbsökonomie und soziale Gerechtigkeit
Man bekommt, was man verdient: Die moralische Rechtfertigung von Einkommen und Vermögen in einer Wettbewerbsökonomie
Eigentumsrechte und Freiheit
Märkte, Ungleichheit und die Spielregeln
Den Vorrang von Wettbewerbspreisen bei fehlendem Marktversagen hinterfragen
Freiheit, moralische Ansprüche und Umverteilung
Abschließende Bemerkungen
Kapitel 7 Die Freiheit zur Ausbeutung
Marktmacht
Monopolmacht beschneiden und Innovation fördern
Abschließende Bemerkungen
Teil II Freiheit, Überzeugungen, Präferenzen und der Aufbau der guten Gesellschaft
Kapitel 8 Sozialer Zwang und sozialer Zusammenhalt
Die gesellschaftliche Formung von Überzeugungen und Präferenzen
Externalitäten internalisieren und sozialen Zusammenhalt erzeugen
Soziale Kontrolle, Sozialkredit, Werbung und individuelle Freiheit
Individuelle Selbstbestimmung und Gruppendruck: Eine philosophische Debatte
Die Prägung von Überzeugungen und die Zukunftsfähigkeit des neoliberalen Kapitalismus
Abschließende Bemerkungen
Kapitel 9 Wie uns soziale Medien und Big-Tech prägen
Der freie Marktplatz der Ideen
Die Marktmacht der sozialen Medien
Warum Marktmacht im Mediensektor von Bedeutung ist: Eine Vielzahl negativer sozialer Folgen
Warum Polarisierung profitabel ist
Marktmacht, Ungleichheit und gesellschaftliche Metanarrative
Wachsender Konsens über Regulierungsbedarf
Die Zukunft des neoliberalen Kapitalismus
Kapitel 10 Toleranz, Solidarität und Freiheit
Zwei wichtige Unterscheidungen
Die Grenzen der Toleranz
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
Aus welcher Quelle speiste sich die Toleranz der Aufklärung?
Abschließende Bemerkungen
Teil III Die Wirtschaftsordnung der guten und gerechten Gesellschaft
Kapitel 11 Neoliberaler Kapitalismus: Warum er scheiterte
Das vielfältige Versagen des Neoliberalismus
Korrigiert sich unser wirtschaftliches und politisches System von selbst?
Vielleicht ist die Zeit reif: Hoffnungsvolle Anzeichen
Kapitel 12 Freiheit, Souveränität und zwischenstaatlicher Zwang
Geistiges Eigentum
Globale Governance und die Besteuerung multinationaler Konzerne
Die Schuldenfalle
Investitionsabkommen: Verschleierte Ausbeutung
Demokratie, Macht und Weltwirtschaftsarchitektur
Kapitel 13 Progressiver Kapitalismus, Sozialdemokratie und eine lernende Gesellschaft
Der Aufbau einer lernenden Gesellschaft
Eine dezentrale Wirtschaft mit einem reichhaltigen institutionellen Ökosystem
Macht, das Wettbewerbsparadigma und progressiver Kapitalismus
Wirtschaftliche Spaltungen, Macht und soziale Gerechtigkeit
Progressiver Kapitalismus, die Rolle des Staates und Sozialdemokratie
Wie das System Menschen prägt
Abschließende Bemerkungen
Kapitel 14 Demokratie, Freiheit, soziale Gerechtigkeit und die gute Gesellschaft
Konflikte um Freiheit in einer gespaltenen Gesellschaft beilegen
Neoliberalismus und stabile Demokratie
Progressiver Kapitalismus, Sozialdemokratie und soziale Gerechtigkeit
Dank
Anmerkungen
Register
Vorwort
Freiheit ist ein menschlicher Grundwert. Aber viele Freiheitsbefürworter fragen nur selten, was diese Idee eigentlich bedeutet. Freiheit für wen? Was geschieht, wenn die Freiheit einer Person auf Kosten derjenigen einer anderen geht? Der in Oxford lehrende Philosoph Isaiah Berlin1 brachte dies einmal folgendermaßen auf den Punkt: »Die Freiheit der Wölfe hat oftmals den Tod der Schafe bedeutet.«2
Wie können wir politische und wirtschaftliche Freiheit miteinander in Einklang bringen? Welche Bedeutung hat das Wahlrecht für jemanden, der Hunger leidet? Wie steht es mit der Freiheit, sein Potenzial auszuschöpfen, was vielleicht nur möglich ist, wenn wir die Reichen besteuern und ihnen die Freiheit nehmen, ihr Geld nach Belieben auszugeben?
Die politische Rechte in den Vereinigten Staaten hat sich vor einigen Jahrzehnten der Freiheitsrhetorik bemächtigt und sie für sich reklamiert, genauso wie sie Patriotismus und die amerikanische Flagge für sich reklamiert.3 Freiheit ist ein wichtiger Wert, der uns viel bedeutet und bedeuten sollte, aber er ist komplexer und vielschichtiger als die Idee, auf die sich die Rechte beruft. Die gegenwärtige konservative Interpretation des Freiheitsbegriffs ist oberflächlich, irreführend und ideologisch motiviert. Die Rechte spielt sich als Verteidigerin der Freiheit auf. Ich werde zeigen, dass ihre Deutung dieses Begriffs und die Art und Weise, wie sie ihn in praktische Politik umsetzt, zum entgegengesetzten Ergebnis – einer massiven Einschränkung der Freiheiten der meisten Bürger – führten.
Die Gleichsetzung von freien Märkten mit wirtschaftlicher Freiheit und von wirtschaftlicher Freiheit mit politischer Freiheit veranschaulicht in plastischer Weise diese Schwächen. Einige Zitate führender Republikaner vermitteln einen Eindruck von dem, was ich meine. Als die US-Wirtschaft im Jahr 2008 nach jahrzehntelanger Finanzmarktderegulierung am Rande eines Kollapses stand und die Regierung im Begriff war, das größte staatliche Rettungspaket für die Privatwirtschaft in der Weltgeschichte zu schnüren, formulierte George W. Bush, der zur Zeit der Finanzkrise US-Präsident war, das, worum es ging, folgendermaßen:
Zwar sind Reformen im Finanzsektor unabdingbar, die langfristige Lösung für die gegenwärtigen Probleme besteht jedoch in nachhaltigem Wirtschaftswachstum. Und der sicherste Weg zu diesem Wachstum sind freie Märkte und freie Menschen.4
Vor Bush hatte Ronald Reagan, dessen Präsidentschaft von 1981 bis 1989 weithin als ein Wendepunkt hin zu einer rechtsgerichteten Politik und ein lautstarkes Bekenntnis zu freien Märkten angesehen wurde, eine Gesetzesinitiative zur Gewährleistung wirtschaftlicher Grundrechte ins Leben gerufen.5 Er bedauerte, dass die US-Verfassung nicht so weit gegangen war, diese Rechte zu verbürgen, und sich stattdessen auf politische Rechte konzentriert hatte. Er erklärte:
Untrennbar verknüpft mit diesen politischen Freiheiten ist die Sicherung wirtschaftlicher Freiheiten. (…) Während die US-amerikanische Verfassung unsere politischen Freiheiten sehr ausführlich darlegt, sind diese wirtschaftlichen Freiheiten ein integraler Bestandteil davon. (…) Es gibt vier wirtschaftliche Grundfreiheiten. Sie verknüpfen die Lebensgestaltung untrennbar mit der Idee der Freiheit; sie befähigen den Einzelnen, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, und sie machen Selbstbestimmung und persönliche Unabhängigkeit zu einem Teil der amerikanischen Lebensweise.6
Diese vier Freiheiten sind: erstens, die Freiheit zu arbeiten, zweitens, die Freiheit, die Früchte seiner Arbeit zu genießen, drittens, die Freiheit, Eigentum zu besitzen und darüber zu verfügen, und viertens, die Freiheit, an einem freien Markt teilzunehmen – nach Belieben Verträge über Güter und Dienstleistungen abzuschließen und sein Potenzial voll auszuschöpfen, ohne staatliche Beschränkungen der Selbstentfaltung, wirtschaftlicher Unabhängigkeit und Wachstumschancen (Hervorhebung durch den Verfasser).
Während die amerikanischen Siedler, die sich Ende des 18. Jahrhunderts gegen die britische Krone auflehnten, sich den Slogan »Besteuerung ohne Repräsentation ist Tyrannei« zu eigen machten, scheinen ihre Nachfahren im 21. Jahrhundert zu dem Schluss gekommen zu sein, dass Besteuerung mit Repräsentation ebenfalls Tyrannei ist. Ron Paul, ein altgedienter Republikaner aus Texas, der im Jahr 1988 von der Libertären Partei als Kandidat für das Amt des US-Präsidenten aufgestellt wurde, drückte es unverblümt aus: »Wir müssen einsehen: Je mehr der Staat ausgibt, umso mehr Freiheit geht verloren.«7
Rick Santorum, von 1995 bis 2007 republikanischer Senator, der sich 2012 um die republikanische Präsidentschaftskandidatur bewarb und um ein Haar aufgestellt worden wäre, formulierte es andersherum: »Je weniger Geld wir wegnehmen, umso mehr Freiheit haben Sie.«8
Und Ted Cruz, der republikanische Senator aus Texas und ehemalige Präsidentschaftskandidat von 2016, benannte jene Teile des Regierungsapparats, die seines Erachtens die Freiheit der Bürger am stärksten beeinträchtigten:
»Ich habe die Five for Freedom [»Fünf zur Stärkung der Freiheit«] identifiziert: Während meines ersten Jahres als Präsident werde ich mich dafür einsetzen, die Bundessteuerbehörde, das Bildungsministerium, das Energieministerium, das Handelsministerium und das Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung abzuschaffen.«9
Diese Freiheitskonzeptionen stehen in deutlichem Gegensatz zu den Idealen, die Präsident Franklin D. Roosevelt formulierte, als er am 6. Januar 1941 in seiner Rede zur Lage der Nation im Kongress eine Freiheitsvision entwarf, welche über die traditionellen Bürgerrechte hinausging, die er in seiner Rede über die »Vier Freiheiten« nur auf die ersten beiden beschränkte:
Die erste ist die Freiheit der Rede und des Ausdrucks – überall auf der Welt. Die zweite ist die Freiheit jeder Person, Gott auf ihre Weise zu verehren – überall auf der Welt.
In der Erkenntnis, dass diese beiden Freiheiten nicht ausreichten, fügte er zwei weitere hinzu. Die Menschen bräuchten
(…) Freiheit von Not – was, weltweit gesehen, wirtschaftliche Vereinbarungen bedeutet, die jeder Nation gesunde, friedliche Lebensverhältnisse für ihre Einwohner gewähren – überall auf der Welt.
Und sie bräuchten auch
(…) Freiheit von Furcht. Diese bedeutet, weltweit gesehen, eine globale Abrüstung, so gründlich und so lange durchgeführt, bis kein Staat mehr in der Lage sein wird, einen Nachbarn mit Waffengewalt anzugreifen – überall auf der Welt.
Ein Mensch, der extreme Not oder Furcht erlebt, ist nicht frei. Ebenso wenig wie jemand, dessen Fähigkeit, ein erfülltes Leben zu führen und sein Potenzial voll auszuschöpfen, eingeschränkt ist, weil er in Armut hineingeboren wurde. Als ich in Gary im Bundesstaat Indiana, der einst florierenden Stahlstadt am Südufer des Michigansees, aufwuchs, sah ich mit eigenen Augen, dass es Afroamerikanern, die im Zuge der Great Migration vor der Unterdrückung in den Südstaaten geflohen waren, und Kindern vieler Einwanderer, die aus Europa gekommen waren, um in den hiesigen Stahlwerken zu arbeiten, an wirtschaftlicher Freiheit fehlte. Mehrere meiner ehemaligen Klassenkameraden erzählten mir 2015 bei unserem Highschool-Treffen nach 55 Jahren von ihren Lebenserfahrungen. Nach ihrem Abschluss hatten sie in dem Stahlwerk arbeiten wollen, wie es schon ihre Väter getan hatten. Aber nach einer weiteren Wirtschaftskrise hatten sie keine andere Wahl gehabt – keine Freiheit –, als zum Militär zu gehen. Und nach dem Ende ihres Dienstes im Vietnamkrieg hatten sie abermals nur wenige Möglichkeiten gehabt, zumindest ihrer eigenen Einschätzung nach. Die Deindustrialisierung vernichtete Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe, sodass hauptsächlich Stellen für sie übrig blieben, bei denen sie von ihrer militärischen Ausbildung profitierten, wie etwa bei der Polizei.
Sowohl als Entscheidungsträger in Washington als auch als Berater und Kommentator wirtschaftlicher Ereignisse sah ich Freiheit in einem anderen Licht als Bush, Reagan und andere Vertreter der Rechten. Von Reagan bis Clinton haben US-Präsidenten die Freiheit der Banken erweitert. Finanzmarktderegulierung und -liberalisierung bedeutete, den Banken zu erlauben zu tun, was sie wollten.10 Schon das Wort »Liberalisierung« impliziert »Befreiung«. Die Banken nutzten diese neue Freiheit auf eine Weise, die ihren Gewinn steigerte, aber enorme Risiken für die Gesellschaft mit sich brachte. Im Zuge der Finanzkrise von 2008 entdeckten wir dann die Kosten. Viele Amerikaner verloren ihre Freiheit von Furcht und Not, als sich immer deutlicher abzeichnete, dass Millionen von Arbeitnehmern und Rentnern ihre Arbeitsplätze und Immobilien verlieren würden. Wir als Gesellschaft verloren unsere Freiheit – wir hatten keine andere Wahl, als das Geld der Steuerzahler auszugeben, um die Banken zu retten. Andernfalls wäre das gesamte Finanzsystem – und die Wirtschaft – zusammengebrochen.
In den Jahren, in denen ich Präsident Clinton als Berater zur Seite stand (die letzten beiden zwischen 1995 und 1997 als Vorsitzender des wirtschaftlichen Beirats), lehnte ich die Deregulierung des Finanzsektors entschieden ab, zum Teil deshalb, weil ich erkannte, dass dessen »Befreiung« uns letztlich alle weniger frei machen würde. Nach meinem Ausscheiden im Jahr 1997 verabschiedete der Kongress zwei Gesetze: eines, das die Banken deregulierte, und ein zweites, das die Regierung dazu verpflichtete, Derivate nicht zu regulieren – Schritte, die sogar noch über das hinausgingen, was Reagan getan hatte. Deregulierung/Liberalisierung ebneten dem Finanzdebakel von 2008 den Weg. Reagan und Clinton hatten den Wölfen (den Banken) auf Kosten der Schafe (Arbeitnehmern, Kleinanlegern und Hauseigentümern) Freiheiten eingeräumt.
Freiheit im historischen Kontext der USA
Für US-Amerikaner, die fest davon überzeugt sind, dass ihr Land auf den Prinzipien der Freiheit errichtet worden sei, ist der Begriff besonders sinnträchtig. Daher ist es wichtig, dass wir gründlich darüber nachdenken, was das Wort damals, vor 200 Jahren, und was es heute bedeutet. Als die USA gegründet wurden, war »Freiheit« ein mehrdeutiger, widersprüchlicher Begriff, und die grundlegenden konzeptionellen Probleme sind seither nur noch deutlicher zutage getreten. Freiheit bedeutete damals nicht Freiheit für alle. Sie bedeutete nicht Freiheit für die Versklavten. Frauen und anderen Personen ohne eigenen Besitz wurden keine gleichen Rechte garantiert, und sie erhielten diese auch nicht. Frauen mussten Steuern zahlen, ohne repräsentiert zu sein – es sollte 140 Jahre dauern, bis das Land sich mit diesen Widersprüchen auseinandersetzte. Das heutige US-Außengebiet Puerto Rico wurde im 16. Jahrhundert gewaltsam von den Spaniern erobert, nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg 1898 an die USA abgetreten, und seine Bürger unterliegen noch immer einer »Besteuerung ohne Repräsentation«.
Seit Langem ist offensichtlich, dass wirtschaftliche und politische Freiheiten miteinander zusammenhängen. Die Debatte darüber, welcher Freiheit Vorrang eingeräumt werden sollte, war von zentraler Bedeutung für den Kalten Krieg. Der Westen behauptete, politische Freiheiten (an denen es in der kommunistischen Welt ganz klar mangelte) seien wichtiger; die Kommunisten behaupteten, dass politische Rechte wenig bedeuteten, wenn nicht zuvor bestimmte grundlegende wirtschaftliche Rechte gewährleistet würden. Aber konnte eine Nation eine Kategorie von Rechten ohne die andere haben? Ökonomen wie John Stuart Mill, Milton Friedman und Friedrich von Hayek haben sich in diese Debatte eingeschaltet und sich mit der Frage beschäftigt,11 welches Wirtschafts- und politische System diese eng miteinander verschränkten Freiheiten am besten verwirklicht und das individuelle und gesellschaftliche Wohlergehen am besten fördert. Dieses Buch befasst sich aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts mit den gleichen Fragen, und es gelangt zu Antworten, die sich deutlich von denjenigen Friedmans und Hayeks in der Mitte des letzten Jahrhunderts unterscheiden.
Das Konzept von »Trade-offs«* spielt in den Wirtschaftswissenschaften eine zentrale Rolle, und diese Idee liefert einen weiteren Grund dafür, dass Ökonomen Substanzielles zu Diskussionen über das Thema Freiheit beisteuern können. Wie sich noch zeigen wird, gibt es auf diesem Gebiet, wenn überhaupt, dann nur weniges, was absolut gilt. Die Ökonomik stellt Werkzeuge bereit, die es erlauben, über die Natur der Trade-offs nachzudenken, und die in Diskussionen über Freiheiten und die richtige Art, Trade-offs zu adressieren, eine zentrale Rolle spielen sollten.
Außerdem fördern wir jede Menge Paradoxien zutage, sobald wir das oberflächliche Bekenntnis der Rechtskonservativen zur Freiheit genauer unter die Lupe nehmen, wie zum Beispiel die bedeutsame Erkenntnis, dass leichter Zwang – jemanden zu nötigen, etwas zu tun, was er aus eigenem Antrieb nicht tun würde – in einigen Fällen die Freiheit aller mehren kann, auch derjenigen, die unter Druck gesetzt werden. Ich werde zeigen, dass die Wirtschaftswissenschaften eine Erklärung für die zahlreichen wichtigen Fälle liefern, in denen kollektives Handeln – etwas gemeinsam tun, was Individuen nicht von sich aus tun würden – wünschenswert ist. Aber wegen sogenannter Trittbrettfahrerprobleme, die wir später erörtern werden, ist kollektives Handeln ohne ein bisschen Zwang oft nicht möglich.
Freiheit aus der Sicht des 21. Jahrhunderts
Letzten Endes werde ich zeigen, dass die wahren Anhänger eines tiefen, bedeutungsvollen Freiheitsbegriffs der progressiven Bewegung sowohl in den USA als auch im Rest der Welt nahestehen. Sie und die Mitte-links-Parteien, die sie repräsentieren, müssen wieder die Kontrolle über die Freiheitsagenda übernehmen. Insbesondere von den Amerikanern verlangt dies, die Geschichte und die Gründungsmythen ihres Landes einer Neubewertung zu unterziehen.
Das erste Ziel dieses Buches besteht darin, den Freiheitsbegriff aus der Sicht der Wirtschaftswissenschaften des 21. Jahrhunderts auf eine verständliche und einfache Weise zu erklären, so wie es John Stuart Mill in der Mitte des 19. Jahrhunderts in seinem klassischen Werk On Liberty (Über die Freiheit, 1859) getan hat. In den mehr als 160 Jahren, die seither vergangen sind, hat sich die Welt gewandelt, und das Gleiche gilt für unser Verständnis von Wirtschaft und Gesellschaft. Das, worüber heute auf den Korridoren der Macht diskutiert wird, unterscheidet sich von der damaligen politischen Agenda. Damals waren Erinnerungen an die staatliche Verfolgung bestimmter Religionsgemeinschaften (insbesondere durch die britische Regierung, was ein Grund der betroffenen Gläubigen für die Auswanderung nach Nordamerika war) noch lebendig, und es war vor allem dieses Vermächtnis, das einen prägenden Einfluss auf die Ansichten der Menschen hatte. Heute treiben uns Dinge um wie Klimawandel, Waffengewalt, Umweltverschmutzung, das Recht auf Abtreibung und die Freiheit, seine Geschlechtsidentität auszuleben. In größerer Perspektive diskutieren wir über die Bedeutung sozialer Zwänge und der »zwanghaften« Reaktionen dagegen. Unsere gegenwärtigen Herausforderungen machen eine Neubestimmung grundlegender Begriffe einschließlich dem der Freiheit nötig. Tatsächlich sagte Mill selbst, dass Freiheiten im Zuge des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels neu gedacht werden müssten.
Zwar bin ich fest davon überzeugt, dass Wirtschaftswissenschaftler wichtige Beiträge zu unserem Verständnis von Freiheit und ihrer Beziehung zu unserem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem liefern können, aber zugleich engt die besondere, spezifische Brille, durch welche sie für gewöhnlich die Welt betrachten, ihr Gesichtsfeld auch ein. Das Thema ist wesentlich komplexer, als es die begrenzten Blickwinkel von Ökonomen zu erfassen vermögen, und an verschiedenen Stellen im Text weise ich auf diese Begrenzungen hin.12,13
Wirtschaftssysteme und Freiheit
Die Bedeutung von Freiheit zu verstehen, ist eine Vorstufe zu meinem letztendlichen Ziel: ein wirtschaftliches und politisches System zu beschreiben, das nicht nur in Bezug auf Effizienz, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit hält, was es verspricht, sondern auch moralischen Werten gerecht wird. Bei dieser Diskussion ist Freiheit der wichtigste dieser moralischen Werte, aber Freiheit verstanden als ein Wert, der eng mit den Begriffen »Gleichheit«, »Gerechtigkeit« und »Wohlergehen« verbunden ist. Es ist dieser erweiterte Freiheitsbegriff, mit dem gewisse wirtschaftswissenschaftliche Denkrichtungen kurzen Prozess gemacht haben.
Hayek und Friedman waren in der Mitte des 20. Jahrhunderts die bekanntesten Verfechter eines unregulierten, freien Kapitalismus. »Ungezügelte Märkte« – Märkte ohne Regeln und Vorschriften – ist ein Widerspruch in sich, weil ohne staatlich durchgesetzte Regeln und Vorschriften kaum Handel stattfinden würde. Betrug wäre an der Tagesordnung, Vertrauen wäre gering. Eine Welt ohne Beschränkungen wäre ein Dschungel, in dem nur Macht zählte, die bestimmen würde, wer was bekommt und wer was tut. Es wäre überhaupt kein Markt. Verträge über die heutige Lieferung eines Gutes gegen spätere Zahlung wären unmöglich, weil es keinen Durchsetzungsmechanismus gäbe. Aber es besteht ein großer Unterschied zwischen der Aussage, eine gut funktionierende Gesellschaft benötige einen Mechanismus der Vertragsdurchsetzung, und der Aussage, jeder Vertrag sollte durchgesetzt werden.
Hayek und Friedman behaupteten, der Kapitalismus – so wie sie ihn interpretierten – sei in Bezug auf Effizienz das beste System, und ohne freie Märkte und freies Unternehmertum gäbe es keine individuelle Freiheit. Sie waren fest davon überzeugt, dass Märkte von sich aus Wettbewerb sicherstellen würden. Bemerkenswerterweise hatten sie die Erfahrungen der Monopolbildung und wirtschaftlichen Machtballung, die zu den Wettbewerbsgesetzen geführt hatten (in den USA der Sherman Antitrust Act von 1890 und, ein Vierteljahrhundert später, der Clayton Antitrust Act von 1914), bereits vergessen – oder verdrängt. Als nach der Großen Depression, der Ende 1929 einsetzenden Weltwirtschaftskrise, die in vielen Ländern der Welt 25 Prozent der Arbeitnehmer arbeits- und mittellos machte, der Staat verstärkt in die Wirtschaft eingriff, befürchtete Hayek, wir befänden uns auf dem Weg zur Knechtschaft, wie er es in seinem gleichnamigen Buch von 1944 ausdrückte;14 das heißt, auf dem Weg zu einer Gesellschaft, in der Menschen sich der Staatsgewalt unterwerfen würden.
Ich komme zu einer völlig anderen Schlussfolgerung. Aufgrund demokratischer Forderungen haben demokratische Regierungen wie die US-amerikanische durch kollektives Handeln auf die Große Depression reagiert. Das Versagen der deutschen Regierung, angemessen auf die stark steigende Arbeitslosigkeit in der Spätphase der Weimarer Republik zu reagieren, führte zum Aufstieg Hitlers. Heute hat der Neoliberalismus – der Glaube an ungezügelte, unregulierte Märkte15 – zu massiven Ungleichheiten geführt und liefert fruchtbaren Boden für Populisten. Zu den »Verbrechen« des Neoliberalismus zählen unter anderem die Deregulierung der Finanzmärkte, welche die schwerste Finanzkrise der letzten 75 Jahre auslöste, die Liberalisierung des Handels mit der Folge einer beschleunigten Deindustrialisierung und die Tatsache, dass es Unternehmen erlaubt wurde, Verbraucher, Arbeitnehmer und ebenso die Umwelt auszubeuten. Anders als es Friedman in seinem (erstmals 1962 erschienenen) Buch Kapitalismus und Freiheit behauptete,16 fördert diese Form des Kapitalismus nicht die Freiheit in unserer Gesellschaft. Vielmehr verschaffte sie einigen wenigen neue Freiheiten – auf Kosten der vielen. Freiheit für die Wölfe, Tod für die Schafe.
Ähnliche Probleme treten auch auf internationaler Ebene auf; sie enthüllen aufschlussreiche und wichtige Zusammenhänge zwischen Regeln und dem Ideal der Freiheit. Es ist nicht so, dass die Globalisierung ohne Regeln verlaufen würde, aber diese Regeln gewähren Freiheiten und erlegen Beschränkungen in einer Weise auf, die überall dieselben unterschiedlichen Schicksale von Wölfen und Schafen festschreibt – es ist lediglich so, dass Wölfe und Schafe über verschiedene Regionen und Nationen der Welt verteilt sind. Sogenannte Freihandelsabkommen enthalten Regeln, die die Freiheit von Entwicklungs- und Schwellenländern und der Menschen, die in ihnen leben, einschränken, während sie gleichzeitig multinationalen Konzernen mehr Möglichkeiten zur Ausbeutung geben.
Diese ganze Diskussion führt uns über eine bloße Erkundung dessen, was Freiheit bedeutet, hinaus. Wir befassen uns mit Fragen, die die Grundlagen der modernen Volkswirtschaftslehre betreffen: die moralische Legitimität von Eigentumsrechten und die Verteilung von Einkommen und Vermögen, die die Wirtschaft erzeugt. Die politische Rechte spricht oft von der »Unantastbarkeit von Verträgen«, aber ich werde darlegen, dass viele Verträge in einem tieferen Sinne unmoralisch sind, verboten gehören und nicht gerichtlich einklagbar sein sollten. Aus heutiger Sicht hatten die Gründer der amerikanischen Republik ein falsches Verständnis grundlegender Begriffe wie »Eigentum« und »Freiheit«. Sie erkannten die Eigentumsrechte der Sklavenhalter an – tatsächlich bestand das »Eigentum« in den Südstaaten zu einem großen Teil aus Sklaven –, während sie die Rechte der Sklaven, die Früchte ihrer Arbeit zu genießen, nicht anerkannten. Während die Sklavenhalter davon sprachen, das Joch der britischen Herrschaft abzuschütteln, verweigerten sie vielen Menschen, die in den Südstaaten lebten, elementare Freiheitsrechte. Zweifellos wird man in 100 Jahren auch die heutigen Anschauungen wiederum als mangelhaft ansehen.
Der bedeutende italienische Intellektuelle Antonio Gramsci (1891 – 1937) lag höchstwahrscheinlich richtig, als er behauptete, unsere Gesellschaftsideologie bilde das Fundament für das reibungslose Funktionieren der Gesellschaft und für die Aufrechterhaltung der Macht der Eliten. Die Ideologie hilft, Institutionen und Regeln zu legitimieren, die einigen mehr und anderen weniger Freiheiten gewähren – einschließlich der Freiheit, die Regeln zu machen. Die Veränderungen in den Glaubenssystemen Amerikas seit der Verabschiedung der Verfassung sollten uns dies deutlich vor Augen führen. Was damals als legitim angesehen und kaum hinterfragt wurde, gilt heute als abscheulich. Deshalb ist es so wichtig, die Prozesse zu verstehen, durch die Ideologien innerhalb einer Gesellschaft entstehen und weitergegeben werden. Und auch in dieser Hinsicht sind Gramscis Erkenntnisse über die Hegemonie der Eliten sehr aufschlussreich. Selbstverständlich wird Einfluss im 21. Jahrhundert auf eine andere Weise ausgeübt als zu seinen Lebzeiten.
In Teil II dieses Buches befassen wir uns mit der Frage, wie sich allgemein akzeptierte Freiheitskonzeptionen herausbilden.
Es kommt auf die Wörter an
Der modernen Verhaltensökonomik verdanken wir die Erkenntnis, dass das »Framing« (die Art der sprachlichen Formulierung eines Sachverhalts) von großer Bedeutung ist. Eine Prämie dafür, dass man das Richtige getan hat, wird anders wahrgenommen als eine Strafe dafür, dass man das Falsche getan hat, auch wenn die beiden aus Sicht der klassischen Ökonomik äquivalent sein und die gleichen Handlungen auslösen können.
Die Sprache der Freiheit, wie sie heute gebräuchlich ist, hat unsere Fähigkeit eingeschränkt, in vernünftiger Weise darüber nachzudenken, welches politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche System dem gesamtgesellschaftlichen Wohlergehen am förderlichsten ist – und auch darüber, welches System am ehesten der größtmöglichen Zahl von Menschen Freiheit und Wohlergehen in einem bedeutungsvollen Ausmaß bringt. Die Sprache von Zwang und Freiheit ist zu einem emotional stark aufgeladenen Teil unseres politischen Wortschatzes geworden. Freiheit ist gut; Zwang ist schlecht. Tatsächlich gibt es die weitverbreitete, grob vereinfachende Auffassung, wonach »Freiheit« und »Zwang« bloße Gegenbegriffe sein sollen. In einem Fall hat eine Person die Freiheit, eine Maske zu tragen oder nicht, sich impfen zu lassen oder nicht, einen finanziellen Beitrag zu den Verteidigungsanstrengungen ihres Landes zu leisten oder nicht, den Armen Geld zu geben oder nicht. Der Staat hat nun die Macht, ihr diese Freiheiten wegzunehmen. Er kann sie zwingen oder durch Druck dazu bewegen, eine Maske zu tragen, sich impfen zu lassen, Steuern zur Finanzierung der Streitkräfte zu zahlen oder Menschen mit niedrigerem Einkommen zu unterstützen.
Die gleiche Dichotomie gilt für die Beziehungen eines Nationalstaates zu anderen Nationalstaaten. Möglicherweise fühlen sich Staaten dazu gezwungen, etwas zu tun, was sie nicht tun wollen, durch die Androhung entweder militärischer Gewalt oder wirtschaftlicher Maßnahmen, die ihre Wirtschaft so schwer schädigen würden, dass sie ihres Erachtens keine andere Wahl haben.
Allerdings scheint das Wort »Zwang« in vielen Kontexten nicht hilfreich zu sein. Alle Menschen (und alle Staaten) unterliegen Beschränkungen. So könnte man sagen, dass ich gezwungen bin, nicht über meine Verhältnisse zu leben, aber genauso gut könnte man sagen, dass ich keinen Anspruch darauf habe, über meine Verhältnisse zu leben, oder dass niemand anders dazu gezwungen werden kann, mir über mein Budget hinaus zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Wir können die Einschränkung durch ein knapperes Budget einfach als eine von vielen nicht auf Zwang beruhenden Möglichkeiten ansehen, die Handlungsfreiheit einer Person einzuschränken. Aber die Budgetbeschränkung einer Person ist in gewisser Weise gesellschaftlich bestimmt. In einer Marktwirtschaft ist sie das Ergebnis wirtschaftlicher Kräfte, die von gesellschaftlich bestimmten Regeln geprägt werden, wie ich noch ausführlicher darlegen werde.
Folglich hat die grob vereinfachende Verwendung des Wortes »Freiheit« durch die politische Rechte eine zentrale gesellschaftliche Freiheit geschwächt: die Freiheit, ein Wirtschaftssystem auszuwählen, das tatsächlich den meisten Bürgern ein Mehr an Freiheit bringen würde. In diesem Sinne hoffe ich, dass die Diskussion in diesem Buch Raum für eine breitere Debatte schaffen wird – dass sie befreiend sein wird.
Mein intellektueller Werdegang
Lesern meiner früheren Werke wird auffallen, dass dieses Buch auf Ideen aufbaut, die mich schon seit Langem beschäftigen. Meine wissenschaftliche Karriere begann mit dem theoretischen Nachweis, dass langjährige Annahmen, wonach Wettbewerbsmärkte effizient seien, schlichtweg falsch sind, insbesondere bei unvollständiger Information, was immer der Fall ist. Aber meine Tätigkeiten in der Regierung Clinton und bei der Weltbank überzeugten mich davon, dass die Schwächen der US-Wirtschaft (und der vorherrschenden wirtschaftswissenschaftlichen Modelle) tiefgreifender sind.
In meinen früheren Arbeiten beschrieb ich, wie sich Globalisierung, Finanzialisierung und Monopolisierung auf unsere Wirtschaft auswirkten und wie sie zu der zunehmenden Ungleichheit, der Wachstumsschwäche und schwindenden Aufstiegschancen beitrugen. Ich gelangte auch zu der Überzeugung, dass die Probleme in unserer Wirtschaft und Gesellschaft nicht unvermeidlich waren; sie waren nicht das Ergebnis des Wirkens von Natur- oder ökonomischen Gesetzen. Vielmehr waren sie in gewisser Weise das Ergebnis einer freien Wahl – der Regeln und Vorschriften, die die Grundlage unseres Wirtschaftssystems bilden. Diese waren in den letzten Jahrzehnten maßgeblich vom Neoliberalismus geprägt worden, und der Neoliberalismus war schuld daran.
Aber es gibt noch einen zweiten Teilbereich meiner Arbeit, der für dieses Buch von Belang ist. Es begann mit meinem Interesse für natürliche Ressourcen und die Umwelt – Themen, mit denen ich mich in Aufsätzen beschäftigte, die ich vor vielen Jahren geschrieben habe. Es war offensichtlich, dass es beim Schutz der Umwelt und bei der Nutzung natürlicher Ressourcen schwerwiegendes Marktversagen gab. Ich bemühte mich, sowohl die besondere Eigenart dieses Versagens zu verstehen als auch mögliche Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen. Ich war Leitautor des Intergovernmental Report on Climate Change von 1995, des ersten derartigen Berichts, der auch wirtschaftliche Analysen enthielt.17
Gleichzeitig setzte ich mich im Wirtschaftswissenschaftlichen Beirat des Präsidenten dafür ein, unser System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung mit dem Ziel zu überarbeiten, die Auswirkungen der wirtschaftlichen Produktion auf die natürlichen Ressourcen und die Umwelt zu erfassen – kurzum: ein »grünes« Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu berechnen. Das Handelsministerium, das die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung erstellt, hat uns dabei begeistert unterstützt. Wir wussten, dass wir an etwas Wichtigem dran waren, als mehrere Kongressabgeordnete damit drohten, unser Budget zusammenzustreichen, sollten wir unser Vorhaben weiterverfolgen. Meine Arbeit kam vorübergehend zum Erliegen, aber einige Jahre später bat mich der französische Präsident Nicolas Sarkozy, gemeinsam mit dem Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaften Amartya Sen und unserem Ökonomenkollegen Jean-Paul Fitoussi den Vorsitz der internationalen Kommission für die Messung der Wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Sozialen Fortschritts (CMEPSP) zu übernehmen. Unser im Anschluss daran veröffentlichter Bericht Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn’t Add Up beeinflusste die Entstehung einer Bewegung, die gelegentlich auch »Beyond GDP« genannt wird, und die Gründung einer Allianz von Ländern, der Wellbeing Economy Government Alliance, die Wohlergehen im weitesten Sinne in den Mittelpunkt ihrer Agenda stellt.18 Leitidee der Bewegung und der Allianz ist, dass es nicht nur auf die vom BIP gemessenen materiellen Güter und die Dienstleistungen ankommt, sondern auch auf das Wohlergehen des Einzelnen und der Gesellschaft, das viele Dinge umfasst, die das traditionelle BIP nicht berücksichtigt, einschließlich gegebenenfalls einer Beurteilung der »Lage der Freiheit« in einem Land.
Dieses Buch ist sehr stark von diesem Geist geprägt. Noch gravierender als die Ineffizienzen und Instabilitäten, die der Neoliberalismus hervorgebracht hat, sind die zerstörerischen Ungleichheiten, die er erzeugt, die Tatsache, dass er Egoismus und Unaufrichtigkeit fördert, und die Einengung des Horizonts und der Werte, die zwangsläufig daraus folgt. Einer der gravierendsten Mängel des Neoliberalismus ist die Tatsache, dass er die Freiheit der vielen einschränkt, während er die Freiheit der wenigen vergrößert.
Das vorliegende Buch baut auf meinen früheren Arbeiten auf, die es zusammenführt und erweitert. Es genügt nicht, zu verstehen, warum und in welcher Weise der Neoliberalismus gescheitert ist, und zu erkennen, dass wir über das BIP hinausgehen müssen. Wir haben auch zu fragen, was eine gute Gesellschaft ausmacht, und herauszufinden, was wir tun müssen, um sie zu verwirklichen. Auf den folgenden Seiten liefere ich nicht so sehr eindeutige Antworten, sondern stelle vielmehr Fragen und präsentiere einen Bezugsrahmen für die Analyse dieser Probleme einschließlich der sachgerechten Abwägung zwischen verschiedenen Freiheiten.
Nie in meinem Leben sahen sich Demokratie und Freiheit größeren Herausforderungen und Angriffen ausgesetzt als heute. Ich hoffe, dieses Buch trägt zu einem tieferen Verständnis von Freiheit bei und stärkt die demokratische Debatte darüber, welche Art von politischem, wirtschaftlichem und gesellschaftlichem System für die meisten Bürger einen Zugewinn an Freiheit bringt. Die USA sind eine Nation, die aus der Überzeugung geboren wurde, dass Menschen frei sein müssen. Wir können es nicht zulassen, dass wirtschaftliche und politische Freiheit nur von einer Gruppe definiert wird, die beide anschließend nur zu ihrem Vorteil nutzt.
Wir werden und können diesen existenziellen Kampf um Freiheit und Demokratie nur gewinnen, wenn wir ganz genau wissen, was wir wollen. Wofür kämpfen wir? Wie kommt es, dass die politische Rechte lange Zeit unser Denken über die Begriffe verwirrt hat? Die von ihr betriebene Begriffsverwirrung ist ihren Zwecken sehr dienlich, während sie eine Reihe politischer Schlachten anzettelt, die, sollte sie diese gewinnen, zum genauen Gegenteil dessen führen würde, was echte Freiheit bedeutet.
* Wirtschaftswissenschaftlicher Begriff, der bedeutet, dass eine Größe, ein Wert oder ein Ziel nur auf Kosten einer anderen Größe etc. optimiert werden kann, dass insoweit ein Zielkonflikt besteht, der durch Abwägungen/Kompromisse gelöst werden muss. (A. d. Ü.)
Kapitel 1 Einleitung: Gefährdete Freiheit
Die Freiheit ist bedroht. Nach allgemeiner Auffassung leben weltweit immer weniger Menschen in freien und demokratischen Gesellschaften. Freedom House, eine gemeinnützige Organisation in den Vereinigten Staaten, die alljährlich einen Überblick über die weltweite Lage der Freiheit und Entwicklungstrends der Freiheit veröffentlicht, stellte in ihrem Bericht für das Jahr 2022 fest, dass die Freiheiten seit 16 aufeinanderfolgenden Jahren auf dem Rückzug sind. Heute leben 80 Prozent der Weltbevölkerung in Ländern, die Freedom House als autoritär oder lediglich teilweise frei einstuft – das heißt Ländern, denen ein Schlüsselelement einer freien Gesellschaft wie etwa eine unabhängige Presse fehlt. Selbst die Europäische Union mit ihrem klaren Bekenntnis zu Demokratie und Menschenrechten blieb nicht verschont. Ungarn wird seit dem 29. Mai 2010 von Viktor Orbán regiert, der Anhänger eines »illiberalen Demokratiemodells« ist und entschieden gegen eine freie Presse und Selbstbestimmung im Bildungswesen vorgegangen ist. Auf der anderen Seite des Atlantiks hat Donald Trump ganz klar autoritäre Tendenzen, was sich unter anderem daran ablesen lässt, dass er die friedliche Machtübertragung störte, nachdem er bei den Präsidentschaftswahlen von 2020 eine vernichtende Niederlage erlitten hatte. Doch ungeachtet zahlreicher Anklagen und Zivilprozesse, die von Betrug bis zu Vergewaltigung reichten, stellte ihn die Republikanische Partei für die Wahl 2024 abermals als Präsidentschaftskandidaten auf, und nachdem er sogar gute Aussichten gehabt hatte, wurde er tatsächlich ein zweites Mal ins Amt gewählt.
Wir befinden uns mitten in einem globalen intellektuellen und politischen Krieg, in dem es darum geht, Freiheit zu schützen und zu bewahren. Leisten Demokratien und freie Gesellschaften das, was Bürger von ihnen erwarten und was ihnen wichtig ist, und sind sie darin autoritären Regimen überlegen? Dies ist ein Kampf um die Herzen und Köpfe der Menschen überall auf der Welt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Demokratien und freie Gesellschaften die Bedürfnisse ihrer Bürger sehr viel effektiver befriedigen als autoritäre Systeme. Allerdings versagen unsere freien Gesellschaften auf mehreren Schlüsselgebieten, insbesondere in der Wirtschaftspolitik. Aber – und das ist wichtig – dieses Versagen ist nicht unvermeidlich und zum Teil darauf zurückzuführen, dass die verfehlte Freiheitskonzeption der politischen Rechten uns auf den falschen Pfad führte. Es gibt andere Pfade, die eine bessere Versorgung mit den von den Vertretern dieses Lagers gewünschten Gütern und Dienstleistungen gewährleisten, die mehr Sicherheit versprechen und zugleich mehr Menschen einen Zugewinn an Freiheit bringen.1
In diesem Buch nähern wir uns Freiheitsfragen aus der Perspektive und mit der Sprache der Ökonomen, sodass es sich, zumindest anfangs, auf das konzentriert, was man wirtschaftliche Freiheit nennen könnte, im Unterschied zu dem, was für gewöhnlich politische Freiheit genannt wird (später werde ich dann darlegen, dass beide im Grunde nicht voneinander getrennt werden können).
Freiheit in einer Welt der wechselseitigen Verflechtung
Wenn wir überdenken wollen, was Freiheit bedeutet, müssen wir zunächst einmal anerkennen, dass wir voneinander abhängig sind. »Niemand ist eine Insel, in sich ganz«, formulierte der englische Dichter John Donne im Jahr 1624. Dies gilt insbesondere für unsere moderne, urbane, vernetzte Gesellschaft, die sich erheblich von der Agrargesellschaft der präindustriellen Ära unterscheidet, in der viele Menschen mit ihren Angehörigen auf Gehöften lebten, die mitunter weit voneinander entfernt waren. In dicht besiedelten städtischen Gebieten wirkt sich das, was eine Person tut, auf andere aus – angefangen vom Hupen hinterm Steuer bis zum Entfernen der Hinterlassenschaften ihres Hundes beim Gassigehen. Und in unserer industriellen Welt mit ihren Kraftfahrzeugen, Fabriken und der industriellen Landwirtschaft trägt die Luftverschmutzung durch eine Person oder ein Unternehmen nach und nach dazu bei, dass die Atmosphäre zu stark mit Treibhausgasen belastet wird, was zu jener globalen Erwärmung führt, unter der wir alle zu leiden haben.
Eine Grundannahme dieses Buches lautet, dass die Freiheit einer Person oft gleichbedeutend ist mit der Unfreiheit einer anderen Person beziehungsweise, anders formuliert, dass die Stärkung der Freiheit des einen oftmals auf Kosten der Freiheit des anderen geht. Cicero drückte es vor gut 2000 Jahren so aus: »Schließlich sind wir alle Diener des Gesetzes, um frei sein zu können.«2 Nur durch kollektives Handeln, durch eine Regierung, können wir ein Gleichgewicht der Freiheiten erreichen. Klug durchdachte staatliche Maßnahmen wie etwa Vorschriften, die die Handlungsfreiheit bis zu einem gewissen Grad einschränken, können in einem grundlegenden Sinne freiheitsfördernd sein – zumindest für einen Großteil der Bevölkerung. In einem gesunden, modernen Gemeinwesen müssen staatliche Eingriffe und Freiheit nicht im Widerspruch zueinander stehen.
Selbstverständlich wurden die Grenzen der Freiheit von jeher infrage gestellt, und sie sind zwangsläufig nicht klar definiert. Sollte die Meinungsfreiheit überhaupt nicht eingeschränkt werden, auch nicht in Bezug auf Kinderpornografie? Privateigentum stellt eine Beschränkung dar – eine Person hat das Recht, einen Vermögensgegenstand zu gebrauchen und darüber zu verfügen, während andere dieses Recht nicht besitzen. Aber Eigentumsrechte müssen definiert werden, insbesondere was neuere Formen des Eigentums wie zum Beispiel geistiges Eigentum betrifft. Selbst die US-Verfassung erkennt das »hoheitliche Obereigentum« (eminent domain) an, also das Enteignungsrecht des Staates, verbunden mit angemessener Entschädigung. Und die Umstände, unter denen dem Staat dieses Recht zusteht, wandeln sich von Rechtsfall zu Rechtsfall.
Ein Großteil dieser Debatte betrifft die Balance zwischen der Freiheit von staatlichem Zwang und der Freiheit, nicht durch andere geschädigt zu werden. Aber es gibt eine wichtige positive Dimension von Freiheit, die ich bereits erwähnt habe: die Freiheit, sein Potenzial auszuschöpfen. Menschen, die finanziell kaum über die Runden kommen, haben in gewisser Weise keine Freiheit. Sie tun, was sie tun müssen, um zu überleben. Aber um ihnen die Mittel zu geben, die sie benötigen, um ein auskömmliches Leben zu führen oder gar ihr Potenzial auszuschöpfen, ist es nötig, alle Bürger eines Gemeinwesens zu besteuern.3 Manche Anhänger der politischen Rechten behaupten, dass eine solche Besteuerung – auch mit Repräsentation – einer Tyrannei gleichkomme, weil sie das Recht verloren hätten, ihr Geld nach eigenem Belieben auszugeben. In der gleichen Weise sind sie der Meinung, dass Gesetze, die Arbeitgeber dazu verpflichten, den Mindestlohn – oder einen auskömmlichen Lohn – zu zahlen, diesen die Freiheit nimmt, den Lohn zu zahlen, für den jemand bereit ist, für sie zu arbeiten. Diese Freiheit trägt sogar einen eleganten Namen: Vertragsfreiheit.
In diesem Buch geht es mir letztlich darum, zu ergründen, welches Politik-, Wirtschafts- und Gesellschaftssystem den meisten Bürgern am ehesten einen Zugewinn an Freiheiten bringt, unter anderem dadurch, dass Freiheitsgrenzen sachgerecht und angemessen festgelegt, geeignete Regeln und Vorschriften erlassen und die richtigen Abwägungen getroffen werden.
Die Antwort, die ich vorlege, läuft derjenigen zuwider, die sich seit über 100 Jahren in den Schriften von Konservativen findet. Es ist nicht der von Libertären befürwortete »Minimalstaat« und auch nicht der vom Neoliberalismus erträumte »gebundene Staat«.4 Vielmehr läuft mein Vorschlag auf so etwas wie eine modernisierte europäische Sozialdemokratie oder einen neuen Amerikanischen Progressiven Kapitalismus, eine sozialdemokratische Politik für das 21. Jahrhundert oder den skandinavischen Wohlfahrtsstaat hinaus.
Selbstverständlich stehen hinter diesen verschiedenen Wirtschaftssystemen – dem neoliberalen Kapitalismus einerseits und dem progressiven Kapitalismus andererseits – verschiedene Theorien über individuelles Verhalten und die Funktionsweise von Gesellschaften sowie Theoretiker, die erklären, warum das von ihnen bevorzugte System anderen überlegen ist. Im nächsten Kapitel greifen wir diese alternativen Theorien und Theoretiker auf.
Die Vielschichtigkeit des Freiheitsbegriffs am Beispiel der USA
Die Vielschichtigkeit des Freiheitsbegriffs wird durch die Diskussionen über Freiheit in den Vereinigten Staaten besonders gut verdeutlicht. Freiheit saugen Amerikaner schon mit der Muttermilch ein. Die Gründung der USA war ein Akt der Freiheit – die Amerikaner entrissen ihren britischen Oberherren, die Tausende Kilometer weit weg waren, die politische Herrschaftsgewalt. Jedes Schulkind in den Vereinigten Staaten lernt den Ausruf »Gebt mir die Freiheit, oder gebt mir den Tod!«, den einer der bekanntesten Verfechter der Unabhängigkeit, der Rechtsanwalt Patrick Henry aus Virginia, bei einer Rede 1775 prägte, und bei zahllosen öffentlichen Gelegenheiten singen die Amerikaner ihre Nationalhymne mit den Worten »das Land der Freien und die Heimat der Tapferen«. Die ersten zehn Zusatzartikel zur Verfassung, die Bill of Rights, stellen sicher, dass der Staat die Grundfreiheiten des Einzelnen nicht beeinträchtigt. Aber die letzten Jahre haben es mit dieser Darstellung der US-amerikanischen Geschichte nicht gut gemeint. Denn es gab damals zwar Freiheit für einige, doch das Gegenteil von Freiheit für versklavte Völker. Andere – die indigenen Völker des Kontinents – erlebten einen regelrechten Genozid. Die Freiheit, für die sich die Patrioten des Landes einsetzten, war nicht die Freiheit für alle oder ein allgemeines Freiheitsideal, sondern Freiheit für sich selbst. Es war insbesondere politische Freiheit von der Herrschaft des britischen Königs und von den Steuern auf Tee, die er verhängt hatte.
Zumindest von unserem heutigen Blickwinkel aus ist es schwer zu verstehen, wie eine Gesellschaft, die der Freiheit einen so hohen Stellenwert einräumte, es zulassen konnte, dass die Sklaverei fortdauerte. Nach Ansicht mancher Apologeten müssen wir die damaligen Verhältnisse nach den zeitgenössischen Moralvorstellungen beurteilen; aber selbst damals gab es Stimmen, die die Sklaverei als ein moralisches Übel verdammten.5
So gesehen, ging es bei der Amerikanischen Revolution weniger um Freiheit als um die Frage, wer die politische Herrschaft ausüben sollte, darum, ob es eine Autonomie mit einer Regierung der lokalen Eliten oder eine »Fernherrschaft« durch ein Parlament in London geben sollte, in dem die Ablehnung der Sklaverei immer größeren Zuspruch fand. Schließlich schaffte Großbritannien im Jahr 1833 und damit gut 30 Jahre früher als die Vereinigten Staaten die Sklaverei ab. (Noch deutlicher war die zentrale Rolle der Sklaverei in Texas, das gegen Mexiko »rebellierte« und dann im selben Jahr, in dem Mexiko die Sklaverei verbot, den Vereinigten Staaten als Sklavenstaat beitrat.)
Auch später, im 20. Jahrhundert, war es nicht anders: Zur gleichen Zeit, als man im Weißen Haus große Reden über die zentrale Bedeutung von Freiheit hielt, wurden Bemühungen unterstützt, die demokratischen Freiheiten anderer zu untergraben. So war der US-Auslandsgeheimdienst CIA in Militärputsche in einer Reihe von Staaten wie etwa Griechenland und Chile verwickelt – was für Tausende Menschen den Verlust der grundlegendsten Freiheit nach sich zog: der Freiheit zu leben.
Ein anderer Aufstand aus jüngerer Vergangenheit – die Erstürmung des Kapitols in Washington am 6. Januar 2021 – war ein Angriff mit dem Ziel, den wichtigsten Prozess in einem demokratischen Gemeinwesen zu sabotieren – die friedliche Machtübertragung. Als sich ein Großteil der Republikanischen Partei in eine Art Sekte verwandelte und entgegen allen Beweisen behauptete, die Wahl sei gestohlen worden, wurde deutlich, dass die Demokratie in den USA in Gefahr ist, und mit ihr die Freiheiten, die den Amerikanern lange Zeit so viel bedeuteten. Viele derjenigen, die an dieser Erstürmung teilnahmen, behaupteten indes, sie würden die Freiheit verteidigen.
Unsere gespaltene Nation wird nur dann eine Chance haben, wieder zusammenzukommen, wenn wir diese Konzepte besser verstehen.
Zentrale Themen und Fragen
Wie bereits gesagt, lautet die zentrale Botschaft dieses Buches, dass der Begriff der Freiheit vielschichtiger ist, als es seine grob vereinfachende Verwendung durch die politische Rechte nahelegt. Ich möchte hier kurz innehalten, um zu erklären, in welchem Sinne ich den Begriff »die Rechte« verwende. Ich beziehe ihn weit gefasst auf verschiedene Gruppen in den USA – einige davon bezeichnen sich selbst als »Konservative«, andere als »Libertäre«, während sich wieder andere politisch als »rechts von der Mitte« einordnen –, die viele unterschiedliche Sichtweisen haben, aber die Überzeugung teilen, dass die Rolle der US-Bundesregierung und der Umfang kollektiven Handelns begrenzt sein sollten. Anders als einige Anarchisten glauben diese Gruppen jedoch an den Staat. Sie glauben, dass Eigentumsrechte durchgesetzt werden müssen. Die meisten glauben (oft fest) an die Notwendigkeit von Rüstungsausgaben. Und einige würden auch andere begrenzte Maßnahmen des Bundes befürworten, wie etwa öffentliche Unterstützung im Fall einer Krise wie eines verheerenden Erdbebens oder Hurrikans. Dieses Buch erklärt, warum es notwendig ist, dass der Staat eine umfassendere Rolle spielt, und betrachtet diese umfassendere Rolle insbesondere durch die Brille der Freiheit.
Die Reflexion über die Bedeutung von Freiheit lässt uns tiefer über viele Schlüsselaspekte der Gesellschaft nachdenken, die wir oft als selbstverständlich erachten – zum Beispiel über die Arten von Verträgen, die durchgesetzt werden sollten. Sie lässt uns über die Bedeutung von Toleranz und ihre Grenzen nachdenken. Wie tolerant sollten wir gegenüber denjenigen sein, die intolerant sind? Ich werde nicht alle schwierigen Fragen, die aufkommen, beantworten können, aber ich hoffe, dass ich zumindest verdeutlichen kann, worum es geht, und einen Rahmen für eine vertiefte Beschäftigung mit ihnen zu skizzieren vermag. Weil einige der Fragen sehr komplex sind, befürchte ich, dass ich vor lauter Bäumen den Wald aus dem Blick verliere. Daher möchte ich auf den nächsten Seiten einen Abriss des Themas geben und einige der zentralen Ideen und Fragen beschreiben, die von essenzieller Bedeutung für ein tieferes Verständnis von Freiheit sind. Ich strukturiere die Diskussion entsprechend den drei Teilen, in die das Buch gegliedert ist.
Der erste Teil betrachtet Freiheit und Zwang durch die Brille eines traditionellen Ökonomen, der die Überzeugungen und Wünsche eines Individuums als etwas Feststehendes, das sich im Lauf der Zeit nicht verändert und nicht von anderen beeinflusst wird, ansieht. Der zweite Teil greift Erkenntnisse der modernen Verhaltensökonomik auf, wonach Überzeugungen und Verhaltensweisen geformt werden können. Das ist gerade heute in Anbetracht der Tatsache wichtig, dass Meinungen, die oft keinerlei Bezug zu Fakten oder Logik haben, auf der Basis von Falsch- und Desinformation gebildet und propagiert werden.6 Teil II befasst sich auch mit der freiheitseinschränkenden Wirkung von sozialem Zwang. Der dritte Teil greift in den Teilen I und II entwickelte Ideen auf, um uns zu helfen zu verstehen, was eine gute Gesellschaft ausmacht und welche Art von Regierung und internationaler Ordnung diese am ehesten hervorbringt.
Schlüsselprinzipien: Traditionelle Sichtweisen
Grundlegende Freiheit: Handlungsfreiheit
Der wirtschaftliche Freiheitsbegriff eines Ökonomen geht von einer einfachen Idee aus: Die Freiheit einer Person hängt davon ab, was sie tun und wofür sie sich entscheiden kann. Es mag den Anschein haben, als käme diese Sichtweise derjenigen Milton Friedmans nahe, die sich im englischen Originaltitel seines 1980 erschienenen und gemeinsam mit seiner Frau Rose geschriebenen Bestsellers Free to Choose (wörtlich »Die freie Wahl haben«) widerspiegelt. Aber Friedman vergaß eine elementare Tatsache. Jemand mit einem sehr begrenzten Einkommen hat nur geringe Wahlfreiheit. Was zählt, ist die Gesamtheit der Handlungsmöglichkeiten – die Gesamtheit der Optionen –, die jemandem zur Verfügung stehen.7 Aus der Sicht eines Ökonomen ist dies das Einzige, was zählt. Die Gesamtheit seiner Handlungsoptionen bestimmt, ja definiert die Handlungsfreiheit eines Menschen.8 Jede Verringerung des Spektrums seiner verfügbaren Handlungsoptionen ist ein Verlust an Freiheit.9
Es macht keinen Unterschied, wie eine Erweiterung oder Verringerung der Gesamtheit an Handlungsoptionen sprachlich formuliert wird.10,11 Es macht keinen Unterschied, ob man jemanden dazu bewegt, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten, indem man ihm durch Belohnungen Anreize gibt oder ihn durch Bußgelder bestraft, auch wenn wir Ersteres vorziehen, weil es »frei von Zwang« ist (wir rühmen Wirtschaftssysteme, die kluge Anreizsysteme konzipieren, welche das erwünschte Verhalten auslösen), und Letzteres als »auf Zwang beruhend« geißeln.
Versteht man wirtschaftliche Freiheit als Handlungsfreiheit, erscheinen viele der zentralen Fragen im Zusammenhang mit Wirtschaftspolitik und Freiheit in einem neuen Licht. Libertäre und andere Konservative halten die Fähigkeit, das eigene Einkommen nach Belieben auszugeben, für ein definierendes Merkmal wirtschaftlicher Freiheit.12 Sie betrachten Einschränkungen dieser Fähigkeit als Zwang und Besteuerung als die Einschränkung, die den größten Zwangscharakter hat. Aber diese Sichtweise gibt Märkten und Marktpreisen den Vorrang. Ich werde diese Auffassung einer Kritik unterziehen. Es mag ökonomische Kontroversen bezüglich der Höhe und Ausgestaltung von Steuern geben, aber ich werde zeigen, dass dem Markteinkommen von Menschen – dem Einkommen, das sie in unserer Marktwirtschaft aus Löhnen, Dividenden, Kapitalerträgen oder anderen Quellen beziehen – kein nennenswerter beziehungsweise gar kein moralischer Vorrang zukommt und dass es daher kaum bis gar keine moralischen Gründe dafür gibt, diese Einkommen nicht zu besteuern.
Freiheit von Not und Furcht und Freiheit, sein Potenzial auszuschöpfen
Die Freiheit von Menschen, die gerade mal so über die Runden kommen, ist extrem eingeschränkt. Sie müssen ihre ganze Zeit und Tatkraft dafür aufwenden, genügend Geld für Lebensmittel, Unterkunft und Fahrt zur Arbeit zu verdienen. So wie die Einkommen von Menschen an der Spitze der ökonomischen Leiter keine moralische Legitimation besitzen, so gibt es auch keine für die Einkommen der Menschen am Fuß der Leiter. Sie haben nicht unbedingt etwas getan, um ihre Armut zu verdienen. Eine gute Gesellschaft würde etwas gegen die Entbehrungen beziehungsweise Freiheitsminderungen derjenigen tun, die niedrige Einkommen beziehen.
Es ist nicht überraschend, dass Menschen, die in den ärmsten Ländern leben, wirtschaftlichen Rechten, dem Recht auf medizinische Versorgung, auf Unterkunft, auf Bildung und der Freiheit von Hunger große Bedeutung beimessen. Sie sind besorgt über den Freiheitsverlust, der sich nicht nur der Politik einer repressiven Regierung, sondern auch einem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen System verdankt, das große Teile der Bevölkerung in Armut zurückgelassen hat. Man kann diese Freiheiten als negative beschreiben: das, was Menschen verlieren, wenn sie ihr Potenzial nicht ausschöpfen können. Man kann sie aber auch als positive Freiheiten auffassen: das, was Menschen durch gute Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme gewinnen, nämlich die Freiheit, ihr Potenzial auszuschöpfen, eine Freiheit, die mit Chancen auf ein besseres Leben und Zugang zu Bildung, Gesundheitsfürsorge und ausreichender Lebensmittelversorgung verbunden ist.
Die Rechte behauptet, Regierungen hätten die Freiheit der Bürger durch Besteuerung unnötig eingeschränkt; Steuern würden die Budgets der Reichen beschneiden und dadurch (nach unserer Formulierung) ihre Freiheit vermindern. Aber selbst diese Behauptung ist nur teilweise richtig, weil der gesamtgesellschaftliche Nutzen der mit diesen Steuern finanzierten Ausgaben, der Investitionen in Infrastruktur und Technologie zum Beispiel, die Gesamtheit ihrer Handlungsoptionen (ihre Freiheit) womöglich in einem bedeutungsvollen Ausmaß erweitert. Aber selbst wenn sie mit ihrer Beurteilung der Auswirkung auf die Reichen richtigliegen sollten, würden sie die umfassenderen gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen auf Freiheiten übersehen. Eine progressive Besteuerung, bei der die Einnahmen durch Sozial- oder Bildungsprogramme an diejenigen, die weniger gut dastehen, umverteilt werden, gibt den Armen mehr Handlungsoptionen, erhöht ihre Freiheit, auch wenn sie gleichzeitig die Handlungsmöglichkeiten der Reichen einschränken mag. Wie immer geht es um Trade-offs.
Die Freiheit des einen ist die Unfreiheit des anderen
Ich habe dieses zentrale Thema bereits eingeführt und werde in Kapitel 3 die vielfältigen Folgen, die sich daraus ergeben, erläutern. So führt diese unbestreitbare Tatsache zum Beispiel direkt zu dem damit zusammenhängenden Thema der Regelsetzung. Regelsetzung ist nicht das Gegenteil von Freiheit; in einer freien Gesellschaft sind Einschränkungen notwendig. Sogar ältere, einfachere Gesellschaften brauchten Regeln. Die meisten der Zehn Gebote lassen sich als das Minimum an Gesetzen (Vorschriften) auffassen, ohne das eine Gesellschaft nicht funktionieren kann.
Eine der wichtigsten Konsequenzen daraus habe ich ebenfalls bereits erwähnt: Freiheit erfordert oftmals Trade-offs. Manchmal liegt es auf der Hand, wie Rechte gegeneinander abgewogen werden sollten. In allen Gesellschaften ist es verboten, einen Menschen zu töten, außer unter eng definierten Umständen. Das »Recht zu töten« wird dem »Recht, nicht getötet zu werden« untergeordnet. Es gibt viele weitere Fälle, in denen offensichtlich sein sollte, wie Rechte gegeneinander abzuwägen sind, sofern wir uns nur von der Verwirrung frei machen würden, die durch die falsche Rhetorik von Freiheit und Zwang entsteht. Mit der Ausnahme einer Person, für die eine Impfung gesundheitsgefährdend ist, wiegt zum Beispiel das Risiko, dass ein Ungeimpfter ein gefährliches und vielleicht tödliches Virus verbreitet, viel schwerer als die »Unannehmlichkeit« oder der »Freiheitsverlust« einer Person, die gezwungen ist, sich impfen zu lassen. Es sollte auch offensichtlich sein, dass das Ausmaß des Ungleichgewichts mit steigender Infektiosität und Schwere der viralen Erkrankung zunimmt.
Allerdings gibt es einige Fälle, in denen es nicht offensichtlich ist, wie Trade-offs gegeneinander abgewogen werden sollten; in späteren Kapiteln stelle ich einen Rahmen für eine sachgerechte Herangehensweise an solche Situationen vor.
Freie, ungezügelte Märkte begünstigen Ausbeutung, nicht Wahlfreiheit
Ein spezielles Beispiel für Abwägungen, bei denen die Antwort meines Erachtens leicht ist, betrifft Ausbeutung. Diese kann viele Formen annehmen: Marktmacht, einschließlich Wucherpreise in Kriegszeiten, oder Pharmaunternehmen, die Preise während einer Pandemie hoch halten, Zigaretten-, Nahrungsmittel- und Pharmaunternehmen, die Abhängigkeiten ausnutzen, Casinos und Glücksspiel-Webseiten, die Vulnerabilitäten ausnutzen. Jüngste Fortschritte auf dem Gebiet der digitalen Ökonomie haben der Ausbeutung ganz neue Perspektiven eröffnet.
Herkömmliche Wettbewerbsanalysen in der akademischen Volkswirtschaftslehre gehen von der Annahme aus, dass niemand Macht besitzt, jeder perfekt informiert ist und alle vollkommen rational handeln. Dadurch klammern sie Marktmacht und andere Formen von Ausbeutung von vornherein aus. Aber in der heutigen Welt gibt es einige Individuen und Unternehmen, die über erhebliche Macht verfügen.13 Es ist so, als würden Menschen, die der Auffassung sind, der Staat solle nicht in die wirtschaftlichen Abläufe eingreifen, sämtliches Rent-Seeking in einer Volkswirtschaft des 21. Jahrhunderts einfach wegzaubern. (Eine knappe Definition von Rent-Seeking: Renten sind die Erträge einer Dienstleistung, von Arbeit, Kapital oder Grund und Boden, die über das hinausgehen, was für ihre Bereitstellung erforderlich wäre. Da das Angebot an Land konstant ist, zählen Erträge aus Grund und Boden als Renten; in ähnlicher Weise zählen zusätzliche Erträge, die durch Marktmacht erwirtschaftet werden, als Renten. Wenn Unternehmen ihre Marktmacht erhöhen oder in anderer Weise Ausbeutung betreiben wollen, dann bezeichnen wir dies als Rent-Seeking.)14
Ausbeutung bereichert den Ausbeutenden auf Kosten des Ausgebeuteten. Einschränkungen dieser Ausbeutung werden wahrscheinlich die Handlungsoptionen (Freiheit) der meisten vergrößern, während sie die Handlungsoptionen des Ausbeutenden verringern. Es gibt einen Trade-off, und die Gesellschaft muss entscheiden, wer die Gewinner sind und wer die Verlierer. In den meisten Fällen versteht sich das, was getan werden sollte, von selbst: Hier geht es nicht darum, ob die Einkommen beziehungsweise Vermögen der Ausbeutenden oder die der Ausgebeuteten Vorrang haben sollen, sondern um die Art und Weise, wie das Wohlergehen der einen auf Kosten der anderen verbessert werden kann.15 So gibt es zum Beispiel breite Unterstützung für gesetzliche Vorschriften, die Offenlegungspflichten begründen – zu dem Zuckergehalt im Müsli, den mit dem Zigarettenrauchen verbundenen Gefahren, dem effektiven Zins eines Hypothekendarlehens oder den verborgenen Risiken von Kapitalanlageprodukten. Diese Offenlegungspflichten verringern Informationsasymmetrien und dadurch die Möglichkeiten zur Ausbeutung, und sie tragen dazu bei, dass Märkte effizienter arbeiten. Wir können für unterschiedlichste Situationen nachweisen, dass »Zwang«, der Ausbeutung einschränkt, die wirtschaftliche Effizienz selbst in dem engen Sinne, in dem Ökonomen diesen Begriff verwenden, erhöht und die Handlungsoptionen der meisten, wenn nicht aller vergrößert.16
Dies bringt uns zu einem weiteren Thema, das vielleicht noch rätselhafter ist als »die Freiheit des einen ist die Unfreiheit des andere«: Zwang kann allen einen Zugewinn an Freiheit bringen. Ampeln sind eine einfache, leicht durchsetzbare Regel, die es Verkehrsteilnehmern erlaubt, abwechselnd eine Kreuzung zu durchfahren. Ohne sie käme es zu weit mehr Staus oder Unfällen. Alle stünden schlechter da. Es ist klar, dass der kleine Zwang, den Ampeln ausüben – sie schränken ein, was wir tun können –, das Wohlergehen und in einem gewissen Sinne auch die Handlungsfreiheit aller erhöhen kann.
Eigentumsrechte können Freiheit einschränken oder erweitern
Wir betrachten Eigentumsrechte als etwas derart Selbstverständliches, dass die meisten im Westen sie nicht einmal als »Vorschriften« oder »Einschränkungen« ansehen. Wir nehmen die moralische Legitimität von Eigentum und eines auf Eigentumsrecht basierenden Wirtschaftssystems einfach als gegeben hin. Das System der Eigentumsrechte wird aus Gründen der ökonomischen Effizienz verteidigt. Gäbe es keine Eigentumsrechte, dann hätte niemand einen Anreiz, zu arbeiten oder zu sparen. Die Idee, dass die Erhaltung irgendeiner Form von Eigentum für das Funktionieren einer Gesellschaft von zentraler Bedeutung ist, spiegelt sich in dem achten der Zehn Gebote wider: »Du sollst nicht stehlen.«
Eigentumsrechte sind für andere eine Einschränkung (so wird zum Beispiel ihre Freiheit, mein Eigentum zu verletzen, eingeschränkt); aber es ist eine Einschränkung, die, aufs Ganze gesehen, ein »Freiheitsgewinn« ist, weil sie Menschen mehr Handlungs- und Konsummöglichkeiten gibt. Es herrscht allgemeines Einvernehmen darüber, dass Eigentumsrechte öffentlich durchgesetzt werden sollten. Die kollektive Durchsetzung von Eigentumsrechten bedeutet, dass wir keine riesigen Mengen an Ressourcen aufwenden müssen, um unser Eigentum zu verteidigen.
Wie der wegen seiner (weiter unten behandelten) Diskussion der Frage, auf welche Weise sich die übermäßige Abweidung von Allmenden verhindern lasse, berühmte amerikanische Ökologe Garrett Hardin schrieb: »Wir stellen weder in Abrede, noch bedauern wir es, dass wir dadurch die Freiheit potenzieller Räuber schmälern.« Und weiter: »Als Männer übereinkamen, Gesetze gegen Raub zu erlassen, brachte dies der Menschheit ein Mehr, nicht ein Weniger an Freiheit (…) Sobald sie die Notwendigkeit gegenseitiger Zwangsausübung erkannten, wurden sie frei, andere Ziele zu verfolgen.«17
Aber diese Sichtweise stößt an ihre Grenzen. Eigentumsrechte müssen definiert und zugewiesen werden. Die erhitzten Debatten über die Definition neuer Formen von Eigentum – geistigen Eigentums – zeigen ganz klar, dass Eigentum ein soziales Konstrukt ist, bei dem Trade-offs zwischen mehreren Freiheiten vorgenommen werden. Die Freiheit potenzieller Nutzer des betreffenden Wissens ist eingeschränkt, während die Freiheit des tatsächlichen oder zumindest als solcher angegebenen Erfinders oder Wissensentdeckers gestärkt wird. Kapitel 6 zeigt, dass Eigentumsrechte unterschiedlich definiert werden können und in verschiedenen Ländern auch unterschiedlich definiert werden, sowie die verschiedenen damit verbundenen Trade-offs.
Private Verträge und Gesellschaftsverträge – freiwillig akzeptierte Einschränkungen
Bis jetzt sind wir bei unserer Diskussion von der einfachen Annahme ausgegangen, dass die Auferlegung gewisser Einschränkungen die Handlungsoptionen vieler, der meisten oder sogar aller erweitern kann. Selbstverständlich erlegen sich Menschen im Umgang mit anderen auch selbst Beschränkungen auf. Genau darum geht es in Verträgen. Ich erkläre mich bereit, etwas zu tun oder nicht zu tun (das heißt, ich schränke meine Handlungsfreiheit ein), wenn Sie sich im Gegenzug dazu verpflichten, etwas zu tun oder zu unterlassen. Freiwillig geschlossene Verträge stellen beide Parteien besser. Wenn wir einen Vertrag abschließen, glauben wir, dass die Einschränkung unserer Freiheit in einer gewissen Hinsicht unsere Handlungsoptionen – unsere Freiheiten – in anderer Hinsicht erweitert, die uns mehr bedeutet als die Verluste, die uns durch die Einschränkung auferlegt werden. Tatsächlich ist die Durchsetzung von Verträgen eine der wenigen Aufgaben des Staates, die die politische Rechte anerkennt. Verträge gelten als unverletzlich.
Wie wir sehen werden, fehlt es dieser Auffassung von Verträgen an Nuanciertheit. Die Rechtsordnung bestimmt, welche Verträge durchsetzbar sein sollten und durchgesetzt werden, wann Verträge gebrochen werden dürfen und ob und in welcher Höhe Schadensersatz zu leisten ist, wenn dies geschieht. Es ist schlichtweg nicht wahr, dass ein Vertrag, den zwei aus freien Stücken zustimmende Parteien aus eigenem Willen abschließen, notwendigerweise die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt erhöht. Vielmehr ist es so, dass es die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt steigern kann, die Menge der »zulässigen« Verträge einzuschränken – dies kann sogar die Wohlfahrt jedes Mitglieds der Gesellschaft erhöhen.
Ähnliche Überlegungen können und wurden auf den sogenannten Gesellschaftsvertrag angewandt, der die Beziehungen von Bürgern zueinander und zum Staat definiert – beziehungsweise zum Souverän, wie Thomas Hobbes (1588 – 1679) und John Locke (1632 – 1704), zwei der ersten Philosophen, die sich in ihren Schriften mit Gesellschaftsverträgen befassten, meinten. Es ist nicht so, als würden die Bürger tatsächlich einen Vertrag unterzeichnen (oder als hätten sie dies je getan), der eine Reihe von Verpflichtungen mit sich bringt, wie etwa das Zahlen von Steuern im Gegenzug für eine Reihe von staatlichen Leistungen, zu denen etwa Schutz (vor Verbrechen und äußeren Feinden) gehört. Vielmehr soll uns die Idee eines Gesellschaftsvertrags dabei helfen, über die moralische Legitimität kollektiven Handelns und die Verpflichtungen und Einschränkungen, die damit verbunden sind, nachzudenken – eines freien Tauschgeschäfts, auf den sich die Bürger einer Gesellschaft freiwillig einigen.
Schlüsselprinzipien: weitere traditionelle Sichtweisen
Mill, Friedman und Hayek verfassten ihre Werke, bevor sich die moderne Verhaltensökonomik entwickelte, die erkannt hat, dass Menschen sich ganz anders verhalten, als es in der herrschenden Wirtschaftstheorie behauptet wurde. Sie sind weniger rational, aber auch weniger egoistisch.
Die traditionelle Wirtschaftstheorie, insbesondere die neoliberale Wirtschaftslehre, hat einfach unterstellt, Überzeugungen und auch Präferenzen seien unveränderlich und gegeben, und damit die Möglichkeit geleugnet, dass diese beeinflusst werden können. Aus Sicht der traditionellen Wirtschaftslehre wissen Menschen im Grunde schon gleichsam bei ihrer Geburt, was sie mögen und nicht mögen und wie sie mehr von einem Gut gegen weniger von einem anderen tauschen. Nach der Standardtheorie ändern wir unsere Überzeugungen oder unsere Handlungen (bei konstant gehaltenen Einkommen und Preisen) nur aufgrund besserer Informationen. Tatsächlich aber lassen sich Präferenzen und Überzeugungen oftmals beeinflussen, wie jede Mutter und jeder Vater, jeder, der im Marketing oder in der Werbung arbeitet, und jeder, der eine Desinformations- oder Antidesinformationskampagne führt, ganz genau weiß.18 Bei der Beeinflussung von Überzeugungen und Präferenzen geht es nicht nur darum, mehr und bessere Informationen bereitzustellen; es geht darum, Einstellungen zu verändern. Das ist ein Thema, das sowohl Psychologen als auch Marketingexperten erforschen, für das sich Wirtschaftswissenschaftler, die nicht von ihrem geliebten Modell vollständiger Rationalität mit bereits bei der Geburt feststehenden Präferenzen lassen wollen, jedoch in der Regel nicht interessieren.19





























