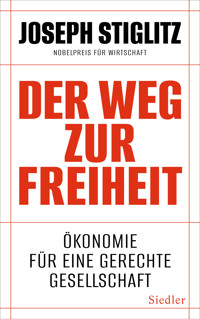21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch der Stunde: Wie kämpfen wir gegen die Auswüchse des Kapitalismus?
Seit dem Crash von 2008 ist es nicht gelungen, den Kapitalismus wirksam zu reformieren. Ganz im Gegenteil, er droht vollends aus dem Ruder zu laufen: Die Finanzindustrie schreibt sich ihre eigenen Regeln; die großen Tech-Firmen beuten unsere persönlichen Daten aus; die Machtballung in der Industrie nimmt zu und der Staat hat seine Kontrollfunktion praktisch aufgegeben. Nobelpreisträger Joseph Stiglitz zeigt, wie es dazu kommen konnte und warum es, was nicht zuletzt das Beispiel Donald Trump zeigt, dringend nötig ist, den Kapitalismus vor sich selbst zu schützen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Seit dem Crash von 2008 ist es nicht gelungen, den Kapitalismus wirksam zu reformieren. Im Gegenteil, er droht vollends aus dem Ruder zu laufen: Die Finanzindustrie schreibt sich ihre eigenen Regeln; die großen Tech-Firmen beuten unsere persönlichen Daten aus; die Machtballung in der Industrie nimmt zu und der Staat hat seine Kontrollfunktion praktisch aufgegeben. Joseph Stiglitz zeigt, wie es dazu kommen konnte und warum es, was nicht zuletzt das Beispiel Donald Trump zeigt, dringend nötig ist, den Kapitalismus vor sich selbst zu schützen.
Der Autor
JOSEPH STIGLITZ, geboren 1943, war Professor für Volkswirtschaft in Yale, Princeton, Oxford und Stanford, bevor er Berater der Clinton-Regierung wurde. Anschließend ging er als Chefvolkswirt zur Weltbank und wurde 2001 mit dem Nobelpreis für Wirtschaft ausgezeichnet. Heute lehrt Stiglitz an der Columbia University in New York und ist ein weltweit geschätzter Experte zu Fragen von Ökonomie, Politik und Gesellschaft. Bei Siedler erschienen unter anderem seine Bestseller »Die Schatten der Globalisierung« (2002), »Die Chancen der Globalisierung« (2006), »Im freien Fall« (2010), »Der Preis der Ungleichheit« (2012) und zuletzt »Reich und Arm« (2015) sowie »Europa spart sich kaputt« (2016).
Joseph E. Stiglitz
Der Preis des Profits
Wir müssen den Kapitalismus vor sich selbst retten!
Aus dem amerikanischen Englisch von Thorsten Schmidt
Siedler
Für meine Enkelkinder.
Und für meine lieben Freunde Tony Atkinson und Jim Mirrlees, die diese Welt viel zu früh verließen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright © 2019 by Joseph E. Stiglitz
Copyright © 2020 für die deutsche Ausgabe by
Siedler Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-26555-7V001
www.siedler-verlag.de
Inhalt
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Vorwort
Teil I
Den Kompass verloren
1. Einleitung
2. Düstere Aussichten
3. Ausbeutung und Marktmacht
4. Der Streit über die Globalisierung in den USA
5. Die Finanzmärkte und die Krise in den USA
6. Die neuen Technologien als Herausforderung
7. Wozu brauchen wir den Staat?
Teil II
Die amerikanische Politik und Wirtschaft erneuern: Was zu tun ist
8. Die Wiederherstellung der Demokratie
9. Die Erneuerung einer dynamischen Wirtschaft
10. Ein menschenwürdiges Leben für alle
11. Rückbesinnung auf die Werte und Ideale Amerikas
Dank
Anmerkungen
Register
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Ich habe dieses Buch vor allem als Reaktion auf beunruhigende Ereignisse in den USA geschrieben. Die wirtschaftlichen und politischen Missstände, die Zunahme der Ungleichheit und der stagnierende Lebensstandard eines Großteils der US-amerikanischen Bevölkerung sind zutiefst beunruhigend. Aber damit nicht genug. Allzu oft zeigt sich bei Großkonzernen ein verstörendes Maß an moralischer Verkommenheit, und dies betrifft keineswegs nur den Finanzsektor. Dies wiederum führte zur Opioid-Krise und trug zu der Diabetes-Epidemie bei Kindern und zur Klimakrise bei. Die zentralen Institutionen unserer Demokratie einschließlich einer freien Presse, einer unabhängigen Justiz und frei forschenden Hochschulen sehen sich heute ständigen Angriffen ausgesetzt. Und da es die USA oftmals gern etwas größer haben und gründlicher machen als andere Länder, ist die Ungleichheit hier größer, die Angriffe auf demokratische und »der Wahrheit verpflichtete« Institutionen sind heftiger und der Kapitalismus ist rücksichtsloser.
Nun ist es aber leider so, dass die USA zwar vorneweg marschieren, aber kein Einzelfall sind. Es gibt beunruhigende Anzeichen dafür, dass sich andere Länder in eine ähnliche Richtung bewegen könnten, dass einige der grundlegenden wirtschaftlichen und politischen Kräfte, welche die Missstände in den USA hervorgebracht haben, weltweit wirksam sind. Aus diesem Grund ist dieses Buch auch für Europa aktuell.
»Der Preis des Profits« macht für die gegenwärtigen Probleme ganz direkt in erster Linie den Neoliberalismus verantwortlich, also die Überzeugung, »der Markt wird es schon richten«. Der Neoliberalismus mit seiner irrationalen Marktgläubigkeit will nicht sehen, was kollektives Handeln – Einzelpersonen und gesellschaftliche Akteure, wenn sie zusammenarbeiten – erreichen kann. Neoliberale Doktrinen, in den USA meist unter dem Oberbegriff »Angebotspolitik« bekannt, haben in den letzten vierzig Jahren die Wirtschaftspolitik überall auf der Welt geprägt, nicht zuletzt beeinflussten sie entscheidend den Ordnungsrahmen der Eurozone. Nicht nur kann man diese Doktrinen für das, was in den USA geschehen ist, verantwortlich machen, sie erklären auch die – zugegeben weniger drastischen – Entwicklungen in Europa allgemein und in Deutschland im Besonderen. Selbst wenn es hier nicht ganz so schlimm gekommen ist, sind die Muster doch ähnlich: geringeres Wirtschaftswachstum, weitgehende Stagnation des Einkommens bei 90 Prozent der Bevölkerung, deutliche Zuwächse nur bei den Spitzenverdienern und ein nichtnachhaltiges Wirtschaftsmodell.
Weiten Teilen der Bevölkerung erging es in Europa deshalb besser – obwohl das BIP-Wachstum geringer und die Arbeitslosigkeit hier höher ist –, weil die »Staatsfeindlichkeit« in Europa nie die gleichen extremen Ausmaße wie in den USA angenommen hat (oder genauer gesagt: nie mit dem gleichen rhetorischen Furor vorgetragen wurde, denn in Wirklichkeit freuten sich die US-Banken natürlich riesig darüber, dass der Staat sie mit Hunderten von Milliarden Dollar vor der Pleite bewahrte, so wie die US-Stahlindustrie die protektionistische Politik Trumps begrüßte, usw.).
Der Markt brachte die tiefe soziale Spaltung in den USA, die Finanz- und die Klimakrise hervor, aber der Markt allein wird keine dieser Krisen bewältigen. Für jene Krise, bei der besonders dringender Handlungsbedarf besteht, gilt: Wenn wir den Planeten retten wollen, müssen wir die Treibhausgasemissionen drastisch reduzieren, und nur der Staat kann einen verbindlichen Ordnungsrahmen setzen, der dies ermöglicht. Hierzu ist es notwendig, ein neues Gleichgewicht zwischen dem Staat, dem Markt und der Zivilgesellschaft – einen neuen Gesellschaftsvertrag – zu schaffen.
Viele Europäer werden in diesem neuen Gesellschaftsvertrag (den ich »progressiven Kapitalismus« nenne) vertraute Elemente erkennen, denn diese Elemente spielten eine zentrale Rolle in dem europäischen »Sozialmodell«, dessen Varianten in einigen Ländern auch »sozialdemokratisches Modell« beziehungsweise »skandinavischer Wohlfahrtsstaat« genannt werden. Leider haben viele Menschen in Europa dieses Modell für selbstverständlich gehalten; im Zuge einschneidender Sparmaßnahmen nach der Eurokrise kam es jedoch in vielen Ländern zu Kürzungen, die dieses Modell untergraben haben. Schlimmer noch, einige Kritiker sahen im europäischen Sozialmodell sogar die Ursache der Eurokrise. Dies ist blanker Unsinn. Weder nahm die Krise ihren Ausgang in den Ländern mit den höchstentwickelten Sozialstaaten, noch wurden diese von ihr am schlimmsten in Mitleidenschaft gezogen. Verursacht wurde die Krise nicht durch einen starken Sozialstaat, sondern durch die Exzesse des Finanzsektors. Die Krise war auch keine Folge einer zu weitgehenden Regulierung – Länder mit einem guten regulatorischen Ordnungsrahmen haben sie viel besser überstanden als jene, die einen Deregulierungskurs eingeschlagen hatten. Aber diese Versuche, den Sozialstaat für die Krise verantwortlich zu machen, haben eines verdeutlicht: Dieselben Sonderinteressen und Ideologien, die zu den Missständen in den USA führten, sind auch in Europa am Werk. Europa darf nicht die Hände in den Schoß legen. Im Gegenteil: Europa muss sein Sozialmodell dringend erneuern und modernisieren. Viele der Ideen, die ich in diesem Buch vorstelle, könnten die Grundlage eines sozialen Wirtschaftsmodells für das Europa des 21. Jahrhunderts bilden.
Ich behaupte in diesem Buch, dass Wachstumsschwäche und Zunahme der Ungleichheit in Wirklichkeit zwei Seiten derselben Medaille sind. Der Neoliberalismus vergaß, dass der Anstieg des Lebensstandards von Erkenntnisfortschritten abhängt, die durch öffentliche Investitionen in die Grundlagenforschung ermöglicht werden. Der Lebensstandard basiert überdies in hohem Maße auf öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur und ins Bildungswesen. Werden die öffentlichen Ausgaben in diesen Bereichen gekürzt, dann macht dies ein Land ärmer. Und der Neoliberalismus hat auch dem Unterschied zwischen den Quellen individuellen und gesamtgesellschaftlichen Wohlstands nicht ausreichend Beachtung geschenkt: Individuen können es dadurch zu Reichtum bringen, dass sie andere übervorteilen oder gar – etwa durch Ausübung von Marktmacht – ausbeuten. Das zunehmende Streben nach leistungslosem Einkommen (rent-seeking) – der Versuch, sich, u. a. durch gezielte Nutzung von Monopolmacht, ein größeres Stück vom nationalen Wirtschaftskuchen anzueignen, statt den Kuchen selbst zu vergrößern – trägt zu niedrigerem Wachstum und größerer Ungleichheit bei.
Daten sprechen dafür, dass es Europa in den letzten Jahren besser gelungen ist, Monopolmacht einzudämmen, als den USA; aber auch hier darf Europa sich nicht selbstzufrieden zurücklehnen. Die Absahner werden nichts unversucht lassen, um sich weiterhin ungestört in die eigene Tasche wirtschaften zu können. Aus diesem Grund parken sie ihr Geld zum Beispiel so gern auf den Kaimaninseln, den Britischen Jungferninseln und in Panama: Dort können sie Steuern vermeiden bzw. hinterziehen und Gesetze umgehen. Und sie werden sich nicht so leicht aus diesen Steuerparadiesen vertreiben lassen.
Einige haben behauptet, mir seien bei meinen Vergleichen zwischen den USA und Europa die Maßstäbe verrückt, meine Kritik an den USA sei jedenfalls überzogen. Die USA stünden wirtschaftlich besser da als Europa. Die USA haben eine niedrigere Arbeitslosigkeit, ein höheres Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und einige der innovativsten Unternehmen der Welt. Da können sie ja wohl nicht alles falsch machen. Und das stimmt natürlich. Die USA haben einige der besten Universitäten der Welt, die von Philanthropen großzügig unterstützt werden, und diese Universitäten bilden die Grundlage der Innovationskraft des Landes. Aber bemerkenswerterweise hat die Regierung Trump einen regelrechten Krieg gegen diese Institutionen vom Zaun gebrochen und ihnen historisch beispiellose Steuern auferlegt.
Aber das BIP pro Kopf oder auch die Arbeitslosenquote sind keine geeigneten Kennzahlen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Ländern. Entscheidend ist der Lebensstandard der meisten Menschen, und während das BIP pro Kopf gestiegen ist, stagniert der Lebensstandard, und die Lebenserwartung ist schockierenderweise sogar rückläufig. Zwar ist die Arbeitslosenquote niedrig, desgleichen aber die Beschäftigungsquote. Eine große Zahl von Arbeitskräften ist wegen des fehlenden Angebots an geeigneten Stellen so frustriert, dass sie gar nicht mehr suchen; viele Amerikaner sind gesundheitlich so stark beeinträchtigt, dass sie keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgehen können; und viele Amerikaner sitzen im Gefängnis.
Wir alle können viel voneinander lernen, sowohl von unseren Erfolgen als auch von unseren Misserfolgen, von unseren Hoffnungen und unseren Enttäuschungen. Der Neoliberalismus hatte sowohl in Europa als auch in den USA negative Auswirkungen. Dennoch haben Manche behauptet, der Neoliberalismus sei alternativlos.
Dieser Behauptung widerspricht dieses Buch in aller Entschiedenheit: Es gibt eine Alternative. Eine andere Gesellschaft ist möglich. Dieses Buch zeigt auf, wie wir sie erbauen können, beginnend mit einem neuen Gesellschaftsvertrag.
Vorwort
Ich wuchs im goldenen Zeitalter des Kapitalismus auf, in Gary, Indiana, am Südufer des Lake Michigan. Damals machte es allerdings keinen so goldenen Eindruck, ich erlebte massive Rassendiskriminierung und Segregation, große Ungleichheit, Arbeitskämpfe und immer wieder Rezessionen. Nicht nur meine Schulkameraden waren davon betroffen, auch das äußere Erscheinungsbild von Gary.
Die Stadt verkörpert wie kaum eine andere die Geschichte der Industrialisierung und Deindustrialisierung in Amerika; sie war 1906 als Standort des größten integrierten Stahlwerks der Welt gegründet und nach dem Gründer und Chairman des Stahlkonzerns US Steel, Elbert H. Gary, benannt worden. Gary war eine typische Firmenstadt. Als ich im Jahr 2015 – noch bevor Trump zur beherrschenden öffentlichen Figur wurde – für das 55-jährige Highschool-Klassentreffen dorthin zurückkehrte, waren die Spannungen spürbar, und dies aus gutem Grund. Die Deindustrialisierung, von der das gesamte Land betroffen war, hatte auch Gary erfasst. Die Stadt zählte jetzt nur noch halb so viele Einwohner wie zu meiner Kindheit. Die Stadt war ausgebrannt. Man drehte hier Hollywoodfilme, die in Kriegszonen oder nach der Apokalypse spielten. Manche Klassenkameraden waren Lehrer geworden, einige wenige auch Ärzte und Juristen und viele von ihnen Sekretärinnen. Doch die bewegendsten Geschichten bei dem Treffen erzählten jene, die nach ihrem Abschluss gehofft hatten, Arbeit in den Stahlwerken zu finden. Aber das Land steckte mal wieder in einer Rezession, und so gingen sie zum Militär, mit der Aussicht auf eine Laufbahn im Polizeidienst. Als ich die Liste derjenigen las, die bereits verstorben waren, und die körperliche Verfassung der anderen sah, zeigte mir dies erneut, wie ungleich Gesundheit und Lebenserwartung in diesem Land verteilt sind. Es kam zu einem Streit zwischen zwei Klassenkameraden, einem ehemaligen Polizisten, der die US-Regierung scharf kritisierte, und einem pensionierten Lehrer, der darauf hinwies, dass die Leistungen aus der Sozialversicherung, etwa auch bei Erwerbsunfähigkeit, auf die der Ex-Polizist angewiesen sei, von ebendieser Regierung kämen.
Wer hätte, als ich 1960 Gary verließ, um am Amherst College in Massachusetts zu studieren, vorhersagen können, welchen Lauf die Geschichte nehmen würde und wie sehr meine Geburtsstadt und die Klassenkameraden davon betroffen sein würden? Die Stadt hatte mich geprägt: Die quälenden Erinnerungen an Ungleichheit und menschliches Leid brachten mich dazu, von der theoretischen Physik, für die ich mich begeistert hatte, auf Volkswirtschaftslehre umzusatteln. Ich wollte verstehen, warum unser Wirtschaftssystem bei so vielen Menschen versagte und was man dagegen tun könne. Aber noch während meines Studiums, das mich besser verstehen ließ, warum Märkte oft nicht gut funktionieren, wurden die Probleme schlimmer. Die Ungleichheit nahm so sehr zu, wie man es sich in meiner Jugend niemals hätte vorstellen können. Jahre später, genauer gesagt1993, als ich in die Regierung von Präsident Clinton eintrat, zuerst als Mitglied und später als Vorsitzender des Wirtschaftswissenschaftlichen Beirats des Präsidenten (Council of Economic Advisers, CEA), rückten diese Probleme gerade erst neu ins Blickfeld; irgendwann Mitte der 1970er- oder Anfang der 1980er-Jahre begann sich die Ungleichheit so übel zu beschleunigen, dass sie 1993 viel höher war als je zuvor in meinem Leben.
Das Studium der Volkswirtschaftslehre hat mich gelehrt, dass die ideologischen Überzeugungen vieler Konservativer falsch sind; ihr beinahe religiöser Glaube an die Macht der Märkte – sie glauben fest daran, dass wir die Steuerung der Wirtschaft weitgehend ungezügelten Märkten überlassen können – entbehrt jeglicher theoretischer und empirischer Grundlage. Die Herausforderung bestand nicht nur darin, andere von dieser Erkenntnis zu überzeugen, sondern auch, Programme und Strategien zu entwickeln, die die gefährliche Zunahme der Ungleichheit und der Destabilisierungsrisiken infolge der Liberalisierung der Finanzmärkte, die in den 1980er-Jahren unter Reagan begonnen hatte, zurückdrehen würden.
Beunruhigenderweise hatte sich der Glaube an die Macht der Märkte in den 1990er-Jahren so weit verbreitet, dass sogar einige meiner Kollegen in der Regierung und schließlich Clinton selbst sich für die Deregulierung der Finanzmärkte einsetzten.1
Schon während meiner Tätigkeit als Berater von Präsident Clinton hatte mich die wachsende Ungleichheit zunehmend beunruhigt, aber erst ab dem Jahr 2000 nahm das Problem wahrhaft erschreckende Ausmaße an. Seit der Zeit vor der Großen Depression haben die reichsten Bürger der USA keinen so hohen Anteil am Volkseinkommen mehr für sich abgeschöpft.2
25 Jahre nach meinem Eintritt in die Regierung Clinton stelle ich mir folgende Fragen: Wie konnte es dazu kommen? Wie geht es weiter? Und was können wir tun, um das Ruder herumzureißen? Ich nähere mich diesen Fragen als Wirtschaftswissenschaftler, und so verwundert es nicht, dass für mich zumindest ein Teil der Antwort darin besteht, dass unsere Wirtschaft mehrfach versagt hat: Wir haben den Wandel von einer Industrie- zu einer Dienstleistungsgesellschaft nicht gut gemeistert, wir haben es nicht geschafft, den Finanzsektor zu bändigen, wir haben die Globalisierung und ihre Folgen nicht aktiv gestaltet und, was am wichtigsten ist, wir haben nicht angemessen auf die wachsende Ungleichheit reagiert und uns stattdessen zu einer Wirtschaft und Demokratie des einen Prozents für das eine Prozent der Bevölkerung entwickelt.3 Meine persönlichen Erfahrungen wie auch meine Forschungen haben mir klargemacht, dass Wirtschaftswissenschaft und Politik sich nicht voneinander trennen lassen, vor allem nicht in den USA, wo Geld eine so entscheidende Rolle im Politikbetrieb spielt. Während also das Buch unsere gegenwärtige Lage hauptsächlich aus der Sicht des Ökonomen analysiert, komme ich nicht umhin, mich auch mit der amerikanischen Politik zu beschäftigen.
Viele Aspekte dieser Diagnose sind mittlerweile allgemein bekannt, etwa die massive Expansion des Finanzsektors, die fehlgesteuerte Globalisierung und die immer größere Macht der Märkte. Ich zeige, wie sie miteinander verzahnt sind, wie dies, im Kontext betrachtet, erklärt, warum das Wachstum so mager ausgefallen ist, und warum selbst die Erträge eines noch so geringen Wachstums so ungleich verteilt sind.
Allerdings begnügt sich dieses Buch nicht mit einer Diagnose, es empfiehlt auch eine Therapie: Maßnahmen, die wir in Zukunft ergreifen können. Dafür muss ich die eigentliche Quelle des Wohlstands der Nationen erklären, wobei ich zwischen der Schaffung von Wohlstand und dem Abschöpfen von Wohlstandsgewinnen unterscheide. Letzteres geschieht immer dann, wenn eine Person anderen durch unterschiedliche Formen von Ausbeutung Wohlstandsgewinne raubt. Die eigentliche Quelle des »Wohlstands einer Nation« liegt in Ersterem, in der Kreativität und Produktivität der Menschen dieser Nation und ihrem fruchtbaren Austausch miteinander. Er basiert auf Fortschritten der Wissenschaften, die uns lehren, wie wir die verborgenen Wahrheiten der Natur ergründen und sie für technologische Innovationen nutzen können. Außerdem beruht er darauf, dass wir durch vernunftgeleiteten Diskurs bessere Formen der sozialen Organisation entwickeln, was wiederum zu Prinzipien wie jenen führt, die uns als »Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und ordnungsgemäße Verfahren« bekannt sind. Ich präsentiere die Eckpunkte einer progressiven Agenda, die das genaue Gegenteil der Agenda Donald Trumps und seiner Unterstützer darstellt. Sie kombiniert in gewisser Weise die Programme von Theodore Roosevelt und Franklin Delano Roosevelt und aktualisiert sie für das 21. Jahrhundert. Mein zentrales Argument lautet, dass die Umsetzung dieser Reformen das Wirtschaftswachstum beschleunigen und breiten Wohlstand für alle bringen wird, sodass der Lebensstandard, nach dem die meisten Amerikaner streben, kein Luftschloss bleibt, sondern ein erreichbares Ziel wird. Kurzum, wenn wir die Quellen des Wohlstands einer Nation wirklich verstehen, können wir eine größere wirtschaftliche Dynamik und zugleich mehr Wohlstand für alle schaffen. Hierzu muss der Staat eine andere, vermutlich größere Rolle spielen als heute: Wir dürfen in unserer komplexen Welt des 21. Jahrhunderts nicht vor notwendigen staatlichen Eingriffen zurückschrecken. Ich zeige auch, dass es eine ganze Reihe erstaunlich kostengünstiger politischer Maßnahmen gibt, die den Aufstieg in die Mittelschicht – was zur Mitte des letzten Jahrhunderts den meisten Amerikanern zum Greifen nahe erschien, jetzt aber zusehends unerreichbar ist – wieder zur Norm statt zur Ausnahme machen können.
Reagonomics, Trumponomics und der Angriff auf die Demokratie
Unsere heutige Situation erinnert unwillkürlich an jene Zeit vor 40 Jahren, als die Rechte schon einmal einen Triumph feierte. Auch damals schien es sich um eine weltweite Bewegung zu handeln: Ronald Reagan in den USA, Margaret Thatcher in Großbritannien. Die keynesianische Wirtschaftspolitik, die auf der Annahme beruht, der Staat könne Vollbeschäftigung aufrechterhalten, indem er die Nachfrage steuert (über die Geld- und Fiskalpolitik), wurde von einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik abgelöst, die ihrerseits voraussetzt, Deregulierung und Steuersenkungen würden die wirtschaftlichen Produktivkräfte entfesseln und geeignete Anreize schaffen, um so das Angebot an Gütern und Dienstleistungen und in der Folge auch das Einkommen der Privatpersonen zu steigern.
Déjà-vu: Voodoo Economics
Eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik brachte schon unter Reagan nicht die erhofften Ergebnisse, und sie wird auch unter Trump scheitern. Die Republikaner reden sich selbst und dem amerikanischen Volk ein, die Trump’schen Steuersenkungen würden die Konjunktur anschieben, und zwar so sehr, dass die Steuerausfälle geringer sein werden als von den Skeptikern behauptet. So argumentieren die Verfechter einer angebotsorientierten Politik, aber wir sollten mittlerweile wissen, dass diese nichts bringt. Die Reagan’sche Steuersenkung im Jahr 1981 leitete eine Ära gigantischer Haushaltsdefizite, schwächeren Wachstums und größerer Ungleichheit ein. Mit seiner Steuerreform von 2017 verabreicht uns Trump eine noch größere Dosis an politischen Maßnahmen, die statt auf wissenschaftlichen Erkenntnissen auf eigennützigem Aberglauben beruhen, als dies bei Reagan der Fall war. Präsident George H. W. Bush nannte die Reagan’sche angebotsorientierte Wirtschaftspolitik Voodoo Economics (sinngemäß »fauler Zauber«). Trumps Neuaufguss ist Voodoo Economics hoch zwei.
Einige der Unterstützer Trumps geben zu, dass seine Politik alles andere als perfekt sei, aber sie verteidigen ihn damit, dass er zumindest denjenigen Aufmerksamkeit schenke, die lange Zeit nicht beachtet worden sind, er ihnen die Würde zurückgebe und den Respekt erweise, Gehör zu finden. Ich würde es anders ausdrücken: Er ist so raffiniert gewesen, die verbreitete Unzufriedenheit zu erkennen, den Unmut weiter anzufachen und skrupellos auszunutzen. Er ist bereit, das Leben der amerikanischen Mittelschicht zu verschlimmern und 13 Millionen Amerikanern den Krankenversicherungsschutz wegzunehmen – in einem Land, in dem schon jetzt die Lebenserwartung sinkt –, und das zeigt, dass er sie nicht respektiert, sondern verachtet. Obendrein gewährt er den Reichen Steuervergünstigungen, während er die Steuern für die meisten Angehörigen der Mittelschicht erhöht.4
Für diejenigen, die Ronald Reagans Regierungszeit miterlebt haben, zeigen sich bemerkenswerte Ähnlichkeiten. Wie Trump nutzte auch er Furcht und Ressentiments aus: Er prägte den Begriff der »Welfare Queen« (sinngemäß: Sozialhilfe-Abzockerin), die hart arbeitende Amerikaner um ihr wohlverdientes Geld bringe. Die unterschwellige Botschaft war klar, denn gemeint waren natürlich in erster Linie Afroamerikanerinnen. Auch er zeigte keinerlei Mitgefühl mit den Armen. Senf und Ketchup als die beiden »Gemüsesorten« hinzustellen, die man für nahrhafte Schulessen benötige, hätte als guter Witz durchgehen können, wäre es nicht so traurig gewesen. Er war ein Heuchler, dessen Lippenbekenntnis zur freien Marktwirtschaft mit weitreichenden protektionistischen Maßnahmen verbunden war. Seine Heuchelei zeigte sich auch in Euphemismen wie »freiwillige Exportbeschränkungen«: Japan konnte wählen, entweder seine Exporte selbst zu drosseln oder sie gedrosselt zu bekommen. Es ist kein Zufall, dass der von Trump ernannte Handelsbeauftragte Robert Lighthizer vor 40 Jahren als stellvertretender US-Handelsbeauftragter unter Reagan in die Lehre ging.
Reagan und Trump teilen auch den unverblümten Willen, Konzerninteressen zu dienen, in einigen Fällen sogar denselben Interessen. Reagan verscherbelte unsere Bodenschätze, indem er den Ölkonzernen erlaubte, sich die riesigen Erdölvorkommen des Landes für einen Bruchteil ihres Werts unter den Nagel zu reißen. Trump kam mit dem Versprechen an die Macht, »den Sumpf trockenzulegen« und so denjenigen eine Stimme zu geben, die glaubten, Washingtons Machtelite habe sie lange Zeit schlichtweg ignoriert. Aber seit seinem Amtsantritt ist der Sumpf schlammiger denn je zuvor.
Ungeachtet all dieser Gemeinsamkeiten gibt es jedoch einige tief greifende Unterschiede, die zu einem Zerwürfnis mit einigen der grauen Eminenzen der Republikaner führten. Reagan hatte sich selbstverständlich mit loyalen Parteigängern umgeben, aber ihm standen auch mehrere hervorragende Staatsdiener in Schlüsselpositionen zur Seite, wie etwa George Shultz (als Außenminister, nachdem er unter Nixon Finanzminister gewesen war.)5 Für solche Leute zählten Vernunft und Wahrheit, sie sahen etwa den Klimawandel als eine existenzielle Bedrohung an und glaubten an Amerikas Position als globale Führungsmacht. Ihnen wäre es, wie Mitgliedern aller Regierungen davor und danach, peinlich gewesen, bei einer unverblümten Lüge ertappt zu werden. Wenn sie auch hin und wieder versuchten, die Wahrheit zu beschönigen, bedeutete sie ihnen doch etwas. Beim gegenwärtigen Bewohner des Weißen Hauses und den Menschen in seinem Umfeld ist das anders.
Reagan hatte wenigstens die Fassade von Vernunft und Logik aufrechterhalten. Seinen Steuersenkungen lag eine Theorie zugrunde, die bereits erwähnte angebotsorientierte Wirtschaftstheorie, doch sie ist 40 Jahre später endgültig widerlegt. Trump und die Republikaner des 21. Jahrhunderts brauchten nicht mal mehr eine Theorie: Sie haben die Steuern gesenkt, weil sie es konnten.
Diese Geringschätzung von Wahrheit, Wissenschaft, Erkenntnis und Demokratie unterscheidet die Regierung Trump und ähnlicher Staats- und Regierungschefs anderswo von Reagan und anderen konservativen Bewegungen der Vergangenheit. Wie ich darlegen werde, ist Trump in mancherlei Hinsicht eher ein Revolutionär als ein Konservativer. Auch wenn wir vielleicht die Gründe verstehen, warum seine verqueren Ideen bei so vielen Amerikanern Widerhall finden, macht sie das nicht ansprechender oder weniger gefährlich.
Die Trump’sche »Steuerreform« von 2017 veranschaulicht, wie weit sich das Land von früheren Traditionen und Normen entfernt hat. Eine Steuerreform ist normalerweise mit Vereinfachungen und dem Schließen von Schlupflöchern verbunden, sie stellt sicher, dass die Lasten fair geteilt werden und das Steueraufkommen ausreicht, um die laufenden Staatsausgaben zu finanzieren. Selbst Reagan zielte 1986 auf eine Vereinfachung ab. Dagegen hat das Steuergesetz von 2017 alles noch komplizierter gemacht und die meisten klaffenden Schlupflöcher beibehalten, etwa dass Mitarbeiter von Private-Equity-Fonds maximal 20 Prozent Einkommensteuer zahlen, während gewöhnliche amerikanische Arbeitnehmer fast doppelt so viel berappen müssen.6 Es schaffte die Mindeststeuer ab, die sicherstellen sollte, dass Privatpersonen und Unternehmen Steuerschlupflöcher nicht übermäßig ausnutzen und wenigstens einen minimalen Prozentsatz ihres Einkommens als Steuern zahlen.
Man hat nicht einmal mehr vorgegeben, das Defizit zu senken; die einzige Frage war, um wie viel es steigen würde. Ende 2018 wurde geschätzt, dass die Regierung 2019 eine Rekordsumme von über einer Billion Dollar an Krediten aufnehmen müsste.7 Das ist selbst in Prozent des BIP ein Rekord zu einer Zeit, in der sich das Land weder im Krieg noch in einer Rezession befindet. Da sich die Wirtschaft der Vollbeschäftigung nähert, sind die Defizite eindeutig kontraproduktiv: Die US-Notenbank muss die Zinsen anheben, was Investitionen und Wachstum negativ beeinflusst; dennoch hat lediglich ein Republikaner (Senator Rand Paul aus Kentucky) mehr als nur zaghaft protestiert. Außerhalb des amerikanischen Politikbetriebs hagelte es jedoch Kritik. Selbst der Internationale Währungsfonds, dem es für gewöhnlich widerstrebt, die USA zu kritisieren, da deren Stimme dort lange Zeit tonangebend gewesen ist, hat sich eindeutig zur unverantwortlichen Haushaltspolitik der USA geäußert.8 Politische Beobachter waren sprachlos angesichts des Ausmaßes an Heuchelei – als es nach der Krise von 2008 tatsächlich eines Konjunkturprogramms bedurfte, eines fiskalisches Impulses, hatten die Republikaner die Meinung vertreten, das Land könne sich ein solches nicht leisten, denn es würde zu untragbar hohen Defiziten führen.
Die Trump’sche Steuerreform war das Produkt eines tiefen politischen Zynismus. Selbst die Almosen, die dieser von den Republikanern ausgeheckte Plan gewöhnlichen Bürgern gewährte – geringfügige Steuersenkungen für die nächsten Jahre –, waren zeitlich befristet. Die Parteistrategie schien auf zwei Annahmen zu beruhen, die ein Armutszeugnis für dieses Land darstellen, sollten sie zutreffen: dass einfache Bürger so kurzsichtig sind, dass sie sich auf die jetzigen geringfügigen Steuersenkungen konzentrieren und deren zeitliche Befristung sowie die Tatsache, dass die meisten Angehörigen der Mittelschicht mehr Steuern zahlen müssen, einfach ausblenden; und dass das, was in der amerikanischen Demokratie wirklich zählt, Geld ist. Die Devise schien zu sein: »Sorge dafür, dass die Reichen zufrieden sind, und sie werden die Republikanische Partei mit Spendengeldern überhäufen, mit denen die benötigten Stimmen gekauft werden können, um mit dieser Politik weiterzumachen.« Diese Reform zeigte, wie weit sich Amerika vom Idealismus seiner Gründungszeit entfernt hatte.
Auch die unverfrorenen Versuche, Wähler davon abzuhalten, ihr Stimmrecht auszuüben, die hemmungslose Manipulation von Wahlkreisgrenzen und das Unterminieren der Demokratie heben diese Regierung von ihren Vorgängerinnen ab. All das geschah zwar auch schon in der Vergangenheit, aber noch nie mit einer solchen Skrupellosigkeit, Raffinesse und Unverblümtheit.
Was vielleicht am wichtigsten ist: In der Vergangenheit hatten sich führende Politiker beider Parteien bemüht, das Land zu einen. Schließlich hatten sie geschworen, die Verfassung zu achten, die mit den Worten beginnt: »Wir, das Volk …« Sie fühlten sich trotz allem dem Gemeinwohl verpflichtet. Trump jedoch nutzt Spaltungen gezielt aus und verstärkt sie.
Das zivilisierte Benehmen, welches für das gedeihliche Miteinander in jeder Gesellschaft unabdingbar ist, ist ebenso auf der Strecke geblieben wie der mindeste Anstand – ob in Wort oder Tat.
Selbstverständlich sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den USA und weltweit heute andere als vor 40 Jahren. Damals begann die Deindustrialisierung gerade erst, und wenn Reagan und seine Nachfolger die richtige Politik gemacht hätten, wäre das industrielle Hinterland der USA vielleicht nicht so verödet, wie es heute ist. Wir standen auch noch am Anfang der »Großen Spaltung«, der sich immer weiter öffnenden Schere zwischen dem einen Prozent der Superreichen und dem Rest der Bevölkerung. Man hatte uns gelehrt, die Ungleichheit sinke, sobald ein Land ein gewisses Entwicklungsstadium erreicht habe – und Amerika hatte diese Theorie bestätigt.9 In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ging es allen gesellschaftlichen Gruppen wirtschaftlich besser, aber die Einkommen der Geringverdiener stiegen schneller als diejenigen der Topverdiener. Wir waren die größte Mittelstandsgesellschaft, die die Welt je gesehen hatte. Als 2016 gewählt wurde, hatte die Ungleichheit jedoch ein Ausmaß erreicht, wie man es seit dem Vergoldeten Zeitalter am Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr gesehen hatte.
Sieht man sich an, wo das Land heute steht und wo es vor vier Jahrzehnten stand, wird deutlich, dass, so verfehlt und wirkungslos Reagans Politik gewesen sein mag, die »Trumponomics« den heutigen Rahmenbedingungen noch weniger gerecht wird. Wir hätten schon damals nicht mehr in die scheinbar idyllische Ära der Regierung Eisenhower zurückkehren können; der Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft war in vollem Gange. Heute, 40 Jahre später, scheinen solche Bestrebungen bar jeglichen Realitätsbezugs zu sein.
Der demografische Wandel in den USA hat diejenigen, die sich nach dieser »glorreichen« Vergangenheit sehnen – von deren Wohlstand große Gruppen wie etwa Frauen und Farbige ausgeschlossen blieben –, in ein demokratisches Dilemma gestürzt. Nicht nur werden Nichtweiße schon bald die Mehrheit in diesem Land stellen, hinzu kommt, dass sich die Welt und die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts nicht mit einer von Männern dominierten Gesellschaft vereinbaren lassen. Zudem haben unsere Ballungsgebiete, ob im Norden oder Süden der USA, in denen eine Mehrheit der Amerikaner lebt, den Wert der Diversität zu schätzen gelernt. Die Bewohner dieser dynamischen Wachstumsregionen haben auch erkannt, wie wichtig Kooperation ist und dass der Staat eine bedeutende Rolle spielt, wenn Wohlstand allen zugutekommen soll. Sie haben die alten Zöpfe, manchmal fast über Nacht, abgeschnitten. Gehen solche Veränderungen vonstatten, kann die Minderheit in einer demokratischen Gesellschaft – ob es sich um Konzerne handelt, die Verbraucher übervorteilen, Banken, die Kreditnehmer schröpfen wollen, oder um Vergangenheitsnostalgiker, die eine untergegangene Welt wieder auferstehen lassen wollen – ihre wirtschaftliche und politische Vorherrschaft nur dadurch aufrechterhalten, dass sie auf die eine oder andere Weise demokratische Prozesse unterdrückt.
So muss es nicht sein – dass die USA ein reiches Land sind mit so vielen Armen, mit so vielen Menschen, die nur mit Mühe über die Runden kommen. Zwar gibt es Kräfte – etwa den technologischen Wandel und die Globalisierung –, welche die Ungleichheit erhöhen, doch die sehr unterschiedlichen Ausprägungen in verschiedenen Ländern zeigen, dass politische Maßnahmen eine wichtige Rolle spielen. Ungleichheit ist gewollt. Sie ist nicht unvermeidlich. Aber wenn wir unseren gegenwärtigen Kurs nicht ändern, wird die Ungleichheit wahrscheinlich zunehmen, und das Wirtschaftswachstum wird wohl auf dem gegenwärtigen niedrigen Niveau verharren – was seinerseits einigermaßen rätselhaft ist, wo wir doch angeblich die innovativste Volkswirtschaft in der innovativsten Ära der Weltgeschichte sind.
Trump hat keinen Plan, um das Land voranzubringen; sein Plan sorgt dafür, dass die Superreichen die Mehrheit der Bevölkerung weiterhin ausplündern können. Dieses Buch zeigt, dass Trumps Agenda und die der Republikanischen Partei vermutlich sämtliche Probleme, mit denen unsere Gesellschaft konfrontiert ist, verschlimmern werden – sie werden die wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Spaltung verschärfen, die Lebenserwartung weiter verringern, die Lage der Staatsfinanzen weiter verschlechtern und das Land in eine neue Ära immer niedrigeren Wachstums führen.
An vielen Problemen unseres Landes ist Trump nicht schuld, aber er hat sie verschärft: Spaltungen waren da und warteten nur darauf, von einem Demagogen instrumentalisiert zu werden. Hätte Trump nicht die Bühne betreten, wäre in ein paar Jahren ein anderer Demagoge dahergekommen. Weltweit gibt es mehr als genug davon – Le Pen in Frankreich, Morawiecki in Polen, Orbán in Ungarn, Erdoğan in der Türkei, Duterte auf den Philippinen und Bolsonaro in Brasilien. Auch wenn man diese Demagogen nicht über einen Kamm scheren kann, ist ihnen allen doch eine Geringschätzung der Demokratie (Orbán erläuterte sogar stolz die Vorzüge einer illiberalen Demokratie) mit ihrer Rechtsstaatlichkeit, freien Medien und unabhängigen Justiz gemeinsam. Sie alle glauben an »starke Männer« – an sich selbst – und treiben einen Personenkult, der in den meisten anderen Ländern der Welt aus der Mode gekommen ist. Und sie machen Fremde für die Probleme ihrer Länder verantwortlich; sie sind nativistische Nationalisten, überzeugt von der angeborenen Überlegenheit ihrer Völker. Diese Generation von Autokraten und Möchtegern-Autokraten zeichnet sich durch eine gewisse Grobschlächtigkeit, teils auch unverhohlene Intoleranz und Frauenfeindlichkeit aus.
Auch andere fortgeschrittene Staaten haben mit den meisten erwähnten Problemen zu kämpfen; aber wie wir sehen werden, sind die USA sozusagen mit negativem Beispiel vorangegangen: Die Ungleichheit ist hier größer, das Gesundheitssystem schlechter und die Spaltung stärker als in anderen Ländern der Welt. Trump gemahnt uns daran, was passieren kann, wenn man diese Wunden allzu lange schwären lässt.
Um dem Populismus das Wasser abzugraben, muss man konkret sagen, wie man es besser machen würde. Das gilt auch für die Wirtschaftspolitik: Um von einem schlechten Plan wegzukommen, muss man zeigen, dass es eine Alternative gibt. Selbst abgesehen vom gegenwärtigen Debakel benötigen wir eine Alternative zu dem Modell, das sich die USA und viele andere Länder in den vergangenen drei Jahrzehnten zu eigen gemacht haben. In diesem Gesellschaftsmodell steht die Wirtschaft im Zentrum, und die Wirtschaft wird durch die Linse »freier« Märkte betrachtet. Das Modell gibt vor, auf einem fortschrittlichen Verständnis von Märkten zu beruhen, in Wahrheit aber verhält es sich genau umgekehrt: Neue wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse der letzten 70 Jahre haben die Grenzen freier Märkte aufgezeigt. Selbstverständlich hätte jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht, dies selbst sehen können: Phasenweise erhöhte, manchmal massive Arbeitslosigkeit, wie in der Großen Depression der 1930er-Jahre, und eine an manchen Orten so hohe Umweltverschmutzung, dass man die Luft förmlich nicht mehr atmen konnte, waren nur die beiden offenkundigsten »Beweise«, dass sich selbst überlassene Märkte nicht unbedingt gut funktionieren.
Ich werde in diesem Buch vor allem darlegen, was die eigentlichen Quellen des Wohlstands einer Nation sind und wie wir sicherstellen können, dass die Erträge einer revitalisierten Wirtschaft gerecht verteilt werden.
Ich stelle eine Alternative zu den politischen Programmen Reagans einerseits und Trumps andererseits vor, eine Agenda, die auf den Erkenntnissen der modernen Volkswirtschaftslehre beruht und meiner Überzeugung nach zu einem »Wohlstand für alle« führen wird. Dabei werde ich erklären, warum der Neoliberalismus, also der Glaube an unregulierte Märkte, scheiterte und warum die Trumponomics, dieses seltsam verquere »Programm«, das niedrige Steuern für die Reichen, eine Deregulierung der Finanzmärkte sowie die Absenkung von Umweltschutzstandards mit Nativismus und Protektionismus – einem hochgradig regulierten Globalisierungsregime – verbindet, ebenfalls scheitern wird.
Doch zuvor werde ich die modernen wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnisse, auf denen ein Großteil dieser Agenda beruht, kurz rekapitulieren.10
Erstens: Märkte erzeugen von sich aus keinen nachhaltigen Wohlstand für alle. Märkte sind für jede gut funktionierende Volkswirtschaft überaus wichtig, und dennoch produzieren sie oft keine fairen und effizienten Ergebnisse, sondern zu viel von gewissen Dingen (etwa Umweltverschmutzung) und zu wenig von anderen (etwa Grundlagenforschung). Und wie die Finanzkrise von 2008 zeigte, sind Märkte von sich aus auch nicht stabil. Vor über 80 Jahren lieferte John Maynard Keynes eine Erklärung dafür, warum Marktwirtschaften oftmals unter anhaltender Arbeitslosigkeit leiden, und er lehrte uns, wie der Staat dauerhaft für Vollbeschäftigung oder wenigstens annähernde Vollbeschäftigung sorgen könne.
Wenn die sozialen Erträge einer wirtschaftlichen Tätigkeit – ihr gesamtgesellschaftlicher Nutzen – und ihre privaten Erträge – der Nutzen für eine Person oder ein Unternehmen – weit auseinanderklaffen, können Märkte allein nicht für Abhilfe sorgen. Der Klimawandel ist hier das Beispiel par excellence: Die globalen sozialen Kosten von Kohlenstoffemissionen sind immens – überhöhte Treibhausgasemissionen stellen eine existenzielle Bedrohung für den Planeten dar – und übersteigen bei Weitem die Kosten, die sämtliche Unternehmen oder auch Länder tragen. Die Kohlenstoffemissionen müssen entweder durch gesetzliche Vorschriften oder durch Bepreisung gesenkt werden.
Auch bei unvollständiger Information und wenn wichtige Märkte nicht existieren (zum Beispiel um bedeutende Risiken wie etwa das der Arbeitslosigkeit zu versichern), funktionieren Volkswirtschaften nicht gut, ebenso bei eingeschränktem Wettbewerb. Diese »Marktunvollkommenheiten« sind weitverbreitet und in gewissen Bereichen wie etwa dem Finanzsektor besonders schädlich. Und daher produzieren Märkte auch nicht genug von sogenannten öffentlichen Gütern wie Brandschutz oder nationale Verteidigung – Güter, die für die gesamte Bevölkerung von Nutzen sind und sich nur schwer anders als durch Steuern finanzieren lassen. Um die Wirtschaft leistungsfähiger zu machen, den allgemeinen Wohlstand zu erhöhen und die Bürger besser gegen Risiken abzusichern, muss der Staat Geld ausgeben – zum Beispiel um eine bessere Arbeitslosenversicherung bereitzustellen oder Grundlagenforschung zu finanzieren –, und er muss durch Regulierung dafür sorgen, dass Menschen andere nicht schädigen. Kapitalistische Volkswirtschaften haben somit von jeher private Märkte mit staatlichen Eingriffen verbunden – die Frage lautet nicht Märkte oder Staat, sondern wie man beide so miteinander kombiniert, dass der größte Nutzen entsteht. Bezüglich dieses Buchs bedeutet dies, dass es staatlichen Handelns bedarf, um eine effiziente und stabile, dynamisch wachsende Wirtschaft zu schaffen und sicherzustellen, dass deren Erträge fair verteilt werden.
Zweitens müssen wir anerkennen, dass der Wohlstand einer Nation auf zwei Säulen ruht. Staaten werden wohlhabender – erreichen einen höheren Lebensstandard –, indem sie produktiver werden, und Produktivitätssteigerungen sind vorrangig auf wissenschaftliche Erkenntnisfortschritte zurückzuführen. Der technologische Fortschritt basiert darauf, neue Erkenntnisse der öffentlich finanzierten Grundlagenforschung anzuwenden. Und der Wohlstand von Nationen steigt infolge der guten Gesamtorganisation einer Gesellschaft, die Menschen erlaubt, sich miteinander auszutauschen, Handel zu treiben und rechtssicher Investitionen zu tätigen. Eine gute gesellschaftliche Organisation ergibt sich aus jahrzehntelanger Reflexion und Diskussion, empirischer Beobachtungen dessen, was sich bewährt hat und was nicht. Dabei hat sich gezeigt, wie wichtig eine demokratische Ordnung mit Rechtsstaatlichkeit, ordnungsgemäßen Verfahren, Gewaltenteilung und einer Vielzahl von Institutionen ist, die daran mitwirken, die Wahrheit aufzudecken, einzuordnen und zu verbreiten.
Drittens darf der Wohlstand einer Nation nicht mit dem bestimmter Einzelpersonen in diesem Land verwechselt werden. Manche Unternehmer feiern mit neuen Produkten, die sich Verbraucher wünschen, Triumphe. Dies ist der gute Weg, um reich zu werden. Andere sind erfolgreich, indem sie ihre Marktmacht nutzen, um Verbraucher oder ihre Mitarbeiter auszubeuten. Dies ist nichts anderes als eine Einkommensumverteilung, es erhöht nicht den Wohlstand des Landes insgesamt. Der wirtschaftswissenschaftliche Fachbegriff dafür lautet »Rente« – beim Streben nach solchen Renten (Rent-Seeking) versucht man, sich ein großes Stück vom wirtschaftlichen Kuchen eines Landes zu sichern. Bei der Schaffung von Wohlstand geht es hingegen darum, den Kuchen größer zu machen. Politische Entscheidungsträger sollten gezielt in jeden Markt eingreifen, auf dem überhöhte Renten abgeschöpft werden können, weil sie damit signalisieren, dass die Wirtschaft effizienter funktionieren könnte: Die Ausbeutung, die überhöhten Renten innewohnt, schwächt die Wirtschaft. Wenn Rent-Seeking erfolgreich bekämpft wird, werden Ressourcen umgeleitet und produktiv genutzt, um Wohlstand zu schaffen.
Viertens, je geringer die soziale Spaltung und Ungleichheit in einer Gesellschaft sind, umso größer ist ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Besonders schädlich sind Ungleichheiten, basierend auf Rasse, Geschlecht und ethnischer Zugehörigkeit. Dies ist eine deutliche Veränderung gegenüber der bisher in der Volkswirtschaftslehre vorherrschenden Auffassung, wonach es einen Zielkonflikt gebe, also mehr Gleichheit notwendigerweise Wachstum und Effizienz beeinträchtige. Die Ungleichheit zu verringern erweist sich dann als besonders vorteilhaft, wenn diese jene extremen Ausmaße erreicht wie in den USA und etwa durch Ausnutzung von Marktmacht oder Diskriminierung entsteht. Das Ziel einer erhöhten Einkommensgleichheit ist daher nicht mit Kosten verbunden.
Wir müssen uns auch von dem Irrglauben an die trickle-down economics verabschieden, also der Vorstellung, dass alle Menschen gleichermaßen von Wirtschaftswachstum profitierten. Diese Annahme lag der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik republikanischer Präsidenten seit Ronald Reagan zugrunde. Dabei zeigen die Daten ganz klar, dass die Wohlfahrtsgewinne durch Wachstum nicht einfach »nach unten durchsickern«. Denken Sie nur an die großen Teile der Bevölkerung in den USA und anderen Industrieländern, die wütend und verzweifelt sind, weil infolge der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik ihre Einkommen jahrzehntelang weitgehend stagnierten, obwohl das BIP gestiegen ist. Märkte helfen von sich aus diesen Menschen nicht unbedingt, staatliche Programme hingegen können hier durchaus etwas ausrichten.
Fünftens müssen sich staatliche Programme, die Wohlstand für alle erreichen wollen, sowohl auf die Verteilung von Markteinkommen – auch »Prädistribution« genannt – als auch auf Umverteilung konzentrieren, also die Einkommen der Bürger nach Steuern und Transferleistungen. Märkte existieren nicht in einem Vakuum; sie müssen strukturiert werden, und wie wir sie strukturieren, wirkt sich sowohl auf die Verteilung des Markteinkommens als auch auf Wachstum und Effizienz aus. Daher führen Gesetze, die es Unternehmen erlauben, ihre Monopolmacht zu missbrauchen oder überhöhte Boni an ihre Topmanager zu zahlen, die wiederum einen Großteil des Unternehmensgewinns aufzehren, zu mehr Ungleichheit und weniger Wachstum. Mehr soziale Gerechtigkeit erfordert Chancengleichheit, die ihrerseits größere Einkommens- und Vermögensgleichheit erfordert. Vorteile werden immer bis zu einem gewissen Grad über Generationen hinweg weitergegeben, sodass übermäßige Einkommens- und Vermögensungleichheiten in einer Generation zu hohen Ungleichheiten in der nächsten führen. Bildung ist ein Teil der Lösung, aber eben nur ein Teil. In den Vereinigten Staaten sind die Bildungschancen ungleicher verteilt als in vielen anderen Ländern, und bessere Bildung für alle könnte die Ungleichheit verringern und das Wirtschaftswachstum steigern. Die gegenwärtigen, extrem niedrigen Erbschaftssteuern verstärken die Effekte ungleicher Bildungschancen und schaffen so in den Vereinigten Staaten eine Erbplutokratie.
Sechstens: Da die Spielregeln und so viele andere Aspekte unserer Wirtschaft und Gesellschaft vom Staat festgelegt werden, kommt es entscheidend darauf an, was dieser tut; Politik und Wirtschaft können nicht voneinander getrennt werden. Aber wirtschaftliche Ungleichheit schlägt sich zwangsläufig in politischer Macht nieder, und wer diese besitzt, nutzt sie, um sich Vorteile zu verschaffen. Wenn wir die Regeln unseres Politikbetriebs nicht reformieren, führen wir unsere Demokratie ad absurdum, weil dann immer öfter nicht mehr die Bürger, sondern Dollar die Wahlen entscheiden. Wenn wir als Gesellschaft ein effektives System der Gewaltenteilung anstreben, das potenzielle Missbräuche durch die Superreichen verhindert, müssen wir für eine größere Vermögens- und Einkommensgleichheit sorgen.
Siebtens prägt das Wirtschaftssystem, auf das wir seit Anfang der 1970er-Jahre zugesteuert haben – der Kapitalismus US-amerikanischer Spielart –, unsere individuelle und nationale Identität auf eine negative Art und Weise. Was sich heute abzeichnet, widerspricht unseren höheren Werten – die Habgier, der Egoismus, die moralische Verkommenheit, die Bereitschaft, andere auszubeuten, und die Unehrlichkeit, die die Große Rezession von 2009 im Finanzsektor enthüllte, all das zeigt sich nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in anderen Ländern. Die Normen, die festlegen, was wir als akzeptables oder inakzeptables Verhalten ansehen, haben sich in einer Weise verändert, die den sozialen Zusammenhalt, das Vertrauen und auch die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft untergräbt.
Achtens: Obwohl Trump und Nativisten weltweit anderen – etwa Migranten und schlecht verhandelten Handelsabkommen – die Schuld an der Misere und insbesondere der misslichen Lage derjenigen geben, die unter den Folgen der Deindustrialisierung leiden, haben wir es uns selbst zuzuschreiben: Wir hätten den Prozess des technologischen Wandels und die Globalisierung besser steuern können, sodass die meisten derjenigen, die arbeitslos wurden, schnell wieder neue Stellen gefunden hätten. In Zukunft müssen wir es besser machen, und ich werde darlegen, wie wir dies tun können. Isolationismus ist allerdings keine Option. Wir leben in einer hochvernetzten Welt und müssen daher unsere internationalen – wirtschaftlichen und politischen – Beziehungen besser gestalten als in der Vergangenheit.
Wir müssen, neuntens, eine umfassende wirtschaftspolitische Agenda für Wachstum und geteilten Wohlstand auf den Weg bringen. Dazu müssen Wachstums- und Gleichheitshindernisse beseitigt werden, wie etwa übermäßige Marktmacht von Konzernen, und ein ausgewogenes Kräfteverhältnis wiederhergestellt werden, zum Beispiel indem die Verhandlungsmacht von Arbeitnehmern gestärkt wird. Es bedeutet auch, mehr Geld für die Grundlagenforschung bereitzustellen und der Privatwirtschaft mehr Anreize zu geben, echten Wohlstand zu schaffen, statt nur in die eigene Tasche zu wirtschaften.
Die Wirtschaft ist selbstverständlich ein Mittel zum Zweck, kein Selbstzweck. Und eine gesicherte bürgerliche Existenz, die den Amerikanern in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg selbstverständlich erschien, wird für immer mehr von ihnen immer unerreichbarer. Wir sind heute ein viel reicheres Land als damals. Wir können es uns leisten, dafür zu sorgen, dass die allermeisten Amerikaner wieder so leben können. Dieses Buch wird zeigen, wie wir das erreichen können.
Es ist an der Zeit für grundlegende Veränderungen. Eine Strategie der kleinen Schritte – geringfügige Korrekturen an unserem politischen und Wirtschaftssystem – ist unzureichend für die anstehenden Aufgaben. Wir brauchen einschneidende Veränderungen, wie sie in diesem Buch gefordert werden. Aber keine dieser wirtschaftlichen Änderungen wird ohne eine starke Demokratie, die die politische Macht der Vermögenskonzentration ausgleicht, erreichbar sein. Also brauchen wir vor diesen wirtschaftlichen Reformen eine politische Reform.
TEIL I
Den Kompass verloren
»Und wenn ein Haus mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen.«
Markus 3, 25; Abraham Lincoln
1. Einleitung
Dass es in den USA und vielen anderen Industriestaaten nicht besonders gut läuft, ist noch gelinde ausgedrückt. Im ganzen Land herrscht weitverbreiteter Unmut.
Den in den letzten 25 Jahren vorherrschenden wirtschafts- und politikwissenschaftlichen Theorien zufolge war das nicht zu erwarten. Nach dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 verkündete Francis Fukuyama Das Ende der Geschichte, da Demokratie und Kapitalismus schließlich triumphiert hätten. Eine neue Ära globalen Wohlstands mit höherem Wirtschaftswachstum denn je zuvor stünde jetzt bevor, und Amerika würde dabei die Führung übernehmen.1
Im Jahr 2018 scheint von diesen hochfliegenden Ideen nichts mehr übrig zu sein. Die Finanzkrise von 2008 zeigte, dass der Kapitalismus die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllte – er schien weder effizient noch stabil zu sein. An einer Fülle von Statistiken ließ sich ablesen, dass die Superreichen am meisten vom Wachstum der letzten 25 Jahre profitiert hatten. Und schließlich weckten Abstimmungen, bei denen Anti-Establishment-Positionen eine Mehrheit erhielten – der Brexit in Großbritannien und die Wahl von Donald Trump in den Vereinigten Staaten –, Zweifel an der politischen Urteilsfähigkeit vieler Wähler in Demokratien.
Unsere Experten haben eine einfache Erklärung dafür geliefert, die richtig, aber nicht erschöpfend ist. Die Eliten haben die Nöte allzu vieler Amerikaner ignoriert, als sie sich für Globalisierung und Liberalisierung – auch der Finanzmärkte – starkmachten und versprachen, diese »Reformen« würden allen nützen. Die versprochenen Vorteile sind jedoch für die meisten Bürger ausgeblieben. Die Globalisierung hat die Deindustrialisierung beschleunigt, weshalb viele Menschen, insbesondere die Geringerqualifizierten und unter diesen vor allem die Männer, den Anschluss verloren haben. Die Finanzmarktliberalisierung bescherte uns die Finanzkrise von2008, die schwerste Rezession seit der Großen Depression, die 1929 begann. Doch während zig Millionen Menschen weltweit arbeitslos wurden und Millionen von Amerikanern ihr Eigenheim verloren, wurde kein einziger der Topbanker, die die Weltwirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs geführt hatten, zur Rechenschaft gezogen. Niemand saß eine Gefängnisstrafe ab, vielmehr wurden sie mit Megaprämien belohnt. Die Banken wurden gerettet, nicht aber diejenigen, die ihnen zum Opfer gefallen waren. Auch wenn es mithilfe wirtschaftspolitischer Maßnahmen gelang, eine zweite Große Depression abzuwenden, ist es nicht weiter verwunderlich, dass diese unausgewogene Rettungsstrategie politische Konsequenzen hatte.2
Es war womöglich ein fataler politischer Fehler, als Hillary Clinton die Menschen in den deindustrialisierten Regionen der USA, die ihren Gegenkandidaten unterstützten, »erbärmliche Geschöpfe« nannte (diese Aussage war selbst erbärmlich): Die Betreffenden empfanden es als Ausdruck der typischen Arroganz der Eliten. Eine Reihe von Büchern wie etwa J. D. Vances Hillbilly Elegie. Die Geschichte meiner Familie und einer Gesellschaft in der Krise3 und Arlie Hochschilds Fremd in ihrem Land. Eine Reise ins Herz der amerikanischen Rechten4 dokumentierte die Gefühle derjenigen, die die Deindustrialisierung und ihre Folgen am eigenen Leib erlebt hatten, und der vielen anderen, die ihren Unmut teilten, und bezeugte die wachsende Entfremdung zwischen ihnen und den Eliten des Landes.5
Einer der Slogans von Bill Clinton im Präsidentschaftswahlkampf 1992 lautete: »It’s the economy, stupid!« (sinngemäß: Allein die Wirtschaft zählt). Das ist eine übermäßige Vereinfachung, und die oben genannten Studien erhellen die Gründe: Menschen wollen Anerkennung, sie möchten das Gefühl haben, dass man ihnen Gehör schenkt.6 Nachdem sie über 30 Jahre lang von den Republikanern belehrt worden sind, dass der Staat keine Probleme lösen könne, erwarten die Menschen auch nicht mehr, dass er ihre löst. Aber sie erwarten, dass ihre Regierung »für sie eintritt« – was auch immer das bedeutet. Und wenn sie dies tut, dann wollen sie nicht, dass die Regierung sie als »die Abgehängten« bezeichnet. Das ist herabwürdigend. Sie haben schwierige Entscheidungen in einer ungerechten Welt getroffen. Sie wollen, dass einige der Ungerechtigkeiten beseitigt werden. Aber in der Krise von2008, die durch die den Interessen der Elite dienende Finanzmarktliberalisierung verursacht wurde, schien die Regierung nur für die Eliten einzutreten. Das zumindest war das Narrativ, das schließlich allgemein geglaubt wurde, und wie ich deutlich machen werde, enthält es mehr als ein Körnchen Wahrheit.7
Auch wenn der Slogan von Präsident Clinton, es komme allein auf die Wirtschaft an, eine allzu holzschnittartige Vereinfachung gewesen sein mag, ist er prinzipiell doch zutreffend. Große Bevölkerungsgruppen in den USA haben von der wirtschaftlichen Entwicklung nicht profitiert. Ganz anders die Reichen, die enorme Vermögenszuwächse verzeichneten. Tatsächlich ist diese wachsende Kluft verantwortlich für die gegenwärtige missliche Lage in den USA und in vielen anderen Industrieländern.
Selbstverständlich hat nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Politik versagt. Unsere wirtschaftliche Spaltung führte zu einer politischen Spaltung, welche wiederum die wirtschaftliche Spaltung verstärkte. Die Wohlhabenden und Mächtigen haben ihre politische Macht genutzt, um die wirtschaftlichen und politischen Spielregeln in einer Weise festzuschreiben, die ihre Privilegien absichert. In den Vereinigten Staaten gibt es eine sehr kleine Elite, die einen immer größeren Teil der Wirtschaft kontrolliert, und eine große und wachsende Gruppe von weitgehend mittellosen Menschen am Fuß der Einkommens- und Vermögenspyramide8 – 40 Prozent der Amerikaner können keine 400 Dollar für Notfälle ausgeben, ob für die ärztliche Behandlung eines erkrankten Kindes oder für die Reparatur eines Autos.9 Das Gesamtvermögen der drei reichsten Amerikaner, Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft) und Warren Buffett (Berkshire Hathaway), übersteigt das der unteren 50 Prozent der US-Bevölkerung zusammengenommen. Dies zeigt, wie viel Vermögen an der Spitze der Pyramide konzentriert und wie wenig an der Basis zu finden ist.10
Buffett, der legendäre milliardenschwere Investor, hatte recht, als er sagte: »Es gibt einen Klassenkampf, aber es ist meine Klasse, die der Reichen, die diesen Kampf angezettelt hat und die ihn gewinnt.«11 Er wollte den Kampf damit nicht befeuern; vielmehr hielt er die Aussage für eine zutreffende Beschreibung der Situation in den Vereinigten Staaten. Und er stellte auch klar, dass es seines Erachtens nicht in Ordnung, ja sogar unamerikanisch sei.
Die USA waren von Anfang an eine repräsentative Demokratie, und die Gründerväter wollten verhindern, dass die Mehrheit die Minderheit unterdrücken kann. Aus diesem Grund verankerten sie in der Verfassung eine Reihe von Schutzklauseln, darunter auch Beschränkungen staatlicher Machtausübung.12 Im Lauf der mehr als 200 Jahre, die seither vergangen sind, hat sich die Lage jedoch verändert. Heute gibt es in den USA eine politische Minderheit, die, wenngleich sie die Mehrheit nicht offen unterdrückt, diese doch zumindest beherrscht und daran hindert, im Interesse des gesamten Landes zu handeln. Eine große Mehrheit der Wähler ist für ein schärferes Waffengesetz, einen höheren Mindestlohn, eine strengere Finanzmarktregulierung und einen besseren Zugang zu Gesundheitsversorgung und Hochschulbildung, ohne dass man sich dafür hoch verschulden muss. Eine Mehrheit der Amerikaner stimmte für Al Gore, nicht für George Bush, für Hillary Clinton, nicht für Donald Trump. Eine Mehrheit hat bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus für die Demokraten gestimmt, dennoch haben die Republikaner in der Regel, teils indem sie Wahlbezirke manipulierten, die Mehrheit der Abgeordneten gestellt – im Jahr 2018 haben die Demokraten dann endlich wieder mit einem eindeutigen Wahlergebnis das Repräsentantenhaus unter ihre Kontrolle gebracht. Eine überwältigende Mehrheit von Amerikanern stimmte für Senatoren der Demokraten. Und dennoch kontrollieren die Republikaner, weil weniger bevölkerte Bundesstaaten wie Wyoming gleich viele Senatoren entsenden wie die bevölkerungsreichsten Bundesstaaten, New York und Kalifornien, weiterhin den Senat, der eine so wichtige Rolle spielt, weil er zum Beispiel die Ernennung von Richtern am Obersten Gerichtshof bestätigen muss.13 Bedauerlicherweise ist Letzterer heute kein unparteiischer Schiedsrichter und Ausleger der Verfassung mehr, sondern schlichtweg zu einem weiteren parteipolitischen Schlachtfeld geworden. Unsere verfassungsrechtlichen Garantien haben für die Mehrheit nichts gebracht, da heute eine Minderheit das Sagen hat.
Die Folgen dieser ökonomischen und politischen Verwerfungen gehen weit über den wirtschaftlichen Bereich hinaus: Sie wirken sich auf die Natur unserer Gesellschaft und unsere nationale Identität aus. Eine wirtschaftliche und politische Ordnung, die sich durch einseitige Interessenbegünstigung, Egoismus und Kurzsichtigkeit auszeichnet, bringt emotionalisierte, egoistische und kurzsichtige Menschen hervor, die ihrerseits die Schwächen in unserem wirtschaftlichen und politischen System verstärken.14 Die Finanzkrise von 2008 und ihre Folgen haben offenbart, dass viele unserer Banker unter dem leiden, was man nur als moralische Verkommenheit bezeichnen kann, denn wie anders sollte man ihre Unehrlichkeit und ihre Bereitschaft, die Schwachen auszunehmen, nennen? Dieses Fehlverhalten ist umso erstaunlicher in einem Land, dessen politischer Diskurs seit Jahrzehnten ganz im Zeichen von »Werten« steht.
Um zu verstehen, wie wir wieder Wachstum »für alle« schaffen können, müssen wir zunächst die eigentlichen Quellen des Wohlstands unserer Nation – beziehungsweise jeder Nation – verstehen. Es sind die Produktivität, Kreativität und Vitalität der Menschen eines Landes; der große naturwissenschaftliche und technische Fortschritt in den letzten 250 Jahren und die Verbesserungen in der wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Organisation, die im gleichen Zeitraum gemacht wurden, wie zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit, gut regulierte Wettbewerbsmärkte, demokratische Institutionen mit Gewaltenteilung und eine breite Palette »die Wahrheit vermittelnder« Institutionen. Basierend auf diesen Fortschritten konnte der Lebensstandard im Lauf der letzten 200 Jahre so enorm steigen.
Das nächste Kapitel beschreibt jedoch zwei beunruhigende Entwicklungen der letzten 40 Jahre, auf die ich bereits hingewiesen habe: Das Wachstum hat sich verlangsamt, und die Einkommen weiter Teile der Bevölkerung blieben gleich oder sind sogar zurückgegangen. Zwischen den Reichen und dem Rest hat sich eine große Kluft aufgetan.
Es genügt nicht, den Entwicklungspfad unserer Wirtschaft und Gesellschaft nachzuzeichnen. Wir müssen die Macht der Ideen und Interessen, die uns in den letzten 40 Jahren so weit vom Kurs abbrachten, besser verstehen und herausfinden, warum sie bei so vielen so gut ankamen und warum sie grundlegend falsch sind. Dass man es Vertretern von Konzerninteressen überließ, die wirtschaftliche und politische Agenda zu diktieren, hat zu einer stärkeren Konzentration wirtschaftlicher und politischer Macht geführt, und dieser Prozess wird weitergehen. Nur wenn wir verstehen, warum unser Wirtschafts- und unser politisches System uns enttäuscht haben, können wir zeigen, dass eine andere Welt möglich ist.
Das ist die hoffnungsvolle Botschaft: Es gibt – wirtschaftlich, wenn auch nicht politisch – leicht umsetzbare Reformen, die zu mehr Wohlstand für alle führen könnten. Wir können ein Wirtschaftssystem schaffen, das mehr mit weithin geteilten Grundwerten in Einklang steht – höheren Werten, zu denen sich unsere politischen, ökonomischen und religiösen Führungspersönlichkeiten bekennen –, sodass es nicht mehr von habgierigen und unredlichen Bankern ausgenutzt werden kann. Eine solche Wirtschaftsordnung wird uns prägen – sie wird uns als Menschen und als Gesellschaft näher an unsere Ideale heranführen. Und so werden wir eine humanere Wirtschaft gestalten können, die den allermeisten Bürgern wieder jenes typische »Mittelschicht«-Leben zugänglich macht, nach dem sie streben, das jedoch zunehmend unerreichbar geworden ist.
Der Wohlstand der Nationen
Adam Smiths berühmtes Buch von1776,Der Wohlstand der Nationen, ist ein guter Ausgangspunkt, um zu verstehen, wie Nationen gedeihen. Es gilt weithin als das Werk, das die moderne Volkswirtschaftslehre begründete. Smith kritisierte zu Recht den Merkantilismus, jene wirtschaftliche Denkschule, die in Europa während der Renaissance und im frühen Industriezeitalter vorherrschte. Merkantilisten plädierten dafür, möglichst viele Güter zu exportieren, um so an Gold zu kommen; sie glaubten, dies würde den Reichtum ihrer Volkswirtschaften erhöhen und die politische Macht ihrer Nationen steigern. Heute mögen wir über diese naiven Vorstellungen schmunzeln: Gold in einer Schatzkammer zu horten sorgt nicht für einen höheren Lebensstandard. Dabei ist ein ähnlicher Irrglaube auch heute weitverbreitet – insbesondere unter denjenigen, die behaupten, ein Land müsse mehr aus- als einführen, und dieses Ziel mit entsprechenden verfehlten politischen Maßnahmen zu erreichen versuchen.
Der wahre Wohlstand einer Nation bemisst sich danach, inwieweit sie in nachhaltiger Weise einen hohen Lebensstandard für all ihre Bürger gewährleisten kann. Dies wiederum hat mit nachhaltigen Produktivitätssteigerungen zu tun, die teils auf Investitionen in Sachanlagen, aber hauptsächlich in Wissen und in der Aufrechterhaltung der Vollbeschäftigung basieren. Denn dies stellt sicher, dass die verfügbaren Ressourcen nicht vergeudet werden beziehungsweise einfach ungenutzt bleiben. Der Wohlstand einer Nation hat jedenfalls nichts, aber auch gar nichts mit der bloßen Anhäufung von Finanzvermögen oder Gold zu tun. Ich werde sogar zeigen, dass die Fokussierung auf Finanzvermögen kontraproduktiv gewesen ist – sein Anwachsen ging auf Kosten des eigentlichen Wohlstands des Landes, was zum Teil erklärt, warum sich das Wachstum in dieser Ära der massiven Expansion des Finanzsektors verlangsamte.
Smith, der zu Beginn der industriellen Revolution schrieb, konnte nicht absehen, was heutzutage den wirklichen Wohlstand von Nationen hervorbringt. Das vergleichsweise hohe Wohlstandsniveau in Großbritannien zur damaligen Zeit und im nachfolgenden Jahrhundert verdankte sich größtenteils der Ausbeutung seiner Kolonien. Smith konzentrierte sich jedoch weder auf Exporte noch auf die Ausbeutung von Kolonien, sondern auf die Rolle von Industrie und Handel. Er wies darauf hin, dass große Märkte die Spezialisierung förderten.15 Das waren wichtige Erkenntnisse, aber auf die Grundlagen des Wohlstands in einer modernen Volkswirtschaft ging er nicht ein: Er befasste sich nicht mit Forschung und Entwicklung oder dem Erwerb neuen Know-hows aufgrund praktischer Erfahrungen – von Wirtschaftswissenschaftlern »Learning by Doing« (Lernen durch Handeln) genannt.16 Das hatte einen einfachen Grund: Technische und Wissensfortschritte spielten in der Wirtschaft des 18. Jahrhunderts nur eine geringe Rolle.
Zu Smiths Zeiten stagnierte der Lebensstandard bereits seit Jahrhunderten.17 Bald nach ihm vertrat der Ökonom Thomas Robert Malthus die Auffassung, eine wachsende Bevölkerung werde die Löhne auf Subsistenzniveau halten. Falls die Löhne jemals darüber anstiegen, würde die Bevölkerung wachsen und den Lohn wieder auf Subsistenzniveau drücken. Ein steigender Lebensstandard wäre demnach schlichtweg ausgeschlossen. Malthus sollte sich gründlich irren.
Die Aufklärung und ihre Folgen
Smith war Teil einer großen intellektuellen Bewegung im späten 18. Jahrhundert, der sogenannten Aufklärung, die oft mit der naturwissenschaftlichen Revolution in Verbindung gebracht wird. Sie beruhte auf Bewegungen, die in den vorangehenden Jahrhunderten aufgekommen waren, beginnend mit der protestantischen Reformation. Vor der Reformation im 16. Jahrhundert, ursprünglich von Martin Luther angestoßen, war die Wahrheit etwas, was geoffenbart, von Autoritäten verfügt wurde. Die Reformation stellte die Autorität der (katholischen) Kirche infrage, und in einem 30-jährigen Krieg, der um 1618 begann, kämpften die Europäer (auch) darum, welche der beiden Konfessionen fortan auf dem Kontinent vorherrschen sollte.
Diese Autoritäten zu hinterfragen zwang Gesellschaften dazu, folgende Fragen zu stellen und zu beantworten: Woher kennen wir die Wahrheit? Wie können wir die Welt um uns herum erkennen? Und wie können und sollten wir unsere Gesellschaft organisieren?
Es entstand eine neue Epistemologie, die sich neben der geistigen Welt auch auf sämtliche Aspekte des Lebens erstreckte: insbesondere auf die Naturwissenschaft mit ihrem System von Vertrauen durch Überprüfung, wo jeder Fortschritt auf früheren Erkenntnissen, die von vorhergehenden Wissenschaftlern gewonnen wurden, basiert.18 Im Lauf der Jahre entstanden Universitäten und andere Forschungsinstitutionen, die uns halfen, Wahres von Falschem zu scheiden und die Natur unserer Welt zu erkennen. Viele der Dinge, die wir heute als selbstverständlich erachten – von Elektrizität über Transistoren und Computer bis hin zu Smartphones, Lasern und moderner Medizin –, sind das Ergebnis wissenschaftlicher Entdeckungen, die auf Grundlagenforschung beruhen. Und dabei geht es nicht nur um Hightech-Fortschritte: Selbst unsere Straßen und unsere Gebäude beruhen auf naturwissenschaftlichen Fortschritten; ohne sie könnten wir keine Wolkenkratzer, keine Autobahnen und keine moderne Stadt bauen.
Ohne eine königliche oder kirchliche Autorität, die diktierte, wie die Gesellschaft organisiert werden sollte, musste die Gesellschaft selbst darüber entscheiden. Man konnte sich nicht mehr auf – irdische oder himmlische – Autoritäten stützen, um sicherzustellen, dass alles gut lief oder zumindest bestmöglich. Es mussten Regierungssysteme geschaffen werden. Die sozialen Institutionen zu entwerfen, die das Wohlergehen einer Gesellschaft sicherstellen sollten, war schwieriger, als die Gesetzmäßigkeiten der Natur zu entdecken. Im Allgemeinen ließen sich keine kontrollierten Experimente durchführen. Das eingehende Studium vergangener Erfahrungen jedoch konnte aufschlussreich sein. Dabei musste man sich auf logisches Denken und rationales Argumentieren stützen – und berücksichtigen, dass kein Einzelner für sich beanspruchen kann, das Rezept für die optimale Organisation der Gesellschaft zu besitzen. Aus dieser Überlegung folgte die Wertschätzung von Rechtsstaatlichkeit, ordnungsgemäßen Verfahren und Systemen der Gewaltenteilung, die getragen wurden von Grundwerten wie allgemeiner Gerechtigkeit und individueller Freiheit.19
Unser Regierungssystem, dem sehr daran gelegen ist, alle Menschen gerecht zu behandeln, erfordert es, die Wahrheit zu ermitteln.20 Systeme guter Regierungsführung erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass gute und gerechte Entscheidungen getroffen werden. Sie sind vielleicht nicht perfekt, aber sie werden eher korrigiert, wenn sie fehlerhaft sind.
Im Lauf der Zeit sind vielfältige Institutionen entstanden, deren hauptsächlicher Zweck darin besteht, die Wahrheit zu entdecken, zu überprüfen und zu verbreiten, und wir verdanken ihnen einen Großteil des Erfolgs unserer Wirtschaft und unserer Demokratie.21 Eminent wichtig sind dabei engagierte Medien. Wie alle Institutionen sind auch sie fehlbar; aber ihre Recherchen gehören zum Gesamtsystem der gegenseitigen Kontrolle in unserer Gesellschaft, und sie stellen ein wichtiges öffentliches Gut bereit.
Der naturwissenschaftlich-technische Fortschritt sowie mit der Aufklärung verbundene Veränderungen der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Organisation führten zu einem Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Produktion, der das Bevölkerungswachstum weit übertraf, sodass das Pro-Kopf-Einkommen zu steigen begann.22 Die Gesellschaft lernte, das Bevölkerungswachstum einzudämmen, und in den Industrieländern entschieden sich immer mehr Menschen dafür, die Familiengröße zu begrenzen, insbesondere als der Lebensstandard zunahm. Der malthusianische Fluch war gebrochen worden. Und so begannen der enorme Anstieg des Lebensstandards während der letzten 250 Jahre (dargestellt in Abbildung 1: nachdem der Lebensstandard jahrhundertelang weitgehend stagniert hatte, begann er sich rasch zu erhöhen, zunächst – gegen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts – in Europa, aber dann auch in anderen Teilen der Welt, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg23) und die Zunahme der Lebenserwartung, von der wir so enorm profitiert haben.24 Es war eine dramatische Schicksalswende für die Menschen. Während sie in der Vergangenheit Tag für Tag von morgens bis abends schuften mussten, um ihren lebensnotwendigen Bedarf zu decken, genügten dafür jetzt ein paar Stunden Arbeit pro Woche.25
Im 19. Jahrhundert waren die Früchte dieses Fortschritts allerdings sehr ungleich verteilt.26 Für viele schienen sich die Lebensumstände sogar zu verschlechtern. Thomas Hobbes hatte es über 100 Jahre früher so formuliert: »[…] das Leben des Menschen ist […] armselig, widerwärtig, vertiert und kurz« – und die industrielle Revolution schien die Verhältnisse sogar noch zu verschlimmern.27 Die Romane von Charles Dickens schilderten höchst einprägsam das Elend breiter englischer Bevölkerungsgruppen zur Mitte des 19. Jahrhunderts.
Abbildung 1: Entwicklung des Lebensstandards