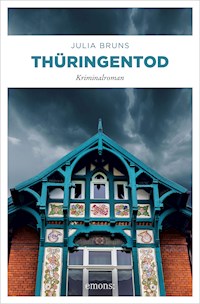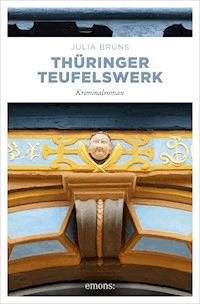9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Krimi
- Serie: Seniorenkrimi
- Sprache: Deutsch
Cosy Crime im Altenheim Das Leben im Seniorenheim ist langweilig. Helmut wusste das vorher, aber seine Frau Margot schwört im Alter auf drei geregelte Mahlzeiten, einen Wäscheservice und einen Fitnessraum. Seinen Einwand, dass eine JVA die gleichen Vorzüge bietet, überhört sie großzügig. Nun teilt sich Helmut mit Gerhard eine Flasche Bier, sucht in Séancen Kontakt zu verstorbenen Haustieren und berät Hannelore bei der Vorbereitung ihres Begräbnisses. Bis zu dem Tag, an dem Küchenhilfe Selma mit einer Fleischgabel in der Nase tot aufgefunden wird. Endlich kommt Leben in die Bude und Helmut läuft zu Hochform auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Vollkommen gegen seinen Willen, allerdings auf ausdrücklichen Wunsch seiner Frau Margot, ist Helmut mit ihr in einer Seniorenresidenz gelandet. Abendessen um 17 Uhr, erzwungene Gruppenbeschäftigung und regelmäßige Zählappelle erinnern ihn aber eher an ein Gefängnis als an eine »reizende Residenz«, wie seine Frau das Ganze gern bezeichnet. Auch seine greisen Tischnachbarn, Margots geschwätzige neue Freundin Hannelore und das nervtötend freundliche Personal gehen ihm gehörig auf den Geist.
Doch eines Tages kommt Leben in die Bude – mit einer Leiche. Als Kriminalhauptkommissar a. D. ist Helmut nun endlich wieder im Spiel – diese Gelegenheit kann er sich unmöglich entgehen lassen …
Von Julia Bruns sind bei dtv außerdem erschienen: Die Rache der Weihnachtsgurke Der Weihnachtsgurkenfluch Tote brauchen keinen Strandkorb Donnerstag ist Schnitzeltag
Julia Bruns
DIE LANGEWEILE STIRBT ZULETZT
Band 1 Ein Seniorenkrimi
Seniorenheime sind nur etwas für alte Leute. Das wusste ich vorher, aber Margot muss sich immer durchsetzen. Das ist bei ihr eine Manie. Das war schon so, als sie noch jung war. Damals sah sie nett aus und ich habe sie auf ein Eis eingeladen. Heute würde ich das auch noch tun, aber sie sagt, die Kälte und ihre Magenschleimhäute vertragen sich nicht. Abgesehen davon macht sie auf Anraten ihrer Freundin Hannelore eine dieser neumodischen Zuckerdiäten. Angeblich ist das gut für die Zähne. Wie natürlich Hannelore dahingehend aufgestellt ist, weiß ich nicht. Aber Margot kaut auf Keramik. Ich muss es wissen, ich habe die Leisten bezahlt. Jedenfalls findet Margot neuerdings immer einen Grund, wieso irgendetwas nicht geht, also alles, was außerhalb unserer Meldeadresse stattfindet. Es ist, als ob sie sich nicht mehr mit mir vor die Tür traut. Mich nervt das. Ich würde gern mal etwas erleben, und wenn es nur zwei Kugeln Eis in einem Waffelbecher sind. Margot sagt, mir wird hier genug geboten und meine negative Einstellung ist das Problem. Die Tatsachen sprechen dagegen, aber die überzeugen Margot nicht. Sie hat ihre eigene Linie und die hält sie konsequent. Das war schon immer so.
Meine erste Verabredung mit ihr lief eigentlich ganz passabel. Ich wollte mal sehen, wie weit ich komme. Margot wollte heiraten. Unsere Messinghochzeit ist nun zwei Wochen her. Fünfundvierzig Jahre plus vierzehn Tage. Margot kriegt eben immer, was sie will. Auch zwei Plätze in einem Seniorenheim.
Nun hocken wir hier. Ich denke, irgendwo muss man ja wohnen. Und Margot spricht nur noch von »meiner ganz reizenden Residenz«. Derartige Wörter hat sie für unser Reihenhäuschen niemals verwendet. Dreißig Jahre lang nicht. Dabei war das nicht nur abbezahlt, sondern ich habe auch noch jede Mode, die Margot gefallen hat, mitgemacht, sogar die Sache mit dem seniorengerechten Toilettenbecken inklusive Haltegriffen. Das hatte sie sich zum sechzigsten Geburtstag gewünscht. Deswegen jedenfalls hätten wir nicht ausziehen müssen. Wegen der geschwollenen Anrede auch nicht. Hier nennen sie uns »unsere lieben Gäste«, heben die Stimme und betonen dabei die Vokale, als hätten sie es mit ein paar lernbehinderten Grundschülern zu tun. Tatsächlich komme ich mir oft so vor. Margot sagt, sie wollte sich schon immer wie eine feine Dame fühlen und in unserer Siedlung wäre das niemals gegangen. Ich habe noch nie gehört, dass man dafür in ein Seniorenheim gehen muss.
Zwei erwachsene Menschen, einundzwanzig Quadratmeter, vier Mahlzeiten am Tag inklusive Wäscheservice. Wenn wir es wünschen, kommt sogar jemand, der uns die Fußnägel schneidet. Margot wünscht das so häufig, dass ich mich frage, ob ihre Zehen überhaupt noch Nägel haben. Ich kriege das alles noch prima allein geregelt. Abgesehen davon muss wenigstens einer auf das Geld achten. Der Laden hier ist verdammt teuer, auch ohne den Extraservice. Margot sagt, man muss sich einfach auch mal was gönnen. Diese Rechnung allerdings geht nur dann auf, wenn wir beide das fünfundachtzigste Lebensjahr nicht überschreiten. Oder einer von uns vorher ins Gras beißt.
Sollte es mich treffen, kann Margot zwar hierbleiben, aber sie muss auf die Sparversion umbuchen. Das mit der Fußpflege und dem ganzen anderen Schnickschnack kann sie dann vergessen. Doch das behalte ich lieber für mich. Seitdem wir hier sind, ist Margot aufgedreht genug. Sie kriegt sich überhaupt nicht darüber ein, wie toll sie das alles findet. Ich wiederum sehe keinen Unterschied zwischen dem Heim hier und einer Justizvollzugsanstalt, außer dass Letztere deutlich günstiger für die Insassen ist. Und etwas Sinnvolles zu tun haben die da drin meistens auch, wenn man nichts gegen Kugelschreiber zusammenstecken und Schrauben abzählen hat.
Ich hingegen spiele Schach, etwa sechs Stunden täglich, quasi auf Teilzeitbasis. Mein Gegner ist mein alter Freund Herbert Grusche. Wir waren fast dreißig Jahre zusammen im Schachverein. Dann musste Herbert ins Krankenhaus und ich ins Seniorenheim. Anfangs war ich fast ein bisschen neidisch auf ihn. Mit seiner Beerdigung hat sich das gegeben. Trotzdem spielt er immer noch besser als ich. Margot meint, es ist schon schlimm genug, dass ich mit einem Toten rede, dann könnte ich ihm nicht auch noch gram sein, nur, weil er der bessere Spieler ist. Ich hingegen finde, wenigstens jetzt könnte mich Herbert ab und zu mal gewinnen lassen. Aber womöglich hat sie recht. Im Alter sollte man die Dinge gelassener sehen.
Ich gebe mir Mühe damit. Wirklich. Dabei ist mir allerdings nicht ganz klar, wie weit ich noch an meinen persönlichen Grenzen schrauben muss. Nehmen wir zum Beispiel das Abendessen. Früher haben Margot und ich gegen sieben gegessen, etwas Brot, Aufschnitt, ein, zwei Flaschen Bier. Wenn etwas Besonderes anstand, hat sie auch mal ein Ei in die Pfanne gehauen oder ein paar Würstchen heiß gemacht. Wir haben dann ein wenig geplaudert, also Margot, denn die war den halben Tag zu Hause und bekam einwandfrei mit, was die Nachbarn so trieben. Mein Büroalltag war dagegen so harmlos wie ein Kindergeburtstag. Ich war bei der Kripo im Range eines Kriminalhauptkommissars. Heute klebt da ein a. D. dran. Mir war während meiner aktiven Dienstzeit nicht bewusst, wie sehr man zwei lumpige Buchstaben hassen kann. Aus der jetzigen Perspektive spielt der Beruf, den man einmal hatte, keine Rolle mehr. Wenn mich heute jemand fragt: Ich bin Pensionär. Das ist für mich nichts weiter als ein unpersönlicher Sammelbegriff, aber ich muss ja relaxter werden, verlangt zumindest Margot. Abgesehen davon fragt einen mit Anfang siebzig auch kein Mensch mehr, was man beruflich macht. Eigentlich schade, denn irgendwie bleibt man doch immer, was man ist. Margot sagt, das seien nur meine Hirngespinste. Sie war halbtags bei der Post, doch heute würde sie lieber nackt herumlaufen, als noch einmal etwas Gelbes anzuziehen. Noch dazu würde sie nicht einmal mehr eine Einkaufstüte über die Straße tragen wollen. Das scheitert schon daran, dass sie ohnehin nicht rausgeht. Aber wie gesagt, mit Logik brauche ich ihr nicht kommen.
Ich habe meine Arbeit immer gemocht. Margot erzählt jedem, dass sie beim nächsten Mal nie wieder einen Polizisten heiraten würde. Sie meint, der Beruf sei undankbar. Ich kann das nicht nachvollziehen. Immerhin leben wir bis heute gut davon, Margot noch mehr als ich. Sie wollte unbedingt in diese Residenz. Zudem frage ich mich, für wie gut sie die Chancen auf eine zweite Heirat hält, und vor allem auf welcher Basis? Wir sind beide im gleichen Alter, und selbst wenn man die Statistik heranzieht, was Margot niemals tun würde, fällt das kaum ins Gewicht.
Trotz meiner Jahresringe bin ich gut in Form. Lediglich der Gebrauch einer Schusswaffe könnte eventuell problematisch werden. Die Augen spielen dabei noch hervorragend mit, wenn ich meine Brille schnell genug finde. Meine Hände machen mir da eher Sorgen. Bei nasskaltem Wetter und Wind kriege ich mit der Arthrose in den Fingergelenken jedenfalls nur unter größter Mühe einen Abzug gedrückt. Aber das hänge ich nicht an die große Glocke. Und irgendwie ist es unerheblich, denn mit dem a. D. verliert man auch den Anspruch auf eine Dienstwaffe.
Jedenfalls habe ich mir fest vorgenommen, nach Margot zu sterben. Nicht, weil ich dann hier drin gute neunzig werden kann. Bloß nicht! Aber wenn ich wieder Single bin, kann ich mir eine eigene Bude nehmen und Herbert nach dem Schach hemmungslos ausmeckern. Ob ich wieder heiraten will, weiß ich noch nicht. Jedenfalls sollte meine Braut nicht auf Senioren-JVAs stehen. Ich verquatsche mich. Das kommt jedoch nur daher, dass ältere Menschen zu wenig Ansprache haben. Wenn die Chance besteht, lassen wir die aufgesparten Monologe der letzten Monate raus.
Aber zurück zu den Höhepunkten in diesem Greisengefängnis: den Mahlzeiten. Hier sitzen wir zu viert an einem Tisch, und bei der Platzwahl hat man so viel Spielraum wie das Strafregister der Straßenverkehrsordnung beim Überfahren einer roten Fußgängerampel in einer Spielstraße. Die mit der längsten Verweildauer besetzen die besten Plätze, wobei die Kriterien »Nähe zur Toilette« und »Sichtachse zum TV-Gerät« die wichtigsten sind. Veränderungen bedürfen eines Totenscheins. Erst dann wird nachgerückt.
Mich hebt das nicht an, denn ich verabscheue ein während der Mahlzeiten laufendes Fernsehprogramm, und auch meine Prostata kann noch genügend Disziplin aufbringen. Einige hier treibt diese Regelung aber in eine echte Lebenskrise. Bei mir ist es der Vierertisch. Natürlich mag ich gesellige Runden und entsprechend häufig hatten wir früher in unserem Haus auch Gäste, aber wenn man sich in einem fremdgesteuerten Lebensabend befindet, ist das anders. Hier entscheidet der Zufall oder das überengagierte Pflegepersonal über die Leute, mit denen man zum Essen zusammenkommt. Und Margot. Die hat nämlich unsere Selbstverpflegung abgelehnt, um sich bedienen lassen zu können. Die ungewollten Nebeneffekte hat sie wie so häufig nicht einkalkuliert, und dabei rede ich nicht vom finanziellen Aufschlag. Ich vergleiche die Mahlzeiten hier immer mit einem Candle-Light-Dinner in einem Restaurant, bei dem plötzlich zwei wildfremde Leute neben dem Tisch stehen und einem mit eindringlichen Blicken auf die letzten beiden freien Plätze im Lokal die Romantik versauen. In der Freiheit, also außerhalb eines Seniorenheims, hat man zwei Möglichkeiten: Entweder man wehrt die Störenfriede konsequent ab und rechtfertigt sich dann den halben Abend voreinander für dieses unhöfliche Verhalten, oder man gibt sich betont sozial, lässt die anderen Platz nehmen und redet bis zum Verlassen der Örtlichkeit nur noch Belangloses.
Nun ist es nicht so, dass der Diät-Streichkäse und die halbe Tomate, die im Heim serviert werden, irgendwelche romantischen Gefühle bei Margot und mir auslösen. Schon gar nicht bei mir. Margot findet den Käse »exquisit« oder »superb«, beides Begriffe, die es in unserem früheren Dasein nicht gab, und tut so, als hätte sie sich fast ihr komplettes Leben danach verzehrt. Dabei hat sie immer bestimmt, was bei uns auf den Tisch kam. Manchmal möchte ich das Zeug nehmen und gegen die Wand werfen, nur damit sie nicht mehr minutenlang darauf herumschmatzt. Das kratzende Geräusch, wenn sie das Silberpapier mit ihrem Messer abschabt, wobei sie ihren kleinen Finger abspreizt, als wäre er Totholz, hätte sich damit ebenfalls erledigt. Das ändert nichts daran, dass ich schon gern selbst entscheiden möchte, mit wem ich meine Zeit verbringe, erwachsene mündige Menschen tun das zuweilen. Fehlanzeige. Wir sind also seit dem ersten Tag unseres Einzuges für die Nahrungsaufnahme auf Hannelore und Gerhard festgelegt. Man kann beide durchaus mögen. Oder eben nicht.
Mit Gerhard komme ich ganz passabel aus. Er ist auf seine Art ein cooler Typ – für einen Achtzigjährigen. Er sagt, dass er ins Heim gezogen ist, um nach dem Tod seiner Frau Marie-Luise etwas Besseres zu finden. Das Angebot schien ihm hier umfangreicher als bei einem nachmittäglichen Tanztee im städtischen Seniorenzentrum, und vor allem bekäme man durch das dauerhafte Zusammenleben einen ungeschönten Blick auf die Dinge. Ich verstehe, was er meint. Wenn man die ein oder andere mit Lockenwicklern, Bademantel und Latschen über den Flur straucheln sieht, weiß man zumindest, was man nicht will. Im Ergebnis jedenfalls scheint das Heim für Gerhard ein wenig zu viel Realität gebracht zu haben. Er hatte eine kurze Affäre mit Ingeborg, aber die wollte angeblich, dass er die Klamotten ihres verstorbenen Mannes aufträgt. Gerhard hat vielleicht seine Macken, aber geizig ist er nicht, und pietätlos auch nicht. Infolge dieser Erfahrung hat er schließlich die Suche nach etwas mehr als drei Jahren aufgegeben.
Einen Ersatz dafür hat er mittlerweile auch gefunden. Gerhard ist ein militanter Hypochonder. Das äußert sich nicht nur in unseren Tischgesprächen, sondern birgt auch jede Menge Potenzial für Marotten. Die Sache mit dem Alkohol zum Beispiel. Gerhard bringt es an guten Tagen zum Abendessen auf eine halbe Flasche Bier, denn er hat Sorge, seine Leberzirrhose zu befeuern. Ich darf mir dann den Rest nehmen. Wie gesagt, Gerhard ist kein schlechter Kerl, aber mal ehrlich, welcher kerngesunde Mann versagt an einer Flasche Bier. Und was muss das für ein armes Würstchen sein, der anderer Leute Neigen austrinkt? Ich gebe es zu, die ersten drei Tage bin ich standhaft geblieben, aber irgendwann sind die Dämme gebrochen. Bier kippt man nun einmal nicht weg. Und auf diese Art und Weise umschiffe ich die Gesundheitspolitik in diesem Hause.
Wieder so ein Ding. Normalerweise bestimmt man schon im Kindesalter, was man zu sich nimmt und was nicht. Gut, wenn man verheiratet ist, muss man auch da wieder Abstriche machen, aber die lassen sich diskutieren, ein wenig zumindest. Mit Margot war ich dahingehend immer auf einem guten Nenner. Drei Bier waren frei, bei jedem weiteren wurde gefragt. Jeder zusätzliche Schnaps wurde von der Biermenge abgezogen.
Hier gibt es dahingehend so gut wie keinen Spielraum. Frau Mehltau, die Leiterin der Seniorenverwahranstalt und eigentlich eine sehr umgängliche Person, macht die Bierregeln, und die lauten: Unter der Woche nicht mehr als eine Flasche für jeden. An den Wochenenden ist sie etwas großzügiger. Sie sagt, sie ist für unser Wohlergehen verantwortlich. Ich bin überzeugt, sie hat Angst vor Exzessen. Mit den Massen an Blutverdünnern, die wir alle intus haben, können die Verzehrmengen quasi ins Uferlose steigen. Ich meine, was haben alte Leute denn noch zu verlieren? Was mich angeht, ich schätze hin und wieder ein Schlückchen Alkohol. Warum denn auch nicht? Ich bin ein Mann in den besten Jahren, auch wenn mein Wohnsitz etwas anderes suggeriert. Und dafür geht auch noch meine ganze Pension drauf.
Manchmal frage ich mich wirklich, ob Margot eigentlich weiß, was sie mir antut. Früher jedenfalls war alles besser. Da hat sich mein Leben in Arbeitszeit und Freizeit unterteilt. Auch die Nuancen waren klar: neue Fälle, Ermittlungsarbeit, Urlaube, Feiertage, Dienstjubiläen, die Abende im Schachverein und so weiter. Das war etwas Reelles. Heute unterscheiden sich die Tage lediglich dadurch, ob ich ein oder zwei Bier zu mir nehmen darf. Aber ich beschwere mich schon wieder.
Mit Gerhard jedenfalls ist ein Auskommen. Hannelore hingegen ist eine echte Herausforderung. Margot sagt, ich soll nett über unsere Mitbewohner sprechen. Aber ich sehe das so: Wenn ich mit jemandem zusammenleben wollte, wäre ich nie bei meinen Eltern ausgezogen. Jedenfalls hätte ich mir die Leute in meinem direkten Umfeld gern selbst ausgesucht, so wie den Streichkäse. Stattdessen sind sie einfach da. Das ist ungefähr so, als würde man Straßenbahn fahren und danach die anderen Fahrgäste im Schlepptau haben, lebenslänglich. Ich weiß, »lebenslänglich« ist in unserem Alter nicht mehr ganz so dramatisch, aber das ist noch lange kein Grund, schon vorher aufzugeben. Ich soll es jedoch mit einer positiven Sichtweise versuchen, sagt Margot. Woher ich die nehmen soll, sagt sie nicht.
Hannelore ist ledig, neunundsechzig, und hat noch kein graues Haar. Wenn ich auf Jüngere stünde, würde ich sogar sagen, sie ist recht attraktiv, vorausgesetzt, sie klappt ihre Mundwinkel nach oben, was ich bei ihr noch nie gesehen habe. Mehr Nettes fällt mir nicht ein. Darüber hinaus ist sie Margots beste Freundin, was ich als ein echtes Problem empfinde. Nicht nur, dass die beiden andauernd zusammenhängen und ich mir dabei ziemlich überflüssig vorkomme. Das geht noch irgendwie, zumindest solange ich meine Schachduelle mit Herbert habe. Viel schlimmer ist, dass sie über mich reden. Ich habe Margot danach gefragt, aber sie sagt, das sei nicht so und ich nähme mich zu wichtig. Dabei habe ich genau gehört, wie sie mehrfach hintereinander »Herr Katuschek« gesagt haben. Herr Katuschek bin ich. Margot nennt mich so, wenn sie schlecht auf mich zu sprechen ist. Ansonsten sagt sie Helmut zu mir. Wie dem auch sei, ich möchte nicht das Gesprächsthema anderer Leute sein. Nicht einmal, wenn die anderen Leute meine Ehefrau sind. Das ist mir unangenehm. Überdies leuchtet mir nicht ein, was an mir so interessant sein könnte. Meine Nase sagt mir, dass Hannelore Margot gegen mich aufwiegelt.
Erst neulich habe ich mitbekommen, dass Hannelore meint, die Männer verdürben den Frauen grundsätzlich das Leben. Angeblich soll der Trauschein der Freibrief dafür sein, das Ganze noch zu perfektionieren. Wie gesagt, Hannelore ist nicht verheiratet und sie war es auch niemals. Was an ihrem Leben deswegen besser sein soll, erschließt sich mir nicht. Wenn dem so wäre, würde sie jedenfalls nicht andauernd über ihren Tod reden, ganz zu schweigen davon, dass sie den lieben langen Tag damit beschäftigt ist, die Zeit danach akribisch zu planen. Seit ich sie kenne, bereitet sie ihr Begräbnis vor, und damit das alles möglichst authentisch daherkommt, kleidet sie sich schon jetzt konsequent schwarz und trägt eine Leidensmiene spazieren, die für normale Menschen nur schwer erträglich ist. Zu allem Überfluss bekreuzigt sie sich so häufig, dass man annehmen könnte, dies wäre eine Übung, um die Armmuskeln zu stärken. Wenn wir jung wären, würde Hannelore bestimmt zur Gothic-Szene gehören, aber in einem Seniorenheim gibt es derartig extreme Ausschläge bei den Lebenshaltungen nicht. Hier geht es insgesamt gediegener und damit überschaubarer zu.
Im Grunde genommen kann man die Insassen in zwei Fraktionen unterteilen: eine, die leben will, und eine, die sterben will. Mehr nicht. Die darüber hinausgehende Vielfalt des menschlichen Daseins spielt sich nur noch in meiner Erinnerung oder außerhalb dieser Mauern ab. Sehr bedauerlich, denn etwas mehr Abwechslung fände ich wirklich nicht übel. Hannelores Faszination für das Sterben scheint Margot jedoch nichts auszumachen. Hauptsache, an mir kann sie wegen meiner angeblich düsteren Gedanken hemmungslos herumkritisieren.
»Herr Katuschek, bist du noch bei uns?«, fragt Margot in diesem Moment, und ich kann schon allein an ihrem Tonfall hören, dass ihr irgendetwas ziemlich aufstößt. »Eine gemeinsame Mahlzeit lebt von Konversation.« Pause. »ALLER Anwesenden.«
»Helmut macht bestimmt das Sprudelwasser Probleme«, erwidert Gerhard. »Ich fühle mich davon auch immer so aufgebläht. Und wenn erst das Aufstoßen kommt …« Er winkt ab. Dann greift er nach meinem unangetasteten Glas und schiebt es ein wenig von mir weg, als wollte er mich vor mir selbst schützen. Unter Senioren hilft man sich eben. Ich habe Lust auf ein Bier, mit Kohlensäure versteht sich, aber da wir gerade erst Mittagszeit haben, könnte ich mir auch wünschen, noch einmal zwanzig zu sein: Die Chancen gehen in beiden Fällen gegen null.
Hannelore wirft mir einen verächtlichen Blick zu. Das irritiert mich nicht, denn unser Meinungsaustausch beruht in letzter Zeit auf nahezu nichts anderem.
»Ich habe nachgedacht«, sage ich, um die Diskussion um meine Befindlichkeiten abzukürzen, und hole mir wie beiläufig mein Getränk zurück. Sprudel hat mir noch nie etwas ausgemacht.
»Was das nun wieder geben soll«, wirft Margot ein und tippt mit ihrem Zeigefinger mehrmals auf die unbenutzte Papierserviette neben meinem Teller. Dabei schaut sie mich nicht einmal an, sondern widmet sich umgehend wieder ihrem Gespräch mit Hannelore. Genau das meine ich. Ich werde, wenn überhaupt, nur noch für die Zurschaustellung erzieherischer Maßnahmen herangezogen. Was das in meinem Alter noch bringen soll, weiß ich nicht.
Seit wir hier untergebracht sind, besteht Margot darauf, dass ich meine Oberschenkel beim Essen mit einem Stück buntem Papier bedecke. Sie findet das vornehm. Ich denke, sie hält mich für einen tatterigen Greis, der das Essen nicht ohne Malheur zum Mund führen kann. Was die Servietten angeht, ist das Personal – oder sollte ich lieber sagen: der gemeine Vollzugsbeamte – sehr erfinderisch. Selbst wenn man das Haus niemals verlässt und keinerlei Außenkontakte hat, kann man anhand der Servietten erkennen, welche Jahreszeiten und Feiertage anstehen. Für all die, die schlechter beieinander sind als wir, kann das eine echte Orientierungshilfe sein.
Ich finde es albern, zumal es bei uns zu Hause früher eine weiße Küchenrolle auch getan hat. Die wäre ergiebiger und auch preiswerter. Aber davon will Margot nichts mehr hören. Ich greife also zu dem Papier mit den aufgedruckten Blumenbildchen und kombiniere: Der Sommer steht an und Margot ist schlecht gelaunt.
Die Mahlzeit naht. Für mich persönlich ist das zumindest eine willkommene Abwechslung in diesem Einerlei der Tage, nicht wegen des Essens, das geht so. Obwohl Janko Varga, der Küchenchef, bestimmt ein ganz passabler Koch wäre. Die ungarische Küche soll sehr gut sein. Ich hätte sie gern einmal probiert, aber solange ich im Dienst war, hatte ich kaum Zeit, Margot zum Essen auszuführen, und wenn, dann wollte sie nur zu »Schnitzelheinz« um die Ecke. Margot hat es nicht so mit Überraschungen. Und sie mochte den fertigen Pudding, den Heinz zum Nachtisch angeboten hat. Entsprechend habe ich alle kulinarischen Experimente auf meinen Ruhestand verschoben, wie so vieles andere auch, und die Rechnung ohne Margot gemacht. Rein theoretisch könnte ich nun zumindest jeden Tag ungarisches Pörkölt haben, wenn Janko nicht nur deutsche Hausmannskost in Seniorenportionen auf die Teller bringen würde. Seine Mutter ist Deutsche und vermutlich sehr dominant.
Ehrlich gesagt bin ich aber noch nicht dahintergekommen, ob der Koch allein das Problem ist. Womöglich sorgt sich auch Frau Mehltau bezüglich unserer Verfassung beim Verzehr von scharfen Gewürzen. Kurzum, das Angebot könnte besser sein. Aber ich soll mich ja nicht so viel beschweren. Entscheidend ist, dass wir von Selma, der Küchenhilfe, bedient werden. Sie ist mein Lichtblick in der Einöde, die sich nun mein Leben nennt. Selma nimmt nicht einmal das Alter ernst und teilt sich ab und zu heimlich im Park eine Zigarette mit mir. Ich rauche eigentlich nicht, doch für Selma tue ich es gern. Sie ist Anfang zwanzig, groß, klapperdürr und legt ziemlich viel Wert auf eine gleichmäßige Körperbemalung. Ihre Tattoos reichen sogar bis hinauf zum Hals, was ich persönlich nicht sonderlich ansprechend finde, bei Gerhard aber tagelange Monologe über Erkrankungen an den Lymphknoten ausgelöst hat. Was diesen Körperschmuck angeht, habe ich eine eigene Theorie. Selma ist zwar ein patentes Mädchen, doch sie ist nicht ansatzweise schön, ja nicht einmal hübsch oder zumindest nett anzusehen. Ihr Gesicht ist so asymmetrisch, dass jeder Phantombildzeichner jubilieren würde. Vor allem aber ist es ihr übergroßes Gebiss, das sie, das muss ich leider so sagen, ziemlich entstellt. Das allerdings tritt gegenüber der giftgrünen Schlange auf ihrem Kehlkopf so ziemlich in den Hintergrund. Selma ist wirklich clever, und das nicht nur, was die Verschleierung ihrer körperlichen Makel angeht. Und sie bringt ordentlich Leben in die Bude, denn sie ist nicht auf den Mund gefallen. Sie ist ein echter Kumpel.
»Das sieht verdammt nach fetter Linsensuppe aus«, stellt Gerhard mit lang gezogenem Hals und einem ungenierten Blick zum Nachbartisch fest. Seine Mimik taugt dabei nur bedingt dazu, die Freude auf das Mittagessen zu steigern. Er scheint sogar einen Würgereiz zu unterdrücken. »Oje, ich höre meine Gedärme schon galoppieren.«
»Trompeten trifft es eher«, entgegne ich angestrengt humorvoll, um mir nicht wieder den Vorwurf einzuhandeln, ich würde mich nicht an der Unterhaltung beteiligen.
»Herr Katuschek, bitte«, maßregelt mich Margot. »Wir werden gleich essen.«
Wie man es macht, ist es verkehrt.
Gerhard nickt. »Ja, ja, aber vor den Darmwinden kommt bei mir ein fieses Magenkniepen. Das muss an den ausgekochten Knochen liegen. Eine unangenehme Sache, die mich heute den ganzen Nachmittag ans Bett fesseln wird.« Er klingt auf nervtötende Art weinerlich.
»Das wird alles überbewertet«, murmelt Hannelore so mitfühlend wie immer. Zeitgleich schnappt sie sich ihr Besteck, als müsste sie es vor Taschendieben schützen, und hält begierig nach ihrer Portion Ausschau. Das macht sie mit allem so, was es hier scheinbar umsonst gibt, insbesondere aber mit dem Essen. Manchmal zweigt sie sich etwas davon ab, noch bevor wir anderen zulangen können. Dabei scheint sie eine besondere Affinität für Wurst und Fleisch zu haben. Für den Transport von Schnitzeln, Aufschnitt und in seltenen Fällen auch Obst taugen die Servietten übrigens ganz hervorragend, aber auch die langen Ärmel ihrer sackigen Strickjacken werden gern genommen. Dort schiebt sie übrigens auch beim Romméspiel die Joker hinein. Aber ich sollte nicht so indiskret sein. Jedenfalls warte ich nur darauf, dass sie irgendwann einmal Margots Streichkäse für sich entdeckt. Dann haben wir Krieg und das Getratsche über Herrn Katuschek findet womöglich ein abruptes Ende.
Grundsätzlich ist es nicht so, dass mich Hannelores Essensraffgier stört, aber seltsam finde ich es schon, vor allem für jemanden, der lieber jetzt als später seinem Schöpfer entgegentreten möchte. Wie soll das gehen mit vollen Backen? Nach meinem Dafürhalten tickt Hannelore nicht ganz sauber. Ich wette, sie verkauft die Sachen, um sich ihre Rente aufzubessern. So eine Beerdigung geht ins Geld. Womöglich handelt es sich aber auch dabei nur um eine Show. Hannelore lechzt nach Aufmerksamkeit. Von mir wird sie die nicht bekommen, und wenn sie sich den kompletten Teller mit dem Aufschnitt in ihre Ärmel schiebt.
»Du hast recht«, erwidert Margot. »Wir nehmen das Essen viel zu wichtig. Es gibt Länder, da sind die Menschen froh, ein Schälchen Reis für den Tag zu haben. Oje, diese Genügsamkeit ist mir nicht gegeben.« Margot macht eine betroffene Miene und fährt andächtig über den Blumenzellstoff auf ihrem Schoß.
Mit Genügsamkeit hat das wohl kaum zu tun, denke ich und nippe an meinem Sprudelwasser.
»Zu viel Reis ist nicht gut. Er entzieht dem Körper Flüssigkeit«, weiß Gerhard. Er hat schon beim ersten Blick auf die Suppe damit begonnen, sich vorsorglich den Magen zu reiben. Auch sonst sieht er ziemlich leidend aus. Ich glaube, wenn er nur etwas mehr Mumm hätte, würde er aufstehen und fortlaufen. Aber was würde das nützen? In einem Seniorenheim kann man nicht einmal vor dem Essen flüchten. Irgendeiner trägt ihm seine Portion todsicher bis ans Bett nach. Ich an Gerhards Stelle würde mir etwas Diätisches bestellen, aber selbst das geht er nicht an. Lieber jammert er weiter.
»Oje, oje, jetzt geht es schon los. Nun gibt es kein Entrinnen mehr.« Er legt das Kinn auf die Brust, schließt die Augen und faltet die Hände, als müsste er das Unheil wegbeten.
Man könnte wirklich meinen, etwas Entsetzliches stünde ihm bevor. Stattdessen kommt nur Linsensuppe. Und Selma. Glücklicherweise. Sie lächelt. Etwas anderes habe ich von ihr auch nicht erwartet.
»Mahlzeit, die Herrschaften«, flötet sie in die Runde und stellt schwungvoll den ersten Teller vor Gerhard ab. »Ich habe dir nur extra magere Blutwurststückchen aufgetan«, erklärt sie liebevoll. Als Gerhard sich nicht rührt, streichelt sie ihm sanft über die Schulter, hält inne und schaut ihn mit todernstem Blick an. »In der aktuellen Apotheken-Umschau steht ein Artikel über Plattfüße. Den solltest du einmal lesen. Sehr interessant.«
Gerhard hebt die Lider und nickt unsicher, um im gleichen Moment einen Blick unter den Tisch zu wagen. Die Idee mit den Plattfüßen scheint ihm noch nicht gekommen zu sein, aber immerhin lenkt das seine Aufmerksamkeit und unser Tischgespräch von dem eher unappetitlichen Verdauungstrakt ab.
Der nächste Teller kommt angeflogen. »Hannelörchen, schickes Schwarz heute, neu?«, fragt Selma und zupft am Stoff von Hannelores Strickjacke.
»In meinem Alter trägt man nur noch auf. Alles andere ist so kurz vor dem Ableben Verschwendung«, antwortet Hannelore so lebensfroh wie immer und ohne die Augen von ihrem Essen zu lassen.
»Supi, umso mehr Knete kannst du mir vererben«, jubiliert Selma und zwinkert mir dabei keck zu. Mich freut das. An Margots angespannter Körperhaltung hingegen kann ich sehen, dass Selmas Benehmen ihr mal wieder gegen den Strich geht. Selma sieht in ihr nicht die feine Dame, die sie hier gern wäre. Und ich mag Selma. Das sind für meine Frau gleich zwei Gründe, sie unsympathisch zu finden.
»Und auch eine Suppe für dich, Margot«, fährt unsere Küchenfee fort und balanciert den nächsten Teller heran. »Der ungarische Meister der Fertiggerichte hat nur für dich auf den Zusatz von Zucker verzichtet. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen.« Mit Margots Suppe landet auch ein kleines Schälchen mit Zucker auf dem Tisch, nur zur Sicherheit. Margot, deren Zuckerdiät kein Geheimnis ist, nimmt das als Provokation, was es ohne Frage auch ist, und würdigt Selma keines weiteren Blickes.
»Ich danke dir, meine Liebe«, sage ich, noch bevor meine Portion aufgetragen wird.
»Das habe ich in über vierzig Jahren nicht einmal dann gehört, wenn ich ihm den schönsten Braten serviert habe«, beschwert sich Margot, ohne von ihren Linsen aufzusehen, und setzt etwas leiser, aber leider für mich und sicherlich auch alle anderen am Tisch noch hörbar hinzu: »Aber bei dieser Person überschlägt er sich. Bei der genügt es, wenn sie die Teller tragen kann. Dabei sieht sie aus wie ein Pferd, das in einen Farbkasten gefallen ist.«
»Sie ist nun mal jung«, krächzt Hannelore bösartig. »Wie ich es dir immer sage, Männer sind verschwendete Lebenszeit, alle nur verschwendete Lebenszeit.« Sie ist heute wieder besonders gut drauf. »Er wird es dir niemals danken. Niemals!«
Ich finde es nicht sehr höflich, über einen Anwesenden in der dritten Person zu sprechen, doch neuerdings ist das bei den beiden gang und gäbe.
»Ich habe dir eine Extrascheibe Blutwurst reingetan. Die isst du doch so gern«, flüstert Selma mir zu. »Guten Appetit, Helmut, und lass dich nicht ärgern.« Sie knufft mich in den Oberarm. Ich bin nicht der Typ, der fremden Frauen einen Klaps auf den Hintern gibt, und danke es ihr mit einem Nicken und ein paar herzlichen Worten. Nebenbei schäme ich mich für Margot. Die hingegen ist kurz vorm Platzen.
»He, Helmut, kann ich deine Wurst haben?«, meldet sich Rolf Jürgen vom Nachbartisch. Die teuren Hörgeräte, die in seinen Ohren stecken, kommen gegen seine über neunzig Lenze ganz hervorragend an. Die moderne Technik macht so einiges möglich. Ansonsten scheinen bei Rolf Jürgen die Grenzen aber so langsam erreicht zu sein. Er sieht aus wie ein zu groß geratener Schuljunge mit spärlichem Haar und falschen Zähnen. Sein Kopf wackelt in einem fort und er kann sich ohne seine beiden Gehhilfen kaum auf den dünnen Beinen halten. Trotz allem ist er glücklich verheiratet, wie er immer wieder betont. Ich glaube ihm das unbesehen. Diese Verbindung ist so innig, dass seine knapp dreißig Jahre jüngere Frau ihn hier einquartiert hat, um sich in der realen Welt ein schönes Leben zu machen. Dabei wird sie nicht müde, dem armen Kerl weiszumachen, dass sie ihn irgendwann wieder abholen wird. Davon gehe ich auch aus, aber an diesem Tag wird Rolf Jürgen getragen werden, und zwar mit den Füßen voran.
»Ich brauche Tinte auf den Füller, meine Uschi ist unersättlich«, kreischt er unter schmierigem Gelächter. Damit zeigt er uns allen, dass sein Kurzzeitgedächtnis heute wieder einmal nicht bis zum Einsetzen seines Gebisses gekommen ist.
»Funktioniert das mit Blutwurst?«, will Gerhard wissen und betrachtet kritisch den Löffel in seiner Hand. »Das wäre mir neu. Das darin enthaltene Cholesterin verstopft die Adern eher, als dass es sie frei macht.« Vorsichtig nimmt er mit seinem Löffel ein Stückchen Kartoffel auf, pustet so intensiv, dass das Teil demnächst über den Tisch fliegen wird, und schiebt es sich schließlich, und vermutlich mittlerweile erkaltet, in den Mund.
»Eine anständige Wurst braucht der Mann«, vermeldet Rolf Jürgen voller Begeisterung. »Wenn Uschi mich heute Nachmittag holt, bin ich bestens vorbereitet.« Er legt den Kopf leicht in den Nacken, was das Rinnsal der fettigen Suppe, die ihm aus dem Mund über das Kinn läuft, für alle noch einmal schön sichtbar macht. »Hoffentlich hat sie sich ebenfalls anständig gestärkt.« Er reibt sich die Hände. »Nicht, dass sie schlappmacht.«
»Wie ekelhaft für so einen alten Kerl«, raunt Margot neben mir.
»Ich brauche meine Wurst selbst«, sage ich laut und werfe Margot dabei einen scheelen Seitenblick zu. Sie versteht diesen subtilen Hinweis, das weiß ich, denn sie schweigt und hängt mit ihrem Kinn nun fast in der Brühe.
»Oh Margotchen, was du für ein Glück hast!«, säuselt Rolf Jürgens Tischnachbarin Jutta. »So einen Mann wie Helmut wünscht man sich.« Sie schüttelt ihren voluminösen Körper voller Begeisterung.
Ich für meinen Teil will Jutta nicht geschenkt haben, aber wie heißt es so schön: Konkurrenz belebt das Geschäft. Und so nicke ich Jutta herzlich zu und wünsche ihr einen guten Appetit. Margot zerdrückt derweil die Linsen mit ihrem Löffel.
»Meine Uschi hat auch ein verdammtes Glück«, behauptet Rolf Jürgen mit vollem Mund. »Und sie weiß das.« Er klopft sich bestätigend auf die Schulter. »Deswegen bereitet sie zu Hause alles für meine Rückkehr vor, vor allem das Schlafzimmer.« Er jauchzt und klingt dabei jetzt schon, als pfiffe er aus dem letzten Loch.
»Natürlich, Herzchen«, säuselt Jutta und kneift ihren Tischnachbarn in die eingefallene Wange. Diese Geste, die man normalerweise heutzutage nicht mal mehr einem Kind zumutet, gehört zu Juttas Markenzeichen. Sie kneift jeden hier im Haus – außer mich. Wie alt Jutta ist, lässt sich schlecht schätzen. Bei ihrem Gewicht ist das leichter. Da würde ich locker auf das Doppelte von Rolf Jürgens tippen. Dafür ist sie aber auch nur halb so groß. Damit sie nicht übersehen wird, trägt Jutta vorwiegend großblumige bunte Motive auf wallenden Gewändern über hautengen rosa oder mintgrünen Leggings und hat ihre rot gefärbten Haare zu einem Turm nach oben gebunden. Margot sagt, in Leggings sieht eine Frau von vorn immer gut aus und von hinten ist es egal. Für Jutta scheint diese Faustformel nicht zu gelten, zumindest schließe ich das aus den Lästereien der Frauen. Mich interessiert das nicht.
Jutta jedenfalls ist hier so etwas wie das Heimorakel, zumindest sieht sie sich gern in dieser eher geheimnisvollen Rolle. Ich glaube, sie hat ihr ganzes Leben niemals richtig gearbeitet und ihre Zeit nur damit totgeschlagen, dass sie anderen Leuten ihre erfundenen Wahrsagereien und Lebensweisheiten aufdrängt. Wie das bei ihren diversen Ehemännern angekommen ist, liegt wohl auf der Hand. Jutta ist drei Mal geschieden, und das sind nur diejenigen, von denen mir Margot erzählt hat. Dass sie dabei allerdings äußerst clever vorgegangen sein muss, lässt sich nicht leugnen. Wie sonst könnte sie sich den Schuppen hier leisten? Aber auch das sind nur die Gerüchte, die Margot mir erzählt, wenn Hannelore anderweitig beschäftigt ist.
»Habt ihr schon von dem neusten Projekt unseres süßen Lennox gehört?«, plappert Jutta, der es mühelos gelingt, jedes Tischgespräch im Speiseraum zu dominieren. Das ist bei uns ohnehin nicht sonderlich schwer, denn Margot flüstert nur mit Hannelore, während Gerhard mit seinem Essen kämpft, egal, ob es Linsen gibt oder etwas anderes. Meist stört mich Juttas aufdringliche Art total, heute finde ich es gar nicht so übel, dass sie so redselig ist. Wenn Margot ohne erkennbaren Grund dumm mit mir tut, plaudere ich eben mit Jutta. Die tut mir irgendwie auch leid, denn sie teilt sich, seit wir hier sind, einen Tisch allein mit Rolf Jürgen und alles, was dem Greis beim Essen in den Sinn kommt, hat mit einer kopulierenden Uschi zu tun. Da braucht man Zerstreuung, keine Frage.
»Was treibt ihn denn um, unseren Herrn Bergmann?«, frage ich, auch wenn ich zugeben muss, dass mich der Wasserstand an irgendeinem x-beliebigen deutschen Hafen mehr interessieren würde. Lennox Bergmann, der junge Assistent unserer Heimleitung, ist niemand, an den ich meine Lebenszeit verschwenden möchte. Da ich mit meinem Aufenthalt hier jedoch ohnehin nichts anderes tue, kann ich mir auch den neuesten Heimtratsch anhören. Ich weiß, dass vor allem die Frauen bei uns total vernarrt in diesen Burschen sind – oberflächlich und durchschaubar unsere Damen, ich sag’s ja.
»Der niedliche Lennox bringt ordentlich Schwung in uns lahme Enten«, jubiliert Jutta. Sie gestikuliert dabei wie wild und schreckt vor lauter Begeisterung auch nicht davor zurück, mit weit offenem Mund zu sprechen. »Wir werden das erste hochmoderne Seniorenheim.« Sie beugt sich nach vorn, wobei ihre ausladende Oberweite den Suppenteller nahezu vollständig unter sich begräbt. »Digitalisierung heißt das Zauberwort.«
Rolf Jürgen interessiert sich weniger für das Zauberwort als für Juttas Ausschnitt. Gerade als er versucht, mit seiner zittrigen rechten Hand hineinzulangen, lehnt sie sich wieder zurück und fährt ungerührt fort. Der arme Kerl greift ins Leere.
»Wir bekommen alle Armbänder, solche Fitnessdinger, ihr wisst schon«, erklärt Jutta. »Die zählen unsere Schritte und messen den Blutdruck. Im Notfall können die wohl auch nach Hilfe rufen.« Jutta wirbelt ihre Blümchenserviette durch die Luft und kichert begeistert. »Angeblich soll man uns damit auch orten können. Das ist alles so aufregend.«
Gegen Letzteres hätte ich normalerweise schon rein datenschutzrechtlich etwas einzuwenden. Aber da mein Radius seit Neuestem erheblich begrenzt und einer äußerst transparenten Gruppendynamik unterworfen ist, lohnt das nicht.
Erstaunlicherweise können sich nun auch Margot und Hannelore voneinander lösen und gewähren Außenstehenden die Ehre ihrer Aufmerksamkeit. Ich meine Jutta, nicht mich.
»Davon habe ich auch schon gehört«, antwortet Margot und klingt so begeistert wie bei ihren allabendlichen Streichkäseorgien. »Ich bin gespannt, auf wie viele Kilometer ich am Tag komme.« Sie reibt sich die Hände. »Da kann man hervorragend sehen, wie fit man noch ist.«
Rolf Jürgen stimmt ihr zu, aber ich glaube, was er aufzeichnen möchte, kann der Tracker nicht erfassen. Ich hoffe es zumindest. Außerdem war mir nicht klar, dass die Entfernung zwischen unserem Appartement im ersten Stock und dem Fußpflegezimmer im Souterrain in Kilometern gemessen werden kann.
»Ich habe mir eins in Blau bestellt.« Margot schäumt förmlich über. »Das passt am besten zu meinen Augen.« Sie lässt die Wimpern klimpern.
»Meines wird schwarz und ich habe darauf bestanden, den Notknopf ausschalten zu können«, erklärt Hannelore.
Gerhard nickt und scheint sich ebenfalls darüber zu freuen. »Hier wird ordentlich was in uns investiert«, stellt er anerkennend fest. »Da kann man nicht meckern.«
»Lennox sagt, die Maschine kann sogar die fruchtbaren Tage bei einer Frau anzeigen«, vermeldet Rolf Jürgen. »Das ist mal ein echtes Ding, was?« Er schlägt mit der flachen Hand auf die Tischplatte. »Wenn es piept, weißt du, dass du nicht rankannst.« Er frohlockt wie ein kleiner Junge, der eine neue elektrische Eisenbahn bekommen wird.
Die Frauen schauen sich nur betreten an. Die Menopause kommt ohne Piepgeräusche aus. Ich verstehe. Was ich allerdings nicht begreife, ist, wieso alle hier von dieser Schnapsidee unseres aufstrebenden Heimleiters in spe zu wissen scheinen. Alle außer mir. Ich schaue Margot fragend an, aber die weicht meinem Blick aus.
»Und was soll diese Form der totalen Überwachung bringen?«, frage ich in die euphorische Runde hinein.
Margot zischt irgendetwas Niederträchtiges und versetzt mir unter dem Tisch einen Tritt.
Rolf Jürgen reagiert zuerst. »Du kannst lauter kleine Abenteuer haben, ohne die Spätfolgen einkalkulieren zu müssen«, erklärt er und ich komme mir dabei vor, als schaute ich einen der Aufklärungsfilme von Oswald Kolle.
»Unsere Sicherheit natürlich«, kreischt Jutta, als hätte ich sie zutiefst beleidigt.
»Unser ungestörtes Ende«, keift Hannelore.
»Und unsere Fitness«, weiß Margot.
Wie die beiden letzten Punkte zusammengehen, habe ich nicht zu beurteilen.
Gerhards mitleidiger Blick in meine Richtung ist kaum auszuhalten. »Das bisschen Plastik kann euch allen einmal das Leben retten«, sagt er. »Stell dir vor, ich breche auf dem Klo zusammen und niemand weiß, wo ich bin …« Seine Augen werden immer größer und er scheint darauf zu warten, dass ich ihm beipflichte. Ich bin ein höflicher Mensch und tue das, obwohl ich mich frage, wie Gerhard in seinem achtzehn Quadratmeter großen Appartement inklusive Badezimmer verloren gehen kann. Gerhard scheint mein Einlenken noch nicht zu genügen. Er wird kreidebleich und stiert nur noch apathisch ins Leere. Ich wollte ihn nicht aufregen, und wenn er sich mit einem solchen Armband wohler fühlt, kann er es gern tragen. Ich sage ihm das und füge noch irgendetwas Beschwichtigendes hinzu, aber er reagiert nicht mehr auf mich. Stattdessen legt er den Kopf in den Nacken, reißt den Mund weit auf und röchelt.
Ich weiß, wie ein Mann aussieht, der kurz vorm Ersticken ist, aber noch ehe ich ihm helfen kann, eilt Selma herbei und versetzt ihm einen so heftigen Schlag auf den Rücken, dass er vom Stuhl rutscht und auf den Boden fällt. Nachdem nicht einmal der Aufprall etwas an seinem Zustand zu ändern scheint und Gerhard mittlerweile leicht bläulich wirkt, springt sie auf ihn, reißt ihm das Hemd runter und beginnt, auf seinem Brustkorb herumzutrommeln. Gerhards Körper vibriert unter Selmas erstaunlich kräftigen Armen. Ich helfe ihr und versuche, ihn über seine Nase mit Sauerstoff zu versorgen. Was die anderen machen, kriege ich nicht mit. Nur Margot ist nicht zu überhören. Sie schreit, aber das tut sie immer, wenn sie sich nicht zu helfen weiß. Selma und ich jedenfalls kämpfen verzweifelt um das Leben von Gerhard.
»Das gibt richtig Ärger«, japst sie irgendwann mit knallrot leuchtenden Wangen. »Wieso kann er auch nicht wie ein normaler Mensch essen?«
Ich verstehe nicht, was sie meint, und unterbreche kurz meine Beatmung. Just in diesem Moment bekommt Gerhard einen Hustenanfall. Wenig später landet etwas Weiches in meinem Gesicht. Es handelt sich um ein Stückchen Kartoffel, das ihm vermutlich in der Luftröhre gesessen hat.
Selma hält nun ebenfalls inne und betrachtet unsicher den unter ihr liegenden Gerhard.
Der röchelt, und kaum, dass er die Augen aufgeschlagen hat, drückt er sie auch wieder zu. »Marie-Luise, oh nein«, haucht er kraftlos. »Ich dachte, es wäre endlich vorbei.«
Selma rührt sich nicht und mustert ihn weiter ungeniert. Irgendwann fängt sie an zu grinsen. »Selma ist immer noch mein werter Name«, sagt sie. »Trotzdem, ohne deine Unterschrift …«, sie hüpft mit flinken Bewegungen von ihm herunter, »… kann ich das leider nicht akzeptieren.«
Ich verstehe noch immer nicht. Selma scheint mir das anzusehen, denn sie deutet mit dem Zeigefinger auf Gerhards Brustbein. Ich beuge mich über ihn und verstehe, was sie meint. Auf Gerhards knittriger Haut prangt ein Schriftzug: »Bitte nicht wiederbeleben«, steht dort in übergroßer Zeitungschrift. Ich folge einem Reflex, benetze meinen Zeigefinger mit Speichel und schiebe ihn über das große B. Nichts tut sich. Gerhard trägt eine Tätowierung, und er ist verdammt sauer.
Seppel?« Schweigen. »Seppel, bist du da? Sprich mit uns, Seppel. Gib uns ein Zeichen.« Die Stimme von Jutta klingt etwas anders als sonst, irgendwie noch kratziger und gequälter. Damit will sie sicherlich geheimnisvoller wirken. Wie das mit der enormen Lautstärke, die sie draufhat, einhergeht, leuchtet mir nicht ein, aber womöglich praktiziert sie nur das, was die Jugend heutzutage »zielgruppengerechte Ansprache« nennt. Über die Hälfte der hier Anwesenden ist schwerhörig und Jutta will eben alle mitnehmen. Meine Ohren funktionieren noch tadellos, aber dafür bin ich der einzige Neuling in dieser Runde.
Eigentlich sitze ich nur hier, weil Margot gesagt hat, ich solle mich nicht immer so vereinzeln. Außerdem ist Gerhard nach dem kleinen Zwischenfall von vorhin noch immer etwas malade und ich bin quasi seine Vertretung. Das hat Margot nicht gesagt, das ist meine Interpretation des Ganzen, und womöglich hat mich auch ein kleines bisschen mein schlechtes Gewissen hergetrieben. Wenn ich meine Brille getragen hätte, wäre die Sache womöglich anders gelaufen. Aber wer kann denn auch ahnen, dass Gerhard den entscheidenden Punkt seiner Vorsorgevollmacht auf der Haut trägt? Jetzt ist es zu spät. Er ist stinksauer, weil ich seinen letzten Willen ignoriert habe.
Dafür scheint Margot mittlerweile wieder etwas zugänglicher. Sie liebt diese Mittwochnachmittage. Mit Kartenlegen, aus der Hand lesen, in die Glaskugel schauen. Eben all diese Dinge, die in drittklassigen Fernsehsendern laufen und die ein normaler Mensch als Nonsens abtut. Heute stand wohl eigentlich eine Gesprächsrunde mit dem Jenseits auf dem Plan. Gerhard hatte darum gebeten, mit seiner Stiefschwester Kontakt aufzunehmen, um seine Blutwerte mit den ihren zu vergleichen, doch nach der unschönen Geschichte beim Essen liegt Gerhard nun flach und Jutta musste umdisponieren. Wegen mir hätte der Quatsch ruhig ausfallen können, aber daran war nicht zu denken. Jutta muss sich angeblich einschwingen, und nachdem sie das heute schon den ganzen Tag getan hat, gibt es kein Zurück mehr.
Wir bewegen uns also ins Jenseits, wenngleich auch in den Hades der Haustiere. Jutta hat dahingehend keine Berührungsängste und ist ein Allroundtalent. Gemeinsam rufen wir nach verstorbenen Wellensittichen, Zwergkaninchen, Goldfischen und, und, und. Erstaunlicherweise interessiert sich Margot plötzlich brennend dafür, wie es unserem verstorbenen Kanarienvogel geht. Sie sagt, er hieß Pieper oder so. Ich weiß nicht mal mehr, dass er überhaupt einen Namen hatte. Nur an meine Aktion mit dem Unkrautvernichtungsmittel, daran erinnere ich mich genau. Der Käfig des Vogels stand dabei etwas ungünstig. Jedenfalls lag er hinterher tot auf dem Boden. Da war ich gegenüber Margot echt in der Bredouille. Sie war es, die damals auf ein Haustier bestanden hatte, als Ausgleich für meine familienunfreundlichen Arbeitszeiten. Der Vogel war also irgendwie ein Kompromiss. Für zwanzig Mark hat der Tierarzt dann Herzversagen attestiert. Seltsam, den Geldschein, den ich dem Kerl über den Tisch geschoben habe, sehe ich heute noch vor mir. Nach über dreißig Jahren, da soll mal einer sagen, im Alter lasse das Gedächtnis nach.
Margot jedenfalls sitzt nun neben mir, hält mich und ihre Freundin Hannelore an den Händen und ist guter Dinge, dass Pieper uns gleich Einblicke in das Leben nach seinem Tod geben wird. Ich hätte lieber meinen Krimi zu Ende gelesen, da kenne ich wenigstens das Ende noch nicht, oder meine Schachpartie mit Herbert fortgesetzt. Margot sagt, dass zwei Jahre kein Alter für einen Vogel sind, und da mag sie recht haben. Doch sie sind nichts gegen die drei Jahrzehnte, die Margot das einzige Tier, das jemals bei uns gelebt hat, vergessen hatte. Da kam Gerhards Unglück genau richtig. Seit einer halben Stunde braucht jeder hier bei uns ein Tier, also ein totes. Margot hatte Glück. Ihr ist Pieper wieder eingefallen. Seitdem kann sie sich vor Trauer um den Vogel überhaupt nicht beruhigen. Und ich weiß nicht, wo ich vor lauter Peinlichkeit hinschauen soll.
»Seppilein? Ich spüre, dass du bei uns bist«, intoniert Jutta aus ihrem tiefsten Inneren.
In dem vertrockneten Blumenstrauß, der auf der Anrichte steht, raschelt es.
Margot zuckt neben mir zusammen. Ihre Freundin Hannelore sicherlich auch. Die beiden machen einander immer alles nach.
»Seppilein mochte er immer besonders gern genannt werden«, schluchzt Ingeborg und drückt ein paar Tränen in ihr Taschentuch.
Das Orakel Jutta duldet kein Dazwischengequatsche und straft Ingeborg mit einem fiesen Blick. »Seppel, wie schön. Magst du uns berichten, wie es dir geht?«
»Dein Frauchen vermisst dich sehr«, jammert Ingeborg in einem unkontrollierten emotionalen Ausbruch.
»Ruhe!«, herrscht Jutta sie an. »Es kann nur ein Medium geben. Du vergraulst den Dackel am Ende noch.«
»Seppilein ist ein Zwergpudel«, wimmert Ingeborg nun vollkommen aufgelöst.
»Es gibt nur noch die Seele«, versetzt Jutta, ohne Luft zu holen. »Locken oder Glatthaar ist dabei unerheblich.«
Ich sehe in Margots Gesicht so etwas wie tiefes Verständnis.
Ingeborg verdrückt weitere Tränen.
Hannelore gähnt ungeniert.
Stille. Dann raschelt es wieder in den Blumen. Ich frage mich, wie Jutta das hinbekommt, und halte nach einem Draht oder einem Faden, der zwischen ihr und dem Schrank verläuft, Ausschau. Aber ich kann nichts erkennen. Dafür hat der Zwergpudel enormen Redebedarf.
»Seppi sagt, er kaut einen Büffelhautknochen«, fährt Jutta fort und ihre Stimme überschlägt sich fast. »Es ist so einer, den du ihm nie kaufen wolltest. Überdies kann er den ganzen Tag auf der Wiese herumtollen und niemand unterbricht ihn dabei, um ihn auf eine alte, stinkende Decke zu legen und seine Ohren mit zu lauter Volksmusik zu quälen.« Jutta zögert keinen Moment, um den finalen Schlag zu setzen. »Seppilein ist heilfroh, das alles hinter sich zu haben, und schaut nur noch nach vorn, in das schöne, helle Licht und auf die bunten Farben des Regenbogens.«
Betretenes Schweigen. Ingeborg hat keine Tränen mehr, sondern schaut fassungslos in die Runde. Der Zwergpudel musste sich mal anständig Luft machen. Dafür habe ich absolutes Verständnis.
»Hat er gesagt, dass er mich vermisst?«, fragt Ingeborg irgendwann tonlos.
Jutta schüttelt nur energisch den Kopf. Dabei sieht sie aus, als hätte sie der armen Ingeborg den wirklich heftigen Teil von Seppis Äußerungen verschwiegen. Meine Güte, wenn der Pudel schon so ein Hundeleben hatte, dann soll Ingeborg doch froh sein, dass wir ihren Mann nicht befragen.
Ingeborg kann sich damit offenkundig nicht zufriedengeben. »Und was ist mit Karlchen?«, will sie ganz aufgelöst wissen. »Konntest du auch mit meinem Goldhamster reden?«
Jutta verneint kategorisch. »Jeder nur ein Tier. Alle wollen drankommen.« Sie legt ihre Hände flach ausgestreckt vor sich auf die Tischplatte und lässt ihren Blick in Zeitlupe von einem zum anderen schweifen. Schließlich bleibt sie an Margot hängen. »Mit wem möchtest du reden?«, fragt sie und klingt, als wollte sie Margot den Satan austreiben. Mir wäre das recht, aber ich befürchte, daran würde selbst die taffe Jutta scheitern.
»Ich?« Margot reißt die Augen weit auf und legt sich eine Hand auf das Herz. Mit der anderen hält sie Hannelores Unterarm fest umklammert. Na klar, was denn auch sonst?
»Jeder am Tisch sollte ein Haustier gehabt haben«, bemerkt Jutta ein wenig ungehalten. Sie fühlt sich in ihrer Ehre als Seherin gekränkt, verständlicherweise.
»Äh, ich … na ja …«, stammelt Margot. Dann schaut sie zu mir herüber. »Wir …«
Nichts mit wir, denke ich. Du wolltest diesen blöden Vogel. Ich tue so, als ginge mich das alles nichts an. Irgendwie ist das ja auch so. Ich bin nur Gerhards Vertretung, der Platzhalter quasi.
»Ich weiß nicht mehr, ob…« Margot versucht, sich herauszureden, aber darin war sie noch nie gut. Ich frage mich allerdings, woher ihre plötzliche Zurückhaltung rührt. Bis gerade eben gab es nichts Wichtigeres als den ollen Vogel, ihren Liebling. Ich schaue sie prüfend von der Seite an. Auf ihrer Stirn stehen Schweißperlen. Margot Katuschek hat die Hosen voll, ohne Zweifel. Je länger ich sie beobachte, umso unsicherer wird sie. Natürlich! Sie befürchtet, dass Pieper oder wie das Vieh auch immer hieß, auch nachtritt. Die Wahrheit ist ein scharfes Schwert. Was, wenn ihm das Vogelfutter nicht geschmeckt hat? Womöglich ist er auch nicht den Gifttod gestorben, sondern durch Margots Verschulden? Dann hätte ich die letzten drei Jahrzehnte vollkommen umsonst an dieser Bürde getragen. Nur gut, dass mir das alles bis heute entfallen war.
»Du hattest doch einen Wellensittich«, ermuntert Hannelore ihre Freundin. »Der war dir doch so wichtig.«
Jutta schaut mich fragend an. Ich schließe die Augen.
»Ich hatte einen Rammler«, plärrt Rolf Jürgen in die verstummte Runde. »Das muss so um das Jahr 1943, 1944 gewesen sein.«
Einen Rammler, was auch sonst, denke ich, und es ärgert mich, dass der Kelch an Margot vorübergegangen zu sein scheint. Wenn ich den Vogel damals nicht in der Restmülltonne entsorgt hätte, würde ich ihn jetzt glatt in die Pathologie zur Untersuchung bringen. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass Margot sein Ableben verschuldet hat und ich mir die zwanzig Mark hätte sparen können.
»Adolf war sein Name«, ergänzt Rolf Jürgen. »Ein Deutscher Riese.«
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass Rolf Jürgen neben seinen stetigen sexuellen Ausschweifungen (rein theoretischer Art natürlich) auch noch diverse Defizite in seiner politischen Haltung aufweist.
»Jutta, hol den Karnickelbock mal ran und frag ihn, woran er gestorben ist«, fordert Rolf Jürgen.
Jutta scheint froh, Margots Totalausfall überbrücken zu können. Sie schließt die Augen und ruft nach Adolf. Ich gebe zu, die Situation hat etwas Absurdes, aber wir sind in einem Seniorenheim, da überrascht mich nicht mehr viel.
Es dauert ein Weilchen, dann meldet sich der Deutsche Riese über das Medium Jutta zu Wort.
»Er hatte einen vereiterten Zehennagel, hinten rechts«, erklärt Jutta in tiefster Betroffenheit.
Ich bin unsicher, ob sie sich nur einen Scherz erlaubt, und schaue in die Runde. Die langen Gesichter sprechen dagegen. Wir bemitleiden also das Hinterlaufproblem eines Karnickels, das seit rund achtzig Jahren tot ist.
Margots Selbstbewusstsein ist zurück und ich kriege das in Form eines vorwurfsvollen Blickes zu spüren. Der soll mich sicherlich an meine Kritik bezüglich ihrer exzessiven Fußpflege erinnern.
Rolf Jürgen ist verdutzt. »Ziemlich komisch geschmeckt hat er schon irgendwie«, sagt er und schmatzt dazu unappetitlich.
Alle überhören das, wobei sicher die Hälfte der Anwesenden auch keine andere Wahl hat. Nicht jeder hat so ein modernes Hörgerät wie Rolf Jürgen.