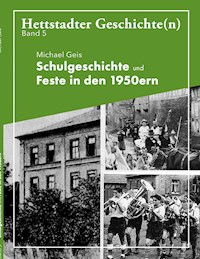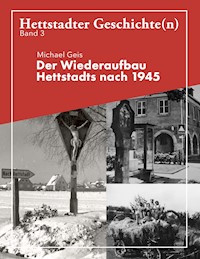
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der vorliegende Band der Hettstadter Geschichte(n) beschäftigt sich mit dem Wiederaufbau des Ortes nach der Zerstörung am 1. April 1945. Die Schwierigkeiten aber auch die große Aufbauleistung der Bewohner Hettstadts soll hier aufgezeigt werden. Zudem werden im letzten Kapitel neue Erkenntnisse und Erzählungen zum Buch "Der Kampf um Hettstadt", beschrieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 58
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt:
Zum Geleit
Der Wiederaufbau Hettstadts
Grundversorgung
Wohnsituation
Unterstützung
Wohnungsausstattung
Zuzug
Handwerker
Fahrten
Material
Landwirtschaft
Verwaltung
Gewerbe
Dorfleben
Schule
Vereine
Kirche
Beispiel für den Wiederaufbau eines Hofes
Nachträge zum Buch „Der Kampf um Hettstadt
Quellen
Zum Geleit
Das dritte Buch der „Hettstadter Geschichte(n)“ beschäftigt sich in der Hauptsache mit den Folgen des 1. April 1945, nach der Zerstörung des Ortes Hettstadt.
Der Wiederaufbau des Ortes erforderte viel Kraft aber auch viel Hilfsbereitschaft, Flexibilität, Organisationstalent sowie Beziehungen.
In relativ kurzer Zeit, binnen sechs bis sieben Jahren, war der Ort soweit wiederhergestellt, dass ein normales Dorfleben wieder Einzug halten konnte.
Von dem großen Willen zum Wiederaufbau der Einwohner erzählt dieser Band der „Hettstadter Geschichte(n)`“.
Im zweiten Teil des Buches werden neue Erkenntnisse und Nachträge zum Buch „Der Kampf um Hettstadt“ beschrieben. So mussten ein paar Aussagen korrigiert werden, neue Informationen kamen hinzu. Dazu kamen auch ein paar neue Bilder und eine Luftaufnahme der alliierten Streitkräfte vom September 1944, die von dem damals noch unzerstörten Hettstadt zeugt.
Ich wünsche meinen Lesern mit diesem Buch.
Hettstadt im November 2018
Mike Geis
Der Wiederaufbau Hettstadts
Das Regime der Nationalsozialisten im sogenannten Dritten Reich, war für die Bürger von Hettstadt zu Ende. Am 1. April 1945 hatten amerikanische Streitkräfte nach harten Kämpfen gegen Einheiten der deutschen Wehrmacht den Ort erobert und somit befreit.
Doch die Eroberung Hettstadts durch die amerikanischen Streitkräfte bedeutete, aufgrund der harten Kämpfe, massive Schäden für den Ort. Neben dem Tod von zehn Zivilpersonen, darunter auch zwei Kinder, brachten, bedingt durch die Brände, vor allem die zerstörten Gebäude und das getötete Vieh, sehr große Einschnitte für die Bevölkerung mit sich.
Anhand von Protokollen der Gemeinde Hettstadt, von Veröffentlichungen, Niederschriften des damaligen Pfarrers August Wörner und vielen Gesprächen mit Hettstadter Bürgern, die zu dieser Zeit Kinder, Jugendliche oder bereits Erwachsene waren. habe ich versucht. den anstrengenden Prozess des Wiederaufbaus von Hettstadt darzustellen.
Der Zustand des Ortes
Der ganze Ortskern von Hettstadt, bestehend meist aus Bauernhöfen, war ausgebrannt, sehr viel Hab und Gut zerstört: landwirtschaftliche Maschinen, Gerätschaften und auch Vieh, mithin bei vielen Leuten die Grundlage ihrer Existenz.
81 Wohnhäuser, das waren 50 Prozent, sowie 75 Scheunen und 77 Ställe waren zerstört. 21 Prozent der Viehbestände, davon 147 Stück Großvieh wie Rinder und Pferde, waren tot und 67 Prozent der Futtervorräte vernichtet. Ca. 300 Personen aus 99 Haushaltungen, das entsprach 39 Prozent der Bevölkerung, waren obdachlos.
Der Schaden nur an den Gebäuden wurde von offizieller Seite auf 1,3 Millionen Reichsmark (RM) geschätzt.
Erschwerend kam hinzu, dass es weder eine Telefonverbindung-noch eine Postverbindung gab. Das gesamte öffentliche Leben lag darnieder. Es gab nur die Militärverwaltung, und diese hatte andere Schwerpunkte, als sich um die anstehenden zivilen Belange zu kümmern.
Es gab vorerst keine öffentlichen Stellen, an die sich Zivilpersonen oder Gemeindevertreter wenden konnten. Die Gemeinderäte des alten Regimes waren von der amerikanischen Militärverwaltung sofort abgesetzt worden. Der bisherige Bürgermeister August Wolf hatte nur eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten, da er von den Nationalsozialisten eingesetzt worden war. Es herrschte über etliche Monate ein Vakuum. Eine der wenigen „offiziellen“ Respektspersonen war Pfarrer August Wörner. Schon während der Angriffe am 1. April hatte er Übermenschliches geleistet, um Leben zu retten und die Brände im Dorf einzudämmen. Das Viertel um das Pfarrhaus und die Kirche herum verzeichnete die geringsten Gebäudeschäden, was unter anderem seinem großen Einsatz zu verdanken war.
In den ersten beiden Wochen nach der Eroberung Würzburgs am 6. April 1945 durch die amerikanischen Streitkräfte gab es keine öffentliche Ordnung. Man nannte diese beiden Wochen „die Besatzungsohnmacht“.
Auch die Landkreisverwaltung lag darnieder. Erst am 25. Juli 1945 wurde von den Amerikanern der Würzburger Rechtsanwalt Michael Meisner zum Landrat ernannt. Dieser baute nach und nach wieder eine handlungsfähige Verwaltung auf.
Ein jeder musste für sich selbst sorgen. Plünderungen waren keine Seltenheit. Auch von Hettstadter Bürgern wurde immer wieder erzählt, dass ein Lager in Zell am Main ausgeräumt wurde. Wer die Möglichkeit hatte dorthin zu kommen, holte was er nur tragen konnte. Mit Handwägen, in Rucksäcken oder mit noch vorhandenen Leiterwägen wurde das Beutegut nach Hettstadt gebracht.
Außer einem Fahrrad und einem Fuhrwerk von Heinrich Kempf- gab es keine weiteren Fahrzeuge mehr in Hettstadt. Mit dem Fahrrad wurden die Fahrten unternommen, um Maurer und Zimmerleute zu finden, die bereit waren, beim Wiederaufbau von Hettstadt zu helfen. Es wurde nach Werkzeugen, Maschinen und sonstigem Baumaterial gesucht. Doch fast überall fehlte es an allem. Gerade Arbeiter fehlten völlig. Die wenigen, die es gab, waren im zerstörten Würzburg eingesetzt.
Um das Fuhrwerk des Gastwirtes Heinrich Kempf zu benutzen, bedurfte es aber der Genehmigung der Militärregierung, doch diese ließ lange auf sich warten.
All diese Hindernisse konnten die Einwohner von Hettstadt aber nicht stoppen. Sie gingen sofort ans Werk. Und so waren trotz all dieser Widrigkeiten im Oktober 1946 bereits 21 Wohnhäuser, 4 Scheunen und 38 Stallungen wieder aufgebaut.
Grundversorgung
Auch viele Geschäfte und Betriebe waren nach dem Angriff zerstört und konnten nicht arbeiten bzw. produzieren.
Gerade die lebensmittelverarbeitenden bzw. - produzierenden Betriebe hatten absoluten Vorrang vor allen anderen wichtigen Aufgaben, da sie überlebensnotwendig waren.
Das gemeindliche Backhaus war zum Glück unbeschädigt geblieben. Der freie Platz um das Backhaus herum hatte es vor dem Feuer verschont. Eine der ersten organisatorischen Maßnahmen des im Juli 1945 neu eingesetzten Gemeinderates war, die Nutzung im gemeindlichen Backhaus zu regeln. Die Reihenfolge, in der die Einwohner backen durften, wurde ausgelost. Man nannte das „Spielen“. Meist backten zwei Parteien gleichzeitig, da zwei Öfen vorhanden waren. Im Sommer wurden fünf Durchgänge gebacken. Im Winter vier. Immer von Montag bis Samstag. So konnten viele Einwohner ihren Bedarf an Brot decken. Zudem hatten etliche Höfe eigene Backöfen, die genutzt wurden.
Bäckerei von Peter Gehr, links im Hof sieht man das alte Haus
Bei der Bäckerei von Peter Gehr war das zur Würzburger Straße stehende, 1938 erbaute Gebäude von den Flammen verschont geblieben. Nur das alte Wohnhaus im hinteren Teil des Hofes war abgebrannt. So konnte bei Gehr nahtlos die Versorgung mit Brot wieder aufgenommen werden soweit Mehl vorhanden war. Die Bäckerei von Robert Noeth- gegenüber, war schwerer beschädigt. Hier wurde auf das erhaltene Erdgeschoss ein Notdach aufgebracht, damit zumindest gebacken werden konnte.
Die Bäckerei von Robert Noeth – vor der Zerstörung ca. 1920
Die Gebäude der Metzgereien Georg Schmitt, Adlergasse 1, und Michael Siedler, Würzburger Straße 56, waren zum Teil zerstört, ebenso das Haus des Schmieds Michael Blatz.
Metzger Siedler konnte recht schnell eine provisorische Metzgerei eröffnen. Das Wohnhaus war zwar total zerstört, das Schlachthaus und die Metzgerei waren aber weitestgehend erhalten geblieben. Allerdings wohnte die Familie bis 1959 in den Baracken. Erst dann konnte sie die neu erbaute Metzgerei in der Kirchgasse beziehen.
Metzger Georg Schmitt war zu alt, um einen Neuanfang zu wagen.