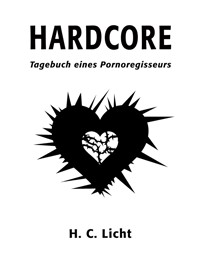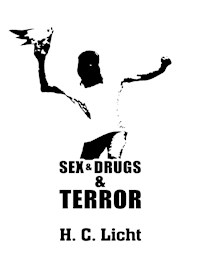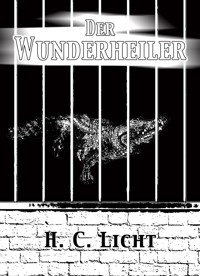
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der Kurierfahrer Reiner bei einer seiner "Extratouren" mit fünfzehn Kilo Koks erwischt und zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt wird, macht er sich auf die Suche nach einem Fluchtweg in die Freiheit. Dabei entdeckt er seine Gabe über das Wasser und durch Mauern zu gehen. Auch wenn er im Knast sitzt, seine Gedanken sind frei und sein Geist ist es auch. Reiner begreift, er ist in seinem Leben an einer entscheidenden Weggabelung angekommen und, dass es nun darum geht, die richtige Entscheidung zu treffen. Weiße oder schwarze Magie, will er den dunklen Wolf füttern oder den hellen? Doch dann geschieht ein Unglück und Reiner bleibt nichts anderes übrig, als seiner Bestimmung zu folgen, vom Drogenkurier zum Wunderheiler in nur einem einzigen Jahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
H. C. Licht
Der Wunderheiler
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Nachts im Knast
Familienbande
Schwesterherz
Auf der Reeperbahn nachts um halb eins
Krumme Geschäfte
Verfolgungsjagd
Im Hinterzimmer
Die Traumfrau
Polizeikontrolle
Gefängnisalltag
Rache ist süß
Einsam und lüstern
Besuchszeit
Kindheitserinnerungen
Schmerz und Respekt
Kind in Not
Auf Reisen
Transformation
Ein schöner Tag, um zu leben
Neustart
Ein altbekannter Quälgeist
Stirb und werde
Ein vergifteter Ort
Transzendentales Feedback
Impressum neobooks
Nachts im Knast
Vom Drogenkurier zum Wunderheiler in einem einzigen Jahr, so eine steile Karriere muss mir erst einmal jemand nachmachen, dachte er.
Auch wenn dieser ungewöhnliche Werdegang ein ziemlich harter Trip gewesen war, erzeugte sein Gedankengang eine Woge beschwingter Heiterkeit in ihm. Glucksend stieg sie in seiner Kehle auf und verlor sich als leises Gelächter im ungastlichen Halbdunkel der nächtlichen Arrestzelle.
Nein, die Fähigkeit sich nach Herzenslust über die Irrungen und Wirrungen seines chaotischen Daseins amüsieren zu können, hatten sie ihm nicht austreiben können. Weder irgendwelche selbstgefälligen Wichser mit dem Hang zu Chefallüren, noch die gestörten Killertypen von der Mafia, nicht einmal die brutalen Menschenschinder, die sich Gefängniswärter schimpften. Wirklicher Humor wurde einem nicht geschenkt oder in die Wiege gelegt, Humor musste man sich erarbeiten und dann für seinen lebenslangen Erhalt kämpfen. „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“, war ein Spruch, der sich prima auf seinem Grabstein machen würde, als Motto und Fazit seines Lebens sozusagen.
Schmunzelnd drehte sich Reiner auf seiner schmalen Pritsche um und starrte auf die schwarze Silhouette des engmaschigen Gitters, das vor dem einzigen Fenster des Raums angebracht war. Die großen Flutlichter im Innenhof des Gefängnisses wurden jeden Abend bei Dämmerung angezündet und erst bei Sonnenaufgang ausgeschaltet. Sie tauchten die Nacht außerhalb der Zellen in eine künstliche Atmosphäre. Der menschenleere, hell ausgeleuchtete Innenhof wirkte wie ein Fußballstadion ohne Spieler und Publikum.
Auch wenn Reiner inzwischen recht routiniert war im Umgang mit Störungen aller Art, glich es jedes Mal einem Kraftakt geistiger Kontemplation, die nächtliche Geräuschkulisse des Gefängnisses aus seinem Bewusstsein herauszufiltern. Wobei die größte Herausforderung natürlich darin bestand, sich nicht von dem phasenweise extrem lauten Schnarchen, Schmatzen und Grunzen seines kaum zwei Meter entfernten Zellengenossen aus der Ruhe bringen zu lassen.
Manchmal brauchte Reiner zwei Anläufe und mehr, um sich in die richtige Stimmung zu versetzen. Wenn er sich wirklich fallen lassen wollte, und das war eine der elementaren Voraussetzungen für seine nächtlichen Streifzüge, dann musste er die Kontrolle aufgeben. Und das war einfacher gesagt als getan in dem Umfeld, das er seit ein paar Monaten sein Zuhause nennen durfte. Rund um die Uhr schienen überall Gefahren zu lauern, da fiel es ihm schwer sich zu entspannen.
Das Gefühl ständig auf der Hut sein zu müssen, wurde er los, indem er seinen Blickwinkel änderte. Erst aus der Vogelperspektive kam ihm nichts mehr wirklich bedrohlich oder dringlich vor. Er war im Knast. Das bedeutete, er verpasste entweder alles oder rein gar nichts. Welches von beidem zutraf, war letztendlich nur eine Frage der richtigen Sicht der Dinge, und Reiner hatte sich entschieden seine innere Einstellung den äußeren Umständen anzupassen.
Wozu der Stress, mir läuft nichts weg. Im Gegenteil, ich habe alle Zeit der Welt, sagte er sich immer wieder. Dieser Leitsatz war zu seinem Mantra geworden. Er hatte ihn so oft wiederholt, bis er fest daran glaubte.
Auch an diesem Abend war er nach ein paar lockeren Atemübungen die Ruhe selbst und in seiner Mitte angekommen, sodass er gesammelt und hochkonzentriert in dem stillen Ozean seiner Erinnerungen abtauchen konnte. Er begab sich auf eine Traumreise, wobei der Begriff „Traum“ nicht wirklich treffend beschrieb, worum es bei diesen Ausflügen ins Geisterland ging. „Innere Reise“, das definierte es wesentlich besser, sie war als allabendliches Ritual inzwischen zu einem festen, unverzichtbaren Bestandteil seines Gefängnisalltags geworden.
Spät abends, nachdem die Lichter im Knast ausgegangen waren und die regelmäßigen Atemzüge seines Zellengenossen davon kündeten, dass er tief und fest schlief, nahm Reiner Anlauf und sprang kopfüber in den Fluss der Geschichte, der die Vergangenheit mit der Gegenwart verband. Und während Zeit und Raum sich allmählich auflösten und schließlich bedeutungslos wurden, ließ er sich treiben. Er schwebte er mit offenen Sinnen durch eine Welt, in der es keine Gefängnisse, Verbote und Strafen gab, durch eine Welt ohne Grenzen.
Seine Erfahrungen machten ihm Mut sich immer weiter vorzuwagen. Auf jeder neuen Reise konnte er die Highlights seines bisherigen Lebens ein bisschen bewusster und zielgerichteter ansteuern. Manchmal schwamm er ans Ufer des Zeitstromes und warf seine Rute aus wie ein Angler, um bestimmte Lebensabschnitte herauszufischen und genauer unter die Lupe zu nehmen. Es überraschte ihn immer wieder aufs Neue, wie nahezu unbegrenzt die Möglichkeiten eines fokussierten, auf ein bestimmtes Ziel konzentrierten Bewusstseins waren.
Er hatte eine Grenze überschritten, und wusste, es gab kein Zurück. Dafür gab es aber auch kein Limit mehr. Wieweit er in Zukunft gehen würde, bestimmte allein er selbst.
In dem Neuland, das er sich anschickte zu erobern, wurde aus dem ewigen Opfer ein Mann, der auf eigene Faust handelte. Sobald er die Grenze zur anderen Welt übertreten hatte, legte er die Rolle des Losers ab und verwandelte er sich in einen mutigen Abenteurer, in seinen eigenen Helden. Seit er sich aufgemacht hatte, die geistige Sphäre zu erforschen und die in ihr verborgenen Möglichkeiten auszuloten, war etwas in ihm geheilt. Statt der ewigen nörgelnden Stimme in seinem Kopf, die ihn mit Kritik und Hohn überschüttete, empfand er plötzlich Selbstrespekt. Und dort, wo ihn vorher ein düsterer Abgrund voller Ängste das Leben zur Hölle gemacht hatte, war nun ein gewisses Maß an Vertrauen eingekehrt, Vertrauen darin, dass er auf einem guten Weg war.
Doch bevor er an diesem, nach vorübergehender Erlösung klingenden Punkt in seinem Leben anlangte, wurde er auf Herz und Nieren geprüft von einer Realität, die zunächst härter zu sein schien als er selbst und an der er zu zerbrechen drohte. Nach einigen ziemlich schmerzhaften körperlichen Auseinandersetzungen erkannte Reiner, dass der, in modernen Gesellschaften bezüglich Menschenwürde und Meinungsfreiheit grundsätzlich vorherrschende Konsens im Bau null und nichtig war. Ein Mangel, der sogar auf Gefängnisse zuzutreffen schien, die sich inmitten des angeblich freiheitlich demokratischen Deutschlands befanden. Erst jetzt, hinter Gittern, erkannte Reiner was für ein Privileg es war, jederzeit ungestraft seine Meinung äußern zu können.
Trotz alledem konnte er den Knast inzwischen als guten Lehrer sehen. Ohne ihn hätte sich sein Talent zum außerkörperlichen Reisen nicht entpuppt, und das Reiten auf den Schwingen seines Gedächtnisses wäre niemals zu seinem heimlichen Steckenpferd geworden. Wenn man den Himmel monatelang nur durch engmaschige Gitter betrachten konnte und selbst beim Hofgang nichts als hohe Mauern und finstere Visagen um sich hatte, musste man sich geheime Hintertüren suchen, um dem alltäglichen Wahnsinn zu entfliehen. Im Gefängnis konnte man sich nicht frei bewegen, frei sprechen schon gar nicht, nur im Geiste konnte man hier wirklich frei sein. Hier im Bau gab es keinen anderen Ausweg als denjenigen, der nach innen, direkt in die Quelle des Bewusstseins führte.
Die Geistreisen waren Reiners Freigänge. Sie hielten ihn am Leben.
Die Psychologen, diese elitäre Kaste aufgeblasener Klugscheißer, behaupteten ja, Menschen seien grundsätzlich nicht imstande sich frühkindlicher Erfahrungen zu entsinnen. Mochte ja sein, dass diese Faustregel auf den Großteil der Erdbevölkerung zutraf, für ihn galt sie jedenfalls nicht. Nach einer längeren Phase intensiven Trainings war er inzwischen in Lage in dem weiten Feld seines Gedächtnisses fast bis zum Zeitpunkt seiner Geburt zurückzureisen. Allabendlich koppelte er sich von allen irdischen Gesetzmäßigkeiten ab, um sich schwerelos und ohne jeden Kraftaufwand wie ein zauberischer Schwimmer entgegen dem Zeitstrom flussaufwärts treiben zu lassen.
Nahezu lückenlose Protokolle vergangener Ereignisse und Begegnungen, sogar flüchtige Details wie das Wechselspiel in der Mimik der jeweiligen Gesprächspartner, rief er mithilfe dieser Methode ab. Mühelos entsann er sich vergangener Szenarien, gelegentlich konnte er sogar Einzelheiten in Räumen und Landschaften ausmachen, die ihm ursprünglich, im eigentlichen Moment des Erlebens, entgangen waren. Von vielschichtigen Geräuschkulissen bis hin zu komplexen Gerüchen flogen ihm die Bausteine der Vergangenheit wie selbstverständlich zu und verfingen sich im Netz seines Bewusstseins. Alles, was er dafür tun musste, war sich auf einen bestimmten Punkt auf der Zeitachse seines Lebens zu konzentrieren und fallen zu lassen. Solange er offenen Herzens war, vorurteilsfrei und ohne zu bewerten auf Empfang blieb, liefen selbst die, in den tiefsten Schichten seines Unterbewusstseins beheimateten Erinnerungen in epischer Breite vor seinem inneren Auge ab wie ein Hollywoodfilm.
Zu den frühesten Erlebnissen, die er aus der phasenweise undurchdringlich anmutenden Schwärze seiner Gedächtnislücken ans Licht holen konnte, zählte eine Begegnung mit einem leibhaftigen Teufel. Nur zögerlich, bruchstückhaft hatte sie sich ihm nach und nach offenbart, als schämte sie sich für ihre Existenz.
Da! Unwillentlich zuckte Reiner auf seiner Pritsche zusammen, als sich das fremdartige Wesen plötzlich aus den Schatten erhob. Wie auf Kommando tauchte es aus der Versenkung auf und betrat die Bühne, als hätte es die ganze Zeit, zum Greifen nahe, im Dunkel des Hintergrunds gestanden und auf seinen Einsatz gewartet.
Als ob eine eisige Hand der Länge nach über seinen Körper streichen würde, lief ein eisiger Schauer über seine Haut. Trotz der Bettdecke begann er zu frieren. Es war jedes Mal das Gleiche. Kaum hatte er an ihn gedacht, schälte er sich aus dem undurchdringlichen Dunkel, das hinter Reiners geschlossen Augenlidern herrschte. Sein Erscheinen versetzte ihn in die Vergangenheit.
Die schweren Vorhänge waren zugezogen, im Zimmer war es stockfinster. Er fand sich auf dem Rücken liegend wieder, im Körper eines Babys. Reiner nahm wahr, wie abhängig und hilflos ein Mensch sich in den ersten Monaten nach seiner Geburt fühlte. Es war kaum auszuhalten und ließ sich wohl nur mithilfe des hohen Maßes an Urvertrauen ertragen mit dem Kinder auf die Welt kommen.
Als nächstes erinnerte er sich daran herzzerreißend geweint zu haben. Der Grund dafür blieb unklar. Nächtelang hatte er geweint, doch weder Vater noch Mutter schienen ihn zu hören. Vielleicht waren sie aber auch einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt und wollten nicht gestört werden.
An ihrer Stelle trat irgendwann ein besonders unheimliches Exemplar der Gattung ewiger Widersacher in Erscheinung. Wie aus dem Nichts erschien es im Kinderzimmer, näherte sich auf leisen Sohlen dem Gitterbettchen und beugte sich über den kleinen Reiner. Mit ruhigen, behutsamen Bewegungen, als befürchte es seinen zarten Körper zu zerbrechen, hob das Ungetüm ihn hoch und wiegte ihn in seinen pelzigen Armen,
Obwohl ein Teufel, als pfiffiger, mit allen Wassern der Unsterblichkeit gewaschener Formwandler, in wesentlich spektakulärerer Gestalt hätte auftreten können, entschied er sich für ein klassisches Klischee. Ausgestattet mit einem gewaltigen Vollbart und den langen, gedrehten Hörnern eines ausgewachsenen, männlichen Widders ähnelte seine Erscheinung einer der Illustrationen, die man in den Märchen der Gebrüder Grimm finden kann. Offensichtlich war es ihm wichtig möglichst umgänglich und zutraulich zu wirken. Er spielte die Rolle einer etwas wunderlichen, aber zärtlichen Vaterfigur, um dem Kleinkind keine Furcht, sondern Vertrauen einzuflößen.
Im Knast hatte Reiner jede Menge Zeit zur Verfügung, um solchen frühkindlichen Erinnerungen auf den Grund zu gehen. Nachdem Reiner wochenlang erst sein eigenes und, als er dort nicht fündig wurde, das sogenannte kollektive Bewusstsein nach einer Erklärung durchstöbert hatte, kam er zu dem Schluss, dass diese seltsam anmutende, möglicherweise eingebildete Begegnung aus dem Schmerz tiefster Einsamkeit geboren worden war. Sie resultierte aus einem lange andauernden Zustand der Isolation, die sich wie ein roter Faden durch seine Kindheit und frühe Jugend zog.
Es war kein großes Geheimnis, dass ungewollter Nachwuchs, der sich verlassen und ungeliebt fühlte, dass Babys, deren Gefühl der Ungeborgenheit zum Himmel schrie, ein gefundenes Fressen für die bösen Götter waren. Diese üblen Gesellen hatten schon immer ein untrügliches Gespür für Menschen in Not. Kaum hatten sie deren Witterung aufgenommen und, wie in Reiners Fall, den süßen Duft hilflosen und von Schmerz erfüllten Frischfleischs in ihren feinen Nasen, stiegen sie aus ihren Höllen herab, um sich schnurstracks in ihre Wirtskörper zu bohren. Die Teufel waren routinierte Parasiten und hatten stets einen ausgeklügelten Plan in petto, wie sie ihre hinterhältigen Ränke schmieden mussten, um ihre Opfer in ihre engmaschigen Netze zu locken.
Und so blieb nicht bei dem einen Teufel, der die Rolle des herzensguten Daddys spielte. Nein, wo ein Teufel auftauchte, waren die anderen nicht weit. Angesichts der gruseligen Besucher, die sich Nacht für Nacht die Klinke seiner Kinderzimmertür in die Hand gaben, weinte und schrie Baby Reiner noch verzweifelter als zuvor. Er rief nächtelang um Hilfe, doch bis auf das gellende Echo seiner Stimme blieb sein Flehen unbeantwortet. Um ihn herum herrschte tiefste Nacht und Totenstille, und nur das wie von elektrischer Spannung aufgeladene Knistern in der Atmosphäre verriet, dass ihn, verborgen in der undurchdringlichen Finsternis, Legionen diabolischer Nachtmahre belauerten.
Wie alle Neugeborenen hatte Reiner zu dieser Zeit noch einen winzigen Körper bewohnt und war dementsprechend wehrlos, und vor allem rundum abhängig von den ihm zugeteilten erziehungsberechtigten Personen. Was den Entwicklungsgrad seines Bewusstseins betraf, war er allerdings schon damals, kurz nach seiner Geburt, ziemlich alt und weise. Er konnte sich sogar noch vage daran erinnern, dass er, im Gegensatz zum Großteil seiner Mitmenschen, freiwillig reinkarniert und auf die Erde zurückgekommen war.
Ein Schritt, der in den Kreisen Erleuchteter als eher ungewöhnlich galt. Wenn ein Wesen dem, aus irdischer Sicht, ewiglich erscheinenden Kreislauf des Lebens einmal entronnen war, konnte es sich glücklich schätzen, ihn endlich hinter sich zu haben. Sich abermals auf das Rad von Tod und Wiedergeburt flechten zu lassen, wäre für die Meisten einer Foltermethode gleichgekommen.
„Nochmal einen Fuß auf das hammerharte Pflaster des Lebens setzen? Nur über meine Leiche, und selbst dann nur höchst widerwillig.“, lautete die Standardantwort auf entsprechende Anfragen. Kein Geist, der den Grad der Vollendung erreicht hatte und einigermaßen bei Verstand war, würde freiwillig noch einmal in der sterblichen Hülle eines irdischen Wesens inkarnieren.
Bei Reiners Beschluss sich erneut auf die brandgefährliche Bühne irdischen Lebens zu begeben, handelte sich also um eine Entscheidung, die kein Lebewesen aus Jux und Tollerei, sprich ohne einen triftigen Grund traf. Doch den hatte Reiner in der Tat. Kurz nach seiner Geburt, also auch noch während der unerfreulichen Begegnungen mit den Teufeln, konnte er sich noch sehr gut an seinen Beweggrund erinnern. Die Kenntnis über die Vorgeschichte dieser Reise war tief in seinem Bewusstsein verankert.
Und während ihm die Teufel, nach dem Prinzip „Zuckerbrot und Peitsche“, abwechselnd fürsorgliche Gefühle vorgaukelten und Furcht einflößten, entsann sich der klitzekleine Reiner, dass er sich, bevor er im Schoß seiner Mutter zu wachsen begann, für eine dringliche himmlische Mission zur Verfügung gestellt hatte. Lange vor seiner physischen Ankunft auf der Erde hatte er eine komplexe Aufgabe übernommen, deren Erfüllung allen lebendigen Wesen zugute kommen, ihr Leben etwas lichter und hoffnungsvoller machen würde.
Da es in der geistigen Welt so gut wie keine Geheimnisse gab, hatte die Chefetage der dunklen Mächte von seinen Plänen selbstverständlich schnell Wind bekommen. Das war auch der eigentliche Grund, warum ihn die Teufel nächtens so oft heimsuchten. Sie waren darüber im Bilde, dass in der sterblichen Hülle des süßen, unschuldigen Babys mit dem Vornamen Reiner ein ausgewachsener Engel steckte und dieser den magischen Schlüssel Mitgefühl in seinem Herzen trug.
Sein Verständnis für das Große und Ganze und seine Zusammenhänge, sein Bewusstsein, dass das Alles miteinander verbunden war und vor allem seine nahezu unverwüstliche Liebesfähigkeit machten ihn zu einem schwer einzuschätzenden Gegner, von dem potentiell eine große Gefahr ausging. Reiner hatte das Zeug dazu, eine Vielzahl zukünftiger diabolischer Schachzüge ins Leere laufen und wirkungslos verpuffen zu lassen. Daher hatte die Geheimgesellschaft der Teufel extra einen der ihren abkommandiert, um den Engel in einen gefallenen Engel zu verwandeln. Das schwarzherzige Wesen sollte den himmlischen Agenten auf direktem Weg in einen der finsteren Abgründe locken, die die schwarze Bruderschaft auf der Erde so reichlich installiert hatte.
Und der ewige Bösewicht hatte schon ein guten Plan, einen wahrhaftigen Masterplan, ausbaldowert, wie er das bewerkstelligen wollte. Er würde diesem Wächter der Liebe so viele Steine in den Weg legen wie nötig waren, um ihn zu Fall zu bringen. Er würde seinen Geist verwirren, bis er nicht mehr wusste, wo oben und unten war. Er würde ihm so lange und unerbittlich zusetzen, bis er vom Pfad der Tugend abkam. Er würde ihn dazu bringen, dass er den Zeitpunkt seiner Geburt verfluchte. Er musste es unter allen Umständen schaffen, Reiner umzudrehen und in einen Diener der dunklen Mächte zu verwandeln.
Familienbande
Knapp ein Jahr zuvor saß Reiner noch nicht im Gefängnis und konnte sich mit Fug und Recht als freien Mann bezeichnen. Aber was hieß schon frei, wenn man sich als Mensch zweiter Klasse, der er als Ungelernter war, von einem Hilfsjob zum nächsten hangelte? Wenn man wie er jeden Euro zweimal umdrehen musste, war das kein Leben, sondern nichts weiter als ein ständiger Kampf ums Überleben.
Verdammt noch mal, selbst für seine Verhältnisse hatte er in letzter Zeit extrem viel Pech gehabt. Glücklicherweise war er mit einer sprichwörtlichen Engelsgeduld gesegnet. Als fester Bestandteil seines Charakters hatte sie sich in der Vergangenheit oftmals als Rettungsanker erwiesen. Ihr verdankte er seine bemerkenswert lange Zündschnur und sein überdurchschnittlich sonniges Gemüt. Nichtsdestotrotz wurde ihm die ganze Achterbahnfahrt namens Leben manchmal definitiv zu bunt. In solchen schwachen Momenten neigte er dazu, sich unheilschwangere Verschwörungstheorien aus den Fingern zu saugen. Dann überwältigten ihn dunkle, bleischwere Endzeitgefühle und er war plötzlich fest davon überzeugt, dass es in seinem Leben nicht mit rechten Dingen zuging.
Irgendeine Erklärung musste es doch dafür geben, dass er das Unglück anzog wie Scheiße die Fliegen. Egal was für vielversprechende Projekte er in Angriff nahm und wie sehr er sich auch abstrampelte, seine Ambitionen schienen von vornherein zum Scheitern verurteilt zu sein. Alle seine Bemühungen seine unbefriedigende Situation auf ein Mindestmaß an Lebensqualität aufzuwerten, selbst noch so vielversprechende, akribisch ausgefeilte Zukunftspläne entpuppten sich im Handumdrehen als unrealistische Totgeburten. Kurz gesagt, eine Pechsträhne folgte auf die nächste.
Reiners bisheriger Lebenslauf sprach für sich und hätte als schriftliche Bewerbung, für den mehr als unwahrscheinlichen Fall, dass er etwas Derartiges jemals in Angriff nehmen sollte, fraglos schnell den Weg in den nächsten Mülleimer gefunden. Auf einen, von einem unterdurchschnittlichen Notendurchschnitt gekrönten Abschluss in mittlerer Reife folgte ein gutes Dutzend Aushilfsjobs, von denen er keinen länger als ein paar Monate durchhielt. Beliebig aneinandergereihte Aktivitäten, die letztendlich nur eines gemeinsam hatten, nämlich, dass ein zu Tode gelangweilter Reiner ihm mit derselben Lustlosigkeit und einer demonstrativ zur Schau getragenen sauertöpfischen Miene nachging.
Er war Mitte Zwanzig, als er schließlich mangels besserer Alternativen einem Verein von Kurierfahrern beitrat und sich in die Armee von Scheinselbstständigen einreihte, die die Straßen unsicher machten, indem sie ihre verbeulten Kleinbusse an jeder Ecke in der zweiten Reihe parkten, während sie stapelweise Pakete und eilige Briefsendungen an Gott und die Welt auslieferten. Das klang nach -Zuviel zum Sterben und zu wenig zum Leben-, nach Hungerlohn und jeder Menge Stress, aber es war immer noch besser, als an der Nabelschnur des Arbeitsamts zu hängen oder, noch schlimmer, tagtäglich von früh bis spät nach der Pfeife irgendeines machtgeilen Arbeitgebers zu tanzen.
Während seiner Odyssee durch die Niederungen des Niedriglohn-Markts hatte er die leidvolle Erfahrung gemacht, dass Chefs ohne Chefallüren ausgesprochen rar gesät waren. Seine bisherigen Brötchengeber waren jedenfalls durch die Bank erfolgsverwöhnte Jungunternehmer mit absurd aufgeplusterten Egos gewesen, die von ihm erwarteten, dass er für einen Hungerlohn rund um die Uhr bereit war auf Abruf Scheiße zu schaufeln und obendrein auch noch widerspruchslos ihre cholerischen Anfälle zu ertragen. Nein danke, auf die Rolle des unterbezahlten Blitzableiters vom Dienst hatte er definitiv keinen Bock mehr. Das war eine moderne Form der Sklaverei.
Beim Stichwort Arbeitssklave trat ihm sofort die ausgemergelte Gestalt seines Vaters Dirk vor Augen. Dieser war schon ein alter Mann, als er heiratete und Kinder in die Welt setzte, heute, als Frührentner, wirkte er wie ein Tattergreis und wurde, bei gelegentlichen gemeinsamen Einkäufen im Supermarkt, für sein Opa gehalten. Sein Vater Dirk strahlte mit seinen sechsundsechzig Jahren vor allem eines aus: Dass er mit dem Leben abgeschlossen hatte und nur noch auf ein baldiges Ableben wartete.
Wie alle Söhne hatte Reiner es natürlich besser machen wollen als sein Erzeuger. Alles schien besser zu sein, als auf dem gleichen gesellschaftlichen Abstellgleis zu enden wie er. Als Verwaltungsfachangestellter bei der deutschen Bahn wurde er sogar einmal zum Mitarbeiter des Monats gekürt, sein Einkommen reichte dennoch hinten und vorne nicht. Obwohl Reiner ihn insgeheim für seinen duckmäuserischen Charakter und seine, jeden kleinsten Funken Spontanität absorbierende, Berufswahl verachtete, besuchte er ihn regelmäßig. Irgendwie fühlte er sich dazu verpflichtet in der, nach Alter und Müll müffelnden Absteige seines Vaters vorbeizuschauen, ab und zu nach dem Rechten zu sehen und sich zu vergewissern, ob auf dem durchgesessenen Sofa nicht inzwischen ein halb verwester Leichnam vor der Flimmerkiste saß und die Luft verpestete.
Die sporadischen Stippvisiten waren kein Liebesdienst, Reiner raffte sich mehr aus Mitleid, als aus wirklichem Interesse zu ihnen auf. Kein Wunder, denn die Atmosphäre zwischen ihnen fühlte sich bei den meisten ihrer Begegnungen inhaltsleer und unterschwellig toxisch an. Beide hatten sich längst damit abgefunden, sich nicht mehr besonders viel zu sagen zu haben. Aber was heißt schon „nicht mehr“? Soweit Reiner sich erinnern konnte, hatte sich ihr Austausch schon immer auf belanglosen Smalltalk beschränkt. Alle heiklen Themen, speziell die persönlichen oder politischen Inhalts, klammerten sie traditionell aus.
Und so entwickelten sich seine Besuche bei dem alten Mann nach und nach zu einem abgekarteten Trauerspiel, zu einem stereotypen Ritual bitterböser Realsatire, bei dem sie beide, Vater und Sohn, auf bestimmte Rollen festgelegt waren, von denen abzuweichen sie nicht einmal mehr auf den Gedanken kamen. Sie hatten sich aufeinander eingespielt wie verbitterte Eheleute, die allein aus alter Gewohnheit nicht voneinander schieden.
Reiner und seine Schwester Maria hatten die elterliche Wohnung vor einer halben Ewigkeit verlassen. Beide konnten sich noch gut daran erinnern, wie erleichtert sie damals gewesen waren, endlich flügge genug zu sein, um ihre eigenen Wege gehen zu können, egal wie desaströs diese manchmal auch aussehen mochten.
Heike, ihre Mutter, folgte ihnen kurz drauf nach. Schon lange vor dem Auszug ihrer Kinder hatte sie das Warten auf bessere Zeiten satt gehabt. Auch wenn sie es sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingestehen wollte, hatte sie längst begriffen, dass sie diese besseren Zeiten an der Seite ihres Ehemannes niemals erleben würde. Nun, nach dem Auszug ihrer Kinder fand sie sich plötzlich entbunden von allen erzieherischen Aufgaben wieder. Da erkannte sie die Gunst der Stunde, realisierte, dass ihr Leben noch nicht vorbei war und ihr noch eine gute Chance für einen Neuanfang blieb. Was sprach dagegen an der Seite eines anderen, und vor allem jüngeren und agilerem Partners das Glück zu finden, schließlich war sie auch mit Mitte Vierzig immer noch eine Augenweide, nach der sich die Männer auf Straße umdrehten. Also packte sie, als hätte sie insgeheim nur auf eine Gelegenheit wie diese gewartet, ohne eine Erklärung ihre Siebensachen und zog in eine andere Stadt.
Und nun hauste Papa Dirk, wie Reiner ihn immer noch nannte, mutterseelenallein in seiner hoffnungslos verdreckten, für eine einzelne Person viel zu geräumigen, aber inzwischen abbezahlten Eigentumswohnung. Früher, als er noch in Lohn und Brot war, während des Lebensabschnitts, den man gemeinhin als die Blüte des Lebens bezeichnet, war er Reiner vorgekommen wie eine Marionette, wie ein aufgezogenes Match-Box-Auto, das auf einer kleinen Rennbahn im Kreis rast und diese künstliche Welt für die Wirklichkeit hält. Auch heute erinnerte er ihn immer noch an eine Marionette, allerdings an eine, deren Fäden nicht mehr in der Händen eines Puppenspielers, sondern im Nichts endeten. Lustlos, richtungslos, orientierungslos und vollkommen sinnlos, ein nutzloses Häufchen Mensch, das Tag für Tag nichts tat, als lethargisch auf seinem alten knochigen Arsch zu hocken und in die Glotze zu starren.
„Vollidiot! Gib bloß den Lappen ab!“
Das war verdammt knapp gewesen. Reiner ging voll in die Eisen und schlidderte haarscharf an der Kühlerhaube eines nagelneu und sehr teuer aussehenden Mercedes der E-Klasse vorbei. In irgendeiner Zeitschrift hatte er vor kurzem gelesen, dass frontale Zusammenstöße zwischen fahrenden PKWs am gefährlichsten waren. In dem mit hochtrabenden Fachausdrücken gespickten Artikel dozierte ein Wissenschaftler über die Kräfte, die sich bei solchen Karambolagen potenzieren. Reiner hatte den Inhalt des Textes zumindest insofern verstanden, dass die Insassen der Fahrzeuge sich in solchen Unfallsituationen glücklich schätzen können, mit einem blauen Auge, beziehungsweise einem Blechschaden davonzukommen.
Unmittelbar nach dem rasanten Ausweichmanöver wechselte sein rechter Fuß vom Brems- auf das Gaspedal, als wäre er ein eigenständig denkendes und handelndes Wesen. Seine intuitives Reaktionsvermögen hatte ihn wieder einmal vor einem Crash und seinen heißgeliebten Bulli vor weiteren Beulen bewahrt.
Es gab Tage in denen das Verkehrschaos sich nicht auf die üblichen Stoßzeiten beschränkte, von früh morgens bis in die Abendstunden hinein kein Ende nahm. Dann kam ihm das unüberschaubare Straßengewirr der niemals schlafenden Großstadt wie ein Dschungel vor, eine Herausforderung, die es zu meistern galt. In diesen Momenten fühlte sich wie ein Jäger auf der Pirsch, der einen Pfad zu finden versucht, auf dem er sich möglichst unbemerkt und ohne anzuecken seiner Beute nähern kann. Ein Hindernissparkur, bei dem er manchmal vergaß, dass es sich bei einem Großteil der Verkehrshindernisse nicht um tote Gegenstände handelte, sondern um Menschen, die zur gleichen Zeit auf engstem Raum unterwegs waren und möglichst schnell an irgend ein Ziel wollten.
Aus Reiners Augenwinkeln betrachtet, verwandelten sie sich in eine undefinierbare Masse aus unkoordiniert über Gehwege und Zebrastreifen hastenden, sich wie ferngesteuert durch den Stadtraum bewegenden gesichtslosen Gestalten. Sie wirkten isoliert und bezugslos, als wäre einer dem anderen ein Fremdkörper. Ohne wirklich anwesend zu sein, starrten sie entweder aneinander vorbei und in ein alltagsgraues Nichts oder glotzten permanent auf die Displays ihrer Handys. Ganz offensichtlich handelte es sich um Wesen mit einer stark eingeschränkten Aufmerksamkeitsspanne. Bei ihnen konnte Reiner sich niemals ganz sicher sein, ob sie eine rote Fußgängerampel tatsächlich registriert hatten oder ihm im nächsten Moment vor das Auto laufen würden. So mutierten die Menschen phasenweise zu abstrakten Hindernissen, denen er bestenfalls den Wert tropischer Bäume zumaß. Er war der Jäger, sie Bestandteil eines unwirtlichen, sich jedem Eindringling mit allen verfügbaren Mitteln widersetzenden Großstadtdschungels.
Wie sehr er sich geirrt hatte, als er vor seinem ersten Arbeitstag als Kurier davon ausging, dass das Zustellen von Paketen und Briefsendungen keine allzu große Sache sein könne. Eine Einschätzung, die oberflächlich betrachtet ja zunächst auch der Wahrheit zu entsprechen schien, wenn man bedenkt, wie wenig theoretisches Wissen und Vorbildung man für diese Art von Tätigkeit mitbringen muss. Doch wie überall auf der Welt steckt der Teufel eben auch hier im Detail. Kaum, dass er losgelegt hatte, zeigte der Job sein wahres Gesicht und er musste erkennen, dass aller Anfang auch in diesem Fall schwer war, auch wenn es zunächst nicht danach aussah.
Nach einer ziemlich harten Eingewöhnungsphase, in der ihm seine Heimatstadt, die er bis zu diesem Zeitpunkt wie seine Westentasche zu kennen glaubte, plötzlich wie Terra incognita vorkam, fing er an, sie mit anderen Augen, aus dem Blickwinkel eines Kuriers, zu sehen. Er entdeckte Gesetzmäßigkeiten und Strukturen, wo er vorher nur ein Chaos aus Lärm, Abgasen und übellaunigen Gesichtern hinter Sicherheitsglas wahrgenommen hatte, er begann den geheimen Rhythmus zu hören, der hinter den Häuserfassaden den Ton angab, den Herzschlag der Großstadt.
An jedem einzelnen Tag lernte er etwas Neues dazu. Er speicherte Straßennahmen und sich wiederholende Zustell- und Abholadressen ab und lernte so nach und nach den Kundenstamm des Kurierunternehmens kennen. Je mehr Routine er bekam, desto mehr Raum blieb ihm, den Verkehrsfluss zu den verschieden Stoßzeiten zu analysieren und das Labyrinth der Häuserschluchten zu sondieren, immer auf der Suche nach neuen Schleichwegen, die ihn schneller ans Ziel bringen konnten.
Mit all den möglichen Fehlerquellen, die er mit sich brachte, glich sein Arbeitsalltag phasenweise einer Herausforderung, die ihn immer wieder an seine Grenzen brachte. Er hätte es niemals für möglich gehalten, aber auch das Kuriergeschäft kann zu einem Prüfstand werden, auf dem sich entscheidet, ob man es ernst meint oder nicht. Selbst hier, auf einer der untersten Sprossen der Karriereleiter kann man den Anspruch haben einen guten Job zu machen. In den Augen mancher seiner Kollegen existierte sogar so etwas wie ein Ehrenkodex, der sie dazu verpflichtete, Aufträge bis ins letzte Detail gewissenhaft abzuwickeln.
Wenn er sich seinen bisherigen beruflichen Werdegang anschaute und einen kritischen Blick auf sein eigenes Potential warf, konnte er keine nennenswerten Qualitäten an sich entdecken. Nein, die Schicksalsgöttin hatte es nicht besonders gut mit ihm gemeint. Nicht ohne Grund stand in krakeliger Kinderschrift der Spruch -Born to lose- auf dem Aufkleber geschrieben, der sich an der Hecktür seines VW-Busses eierschalenfarben vom dunkelblauen Lack abhob. Den Sticker hatte einer seiner Vorbesitzer dort platziert und Reiner fand keinen triftigen Grund ihn zu entfernen. Im Gegenteil, er glaubte in dem ehemaligen Eigentümer des Bullis einen Bruder im Geiste zu erkennen, der gleich ihm im Slogan -Born to lose- eine passende lakonische Zusammenfassung seines Lebensgefühls sah.
Im Widerspruch zu dem ernüchternden Fazit, dass sein Beitrag zu Wohlstand und Entwicklung der menschlichen Gesellschaft bis dato gegen null tendierte, kristallisierte sich mit seinem Eintritt in die Liga der Berufsfahrer unverhofft eine besondere Fähigkeit heraus, von deren Existenz er bislang nichts geahnt hatte. Und diese spezielle, ihm ganz offensichtlich angeborene Superkraft war seine erstaunlich gut funktionierende Intuition, was das Verkehrsgeschehen um ihn herum anging. Im Laufe der ersten Monate als Kurierfahrer entdeckte er an sich eine erstaunlich omnipräsente Wachsamkeit, die er ohne allzu viel Coffein oder andere stärkere Aufputschmittel über einen langen Zeitraum aufrecht erhalten konnte. Egal, wie wuselig, hektisch und unübersichtlich es im Stadtverkehr zuging, er behielt ständig den Überblick, erfasste die entscheidenden Details der Gesamtsituation und interpretierte das Geschehen instinktiv in Bezug auf potentielle Gefahren, und zwar ohne sich dabei besonders anstrengen müssen.
Auf der Welt existiert ein ganzes Potpourri von Gaben, herausragende Fähigkeiten, mit denen manche Menschen ausgestattet sind, Reiners bestand darin sein dunkelblaues Raumschiff störungsfrei durch das alltägliche Chaos zu navigieren. Sobald er hinter dem Steuerrad Platz nahm, legte er innerlich einen Schalter um und fing an die Welt um sich herum aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Er sah sie weitwinkelig, fast wie durch das Objektiv betrachtet, das Fotografen als Fischauge bezeichnen.
Das, was die meisten Autofahrer bis zum Anschlag unter Stress setzt, lief bei ihm nebenbei ab, wie selbstverständlich. Er hatte einen erstaunlichen Instinkt für die Ereignisketten entwickelt, die sich in der unmittelbaren Zukunft um ihn und die dunkelblaue Außenhaut seines geliebten Bullis herum entwickeln würden. Er musste nur kurze Zeit hinter einem anderen Verkehrsteilnehmer herfahren und schon wusste er über dessen Erfahrungshorizont als Fahrer Bescheid. Dann kam es ihm vor, als ob er als heimlicher Passagier auf den Beifahrersitzen ihrer Fahrzeuge säße und in ihre Köpfe hineinsehen könnte. Wie sollte es ihm sonst möglich sein vorherzusehen, wann sie, ohne zu blinken, plötzlich links ausscheren oder völlig unmotiviert abbremsen würden?
Ganz offensichtlich hatte er durch seine Arbeit als Kurier eine Art sechsten Sinn entwickelt, der es ihm ermöglichte verkehrstechnische Vorhersagen zu treffen, die allzu oft in Erfüllung gingen. Manchmal hatte er den Eindruck in die Zukunft sehen zu können. Man könnte sagen, Reiner wurde zu einem hellsichtigen Fahrer, so skurril dieses Adjektiv in diesem Zusammenhang auch klingen mag.
Am Dienstag Vormittag gegen elf Uhr entdeckte er eine Tour auf dem Display seines Handys, von der er annahm, dass sie sich lohnen könnte. Sofort meldete er sich in dem entsprechenden Sektor an. Gerade noch rechtzeitig, nur eine Minute später zeigte die Oberfläche der Kurier-App an, dass sich zwei weitere Fahrer in der Warteposition hinter ihm eingereiht hatten.
Reiner warf den Motor seines T4 an und gab Vollgas. Mit ein bisschen Glück würde er heute doch noch den Jackpot knacken. Manchmal erinnerte ihn der Job ans Lottospielen. Da er keine festen Kunden hatte, sondern immer ad hoc und direkt fuhr, wusste er morgens nie, wohin die Reise gehen und wie viel er am Ende des Tages verdient haben würde.
Die Stadt und ihr näheres Umland waren in sogenannte Sektoren eingeteilt. Ihre Bezeichnungen basierten auf dem alten System der Postleitzahlen und wurden durch jeweils drei Ziffern und ein Kürzel dargestellt, damit es für die Fahrer leichter zuzuordnen war. In dem Innenstadtbereich City-Nord, auf dem Display seines Handys als 606 CITY angezeigt, hatte er schon des öfteren lukrative Ferntouren bekommen.
Die Vorbestellung, so nannte man einen Kurierauftrag, der früh am Tag bestellt worden war, aber erst nachmittags abgeholt werden sollte, wurde nicht in dem Sektor angezeigt, in dem er gerade unterwegs war. Das GPS-Signal seines Handys, auf dem sich die eigens für die Kurierfirma programmierte App befand, ließ sich in diesem Punkt nicht manipulieren. Durch die Möglichkeit der GPS-Ortung wusste die Zentrale, sprich der Rechner, über den die Touren in die Handys der an den Kurierverein angeschlossenen Fahrer eingespielt wurde, immer genau, wo er sich gerade aufhielt.
Wenn Reiner hellsehen könnte und rechtzeitig vorher wüsste, wann und wo eine interessante Tour eingespielt würde, wäre es ja halb so wild. Dann könnte er entspannt in den jeweiligen Stadt- oder Außenbereich gondeln und sich stressfrei auf die Lauer legen. Aber leider lief das nicht so ab. Vorbestellungen wurden immer nur kurz vorher, maximal eine halber Stunde bevor sie terminiert waren, in der Sektorübersicht der App, angezeigt.
Sobald er sich in dem ungefähr zehn Kilometer entfernen Stadtgebiet angemeldet hatte, blieben ihm genau fünfzehn Minuten Zeit den von dem Zentralrechner vorgegebenen Radius zu erreichen, in dem die Tour in einer halben Stunde eingespielt werden würde. Wenn er diese Frist überschritt, den Zielort bis zu diesem Moment noch nicht erreicht hatte, flog er aus dem System raus. Dann legte ihn der Computer in der Schaltzentrale gnadenlos auf Eis. Er verlor seine Wartepostion und musste sich von neuem anmelden. Der Kurierfahrer, der, in der im System registrierten Reihenfolge, hinter ihm gestanden hatte, würde sich natürlich freuen. Er rückte auf Position eins auf und hatte nun seinerseits gute Chancen, die vorbestellte Tour zu ergattern.
Der Countdown lief. Das konnte ziemlich knapp werden. Im Gegensatz zur Fahrzeit auf der Autobahn, wo man pro Kilometer etwa eine Minute einberechnen musste, benötigte man für die selbe Wegstrecke in der Stadt etwa doppelt so viel Zeit, als zwei Minuten. Andererseits waren die vermessenen Sektoren unterschiedlich groß, sodass man den Zielbereich manchmal schneller erreichte, als vermutet.
Und so begann ein neues Rennen gegen die Zeit und Reiner tat das, was ein hochmotivierter Kurierfahrer in so einer Situation immer tun würde. Er drückte das Gaspedal bis zum Bodenblech durch, so oft es der zähe, allmählich zunehmende Feierabendverkehr zuließ. Er holte aus seinem Bulli alles heraus was möglich war und steuerte den Zielsektor an, permanent dicht an der Grenze zur Ordnungswidrigkeit. Reiner steigerte sich oftmals so sehr in diese Wettkämpfe um die Pole-Position in den, auf dem Display seines Handys hellgrün unterlegten Sektoren hinein, dass ihn ein regelrechtes Jagdfieber packte.
Bisher lief der Tag erstaunlich gut. Dabei pflegte der Dienstag normalerweise nicht gerade einer der Wochentage zu sein, der die Kasse zum Klingeln brachte. Aber heute hatte er von Anfang an diesen gewissen Flow gespürt. Auch beim Kurierfahren gab es besondere Konstellationen, frappierende Abfolgen von Zufällen, die im Nachhinein wirkten, als wären sie Bestimmung gewesen. Es gab Tage, an denen alles von einem magischen Zauber umwoben war. Der herausragend gute Geschmack des ersten Espressos am Morgen, die geschmeidige, gut geölte Reaktion des Getriebes beim Umlegen der Schaltknüppels, das zufrieden wirkende, sonore Brummen des Motors und die Begegnungen mit Kunden, die sich freuten wie die Schneekönige, weil sie ihr ersehntes Päckchen etwas früher als erwartet in den Händen hielten. Kleine Wunder, die von außen betrachtet wirkten, als seien sie nichts Besonders, sondern von banaler alltäglicher Natur. Doch in Reiners Augen waren diese Kleinigkeiten irgendwie erstaunlich und beglückend, auf eine besondere Art anrührend in ihrer schönen Einfachheit, wirklich erklären konnte er seine Wahrnehmung nicht.
Aus Reiners Sicht wohnte solchen Tage eine klangvolle Melodie inne, ein zauberhaftes Lied mit einen sehr kurzen, aber aussagekräftigen Text. Und der lautete: Go with the flow. Möglichst wenig darüber nachdenken, einfach genau so weitermachen wie bisher und mit dem Strom schwimmen, der in diesem Fall der Verkehrsfluss war. Alles, was er tun musste, war auszuliefern, gleich im Anschluss, kaum eine Häuserzeile entfernt, die nächste Sendung abzuholen, ins Auto zu steigen und loszufahren, um bald darauf in einem anderen Stadtteil erneut auszuliefern. Und so ging es stundenlang weiter, Tour auf Tour fügte sich der Arbeitstag perfekt zu einer runden Sache zusammen. Kurz gesagt, an Tagen wie diesen lief es einfach wie am Schnürchen.
Doch kaum zehn Minuten später sah die Sache an diesem Tag leider schon wieder etwas anders aus und Reiners Stimmungsbarometer fiel schlagartig um paar Grade ab. Kurz bevor das GPS seines Handys anzeigte, dass er den Sektor mit der begehrten Vorbestellung erreicht hatte, sprang der kleine, in der Kurier-App eingebettete Zähler auf Null und Reiner hatte das Rennen gegen die Zeit verloren. Der Teil des Tages, den er als Glückssträhne empfunden hatte, schien ein Ende zu haben.
„Scheiße, die Tour ist Geschichte.“, brummte er verärgert und fuhr rechts ran. Die Uhr im übersichtlich angeordneten Armaturenbrett des VW-Busses zeigte an, dass es kurz vor zwölf war. Um die Mittagszeit herum flaute das Kuriergeschäft gewöhnlich ab, ein ungeschriebenes Gesetz, das sich auch an diesem Tag bewahrheitete. Er skrollte durch die diversen Menüpunkte der App und rief den Status der Auftragslage ab.
DERZEIT KEIN AUFTRAG!
stand da in großen leuchtenden Buchstaben auf dem Display seines Handys. Normalerweise war das ein schlechtes Zeichen, in diesem Moment allerdings eine willkommene Mitteilung. Da er vormittags einen relativ guten Umsatz gemacht hatte, konnte er die Sache entspannt angehen und eine kleine Pause einlegen. In einem der zahllosen Imbisse, die in der Innenstadt an jeder Ecke ihre Spezialitäten feilboten, würde er einen Happen essen und es sich danach auf seiner provisorischen Bettstatt, die er in Form von Isomatte und Schlafsack stets an Bord hatte, auf der Ladefläche des Bullis gemütlich machen. Nach dem Essen war ein kurzes Nickerchen doch einfach das Größte. Reiner war ein eifriger Anhänger des mittäglichen Powernappings, ein Ritual, das zu einem festen Bestandteil seines Tagesablaufs geworden war und das er zelebrierte, so oft es sein Job zuließ. Er genoss es sehr, für die Dauer einer halben Stunde so richtig tiefenentspannt zu chillen und wegzudösen, um danach umso erfrischter erneut durchzustarten.
Aus dem ursprünglich geplanten kleinen Mittagshappen wurde dann allerdings ein üppiges Menü mit zwei Portionen gebackenen Bananenröllchen als Nachspeise, einem typisch asiatischen Dessert, das an diesem Tag im Angebot war. Und nun zahlte Reiner den Preis für seinen ausufernden Appetit. Niedergestreckt vom Fresskoma fläzte er auf der Ladefläche des VW-Busses und fühlte sich wie eine schwangere Schildkröte, die an der Wasserlinie eines Ozeans einen Verdauungsspaziergang gemacht hatte und unversehens von einer besonders hohen, wie aus dem Nichts kommenden Welle auf den Rücken geworfen worden war und nun hilflos der Dinge harrte, die das ungewisse Schicksal mit sich bringen würde.
Obwohl Reiner sich im turbulenten, mit jeder Menge Kundenadressen gespickten Innenstadtbereich befand, blieb sein Handy stumm. Während der letzten Stunde war ihm keine einzige Tour eingespielt worden, doch das war ihm im Moment auch ganz recht. Er ließ den Alltag los und schloss seine Augen. Während er versuchte sich zu entspannen, nahm er zunächst seinen übervollen Bauch und die bleierne Schwere seiner Gliedmaßen wahr. Bald darauf registrierte er unscharf das vollständige Versiegen seiner ohnehin spärlichen Gedankenströme und dämmerte ganz langsam weg, hinüber in die andere Welt, die ihm an diesem Tag mit farbenfrohen Landschaften aufwartete.
Der schrille Klingelton seines Handys riss ihn brutal aus seinem Schlummer. Er hatte geschlafen wie ein Stein. Ein kurzer Blick auf seine Armbanduhr sagte ihm, dass er eine geschlagene Stunde im Land der Träume verbracht hatte. Als Powernapping konnte man das nicht gerade bezeichnen.