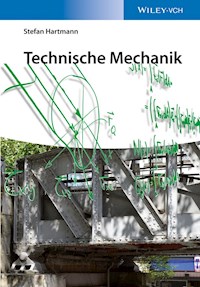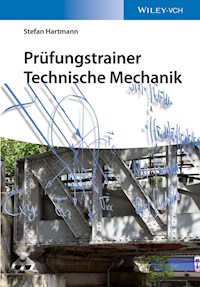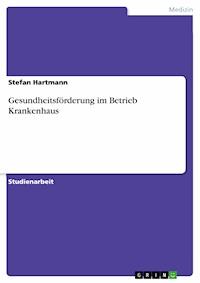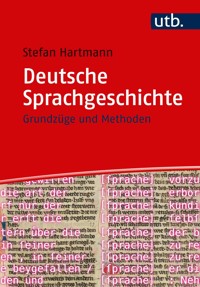
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sprache ist nichts Statisches, sondern in stetem Wandel begriffen. Um zu verstehen, wie die deutsche Sprache wurde, was sie ist, muss man sich daher mit ihrer Geschichte auseinandersetzen. Diese Einführung präsentiert umfassend, verständlich und aktuell den Stand der germanistischen Sprachgeschichtsforschung und gibt Studierenden und Lehrenden zahlreiche Methoden an die Hand, selbst historische Sprachwissenschaft zu betreiben. Von der komparativen Methode über Korpuslinguistik bis hin zu komplexen phylogenetischen Methoden wird das Repertoire der germanistischen Sprachgeschichtsforschung erklärt und mit vielen Aufgaben eingeübt. Zahlreiche Beispiele und Übungsaufgaben sowie umfangreiches digitales Begleitmaterial machen das Buch zu einem idealen Begleiter in Studium und Lehre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 622
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Hartmann
Deutsche Sprachgeschichte
Grundzüge und Methoden
A. Francke Verlag Tübingen
© 2018 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.francke.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen
ePub-ISBN 978-3-8463-4823-9
Inhalt
Vorwort
Wissenschaft kann man nicht alleine betreiben. Sie lebt vom gegenseitigen Austausch, von der Weitergabe von Wissen auf allen nur denkbaren Wegen. Wenn ich in diesem Buch versuche, einen kondensierten Einstieg in die deutsche Sprachgeschichte und die Methoden ihrer Erforschung zu bieten, dann ist das Ergebnis in jeder Hinsicht stark beeinflusst von all denjenigen, die meinen eigenen Blick auf Sprache und Sprachwissenschaft geprägt haben. Hier kann ich nur einige wenige von ihnen nennen und ihnen stellvertretend danken.
Meine sprachgeschichtliche Prägung habe ich an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz bei Damaris Nübling erfahren, die auch den Kontakt zum Narr-Verlag hergestellt und damit den Anstoß für das vorliegende Buch gegeben hat. Ähnlich prägend für meine sprachhistorische Ausbildung waren Kerstin Riedel und Sabine Obermaier. Einen großen Teil der korpuslinguistischen Expertise, die ich in den vergangenen Jahren erwerben konnte, verdanke ich meiner anglistischen Kollegin Susanne Flach (Neuchâtel). Einige sehr wertvolle Hinweise hat mir auch Andreas Klein (Mainz) gegeben.
Während meiner Promotion in Mainz hatte ich das Glück, mit großartigen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten zu können – stellvertretend seien Kristin Kopf und Luise Kempf genannt. Nicht minder großartig sind meine derzeitigen Kolleginnen und Kollegen in Hamburg bzw. (ab Oktober 2017) Bamberg, durch die ich zu vielen der im Folgenden diskutierten Themen auch neue Perspektiven entwickeln konnte. Hier danke ich besonders Renata Szczepaniak, die meine Arbeit an diesem Buch stets voll unterstützt hat. Darüber hinaus danke ich Lisa Dücker, Melitta Gillmann, Eleonore Schmitt, Daniela Schröder und Annika Vieregge für hilfreiche Anmerkungen zu einzelnen Kapiteln. Auch bin ich der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg zu Dank verpflichtet, deren Dienste ich beim Schreiben dieses Buches in teilweise doch recht exzessivem Maße in Anspruch genommen habe. Was meine Kenntnisse in der Programmiersprache R angeht, auf die sich auch große Teile des digitalen Begleitmaterials zu diesem Buch stützen, verdanke ich Fabian Barteld (Hamburg), Ash Chapman (Newcastle) und Peeter Tinits (Tallinn) vieles.
Meinen Studierenden in Mainz und Hamburg danke ich dafür, dass sie meinen Blick auf Sprachgeschichte und ihre didaktische Vermittlung immer wieder mit engagierten Rückfragen und guten Ideen geschärft haben. Auf Seiten des Narr-Verlags gilt mein besonderer Dank Tillmann Bub, der von der ersten Idee bis zur Publikation immer ein guter und verlässlicher Ansprechpartner gewesen ist, und Elena Gastring, dank deren gründlicher Durchsicht des Manuskripts ich noch zahlreiche Fehler und Unklarheiten tilgen konnte – wenn auch sicherlich nicht alle; die verbleibenden liegen selbstverständlich allein in meiner Verantwortung.
Einige Kollegen und gute Freunde haben dieses Buch besonders geprägt: Auch wenn die Grafiken, die ich erstellt habe, wohl keinen Designpreis gewinnen, wären sie ohne die Hilfe von Jonas Nölle (Edinburgh) sicherlich deutlich weniger ansehnlich geworden. Andreas Hölzl (Zürich) hat dankenswerterweise fast das gesamte Manuskript gelesen und sehr viele hilfreiche Vorschläge eingebracht. Michael und Monika Pleyer (Koblenz) haben nicht nur nützliche Rückmeldungen zur vorliegenden Einführung gegeben, sondern mir hin und wieder auch wertvolle Ablenkung von dem Buchprojekt verschafft.
Mein größter Dank gilt jedoch meiner Familie, ohne deren Unterstützung ich es sicherlich nicht geschafft hätte, zusätzlich zu einer Reihe anderer Projekte noch ein Einführungswerk zu schreiben.
Hamburg, September 2017 Stefan Hartmann
Wenn wir nicht wissen,
wie etwas geworden ist,
so kennen wir es nicht.
August Schleicher
1.Einführung
An Einführungen in die deutsche Sprachgeschichte besteht kein Mangel – warum also noch eine weitere? Die Antwort darauf ist ebenso einfach wie folgenreich für die Konzeption dieses Buches: Bücher zur deutschen Sprachgeschichte gibt es viele, aber die deutsche Sprachgeschichte muss erst noch geschrieben werden.
Das heißt jedoch keineswegs, dass ich mir anmaßen würde, die deutsche Sprachgeschichte, also das beste und umfassendste Referenzwerk über die Geschichte der deutschen Sprache zu schreiben. Ganz im Gegenteil: Einen wirklich umfassenden Überblick zu geben über die Entwicklungen, die die deutsche Sprache in den letzten knapp 1.500 Jahren durchgemacht hat, ginge weit über das hinaus, was diese Einführung leisten kann und will. Der Punkt ist ein anderer: Wissenschaft ist ein Prozess, der davon lebt, dass bestehendes Wissen hinterfragt und überprüft wird, dass Forschungslücken gefüllt werden, dass unterschiedliche Methoden und Herangehensweisen erprobt und diskutiert werden. Diese Einführung will daher zwar auch einen Überblick über die deutsche Sprachgeschichte bieten, Ihnen aber vor allem Methoden an die Hand geben, selbst Sprachgeschichtsforschung zu betreiben.
Trotz dieser recht anspruchsvollen Zielsetzung sollte sich das Buch weitgehend ohne Vorkenntnisse lesen lassen. Bis auf Grundbegriffe, die aus dem schulischen Grammatikunterricht bekannt sein sollten, werden alle wichtigen Fachtermini erklärt. Wenn doch ein Begriff unklar sein sollte, ist es heute einfacher denn je, ihn nachzuschlagen, sei es im Internet oder, noch besser, in einem Fachlexikon wie Bußmann (2008) oder Glück & Rödel (2016).
Diese Einführung reagiert mit ihrer dezidiert methodischen Ausrichtung auf Entwicklungen in der germanistischen Sprachgeschichtsforschung, die sich auch in der Lehre niederschlagen. Die historische Sprachwissenschaft des Deutschen hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen ausgeprägten Methodenpluralismus entwickelt. An die Seite qualitativer, philologisch orientierter Arbeit an historischen Texten sind mehr und mehr quantitative und empirische Methoden getreten. Viele Dozierende erwarten mittlerweile von ihren Studierenden empirisches Arbeiten auch in Seminar- und Abschlussarbeiten. In den meisten Einführungen werden aber methodische Aspekte, auch aus Platzgründen, zumeist nur am Rande erwähnt. Zum Einstieg in empirische Methoden musste man bisher auf andere Einführungswerke zurückgreifen, die aber zumeist nicht auf sprachgeschichtliche Fragestellungen zugeschnitten sind, sondern entweder synchron orientiert sind (also die Gegenwartssprache behandeln) oder aus anderen Disziplinen wie der Psychologie oder der Sozialwissenschaft stammen.
Wenn man von germanistischer Sprachgeschichtsforschung spricht, dann ist damit in aller Regel – so auch in diesem Buch – die Untersuchung der deutschen Sprachgeschichte gemeint. Allerdings würde uns vieles entgehen, wenn wir die Perspektive ausschließlich auf das Deutsche einengen: Der Sprachvergleich gehört seit jeher zum Methodenrepertoire der historischen Sprachforschung. Deshalb ist ein Kapitel in diesem Buch auch der komparativen Methode gewidmet, ohne die wir viele der Sprachwandelprozesse, die quasi zum „Kanon“ des sprachgeschichtlichen Wissens gehören, nicht kennen würden.
Die Methode, die sich im Zuge der Digitalisierung wohl am eindrucksvollsten durchgesetzt hat, ist sicherlich die Korpuslinguistik, d.h. die Arbeit mit großen Sammlungen authentischer Sprachdaten. Auf Grundlage von Korpora lassen sich wissenschaftliche Hypothesen überprüfen, Sprachwandelprozesse nachvollziehen, regionale und textsortenspezifische Unterschiede dingfest machen. Germanistische Sprachgeschichtsforschung ohne Korpora – das ist heutzutage fast undenkbar. Schon in studentischen Seminararbeiten erfreut sich Korpuslinguistik erfahrungsgemäß wachsender Beliebtheit. Im methodischen Teil dieses Buches bilden korpuslinguistische Ansätze daher einen Schwerpunkt. Neben einem allgemein gehaltenen Einstieg in korpuslinguistische Methoden in Kapitel 2.2.2 werden mehrere korpusbasierte Fallstudien vorgestellt und diskutiert, und im digitalen Begleitmaterial zu diesem Buch finden sich mehrere praktisch orientierte Anleitungen zu Korpusrecherchen über einschlägige Korpusabfragesysteme.
Zum wachsenden Methodenpluralismus trägt aber auch die Verzahnung der germanistischen Sprachwissenschaft mit der Dialektologie bei. „Das“ Deutsche im Sinne einer überregionalen Standardsprache ist eine recht junge Entwicklung, und bis heute ist die deutsche Sprache in nicht zu unterschätzendem Maße dialektal geprägt. Regionale Unterschiede zu vernachlässigen, würde daher bedeuten, eine wichtige Dimension sprachlicher Variation außer Acht zu lassen. Zum Methodenrepertoire der Dialektologie gehören zum Beispiel Informantenbefragungen, die genutzt werden können, um Sprachraumgrenzen abzustecken: Wo im deutschsprachigen Raum sagt man Appel und wo Apfel? Wo benutzt man gell? als Rückversicherungssignal und wo eher ne? oder oder? Wie wir noch sehen werden, sind regionale Variation und diachroner Wandel bisweilen aufs engste verzahnt.
Nicht nur das Methodenrepertoire der historischen Sprachwissenschaft ist deutlich gewachsen, sondern auch das Spektrum der Fragestellungen ist breiter geworden. So haben beispielsweise Wortbildungswandel, historische Syntax und auch Wandelphänomene im Bereich der Pragmatik in den letzten Jahren verstärkt Aufmerksamkeit erfahren. Damit gehen ebenfalls methodische Herausforderungen einher: Welche Textsorten spiegeln den authentischen Sprachgebrauch früherer Jahrhunderte am besten wider, sodass sich damit pragmatische Phänomene, also Aspekte des Sprachgebrauchs im Kontext, untersuchen lassen? Und welche Textsorten sind dezidiert schriftsprachlich und weisen deshalb verschachteltere Satzstrukturen und komplexere Wortbildungsprodukte auf als es im alltäglichen mündlichen Sprachgebrauch zu erwarten ist?
Diesen und vielen weiteren methodischen Herausforderungen wollen wir uns in den nächsten Kapiteln stellen. Dabei ist jedes Kapitel in zwei Teile untergliedert. Der erste Teil gibt einen Überblick über den jeweiligen Forschungsstand zu den einzelnen Themen, der zweite Teil widmet sich methodischen Aspekten und will Sie mit dem Rüstzeug ausstatten, selbst weiterzuforschen. In den einzelnen Kapiteln – angefangen mit dieser Einleitung – finden sich darüber hinaus immer wieder Infoboxen, die ergänzende Informationen zu den einzelnen Themen oder teilweise auch ganz allgemeiner Art liefern. In den methodischen Kapiteln finden sich hier oft Tipps und Tricks oder Warnungen vor häufigen Fehlern, in den Theoriekapiteln vertiefende Informationen zu einzelnen Aspekten des jeweiligen Kapitels oder terminologische Hinweise.
Dieses Buch will somit nicht nur eine Einführung in die deutsche Sprachgeschichte und die historische Sprachwissenschaft sein, sondern auch und gerade eine Einladung zum wissenschaftlichen Denken. Gerade wenn es um Themen wie Sprache und Sprachwandel geht, kommt die wissenschaftliche Perspektive im öffentlichen Diskurs oft zu kurz. Das ist wenig verwunderlich, denn wir alle benutzen Sprache(n), und folgerichtig hat jeder und jede bestimmte Meinungen und Einstellungen zu Sprache. Doch selbst Studierende in höheren Semestern, die längst nicht mehr an Sprachverfallsmythen glauben (vgl. z.B. Plewina & Witt 2014 für eine Reihe von Aufsätzen, die die populäre Idee eines vermeintlichen Verfalls der deutschen Sprache wissenschaftlich dekonstruieren), haben bisweilen erfahrungsgemäß Probleme, wissenschaftliche Prinzipien zu verstehen, insbesondere wenn es um das Verhältnis von Theorie und Daten, von Explanans (also der Erklärung) und Explanandum (dem zu Erklärenden) geht. Daher ist dieser Einführung besonders daran gelegen, Sprachwissenschaft explizit als Wissenschaft zu präsentieren.
Wenn Sie durch die Kombination aus Überblicksdarstellung und praktisch orientierter Anleitung zum eigenständigen Weiterfragen, Weiterdenken und Weiterforschen Spaß an scheinbar trockenen Themen wie syntaktischem oder morphologischem Wandel, Lautverschiebungen und Ablautreihen gewinnen, hat dieses Buch sein vielleicht wichtigstes Ziel erreicht.
Die deutsche Sprachgeschichte muss erst noch geschrieben werden – schreiben Sie daran mit!
Wie Sie an dieser Stelle schon gemerkt haben dürften, ist dieses Buch eine Chimäre: einerseits eine Einführung in die deutsche Sprachgeschichte, andererseits eine Hinführung zum methodischen Repertoire der historischen Sprachwissenschaft. Daher kann es keinen vollständigen Überblick über die deutsche Sprachgeschichte geben (sofern das überhaupt im Rahmen eines einzigen Werks möglich ist). Auch was die methodischen Ansätze angeht, auf denen der Fokus des Buches liegt, war zwingend eine Auswahl notwendig. Von Polenz (1991: 17–23) weist zu Recht darauf hin, dass das Erkenntnisinteresse der Sprachgeschichtsschreibung über die rein linguistische Perspektive hinausgeht und beispielsweise auch (kultur-)historische Fragestellungen umfasst. Diese Perspektive werde ich in den Überblicksdarstellungen in den folgenden Kapiteln aufgreifen, aber die Vorstellung der Arbeitstechniken beschränkt sich weitgehend auf das ohnehin schon umfangreiche linguistische Methodeninventar.
Da die Arbeit mit Korpora in der germanistischen Sprachgeschichtsforschung die wohl mit Abstand wichtigste Methode des Erkenntnisgewinns darstellt, liegt der Schwerpunkt in dieser Einführung klar auf korpuslinguistischen Zugängen. Stärker als andere Einführungswerke, die dezidiert der Korpuslinguistik gewidmet sind (z.B. Scherer 2006, Perkuhn et al. 2012, Lemnitzer & Zinsmeister 2015), werde ich auf die speziellen Herausforderungen eingehen, die historische Korpuslinguistik mit sich bringt. Dennoch ersetzt dieses Buch natürlich keine Einführung in die Korpuslinguistik. Vielmehr will es quasi ein Sprungbrett für die weitere wissenschaftliche Beschäftigung mit sprachgeschichtlichen Fragestellungen sein.
Weil diese Einführung einen Spagat versucht zwischen der Vermittlung von „Grundzügen“ einerseits und „Methoden“ andererseits, ist jedes der folgenden Kapitel in zwei Teile gegliedert. Der jeweils erste Teil fasst unter dem Motto „Sprachwandel verstehen“ den derzeitigen Forschungsstand zu Kernthemen der germanistischen Sprachgeschichtsforschung zusammen, im zweiten Teil werden methodische Ansätze und Probleme oft anhand von Fallstudien illustriert. Die Kapitel bauen teilweise aufeinander auf, können aber prinzipiell auch unabhängig voneinander gelesen werden, auch wenn Leserinnen und Leser, die keine linguistischen Vorkenntnisse mitbringen, dann eventuell öfter einen Blick ins Wörterbuch werfen (oder im Internet nachsehen) müssen.
Aus Platzgründen kann nur bedingt eine praktisch orientierte Einführung in die jeweiligen Methoden gegeben werden. Allerdings stehen im digitalen Begleitmaterial eine Vielzahl an Tutorials insbesondere aus dem Bereich der Korpuslinguistik zur Verfügung (https://utb-shop.de/9783825248239). Das hat auch den Vorteil, dass ich zeitnah auf Änderungen etwa bei web-basierten Korpusschnittstellen reagieren kann, was in einem gedruckten Buch nur bei einer neuen Auflage möglich wäre. Darüber hinaus finden sich die meisten Daten und Skripts, die den Analysen in diesem Buch zugrundeliegen, in einem Github-Repository (github.com/hartmast/sprachgeschichte). Dort sind auch die besagten Tutorials zusammen mit den dazugehörigen Beispiel-Datensätzen hinterlegt. Ein Teil der Materialien findet sich zudem auf meiner Homepage www.stefanhartmann.eu – etwas Redundanz kann ja angesichts der notorischen Flüchtigkeit von Webinhalten nicht schaden, auch wenn ich natürlich versuchen werde, die Daten auf allen genannten Kanälen dauerhaft verfügbar zu halten.
Wissenschaft kann viel Spaß machen, ist aber nicht immer einfach. Das gilt auch für dieses Buch: Auch wenn es für AnfängerInnen ebenso geschrieben ist wie für LeserInnen, die schon Vorkenntnisse in der Linguistik mitbringen, sind einige Abschnitte sehr anspruchsvoll. Kapitel 3 zum Beispiel fasst auf wenigen Seiten einige Eckpfeiler der deutschen Sprachgeschichte zusammen, wofür man eigentlich ein ganzes Buch oder gar mehrbändige Überblicksdarstellungen benötigen würde. Dadurch lässt dieses Kapitel eine Lawine an Informationen auf Sie los, während es zugleich andere wichtige Entwicklungen in der Geschichte des Deutschen sträflich vernachlässigt. Lassen Sie sich davon bitte nicht abschrecken: Sie sollen die dargestellten Prozesse nicht auswendig lernen, sondern lediglich einen komprimierten Überblick bekommen, der zum Verständnis vieler der Entwicklungen erforderlich ist, die in den darauffolgenden Kapiteln genauer skizziert werden.
Im Methodenteil indes gilt: Keine Angst vor Zahlen und keine Angst vor Statistik! Erfahrungsgemäß finden viele Studierende den Gedanken, statistische Analysen durchzuführen, eher abschreckend (oder haben ein Germanistikstudium gewählt, um genau so etwas nie wieder machen zu müssen).
Dreierlei zur Beruhigung und Ermutigung. Erstens: Statistik ist keine Zauberkunst, sondern basiert auf relativ einfachen und intuitiv nachvollziehbaren Prinzipien. (Die Mathematik dahinter mag teilweise komplex sein, aber mit ihr müssen wir uns nur im Ansatz auseinandersetzen.) Zweitens: Die statistischen Tests, die ich in diesem Buch und im Begleitmaterial dazu vorstelle, sind – mit wenigen Ausnahmen – wirklich sehr grundlegend und können auch von Anfängerinnen und Anfängern gut verstanden werden. Und drittens: Statistik ist keine Wissenschaft für den Elfenbeinturm. Statistik-Kenntnisse können im Alltag außerordentlich vorteilhaft sein. Das gilt auch für angehende Lehrerinnen und Lehrer. Wie oben erwähnt, will dieses Buch auch eine Einladung zum wissenschaftlichen Denken sein. Dazu gehört, die wissenschaftliche Methode zu verstehen, die in Kap. 2 vorgestellt wird. Die wissenschaftliche Methode indes ist ohne Statistik kaum denkbar – wir brauchen Statistik, um unterschiedliche Erklärungsmodelle miteinander vergleichen und entscheiden zu können, welches das überzeugendste ist. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen in Teilen von Politik und Gesellschaft offene Wissenschaftsfeindlichkeit (auch gegenüber der Linguistik) salonfähig geworden ist, ist es wichtiger denn je, zu verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, und auch Schülerinnen und Schüler ans wissenschaftliche Denken heranzuführen.
Infobox 1: Linguistische Auszeichnungen und Konventionen
In der Linguistik gibt es einige Notationskonventionen, mit denen man sich vertraut machen muss, um sprachwissenschaftliche Texte zu verstehen und selbst Sprachwissenschaft zu betreiben.
Kursivierung
Metasprachliches wird kursiv gesetzt. Der Unterschied zwischen Metasprache einerseits und Objektsprache andererseits lässt sich an einem einfachen Beispiel illustrieren: In dem Satz „Der Hund hat vier Beine“ wird das Wort Hund objektsprachlich gebraucht, bezieht sich also auf das Tier. In dem Satz „Das Wort Hund beginnt mit dem Laut /h/“ wird Hund metasprachlich gebraucht: es geht um das Wort, um die sprachliche Einheit.
‚…‘
In einfachen Anführungszeichen werden Bedeutungen angegeben, z.B.: das englische Wort dog ‚Hund‘; das deutsche Wort Hund ‚Säugetier mit vier Beinen‘
/hʊnt/
In /…/ stehen Phoneme. Unter Phonemen versteht man die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit: Im sog. MinimalpaarHaus vs. Maus kommt der Bedeutungsunterschied nur durch ein einziges variierendes Phonem – /h/ vs. /m/ – zustande.
[hʊnt]
In […] stehen Phone. Unter Phonen versteht man die konkrete lautliche Realisierung eines Phonems. So kann das Phonem /ʁ/ in Rat (in Lautschrift: [ʁa:t] bzw. [ra:t]) als Gaumenzäpfchen-r gesprochen werden ([ʁ]), was die in Deutschland verbreitetste Variante ist. Gerade in Bayern, Österreich und der Schweiz findet man aber auch das „rollende“ Zungenspitzen-r ([r]) (vgl. Meibauer et al. 2015: 87; Becker 2014: 27f.).
<Hund>
In <…> werden Grapheme notiert, also Schriftzeichen. Zu den großen „Aha-Erlebnissen“ angehender Studierender der Sprachwissenschaft gehört oft die Erkenntnis, dass Sprache und deren Verschriftung zwei unterschiedliche Dinge sind. Dies wird schon im mehrfach erwähnten Beispiel <Hund> deutlich: Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht – wir sprechen Hund nicht mit einem /d/, also einem stimmhaften Plosiv, aus, sondern mit /t/, einem stimmlosen Laut (s.u. 3.3.1). Noch deutlicher wird der Unterschied zwischen Sprache und Schrift, wenn wir uns vor Augen führen, dass in einigen Fällen ein Laut (z.B. /ʃ/) durch drei Grapheme wiedergegeben wird (<sch>) oder dass das gleiche graphische Zeichen (z.B. der Digraph <ch>) für ganz unterschiedliche Laute stehen kann (/ç/ in ich vs. /χ/ in ach).
> und <
> ist zu lesen als ‚wandelt sich zu‘, z.B. gebollen > gebellt ‚gebollen wandelt sich zu gebellt‘. < ist umgekehrt zu lesen als ‚geht hervor aus‘, z.B. entsprechend gebellt < gebollen ‚gebellt geht hervor aus gebollen‘.
*
Der Asterisk kennzeichnet in der Regel ungrammatische Formen, die als Beispiele angeführt werden, z.B. *die Computers. Außerdem werden damit nicht belegte und rekonstruierte Formen ausgezeichnet, etwa in einem Satz wie „Das deutsche Wort Bruder geht auf indoeuropäisch *bhrāter- zurück“. Da uns aus dem Indoeuropäischen keine Quellen überliefert sind, ist die genannte Form natürlich nicht belegt. Vielmehr wurde sie auf Grundlage vergleichender Studien zwischen vielen indoeuropäischen Einzelsprachen rekonstruiert (s.u. 2.2.1)
?
Während einige Formen eindeutig ungrammatisch sind (z.B. *ich kief statt ich kaufte), schwankt bei anderen die grammatische Akzeptabilität. Solche Fälle sind statt mit Asterisk mit Fragezeichen gekennzeichnet (?Globusse,?Atlasse statt Globen, Atlanten).
Zur Darstellung von Phonen und Phonemen wird das Internationale Phonetische Alphabet verwendet, kurz IPA. Die jeweils aktuelle Version des IPA findet sich auf der Seite der International Phonetics Association unter https://www.internationalphoneticassociation.org/content/full-ipa-chart (zuletzt abgerufen am 10.09.2016).
2. Sprachwandel verstehen und untersuchen
Dieses Kapitel stellt zunächst zentrale Begriffe und Konzepte der Linguistik vor, um anschließend drei wichtige methodische Herangehensweisen der (historischen) Sprachwissenschaft einzuführen: die komparative Methode, Korpuslinguistik sowie Fragebogenstudien und Experimente. Wer bereits über solides linguistisches Grundwissen verfügt, kann Kapitel 2.1.1 getrost überspringen.
2.1Sprachwandel verstehen
2.1.1Untersuchungsebenen
In der Beschäftigung mit Sprache unterscheidet man traditionell verschiedene Betrachtungsebenen, die sich mit Nübling et al. (2013) auch als „Schichten“ interpretieren lassen: Phonologie, Morphologie und Syntax bilden in diesem Modell gleichsam den Kern der Sprache. In den äußeren Schichten sind Semantik, Lexik und Pragmatik angesiedelt. All diese Begriffe können sowohl eine Teildisziplin der Linguistik als auch ihren Forschungsgegenstand bezeichnen: So kann man von der Semantik, also der Bedeutung, eines Wortes sprechen, aber auch von Semantik als linguistischer Disziplin, die sich mit der Untersuchung von Bedeutung befasst. Ähnlich kann man von der Phonologie einer Sprache, etwa des Deutschen, sprechen oder auch von Phonologie als linguistischer Teildisziplin.
Fig. 1: Überblick über die verschiedenen Untersuchungsebenen.
Gegenstand der PhonologiePhonologie (Kap. 4) sind Phoneme, also die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten in einer Sprache (s. auch Infobox 1). Die Phonologie ist nicht zu verwechseln mit der PhonetikPhonetik, die sich mit den konkreten lautlichen Realisierungen von Phonemen, den sogenannten Phonen (Singular: Phon), befasst.
Die MorphologieMorphologie (Kap. 5) befasst sich mit den kleinsten bedeutungstragenden Einheiten einer Sprache, den sogenannten Morphemen. Der Unterschied zwischen Phonem und Morphem lässt sich an den Beispielen Haus und Maus aufzeigen: Beide unterscheiden sich in nur einem Phonem, /h/ vs. /m/. /h/ und /m/ sind daher bedeutungsunterscheidend, ohne jedoch selbst Bedeutung zu tragen. Die Wörter Haus und Maus hingegen tragen Bedeutung. So lässt sich die Frage: „Was bedeutet Maus?“ beantworten mit: „Das Wort Maus bezeichnet ein Nagetier.“, während die Frage „Was bedeutet /h/?“ keinen Sinn ergibt.
Haus und Maus sind also Morpheme. Doch nicht jedes Morphem ist ein eigenständiges Wort. Beispielsweise ist auch das -en in Frauen eine bedeutungstragende Einheit: Es bringt die grammatische Information ‚Plural‘ zum Ausdruck. Dieses Beispiel zeigt auch, dass Wörter oft aus mehr als einem Morphem bestehen. Frauen besteht aus zweien, dem Stamm Frau und dem Pluralmarker -en. Während Haus frei vorkommen kann, ist dies beim Pluralmarker nicht der Fall: *Heute habe ich viele -en gesammelt.
Den Bereich der Morphologie kann man unterteilen in WortbildungWortbildung und FlexionFlexion. Mit Flexionsmustern, die grammatische Informationen wie Tempus (Zeit) oder Numerus (Anzahl) kodieren, werden unterschiedliche Formen desselben Wortes gebildet, z.B. ich lache (Präsens) – ich lachte (Präteritum), die Frau (Singular) – die Frauen (Plural). Durch Wortbildung indes entstehen neue Wörter, etwa durch Komposition (Donau + Dampf + Schiff → Donaudampfschiff) oder durch Derivation, z.B. mit Suffixen wie -ung: befragen – Befragung.
Die SyntaxSyntax (Kap. 6) schließlich befasst sich mit der Frage, nach welchen Prinzipien Wörter zu Phrasen und Sätzen kombiniert werden. Die Wortstellung ist dabei keineswegs willkürlich.1 Vielmehr erfüllt auch sie oft genug eine ganz konkrete Funktion. So unterscheidet sich die Wortstellung im Deutschen zwischen Aussage- und Fragesatz:
(1)
IchSUBJ treffe meine TanteOBJ.
(2)
TriffstVduSUBJ auch deinen OnkelOBJ?
Damit kommen wir zu jenen Untersuchungsebenen, die zwar oft nicht der „Kernlinguistik“ zugerechnet werden, aber nicht minder bedeutsam sind: Lexik, Semantik und Pragmatik. Die LexikLexik (Kap. 7) bezeichnet den Wortschatz einer Sprache, der ebenfalls einer diachronen Dynamik unterliegt – so kann er etwa durch EntlehnungEntlehnung erweitert werden, während andere Wörter außer Gebrauch kommen. Beispielsweise gehört saelde, im Mittelhochdeutschen noch ein geläufiger Begriff, dessen Bedeutung sich mit ‚Güte, Segen, Glück‘ umschreiben lässt, nicht mehr zum neuhochdeutschen Wortschatz, während wir im Mittelhochdeutschen ein Wort wie W-LAN-Router vergeblich suchen. SemantikSemantik (ebenfalls Kap. 7) befasst sich mit der Bedeutung von Wörtern und Konstruktionen. Dabei ist, wie Kap. 7.1 zeigen wird, sehr umstritten, was genau unter Bedeutung zu verstehen ist und wie weit der Bedeutungsbegriff gefasst werden kann: Können wir beispielsweise sagen, dass ein Suffix wie -heit in Freiheit eine Bedeutung hat? Manche neueren Ansätze gerade in der Konstruktionsgrammatik (vgl. z.B. Kap. 6.2.3 und 8.2.2) vertreten dabei einen sehr weiten Bedeutungsbegriff, nach dem beispielsweise auch syntaktische Muster Bedeutung tragen können.
Die Pragmatik (Kap. 8) schließlich befasst sich mit sprachlichem Handeln. Dazu gehören z.B. Aspekte, die über die wörtliche Bedeutung einer Äußerung hinausgehen. Beispielsweise kann mit einer Aussage wie Es zieht eine indirekte Aufforderung vermittelt werden: ‚Bitte schließe das Fenster!‘ Es handelt sich um einen sog. indirekten Sprechakt. Auch andere Aspekte der konkreten Sprachverwendung, etwa die Verknüpfung von Äußerungen mit positiven oder negativen Einstellungen (vgl. das Zeitliche segnen vs. abnippeln) oder auch mit Kontextfaktoren (vgl. Sehr geehrte Frau Prof. Meier vs. Yo bro!), gehören in den Bereich der Pragmatik. Die Grenzen zwischen Semantik und Pragmatik sind dabei oft fließend. So lässt sich darüber streiten, ob das Wort Pferd und sein pejoratives (abwertendes) Pendant Gaul die gleiche Bedeutung haben, weil sie beide auf ein Tier der biologisch Equus genannten Gattung referieren und sich nur pragmatisch unterscheiden, oder ob der pejorative Gehalt als Teil der Semantik des Wortes gesehen werden muss.
Die GraphematikGraphematik (Kap. 9) befasst sich mit der Verschriftung von Sprache. Dabei gilt es im Blick zu behalten, dass Schrift gegenüber der Sprache sekundär ist – Sprache(n) gibt es schon viel länger als Schrift, und bis heute können viele Menschen nicht lesen und schreiben, aber alle normal entwickelten Menschen beherrschen eine Sprache. Das hat dazu geführt, dass die Graphematik in der Linguistik lange Zeit ein Schattendasein geführt hat und teilweise immer noch führt. In der germanistischen Linguistik hat sich jedoch ein ausgeprägtes Interesse am Verhältnis von Sprache und Schrift entwickelt. Die Graphematik ist auch insofern ein sehr vielversprechender Forschungszweig, als man davon ausgehen kann, dass in einer alphabetisierten Gesellschaft, in der zudem Schrift quasi omnipräsent ist, unser sprachliches Wissen auch sehr stark durch die Verschriftung von Sprache geprägt ist.
2.1.2Wie verändern wir Sprache? Zur Theorie des Sprachwandels
Dass Sprache sich wandelt, ist eine Tatsache, die kaum ernsthaft in Frage gestellt werden kann. Wie Sprache sich wandelt und warum, ist jedoch umstritten. An dieser Stelle kann nur ein sehr knapper Überblick über verschiedene Ansätze gegeben werden, auch weil sich dieses Buch nur indirekt mit Sprachwandeltheorie beschäftigt – im Mittelpunkt stehen vielmehr Methoden, mit deren Hilfe sich Sprachwandel empirisch untersuchen lässt. Die empirischen Ergebnisse können dann wiederum theoretische Erklärungsansätze untermauern oder in Frage stellen.
Die Antwort auf die Frage, wie und warum Sprachen sich verändern, hängt stark von der Konzeption ab, die man von Sprache hat. Stark vereinfachend kann man zwei sehr unterschiedliche Auffassungen von Sprache unterscheiden, auch wenn es in beiden „Lagern“ sehr viel Variation gibt und die Grenzen zwischen den unterschiedlichen Richtungen sehr viel unschärfer sind, als ich sie hier darstelle. Eine modularistischeModularismus Sprachauffassung, wie sie insbesondere die generative Grammatik vertritt1, sieht Sprache als eigenständige Komponente der Kognition. Sie nimmt an, dass es bestimmte Gehirnareale gibt, die spezifisch für Sprachverarbeitung zuständig sind. Das „Sprachmodul“ ist dabei zwar in einigen Varianten der Theorie über Schnittstellen mit anderen kognitiven Modulen verbunden, aber prinzipiell von diesen unabhängig. Die Sprachfähigkeit gilt in diesem Ansatz als angeborene Fähigkeit: Eine Sprache muss zwar erworben werden, doch die kognitiven Voraussetzungen dafür sind biologisch verankert. Ein (umstrittenes) Hauptargument dafür lautet, dass Kinder eigentlich gar nicht genug Input bekämen, um eine Sprache vollständig erwerben zu können (poverty of stimulus). Insbesondere erhielten sie kaum negatives Feedback z.B. durch Fehlerkorrektur. Daher müsse es angeborene Grundlagen der Sprachfähigkeit geben. Zu diesen kognitiven Grundlagen zählt eine Universalgrammatik, also ein Regelinventar, das allen Sprachen zugrundeliegt. Folgerichtig ist das eigentliche Erkenntnisinteresse der Sprachwissenschaft aus generativer Sicht auch nicht die Beschreibung sprachlicher Oberflächenstrukturen, sondern vielmehr eben dieser Universalgrammatik. Das heißt aber nicht, dass die generative Linguistik per se nicht an sprachlicher Diversität und Variation interessiert wäre (auch wenn man ihr das manchmal vorwirft). Im Fokus steht jedoch die Frage, wie sich die Heterogenität menschlicher Sprachen aus einem als homogen angenommenen Regelinventar ergibt.
Der Fokus auf die angeborene Sprachfähigkeit im allgemeinen und auf die Universalgrammatik im besonderen bringt für die generative Linguistik Herausforderungen mit sich, wenn es um die Erklärung von Sprachwandel geht, da die Universalgrammatik ja eine relativ statische Größe sein muss. Aus diesem Grund wird in solchen Ansätzen gerade dem Spracherwerb eine zentrale Rolle zugeschrieben. Im Principles-and-Parameters-Ansatz der generativen Grammatik geht man davon aus, dass die Universalgrammatik aus invariablen Prinzipien besteht, die allerdings unterschiedlich realisiert werden können. Diese unterschiedliche Realisierung geschieht über Parametersetzung. Im Spracherwerb setzt das Kind die Parameter entsprechend seiner Muttersprache, wobei jedoch die Möglichkeit (meist geringfügiger) Abweichungen besteht (vgl. z.B. Boeckx 2006, Roberts & Roussou 2003).
Im diametralen Gegensatz dazu steht die holistischeHolismus Sprachauffassung, die beispielsweise in der sog. Kognitiven Linguistik, in funktionalistischen Ansätzen und in den meisten Spielarten der Konstruktionsgrammatik vertreten wird.2 Ziem (2008: 103) weist darauf hin, dass sich der Begriff Holismus nur in der deutschsprachigen Literatur findet, in der internationalen Literatur spricht man meist von einem integralen (integral) oder einheitlichen (unitary, uniform) Modell. Spivey (2007) nutzt Kontinuität (continuity) als Gegenbegriff zu Modularität.3 Gemeint ist jeweils, dass es keine strenge Aufteilung der „Zuständigkeiten“ in der menschlichen Kognition gibt. Somit bildet auch Sprache nach dieser Auffassung kein eigenständiges kognitives Modul, sondern ist vielmehr eng mit anderen Bereichen der Kognition verwoben. In einer etwas überzeichneten Metapher könnte man sagen, dass die „Arbeitsteilung“ im menschlichen Geist hier einer Fußballmannschaft entspricht, die kein Spiel gewinnen könnte, wenn nicht die Stürmer auch ab und zu Abwehr spielen würden und umgekehrt. Im modularistischen Modell funktioniert Kogniton hingegen eher wie eine Behörde, in der jede Abteilung ihre eigenen Zuständigkeiten hat und es tunlichst vermeidet, sich in die Geschäfte der anderen Abteilungen einzumischen.
Die holistische Sprachauffassung lehnt die Annahme einer angeborenen Sprachfähigkeit ab und hält das poverty of stimulus-Argument für nicht überzeugend. Sie geht davon aus, dass Sprache „statistisch“ erworben wird – unbewusst führen wir quasi Buch über die Wörter und Konstruktionen, die uns begegnen, und wissen daher sehr genau, was in welchem Kontext die richtige Wahl ist. Zum Beispiel merken wir mit der Zeit, dass Sprecherinnen und Sprecher immer ging sagen, wo man sonst vielleicht *gehte erwarten würde, wenn man die regelmäßige Vergangenheitsform des Deutschen kennt. Das poverty of stimulus-Argument, so die holistische Sicht, unterschätzt diese Fähigkeiten drastisch (vgl. z.B. Tomasello 2003, Goldberg 2011).
Weil holistische Ansätze Sprache als hochgradig dynamisch betrachten, ist der Spracherwerb aus dieser Sicht nicht der vorrangige Ort des Sprachwandels. Das ist vielmehr der Sprachgebrauch: Jede einzelne Äußerung, die getätigt wird, kann prinzipiell zu einer Rekonfiguration unseres sprachlichen Wissens führen.
Die gerade in letzter Zeit wieder äußerst polemisch geführten Debatten zwischen Anhängern der beiden hier vorgestellten Richtungen zeigen, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist (vgl. z.B. Evans 2014, Adger 2015). Das vorliegende Buch verortet sich im holistischen Ansatz, wenngleich die meisten Beobachtungen und Fallstudien, die in den folgenden Kapiteln dargelegt werden, „theorieneutral“ sind und sich durchaus auch für unterschiedliche Interpretationen aus diversen theoretischen Perspektiven anbieten.
Obwohl die beiden Auffassungen von Sprache und Kognition unterschiedlicher kaum sein könnten, haben sie doch eines gemeinsam, nämlich den Fokus auf das individuelle sprachliche Wissen. Die generative Linguistik stellt die sprachliche Kompetenz oder auch I(nterne)-Sprache in den Vordergrund und sieht die Performanz oder auch E(xternalisierte)-Sprache als sekundär. Unter den holistischen Ansätzen verfolgt gerade die Konstruktionsgrammatik explizit das Ziel, sprachliches Wissen zu modellieren. In der generativen Linguistik geht man von einem „idealen Sprecher-Hörer“ aus, der quasi stellvertretend für die „durchschnittliche“ Sprachbenutzerin steht. In holistischen Ansätzen tut man das in gewisser Weise auch, wenngleich man sich bewusst ist, dass es zwischen dem sprachlichen Wissen unterschiedlicher Personen recht drastische Unterschiede geben kann: „Different speakers, different grammars.“ (Dąbrowska 2012). In jüngerer Zeit ist jedoch die Frage nach dem Verhältnis zwischen individuellem und kollektivem Sprachwissen wieder stärker in den Vordergrund gerückt. So unterscheiden z.B. Traugott & Trousdale (2013) zwischen dem sprachlichen Wissen eines Individuums und dem sprachlichen Wissen einer Population von Sprecherinnen und Sprechern. Beide Aspekte sind eng miteinander verwoben: Überindividuelles sprachliches Wissen kann nur als Abstraktion über individuelles sprachliches Wissen existieren, quasi als Schnittmenge des Wissens vieler Einzelpersonen. Deshalb kann es auch so etwas wie „die (deutsche) Sprache“ oder „die Grammatik“ nur bedingt geben. Aus dieser Perspektive ist Sprache ein komplexes adaptives Systemkomplexes adaptives System, Sprache als (vgl. z.B. Steels 2000, Beckner et al. 2009, Kirby 2012). Damit ist ein System gemeint, das
aus verschiedenen „Akteuren“ besteht, die miteinander interagieren. Das ist bei Sprache trivialerweise der Fall – ich kann zwar auch mit mir selbst reden, aber eine Sprache lernen könnte ich alleine nicht;
adaptiv ist, d.h. Sprecherinnen und Sprecher passen ihr sprachliches Verhalten immer wieder auf Grundlage ihrer Erfahrungen an. Wenn ich zum Beispiel merke, dass alle in meinem Umfeld Kirche wie „Kürche“ und Gehirn wie „Gehürn“ aussprechen, passe ich meine eigene Aussprache früher oder später möglicherweise auch an. Und wenn ich merke, dass mich in Norddeutschland niemand versteht, wenn ich nachdem kausal, also begründend, verwende (Nachdem wir nächste Woche essen gehen wollen, müssen wir bald einen Tisch reservieren), weiche ich vielleicht in Zukunft auf eine dort üblichere Form wie weil oder da aus;
sich aus sprachlichen Verhaltensmustern ergibt, die ihrerseits Resultat eines komplexen Zusammenwirkens unterschiedlichster Faktoren sind: So spielen die biologischen Voraussetzungen sprachlicher Artikulation ebenso eine Rolle für die Entwicklung des Systems wie kognitive und kulturelle Faktoren.
Sprachwandel ist in aller Regel ein unbeabsichtigtes „Nebenprodukt“ sprachlichen Handelns. Keller ([1990] 2014) hat zur Veranschaulichung dieses Phänomens die Metapher der „unsichtbaren HandInvisible-hand-TheorieUnsichtbare HandUnsichtbare Hand“ aus den Wirtschaftswissenschaften entlehnt, die er mit dem berühmt gewordenen Beispiel des Trampelpfads erklärt: Dieser entsteht nicht absichtlich, sondern als unabsichtliches Nebenprodukt des Handelns vieler Individuen, die ein ähnliches Ziel verfolgen – nämlich eine Abkürzung zu nehmen. Wie durch eine unsichtbare Hand entsteht so mit der Zeit ein Pfad, der womöglich gar den Eindruck erweckt, bewusst und planvoll angelegt zu sein – „design without a designer“ quasi (Cornish 2010).
Kellers Invisible-hand-Theorie hat viel mit der Charakterisierung von Sprache als komplexes adaptives System gemeinsam, die zusätzlich den Fokus auf die Heterogenität der Faktoren legt, die dabei involviert sein können. Sprachwandel vollzieht sich immer an der Schnittstelle von Gesellschaft, Kultur und Kognition (vgl. auch Bybee 2010). Wenn wir in der Sprachgeschichtsschreibung über die rein beschreibende Perspektive hinausgehen und Sprachwandelprozesse zu erklären versuchen, gilt es dieses Geflecht im Blick zu behalten. Und gerade weil die einzelnen Faktoren und ihre Interaktion so komplex sind, ist die Sprachgeschichte, sei es des Deutschen oder auch anderer Sprachen, noch lange nicht „ausgeforscht“. Für die zukünftige Forschung tun sich hier spannende Fragen auf, die bisher erst im Ansatz behandelt wurden, zum Beispiel: Wer verändert eigentlich Sprache? Einerseits kann die Antwort darauf nur lauten: Wir alle, denn Sprache ist hochdemokratisch – andererseits hängt die Akzeptanz einer Innovation, die ich als Sprecherin in die Welt setze, von vielen verschiedenen Faktoren ab, nicht zuletzt auch von der Größe des Personenkreises, den ich damit erreiche, und von meiner eigenen Stellung im Kreis der Adressaten. Eine weitere interessante Frage könnte lauten: Wie wahrnehmbar sind Sprachwandelprozesse, und welche Faktoren steuern ihre Wahrnehmbarkeit? Einige Wandelprozesse, etwa der vermeintliche „Tod“ des Genitivs oder der angeblich übermäßige Gebrauch von AnglizismenAnglizismen, werden von Laien lautstark kommentiert (und beklagt), andere, wie etwa das Aufkommen des oben erwähnten kausalen nachdem, scheinen eher unbemerkt vonstatten zu gehen. Der Katalog offener Fragen ließe sich mühelos fortsetzen.
Um solche Fragestellungen wissenschaftlich fundiert angehen zu können, benötigen wir, sozusagen als Werkzeugkasten, ein Repertoire an Methoden, das selbstverständlich auch keine abgeschlossene Menge bildet, sondern immer wieder mit neuen Ansätzen erweitert werden kann. In den nächsten Abschnitten werden wir einige der wichtigsten Methoden, mit denen in der Sprachgeschichtsforschung gearbeitet wird, näher kennenlernen.
2.2Untersuchungsmethoden
Dieses Buch will zum einen einen Überblick über die deutsche Sprachgeschichte geben, zum anderen Zugänge zu ihrer empirischen Untersuchung eröffnen. Es will Sie ermutigen, Sprachgeschichtsforschung wissenschaftlich zu betreiben. Ehe wir uns drei der wichtigsten Methodenfelder der historischen Sprachwissenschaft zuwenden, lohnt es sich daher, zunächst auf die wissenschaftliche Methodewissenschaftliche Methode näher einzugehen. Wenn heute von der „wissenschaftlichen Methode“ die Rede ist, dann ist damit zumeist der in Fig. 2 dargestellte Zyklus des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns gemeint. Dieser wiederum ist eng mit dem Prinzip des FalsifikationismusFalsifikationismus verbunden, das auf den Philosophen Karl Popper zurückgeht (vgl. z.B. Popper 1963). Maxwell & Delaney (2004: 13f.) illustrieren die Grundidee des Falsifikationismus, indem sie sie den Ideen des logischen Positivismus gegenüberstellen, der die Wissenschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dominierte. Dieser folgt dem in (3) dargestellten Syllogismus der Bestätigung:
(3)
Syllogismus der Bestätigung:
Annahme: Wenn meine Theorie wahr ist, folgen meine Daten dem vorausgesagten Muster.
Beobachtung: Die Daten folgen dem vorausgesagten Muster.
Schluss: Deshalb ist meine Theorie wahr.
Die Idee hinter diesem recht abstrakten Syllogismus lässt sich an einem einfachen Alltagsbeispiel illustrieren. Angenommen, ich wohne in einer WG und frage mich, wer im Badezimmer das Licht angelassen hat. Ich tippe auf meinen Mitbewohner, den angehenden Lehrer, zumal der ohnehin oft etwas verplant ist. Nun weiß ich, dass dieser Mitbewohner, wenn er nach Hause kommt, immer Kreide an den Fingern hat und deshalb dazu neigt, Kreideflecken zu hinterlassen. Mir fällt auf, dass am Lichtschalter ein kleiner Kreidefleck ist, der vorher noch nicht da war, und ich denke mir: Wusste ich’s doch!
Mein Schlussprozess folgt also dem Syllogismus der Bestätigung: Ich habe eine Theorie und überprüfe, ob die Daten mit meiner Theorie kompatibel sind. Dieses deduktive (ableitende) Verfahren ist sowohl für den logischen Positivismus als auch für den Falsifikationismus charakteristisch. Letzterer jedoch geht den dritten Schritt nicht mit – den nämlich, dass ich meine Theorie deshalb als wahr annehme.
Um bei unserem Beispiel zu bleiben: Der Kreidefleck mag verräterisch sein, aber er ist natürlich keine hinreichende Evidenz, dass der Lehrer tatsächlich der Schuldige ist. Erstens muss der Kreidefleck nicht von ihm stammen – er könnte auch von meiner Mitbewohnerin stammen, die beim Klettern Unmengen an Magnesiumcarbonat verwendet. Zweitens kann auch nach ihm jemand im Bad gewesen sein, ohne eine Spur am Lichtschalter zu hinterlassen. Theoretisch ist sogar denkbar, dass es einen Einbruch gab, von dem niemand etwas bemerkt hat, weil der Einbrecher unverrichteter Dinge wieder gegangen ist, als er merkte, dass hier Geisteswissenschaftler leben, bei denen nichts zu holen ist – nur das Licht im Bad hat er angelassen. Diese Theorie ist zwar etwas weit hergeholt, aber es kann doch nicht ganz ausgeschlossen werden, dass sie zutrifft. Das gleiche gilt für praktisch unendlich viele andere Theorien, die meine Beobachtungen erklären können. Deshalb geht Popper auch davon aus, dass es grundsätzlich nicht möglich ist, eine Theorie zu bestätigen. Hingegen ist es durchaus möglich, eine Theorie zurückzuweisen – mit dem Syllogismus der Falsifikation in (4).
(4)
Syllogismus der FalsifikationFalsifikationismus:
Annahme: Wenn meine Theorie wahr ist, folgen meine Daten dem vorausgesagten Muster.
Beobachtung: Die Daten folgen dem vorausgesagten Muster nicht.
Schluss: Deshalb ist meine Theorie falsch.
Fig. 2: Der Zyklus des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns, modifiziert nach Stefanowitsch (im Ersch.).
Aus diesem Grund ist es in empirischen Studien heute üblich, Hypothesen nicht direkt zu überprüfen, sondern stattdessen NullhypothesenNullhypothese (H0) zu testen. Die Nullhypothese ist das logische Gegenteil zu meiner eigenen Hypothese, der sog. Alternativhypothese H1. Schauen wir uns ein sprachgeschichtliches Beispiel dazu an. Das Adverb bisschen geht auf das Substantiv Bissen zurück, wie in ein Bissen Brot. Es hat sich von einem Wort mit sehr konkreter Bedeutung zu einem Wort mit eher abstrakter, quantifizierender Bedeutung gewandelt. Heute kann ich nicht nur einen Bissen Lasagne essen oder mir im Sommer ein bisschen Eis gönnen, sondern auch ein bisschen müde sein oder ein bisschen spazieren gehen. Wenn es stimmt, dass bisschen graduell eine immer abstraktere Bedeutung angenommen hat, dann ist zu erwarten, dass es ursprünglich zunächst mit Substantiven auftritt, die etwas sehr Konkretes bezeichnen, womöglich sogar etwas Essbares, und dass es sich erst allmählich auf Adjektive und Verben ausdehnt. In diesem Fall wäre die H1 also: bisschen tritt im Laufe der Zeit immer häufiger mit Wörtern auf, die nicht zur Wortart Substantiv gehören. Entsprechend lautet also die H0: bisschen tritt im Laufe der Zeit nicht häufiger mit Wörtern auf, die nicht zur Wortart Substantiv gehören.
Wenn nun eine empirische Studie mit Texten aus verschiedenen Zeitstufen belegt, dass bisschen in späteren Zeitstufen tatsächlich häufiger mit Adjektiven und Verben auftritt – und zwar so viel häufiger, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass eine solche Verteilung durch Zufall zustande kommt –, dann können wir zwar immer noch nicht völlig sicher sein, dass die Alternativhypothese zutrifft. Aber wir können mit großer Gewissheit die Nullhypothese zurückweisen – und dadurch unsere Alternativhypothese bestärkt sehen.
Das führt uns zu der Frage, was eigentlich eine wissenschaftliche HypotheseHypothese ist und welchen Kriterien sie genügen sollte. Bortz & Döring (2006: 4) definieren eine wissenschaftliche Hypothese wie folgt:
Eine wissenschaftliche Hypothese bezieht sich auf reale Sachverhalte, die empirisch untersuchbar sind.
Eine wissenschaftliche Hypothese ist eine allgemeingültige, über den Einzelfall oder ein singuläres Ereignis hinausgehende Behauptung („All-Satz“).
Einer wissenschaftlichen Hypothese muss zumindest implizit die Formalstruktur eines sinnvollen Konditionalsatzes („Wenn-dann-Satz“ bzw. „Je-desto-Satz“) zugrunde liegen.
Der Konditionalsatz muss potenziell falsifizierbar sein, d.h., es müssen Ereignisse denkbar sein, die dem Konditionalsatz widersprechen.
Denkpause
Welche der folgenden Annahmen können als wissenschaftliche Hypothesen gelten, welche nicht?
Bayern trinken häufig Bier.
Bayern trinken häufiger Bier als Schwaben.
Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, bei einem Haushaltsunfall zu sterben.
Wenn ein Kind ohne Sprache aufwächst, spricht es am Ende Vogonisch.
Eine Annahme wie Bayern trinken häufig Bier wäre nach den oben genannten Kriterien keine wissenschaftliche Hypothese, denn es wird nicht klar, was mit „häufig“ gemeint ist – deshalb ist die Aussage nicht nach klaren Kriterien falsifizierbar: „Falsifizierbarkeit setzt begriffliche Invarianz voraus“ (Bortz & Döring 2006: 5). Anders wäre es, wenn wir „häufig“ klar definieren, z.B. als „mindestens einmal am Tag eine Maß Bier“. Dann könnten wir daraus den Wenn-dann-Satz formulieren: „Wenn jemand Bayer ist, trinkt er mindestens einmal am Tag eine Maß Bier“ und könnten folgerichtig Daten von bayerischen und nicht-bayerischen Probanden erheben und vergleichen. Bayern trinken häufiger Bier als Schwaben ist eine wissenschaftliche Hypothese, denn hier haben wir ein klares Vergleichskriterium. Gleiches gilt für die dritte Hypothese, Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, bei einem Haushaltsunfall zu sterben. Diese Hypothese könnte man z.B. überprüfen, indem man Daten von tödlichen Haushaltsunfällen erhebt und die Altersverteilung der Todesopfer mit der Altersverteilung in der Gesamtbevölkerung vergleicht. Die vierte Hypothese ist ein schwierigerer Fall: Sie wäre potentiell falsifizierbar, allerdings müsste man dafür ein Kind ohne Sprache aufwachsen lassen. Aus offensichtlichen Gründen erachtet man ein solches Experiment heute als unethisch und überlässt es ägyptischen Pharaonen und mittelalterlichen Herrschern (vgl. Cohen 2013 für Beispiele). Ob es sich dennoch um eine wissenschaftliche Hypothese handelt, auch wenn sie nur in der Theorie falsifizierbar ist, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Da man solche Fragestellungen heute prinzipiell auch ohne Versuche an echten Menschen z.B. über sog. agentenbasierte computationale Modellierung (agent-based modelling) indirekt angehen kann, spricht im Grunde nichts dagegen, die Hypothese zumindest formal als wissenschaftliche Hypothese durchgehen zu lassen – inhaltlich ist sie natürlich offensichtlich unsinnig.
Das führt uns zu der Frage, was eigentlich eine gute wissenschaftliche Hypothese ausmacht. Eine Hypothese speist sich meist aus einer Theorie, also einem Netzwerk an erklärenden Annahmen (vgl. Bartz & Döring 2006: 15). Bisweilen werden die Begriffe Theorie und Hypothese nahezu austauschbar gebraucht, allerdings ist die Unterscheidung zwischen einem übergreifenden Netzwerk an erklärenden Annahmen und einer konkreten, falsifizierbaren Einzelannahme nicht ganz unwichtig; darauf werden wir in einem Exkurs in Kap. 4.1.2 zurückkommen. Eine gute Theorie wiederum ist nach Hussy & Jain (2002: 278f.)
logisch konsistent, also in sich widerspruchsfrei;
gut überprüfbar bzw. falsifizierbar;
einfach: sie sollte mit möglichst wenigen Annahmen möglichst viel erklären;
allgemein: eine Theorie mit größerem Geltungsbereich ist einer Theorie mit geringerem Geltungsbereich vorzuziehen.
Eng mit dem Kriterium der Einfachheit verbunden ist das Prinzip, das als Occam’s razorOccam’s razor (deutsch auch manchmal: Ockhams RasiermesserOckhams RasiermesserOccam’s razor) bekannt ist und das häufig in der Formel zusammengefasst wird: Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, also frei paraphrasiert: Die Zahl der Einheiten, die zur Erklärung eines Sachverhalts herangezogen werden, soll nicht ohne Not erhöht werden. Mit anderen Worten: Die einfachere Erklärung ist die bessere, wenn es nicht gute Gründe gibt, eine voraussetzungsreichere Erklärung zu wählen. Um auf das Beispiel mit dem Kreidefleck zu Beginn des Kapitels zurückzukommen: Die Hypothese, dass Einbrecher im Haus waren und nichts gestohlen, aber einen Fleck hinterlassen haben, macht eine Annahme, die zur Erklärung der Beobachtung nicht notwendig und daher nur gerechtfertigt ist, wenn sich herausstellt, dass die einfacheren Hypothesen zur Erklärung des Phänomens nicht ausreichen.
Ganz grob zusammengefasst besteht die wissenschaftliche Methode also darin, Theorien zur Erklärung beobachtbarer Phänomene zu formulieren. Als Prüfstein für die Validität einer Theorie dient die Überprüfung von Hypothesen durch Falsifikation der entsprechenden Nullhypothese. Kann die Nullhypothese nicht falsifiziert werden, muss die entsprechende Alternativhypothese (vorerst) verworfen und die Theorie entsprechend modifiziert werden.
2.2.1Sprachvergleich und Rekonstruktion: Die komparative Methode
Als 2015 in Südafrika die Überreste einer zuvor unbekannten Menschenart, des Homo naledi, entdeckt wurden (vgl. Berger et al. 2015), war dies eine kleine wissenschaftliche Sensation, die auch auf ein breites Presseecho stieß. Für die Paläoanthropologie, die sich mit der Entwicklungsgeschichte des Menschen befasst, sind solche Funde von zentraler Bedeutung, denn um zu verstehen, wie sich unsere Spezies evolutionär entwickelt hat, ist es wichtig, möglichst viele verwandte Spezies miteinander zu vergleichen. Dies nennt man die komparative MethodeKomparative Methode (vgl. Fitch 2010: 44–46). Derlei Vergleiche können unter anderem dazu beitragen, Rückschlüsse auf den hypothetischen letzten gemeinsamen Vorfahren, den last common ancestor, von Menschen und Schimpansen zu ziehen.
Die komparative MethodeKomparative Methode in der Sprachwissenschaft verfolgt ähnliche Ziele mit ähnlichen Mitteln. Sie ermöglicht es, Sprachstufen zu rekonstruieren, aus denen uns keinerlei Zeugnisse überliefert sind. Die komparative Methode baut auf der Grundannahme auf, dass zwischen den Sprachen der Welt Verwandtschaftsverhältnisse bestehen: Sprachen, die zur gleichen SprachfamilieSprachfamilie gehören, lassen sich demnach auf eine gemeinsame ProtospracheProtosprache zurückführen. So gehören etwa das Deutsche, Englische und Niederländische zur westgermanischen Sprachfamilie, während etwa Isländisch, Norwegisch, Dänisch und Schwedisch zur nordgermanischen zählen. Aus den Gemeinsamkeiten der jeweiligen Einzelsprachen lassen sich Eigenschaften der Protosprache, also des West- bzw. Nordgermanischen, rekonstruieren. Damit ist gemeint, dass wir eine wissenschaftlich fundierte Annahme darüber treffen, wie die jeweilige Protosprache ausgesehen haben könnte (vgl. Crowley & Bowern 2010: 79).
Natürlich sind die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Sprachen weitaus komplexer, als dass man einfach nur für jede Sprachfamilie eine gemeinsame „Ursprache“ annehmen müsste. So gehören das West- und Nordgermanische ihrerseits zur germanischen Sprachfamilie, zusammen mit den ausgestorbenen ostgermanischen Sprachen, zu denen das Gotische gehört, das für die Rekonstruktion des Proto-Germanischen eine zentrale Rolle spielt (vgl. Lehmann 1994: 19). Die germanischen Sprachen indes gehören ebenso wie beispielsweise die romanischen und die slawischen Sprachen zur indoeuropäischen Sprachfamilie, die in der deutschsprachigen Literatur oft auch als „indogermanische“ Sprachfamilie bezeichnet wird.
Um diese Verwandtschaftsverhältnisse zu entschlüsseln, bedarf es des Sprachvergleichs. Tab. 1 stellt die Kardinalzahlen von 1 bis 10 in sieben verschiedenen Sprachen gegenüber: drei westgermanischen, drei romanischen und einer sog. isolierten Sprache, d.h. einer Sprache, die mit keiner anderen bekannten Sprache verwandt ist. Schon ein oberflächlicher Vergleich zeigt deutliche Gemeinsamkeiten zwischen den Zahlwörtern in den eng miteinander verwandten Sprachen. Ebenso fällt auf den ersten Blick ins Auge, dass das Baskische sich ganz deutlich von den anderen Sprachen unterscheidet (außer im Falle von sei ‚sechs‘).
germanisch
romanisch
isoliert
Dt.
Engl.
Nl.
Franz.
Ital.
Span.
Bask.
eins
one
één
un
uno
uno
bat
zwei
two
twee
deux
due
dos
bi
drei
three
drie
trois
tre
tres
hiru
vier
four
vier
quatre
quattro
cuatro
lau
fünf
five
vijf
cinq
cinque
cinco
bost
sechs
six
zes
six
sei
seis
sei
sieben
seven
zeven
sept
sette
siete
zazpi
acht
eight
acht
huit
otto
ocho
zortzi
neun
nine
negen
neuf
nove
nueve
bederatzi
zehn
ten
tien
dix
dieci
diez
hamar
Tab. 1: Die Zahlen von 1 bis 10 in drei westgermanischen und drei romanischen Sprachen sowie einer sog. isolierten Sprache, dem Baskischen, das mit keiner anderen bekannten Sprache verwandt ist.
Für die Ähnlichkeiten gibt es eine einfache und plausible Erklärung: Die einander ähnlichen, aber doch deutliche Unterschiede aufweisenden Sprachen haben sich aus einer gemeinsamen Vorstufe (Protosprache) entwickelt und sind im Laufe der Zeit gleichsam auseinandergedriftet. Die Frage, welche der (heutigen) Sprachen „älter“ oder „jünger“ ist, stellt sich daher zunächst nicht. Die komparative Methode geht von der – natürlich stark idealisierenden – Annahme aus, dass Aufspaltungen zwischen Sprachen plötzlich stattfinden und dass nach der Aufspaltung der Protosprache kein Kontakt mehr zwischen den daraus resultierenden Tochtersprachen besteht (vgl. Campbell 2013: 143).
Campbell (2013: 111–134) schlägt folgende Schritte für die Durchführung einer Rekonstruktion mit Hilfe der komparativen Methode vor (ähnlich auch Crowley & Bowern 2010: 78–94; Trask 2015: 196):
Unter KognatenKognat (von lat. cognatus ‚verwandt; ähnlich/übereinstimmend‘) versteht man Formen, die auf einen gemeinsamen Ursprung zurückgehen. Am Anfang der komparativen Methode steht folgerichtig die Aufgabe, potentielle Kognaten in verwandten Sprachen ausfindig zu machen, bzw. in Sprachen, bei denen man gute Gründe hat, von einer Verwandtschaft auszugehen.
Nicht alle potentiellen Kognaten müssen automatisch auch Kognaten sein. So haben wir bereits gesehen, dass Baskisch sei ‚sechs‘ zwar formal ein hohes Maß an Ähnlichkeit zu seinen Pendants in den romanischen Sprachen aufweist. Aber weil das Baskische nicht mit den romanischen Sprachen verwandt ist, kann es nicht mit Ital. sei oder Span. seis kognat sein. Allenfalls könnte es sich um ein Lehnwort handeln – eine These, die durchaus in Erwägung gezogen wurde (vgl. Uhlenbek 1940–41). LehnwörterLehnwort gelten jedoch nicht als Kognaten (vgl. Campbell 2013: 352), da EntlehnungEntlehnung zunächst ein rein „horizontaler“ Prozess ist, wie Fig. 3 zeigt: Ein Wort wie Restaurant beispielsweise wird zu einem bestimmten Zeitpunkt t aus einer Sprache (S1) in eine andere (S2) entlehnt – hier: aus dem Französischen ins Deutsche. Daher existiert es heute in beiden Sprachen, doch es lässt sich nicht auf eine gemeinsame Proto-Sprache zurückführen. Hingegen lässt sich für dt. Gast und engl. guest, zusammen mit weiteren Kognaten wie nl. gast, norw. gjest, isl. gestur oder dän. gæst eine gemeinsame Ursprungsform annehmen, nämlich germanisch *gasti-. Der Asterisk (*) zeigt hier an, dass es sich um eine rekonstruierte Form handelt, die selbst nicht belegt ist: Es ist vielmehr jene Vorform, die angesichts der überlieferten Formen als die wahrscheinlichste angesehen wird.
Fig. 3: Kognat vs. Lehnwort.
Mit Hilfe der (potentiellen) Kognaten werden anschließend systematische Lautentsprechungen herausgearbeitet. Diese müssen von solchen Entsprechungen unterschieden werden, die höchstwahrscheinlich dem Zufall geschuldet sind. So enden in Tab. 1 span. uno und cinco auf -o, die baskischen Pendants bat und bost auf -t. Hier ein Muster erkennen zu wollen, wäre indes übereilt, wie auch der Blick auf die anderen auf -o endenden spanischen Zahlwörter in der Tabelle zeigt, die keine baskische Entsprechung auf -t haben. Auch wäre eine Stichprobe von nur zwei Wörtern natürlich viel zu klein, um überzeugend eine Lautkorrespondenz aufzuzeigen.
Vergleichen wir hingegen zwei und zehn mit den Kognaten im Englischen und Niederländischen, so zeigt sich ein Muster, das wir auch in vielen anderen Wörtern wiederfinden, wie Tab. 2 verdeutlicht.
Deutsch
Englisch
Niederländisch
Zahn
tooth
tand
zahm
tame
tam
(er)zählen
tell
(ver)tellen
zehren (früher auch: ‚reißen‘, vgl. mhd. zerzern ‚zerreißen‘)
tear ‚(zer)reißen‘
teren ‚zehren‘
Zinn
tin
tin
Zuber
tub
tobbe
Zwirn
twine
twijn
Tab. 2: Beispiele für Kognaten mit /ts/ im Deutschen und /t/ in anderen westgermanischen Sprachen.
Anhand dieser und weiterer Wörter lässt sich eine relativ klare Lautentsprechung nachweisen: Dem /ts/ im Deutschen entspricht im Englischen und Niederländischen – und auch in anderen westgermanischen Sprachen – der stimmlose Plosiv /t/. Historisch ist dies, wie wir in Kap. 4.1.1 sehen werden, auf die 2. Lautverschiebung zurückzuführen, die das Deutsche von allen anderen germanischen Sprachen trennt. Um Wandelphänomene wie die 2. Lautverschiebung entdecken zu können, bedarf es jedoch zunächst des Sprachvergleichs – genauer: der komparativen Methode.
Woher weiß man jedoch, dass bei den in Tab. 2 genannten Beispielen /ts/ der jüngere Laut ist und /t/ der ältere? Hierfür gibt es verschiedene Indizien. Erstens finden zahlreiche Lautwandelprozesse sprachübergreifend in eine bestimmte Richtung statt (Direktionalitätsprinzip): So gibt es viele Sprachen, in denen ein Wandel von /k/ zu /f/ belegt ist, während dieser Wandel in der umgekehrten Richtung praktisch nicht vorkommt (vgl. Campbell 2013: 113).
Zweitens gilt das Mehrheitsprinzip: Wenn keine anderen Indizien dagegen sprechen, wird jener Laut als Proto-Laut angenommen, der in meisten Tochtersprachen der zu rekonstruierenden Proto-Sprache auftritt (vgl. Campbell 2013: 114). So werden wir in Kap. 4.1.1 sehen, dass sich das Deutsche durch die sog. 2. Lautverschiebung von allen anderen germanischen Sprachen unterscheidet. Das zeigt sich auch in Tab. 2, denn das Englische und Niederländische haben hier wie die überwältigende Mehrheit der westgermanischen Sprachen /t/, wo das Deutsche /ts/ hat: isländisch tíu, Afrikaans tien, norwegisch und dänisch ti, schwedisch tio, färöisch tíggju – deutsch zehn. Das lässt darauf schließen, dass /t/ der ältere Laut ist.
Drittens gilt es, die gemeinsamen phonologischen Eigenschaften der unterschiedlichen Laute in den Tochtersprachen einzubeziehen. So diskutiert Campbell (2013: 116) ein Beispiel aus den romanischen Sprachen. Hier entspricht spanisch und portugiesisch /b/ im Französischen /v/ und im Italienischen /p/. Alle drei Laute teilen das Merkmal [+labial]. /b/ und /p/ teilen darüber hinaus das Merkmal [+plosiv], während /b/ und /v/ das Merkmal [+stimmhaft] gemeinsam haben. Nach dem Mehrheitsprinzip könnte man nun annehmen, dass */b/ als Proto-Laut zu rekonstruieren sei, doch spricht das Direktionalitätsprinzip dagegen, da sich stimmlose Plosive häufig zu stimmhaften Plosiven wandeln und Plosive zwischen Vokalen häufig zu Frikativen werden. Daher ist es plausibel anzunehmen, dass */p/ der gesuchte Proto-Laut ist, der in einigen der Tochtersprachen den häufig beschrittenen Wandelpfad p > b > v gegangen ist. Im Zweifelsfall kann es mithin sinnvoll sein, dem Direktionalitätsprinzip – unter Einbezug der geteilten phonologischen Merkmale der jeweiligen Laute – den Vorzug vor dem Mehrheitsprinzip zu geben.
Bislang mag der Eindruck entstanden sein, dass einem Laut in der Protosprache immer genau ein Set an Korrespondenzen entspreche, etwa dem Proto-Laut */p/ die Korrespondenz /b/ – /p/ – /v/ im Spanischen, Portugiesischen, Französischen und Italienischen. Das ist aber keineswegs immer der Fall, wie folgendes Beispiel aus den germ. Sprachen zeigt: Das stimmhafte /d/ in Bruder und das stimmlose /t/ in Vater gehen auf den gleichen Proto-Laut zurück; die rekonstruierten ie. Formen lauten *bhrāter- bzw. *pətḗr (vgl. Pfeifer 1993). Die Formen haben sich im Deutschen durch Lautwandel auseinanderentwickelt. Synchron haben wir es daher mit zwei verschiedenen, sich jedoch teilweise überlappenden Korrespondenzenbündeln zu tun:
dt. /t/
nl. /d/
engl. /ð/
Vater
vader
father
dt. /d/
nl. /d/
engl. /ð/
Bruder
broeder
brother
Tab. 3: Beispiel für zwei verschiedene, einander überlappende Sets an Lautkorrespondenzen.
Die Lautkorrespondenzen in Tab. 3 ließen sich natürlich noch um weitere Sprachen ergänzen. Doch schon in dieser kleinen Auswahl an Sprachen wird deutlich, dass die Faustregel „ein Laut in Sprache A entspricht einem Laut in Sprache B“ keineswegs immer aufgeht. Bei solchen einander überlappenden Korrespondenzenbündeln muss daher in jedem Einzelfall entschieden werden, ob es sich um zwei verschiedene Korrespondenzmuster handelt oder ob sich die beiden Korrespondenzmuster auf einen Proto-Laut zurückführen lassen – was im Falle der Vater/Bruder-Kognaten sehr wahrscheinlich ist.
Abschließend gilt es, die Plausibilität des rekonstruierten Lauts im Kontext des gesamten bisher rekonstruierten Phoneminventars vor dem Hintergrund typologischer Erwartungen zu überprüfen (vgl. Campbell 2013: 124–128) – in anderen Worten: zu überprüfen, wie plausibel die Annahme ist, dass a) eine Sprache das rekonstruierte Phoneminventar aufweist und dass b) in einer Sprache, die dieses Phoneminventar hat, genau dieser Laut auftaucht.
Gehen wir zunächst auf a) näher ein. In den Sprachen der Welt sind bestimmte Phoneminventare deutlich verbreiteter als andere, während einige hypothetisch denkbare Konfigurationen gar nicht auftreten. Zum Beispiel ist keine Sprache bekannt, in der es gar keine Vokale gibt. Ein rekonstruiertes Phoneminventar ganz ohne Vokale wäre folgerichtig eher unplausibel.
Weiterhin gibt es eine Reihe sprachlicher Universalien. Unter Sprachuniversalien versteht man Aussagen, die für alle (oder zumindest tendenziell für alle) Sprachen gelten. Wie „universal“ die in der Forschung angenommenen Universalien sind, ist hochumstritten, zumal nur ein Teil der auf der Welt gesprochenen Sprachen dokumentiert ist, von den bereits ausgestorbenen Sprachen ganz zu schweigen. Evans & Levinson (2009) sehen die Existenz von Sprachuniversalien daher als „Mythos“, wobei sie sich jedoch nur auf Aussagen beziehen, die ausnahmslos für alle Sprachen gelten sollen. Dass es statistische Tendenzen gibt, erkennen sie jedoch ausdrücklich an. Auf genau solche Tendenzen bezieht sich Kriterium b).
Die komparative Methode hat sich als wichtigstes Instrument der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft erwiesen, doch hat sie auch ihre Grenzen. So kann sie beispielsweise in isolierten Sprachen wie dem Baskischen, also solchen Sprachen, für die bisher keine Verwandten gefunden wurden, nicht angewandt werden. Hier muss man auf eine andere Methode zurückgreifen, um mögliche Vorstufen der Sprache zu rekonstruieren, nämlich die interne Rekonstruktion, die sich in manchen Fällen auch in nicht-isolierten Sprachen als Ergänzung zur komparativen Methode eignet. Ausgangspunkt der internen Rekonstruktion sind Allomorphe, also Formen, die im jeweiligen Flexionsparadigma oder auch in über Wortbildung abgeleiteten Wörtern unterschiedliche phonologische Formen haben. Im Deutschen finden wir Allomorphie z.B. in umgelauteten Formen, vgl. Maus – Mäus-e, Bub – Büb-lein. In solchen Fällen kann davon ausgegangen werden, dass die beiden Formen auf eine einzige Form zurückgehen und sich durch Lautwandel auseinanderentwickelt haben (vgl. Trask 2015: 238). Auf Grundlage dessen, was man über sprachübergreifende Lautwandeltendenzen weiß, kann man dann Lautwandelprozesse postulieren, die zur gegenwärtigen Situation geführt haben. Auch hier gilt es dann, die postulierten Prozesse im Kontext des rekonstruierten Gesamtsystems zu überprüfen (vgl. Campbell 2013: 199).
In den vergangenen Jahren haben sich zudem immer stärker computationale Methoden der Lexikostatistik und Glottochronologie etabliert. Bei diesen quantitativen Ansätzen, die allerdings in der historischen Linguistik teilweise noch mit Skepsis betrachtet werden (vgl. z.B. Campbell 2013), handelt es sich um sog. phylogenetische MethodenBayessche phylogenetische Methoden, die sich an der Evolutionsbiologie orientieren. Dass der Begriff „phylogenetische Methoden“ häufig ausschließlich mit diesen modernen Ansätzen in Verbindung gebracht wird, ist freilich etwas irreführend, denn letztlich sind auch die „klassischen“ Methoden, die zur Rekonstruktion von Sprachfamilienstammbäumen verwendet werden, phylogenetisch (von gr. φῦλον ‚Stamm‘ und γενετικός ‚Ursprung, Quelle‘). Auch die Verknüpfung zwischen Sprachwissenschaft und Evolutionsbiologie ist nicht neu: So wurde Darwin bei der Entwicklung der Evolutionsbiologie unter anderem von den Schriften August Schleichers inspiriert, der sich als einer der ersten an der Rekonstruktion der ie. Ursprache versuchte. Umgekehrt lehnen sich viele theoretische Ansätze jüngeren Datums an die Evolutionsbiologie an (z.B. Haspelmath 1999, Croft 2000).
Die Glottochronologie geht davon aus, dass es so etwas wie ein Basisvokabular gibt, also ein Inventar an Konzepten, für das es in allen Sprachen und Kulturen Wörter gibt. Das können z.B. Verwandtschaftsbezeichnungen, Farbwörter, Naturphänomene wie Sonne und Mond oder grundlegende Erfahrungen wie leben und sterben sein (vgl. z.B. Trask 2015: 350