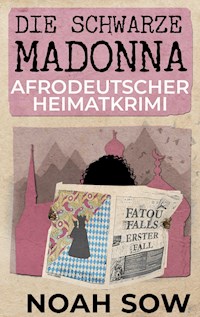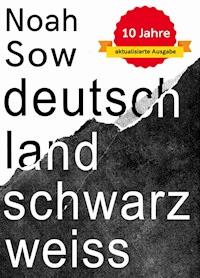
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ausgabe 2018. Für die vorliegende Ausgabe zum zehnjährigen Jubiläum wurden Print- und E-Book-Fassung von »Deutschland Schwarz Weiß« von der Autorin umfänglich überarbeitet und ergänzt. Inhalt: In der Schule lernen wir, dass alle Menschen gleich seien. Gleichzeitig lernen wir jedoch »Grundwissen«, das noch aus der Kolonialzeit stammt. In deutlicher Sprache und mit tiefgründigem Humor entlarvt die bekannte Künstlerin und Aktivistin Noah Sow den Alltagsrassismus, der uns in Deutschland täglich begegnet. So zeigt sie etwa, wie selbst die UNICEF-Werbung sich rassistischer Klischees bedient, und warum es schlimmer ist, »Die weiße Massai« zu Ende zu lesen, als nicht zur Lichterkette zu gehen. Rassismus zu bekämpfen heißt zunächst einmal, ihn zu verstehen. Dieser Prozess wird auch für Angehörige der Mehrheitsgesellschaft nicht ganz schmerzfrei vonstattengehen können. Aber wie nicht zuletzt Noah Sows Buch deutlich macht: lohnen wird es sich allemal, und zwar für alle. »Deutschland Schwarz Weiß« wurde seit seiner Erstauflage 2008 im C. Bertelsmann Verlag zu einem Standardwerk für die Lehre und Diskussion über strukturellen Rassismus in Deutschland und hat bis heute nichts an seiner Aktualität eingebüßt. Es folgten zahlreiche weitere Auflagen sowie eine Audiofassung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Noah Sow
Deutschland Schwarz Weiß
Der alltägliche Rassismus
„Ein kluges, ein wichtiges Buch.“STERN
„Die ideale Gegenspielerin zu Sarrazin“Frankfurter Rundschau
„Für all diejenigen, die sich ernsthaft bereit zeigen, die eigenen Rassismen aufzudecken und zu beginnen, diese kritisch zu hinterfragen und abzustellen, bietet das Buch eine große Chance.“www.bszonline.de
„Ein absolut empfehlenswertes ’Aufklärungs‘-Werk.“Tageblatt
„Humorvoll lässt uns Sow eigenen Vorstellungen begegnen, die wir bisher nie hinterfragt haben, und gibt Anregungen, wie wir eingefahrene Denkmuster aufbrechen können. Denn um Rassismus bekämpfen zu können, müssen wir ihn erst verstehen. Ein aufrüttelndes Buch.“Emotion
„Noah Sow geht es darum, den Leser dafür sensibel zu machen, wo Rassismus beginnt. Und das macht sie sehr, sehr gut. Noah Sow geht mit viel Humor und Selbstironie mit dem Thema um. Daumen hoch!“Radio Bremen
„Folgen wir Noah Sows Aufforderung und wagen wir ein jeder für sich und wir alle gemeinsam diesen Schritt zur Umsetzung der Menschenrechte auch bei diesem Thema. Alles in allem sind Buch und Hörbuch für Leser bzw. Hörer jeden Alters höchst empfehlenswert.“Humanistischer Pressedienst
„Wie Diskriminierung trotz bester Absichten stattfindet, das legt die Musikerin und Moderatorin in ihrer Streitschrift höchst anregend dar.“Neue Presse
„Rassismus ist in der deutschen Gesellschaft fest verankert. Wer glaubt, völlig frei davon zu sein, sollte Noah Sows Buch „Deutschland Schwarz weiss “ lesen. In sieben Kapiteln beschreibt Sow den Alltagsrassismus in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft und untermauert dies durch anschauliche Beispiele. Sow gelingt es hierbei, trotz der persönlichen und direkten Ansprache des Lesers sachlich und wissenschaftlich zu bleiben.“Amadeu-Antonio-Stiftung
„Ein provozierendes Buch, dass die Weißen einlädt zu einem Selbsterkenntnis- und Sensibilisierungsprogramm.“WDR
„Die Autorin schärft mit diesem Buch die Sinne der LeserInnen für den eignen unbewussten Rassismus und liefert das Rüstzeug, um es in Zukunft besser zu machen.“Aviva Berlin
„Die Erfahrung von Noah Sow lassen einem den Atem stocken.“DIE ZEIT
„Eine schonungslose und notwendige Enttarnung des alltäglichen Rassismus mitten unter uns, die eingefahrene Denkmuster infrage stellt.“MADAME
„Obwohl Sow das Phänomen Rassismus sehr detailliert sprachlich, historisch und medial unter die Lupe nimmt, ist ihr Tonfall kein sachlicher, sondern wütend, humorvoll und polemisch. [...] Da Sow kontinuierlich das Selbstverständnis hinterfragt, mit der die deutsche weiße Mehrheit ’'normal‘ und ’abweichend‘ definiert, ist die Lektüre eine unbequeme, aber lohnende.“Hamburger Abendblatt
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.Copyright © 2018 Noah Sow, alle Rechte vorbehalten ISBN: 9783746090542 Herstellung: BoD und Noah Sow Verlag: BoD - Books on Demand, Norderstedt Covergestaltung: Noah Sow, Siebdruck
Inhaltswarnung
Vorab entschuldige ich mich für alle rassistischen Bilder, Ausdrücke und Vorkommnisse, die ich in diesem Buch wiederhole, indem ich sie abbilde. Ich bin der Ansicht, dass sie handverlesen und im geschützten Raum, den ein Buch darstellt, als Anschauungsmaterialien legitim sind, um die Funktionsweisen von Rassismus zu verdeutlichen.
Einsendungen
Wir behalten uns vor, Einsendungen zu diesem Buch zu veröffentlichen. Darunter fallen insbesondere Zuschriften. Bitte machen Sie im Schriftverkehr deutlich, falls Sie anonym bleiben oder einer Vervielfältigung ausdrücklich widersprechen wollen.
INHALT
Formulierungen und Neues
Vorwort
Vorspann: Meine eigene Herkunft
KAPITEL EINS
Der helle Wahn
. Ein erstes Aufräumen mit unerfreulichen rassistischen Gewohnheiten
Klappe, die Erste: Bezeichnungen
Klappe, die Zweite: Wichtige Begriffe
Wer ist Schwarz, und wer ist weiß?
Wie sprachliche Auslagerung mithilft, den rassistischen Status Quo zu erhalten
Kleiner Exkurs am Rande
Weiter im Thema zum rassistischen Status quo
Nachhilfe im Weißsein
Test 1: Weißsein im Selbstversuch – Das VierzehnPunkte-Programm
Test 2: Erkenne ich Rassismus? (mit Auflösung)
KAPITEL ZWEI
Noch lange nicht passé: »Rasse« und Rassismus in Deutschland
Was ist »Rasse«?
Was ist Rassismus?
»Positiv«rassismus
Ist deutscher Rassismus Geschichte?
Verdrängungen: Koloniale Gewalt, koloniale Bilder
Koloniale Kontinuitäten in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus
Schwarze Geschichte – Deutschland/Europa
KAPITEL DREI
Ein weites weißes Feld: Alltagsrassismus in der Gegenwart
Unser täglich Wort: Rassistische Sprache
Ersatzlos zu streichen: Das N-Wort
Unverbesserlich: Das M-Wort
Unser täglich Tun: Rassistische gesellschaftliche Sphären
Kein Einzelfall! Stichwort: struktureller Rassismus
Institutioneller Rassismus
Polizei und Staat: Die Praxis des Racial Profiling
Beispiele für Polizeigewalt
Institution Schule
Rassismus im Sport
KAPITEL VIER
Weißdeutschland spezial: Rassismus und mediale Öffentlichkeiten
Rassismus in den Printmedien
Rassismus im deutschen Fernsehen
Rassismus im Theater
Rassismus in Show und Zirkus
Rassismus in anderen Medien
Werbung für Spendenprojekte
Unterhaltungsmedien für Kinder
Unsere fast funkelnagelneue Gleichstellungsbehörde
Schocktherapie!
KAPITEL FÜNF
Ich sehe, was ich weiß: Rassismus in zwischenmenschlichen Beziehungen
Meine Brille – deine Brille: Rassistische Wahrnehmungen und Rollenzuweisungen
Ein Tag unter Weißen
Das leidige Thema Haare
Nur eine Familienangelegenheit? Weiße Eltern und Schwarze Kinder
Einige Gedanken zum Stichwort Exotismus
Mögliche Problemfelder in Weiße-Eltern-Schwarzes-Kind-Beziehungen
Ein paar Vorschläge für ein traumafreies Miteinander
KAPITEL SECHS
Und täglich grüßt das Murmeltier: Rassistische Dauerschleifen und wie man ihnen begegnen kann
Offene und getarnte rassistische Strategien
Vorwurf des »Rassismus gegen Weiße«
Vorwurf des mangelnden Integrationswillens
Konstruierte Parallelgesellschaften
»Probleme durch Migration« / »Flüchtlingswelle« / »Flüchtlingsflut«
»Aber ich seh doch wirklich, wie die … das machen«
Teile und herrsche
Roman- und Filmfiguren Rassismusphantasien ausagieren lassen
Schwarzsein fremdbesetzen
Ersatz-Schwarze erschaffen
Aneignung und Ausbeutung Schwarzer Forschungsarbeit
Kontroversen provozieren
Stichwort Augenhöhe: Tipps für weiße Bekannte
Liste dummer Sprüche, die wir nie wieder hören wollen
KAPITEL SIEBEN
Tabubruch erwünscht: Überlegungen und Forderungen für die Zukunft
»… es fängt an mit Selbstrespekt«: Ein Interview mit Austen Brandt
Neue Muster schaffen: Die Politik des persönlichen Verhaltens
Neue Strukturen schaffen: Meine Forderungen für eine postkoloniale BRD
ETHNO-LEXIKON
Phänomene und Begriffe aus Ethnologie und Völkerkunde, erklärt anhand des hiesigen Kulturkreises
Dank
Anhang
Literaturauswahl zum Weiterlesen
Erfolgreich rassismuskritisch veranstalten
Deutscher Humor
Anmerkungen, Quellen- und Abbildungsnachweis
FORMULIERUNGEN UND NEUES
Vor Ihnen liegt (oder flimmert im E-Book-Lesegerät) die im Jahr 2018 aktualisierte Fassung von Deutschland Schwarz-Weiß. Was ist in dieser Auflage neu?
- Gegenüber bisheriger Printfassungen sind die Änderungen zahlreich.
Ich habe viele Ergänzungen vorgenommen, die angesichts neuerer Erkenntnisse und Phänomene geboten schienen. Dies betrifft vor allem, aber nicht nur, die so genannte »Flüchtlingswelle«, den Begriff »PoC«, die Abschnitte »Wer ist Schwarz, und wer ist weiß?«, »Was ist Rassismus?«, »Das N-Wort«, »Weiße Eltern und Schwarze Kinder«, »Offene und getarnte rassistische Strategien«, »Institution Schule«, das »Ethno-Lexikon« und einige Abschnitte mehr.
Auch habe ich ableistische diskriminierende Inhalte, die von mir selbst stammten, ersetzt, soweit ich sie identifiziert habe. Dies ändert freilich nichts daran, dass Schaden bereits entstanden ist und es jedes Mal, wenn die bisherigen Print-Auflagen gelesen werden, zu Verletzungen kommt, die vermeidbar gewesen wären. Dies bedauere ich sehr. Ich kann mich nur in aller Form entschuldigen und bei denen bedanken, die die Mühe auf sich genommen haben, mich auf diskriminierende Ausdrücke im Sprachschatz aufmerksam zu machen. Gerade vor dem Hintergrund meiner Behauptung, dass wir alle mit diskriminierendem Gedankengut sozialisiert werden, bin ich dankbar über Handreichungen, eigene Fehlleistungen zu erkennen, so dass ich sie ändern kann. Besonders in intersektionaler Hinsicht bitte ich Sie darum, nur die jeweils aktualisierteste Version des Buches für Zitierungen zu verwenden.
- Auch gegenüber der E-Book-Fassung aus dem Jahr 2015 sind neue Inhalte hinzugekommen. Sie finden sich unter anderem im Kapitel 4 in »Unsere fast funkelnagelneue Gleichstellungsbehörde« sowie im Kapitel 7 in »Neue Strukturen schaffen: Meine Forderungen für eine postkoloniale BRD«. Außerdem habe ich abermals viele Formulierungen hinsichtlich ihrer Gendergerechtigkeit korrigiert.
Im Kern enthält Deutschland Schwarz-Weiß 2018 jedoch denselben Text wie bisher. Weshalb, das beantworte ich im Interview mit Kommunikationsexpertin Julia Brilling{1}:
JB: Mit „Deutschland Schwarz-Weiß“ haben Sie so etwas wie ein Standardwerk zum Thema Rassismus in Deutschland geliefert, das viel zitiert wird. Wird es denn auch eine Fortsetzung geben? Bedarf gäbe es ja genug…
NSW: Da ließen sich sicher jedes Jahr 5 Bücher schreiben. Mir ist es aber lieber, einmal die Grundlagen zusammengefasst zu haben, und dass die, die von dort aus weiter Interesse haben, sich dann aktuellen Geschehnissen zuwenden. Ein Buch kann immer nur aus der Vergangenheit heraus schöpfen. Es gibt aber inzwischen so viele wichtige und lehrreiche Blogs und Webseiten, die immer mitten am Geschehen sind, und vor allem sich auch dem zuwenden, was im Moment, diese Woche, passiert. Das finde ich viel wichtiger als aufzulisten, was letztes Jahr alles blöd lief. (...) Mein Ziel mit dem Buch und Hörbuch war, denjenigen, die sich diese Informationen wünschen, sie griffig aufbereitet zur Verfügung zu stellen. Und auch, dass ich mich danach selbst weiterbewegen kann. Wenn ich ständig dieselben Grundzusammenhänge immer wieder erklären würde, das wäre kontraproduktiv.
Noah Sow, Hamburg, 2018
Deutschland Schwarz Weiß zum Hören
Speziell für die Arbeit in Gruppen und Klassen gibt es die Hörversion, die einen unverfälschten Eindruck vom Tonus der Autorin und des Buches bietet.
Sie enthält eigens produzierte szenische Elemente und Lesepassagen und hat die Länge einer Unterrichtsstunde.
Sie ist zu beziehen als mp3 download unter www.noahsow.de/dsw.
VORWORT
Es ist schwieriger, ein Vorurteil zu zerstören als ein Atom.
ALBERT EINSTEIN
Die Dinge, die ich in diesem Buch vermittle, sind keine Behauptungen, die ich neu aufstelle. Sie sind theoretisch Teil des Allgemeinwissens. Doch in Deutschland passiert gerade etwas sehr Interessantes: Der Zugang zu einem bestimmten Gebiet des Allgemeinwissens wird von der Mehrheit »aktiv« nicht genutzt. Das verwundert:
Die Deutschen wollen doch auch sonst immer alles ganz genau wissen. Warum nur über dieses eine Thema so wenig?
Die Antwort ist ganz einfach: Weil es Angst macht. Weil das Informiertwerden »ganz sachlich«, losgelöst vom eigenen Leben, bei diesem Thema nicht möglich ist. Lohnen tut es sich natürlich trotzdem. Denn der Stand der Aufklärung über die Gesichter des Rassismus und die Rolle, die die Mehrheitsgesellschaft dabei spielt, ist in Deutschland noch sehr, sehr niedrig. Weiße Deutsche haben aber durch die Beschäftigung mit dem Thema die Chance, künftig viele Zusammenhänge (inklusive der Selbstdefinition) in einem neuen Licht zu sehen. Höchste Zeit wäre es allemal: Deutschland ist rückständig, was den Umgang mit Rassismus betrifft.
Dies ist geschichtlich erklärbar, wichtiger aber: Es ist zu ändern. Und sollte zur Vermeidung größerer Blamagen und Verletzungen in nächster Zukunft auf die Reihe bekommen werden.
In diesem Buch werden Sie eigenen Vorstellungen begegnen, die Sie bisher wahrscheinlich nie hinterfragt haben, sowie alten »Wahrheiten«. Und Sie werden vor langer Zeit gelernte »Gewissheiten« überprüfen müssen. Dafür benötigen Sie vor allem – wie man auf Englisch so schön sagt – »the courage to be rational«: den Mut, rational zu bleiben.
Das wird anstrengend sein, es bedeutet Arbeit. Denn Rassismus zu bekämpfen heißt zunächst einmal, ihn zu verstehen. Dieser Prozess wird für Angehörige der Mehrheitsgesellschaft nicht schmerzfrei vonstatten gehen können.
Das vorliegende Buch ist ein Angebot für mehr Gerechtigkeit und Normalität und gegen Gewalt. Denn jede Form von Rassismus ist Gewalt.
Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass Sie ein guter Mensch sind. Wenn ich denken würde, dass Sie böse seien, würde ich mir nicht die Mühe machen, ein Buch zu schreiben, in dem ich versuche, verschiedene Dinge zu erklären. Daran können Sie sich erinnern, falls Sie sich im Lauf der Lektüre ab und zu mal ärgern. Gleichzeitig werden Sie auf den folgenden Seiten aber hin und wieder auch ganz schön hart angefasst werden. Nehmen Sie’s als Erfahrung.
VORSPANN: MEINE EIGENE HERKUNFT
Ich stamme ursprünglich aus einem Land, dessen Zivilisationsgrad vor noch nicht allzu langer Zeit von vielen Staaten der westlichen Welt belächelt und interessiert, aber von oben herab zur Kenntnis genommen wurde. Kein Wunder: Ganz in der Nähe gab es beispielsweise noch Stämme, die die Schädel ihrer verstorbenen Kinder bemalten (!) und sammelten.
Meine Großmutter, eine Eingeborene, hatte sechzehn Geschwister. Das Wasser kam selbstverständlich aus dem Dorfbrunnen statt wie heute aus dem Wasserhahn. Wenn es einmal regnete, wurde das Wasser eifrig gesammelt. Elektrizität hatte damals im Dorf kaum jemand.
Auch heute noch kämpfen wir mit den in unserer Gegend üblichen Problemen: korrupte Politiker, ethnische Konflikte (was vielleicht kein Wunder ist, denn die Grenzen meines Landes waren noch nie länger als zwei Generationen dieselben), hohe Verschuldung und so weiter. In den letzten paar Jahrzehnten hat mein Land aber einen enormen Schritt nach vorne gemacht. Inzwischen ist es politisch recht stabil, und es kann heute auf einiges stolz sein:
Bei der Einteilung des Landes durch Gebietszuteilungen an einzelne ethnische Gruppen, die vor etwa zwei Generationen stattfand, war einige Willkür im Spiel. Die Grenzen der teilsouveränen Stammesgebiete spiegelten nicht wirklich die genaue Besiedelung durch die jeweiligen Kulturen wieder. Zudem variierten die Gebiete stark in ihrer Größe. Trotzdem kam es deswegen nicht zum Bürgerkrieg.
Seit über sechzig Jahren war das Land in keinen ethnischen Krieg mehr verwickelt. Kleinere »Scharmützel« unter einzelnen Gruppierungen werden bisher gut unter Kontrolle gehalten.
Aus den vielen Dialekten, die im Land gesprochen werden, und von denen einige jeweils nur für Eingeborene desselben Gebietes verständlich sind (darunter auch reine Lautsprachen), wurde in einem friedlichen Prozess einer der Dialekte als Amtssprache ausgewählt. Ursprünglich wurde er zwar nur von einem relativ kleinen Stamm gesprochen, doch er setzte sich widerstandslos durch. Alle Landsleute verstehen nun zumindest rudimentär die offizielle Amtssprache. Das können nicht alle Länder von sich behaupten.
Seit Anfang des neuen Jahrtausends gibt es bei uns flächendeckend Festnetz-Telefonanschlüsse. Das war noch bis weit in die 1990er Jahre hinein kaum vorstellbar.
Eine Episode der Militärdiktatur, in die einzelne Stammesgebiete zeitweise zurückfielen, konnte
unblutig
beendet werden.
Die größte Herausforderung, die die Zivilisierung (die zugegebenermaßen durch äußere Kräfte erwirkt wurde) mit sich brachte, war für uns wohl das Erlernen von Demokratie. Dies meistern wir seither immer besser. Obgleich wir quasi »zu unserem Glück gezwungen« wurden, konnten wir eine spektakulär positive wirtschaftliche und sozialpolitische Tendenz verzeichnen, die nicht zuletzt auf jahrelange umfangreiche Lieferung von Hilfsgütern, staatsbildende Entwicklungshilfe und auch militärische Präsenz fortschrittlicher, zumeist westlicher Staaten zurückzuführen ist.
Die neuen Landesgrenzen, die wie bei vielen afrikanischen Ländern nicht durch meinen Staat selbst, sondern durch die Regierungen anderer Länder gezogen worden sind, wurden durch die Regierung meines Landes im Jahr 1990 sogar offiziell anerkannt.
Dieses Land heißt natürlich – Deutschland.
Meine Oma, die Eingeborene, stammt aus Bayern. Nebenan, in Österreich, bemalte man zu ihren Lebzeiten noch Schädel und stellte sie ins Regal. In den neuen Bundesländern hatten 1994 die meisten Haushalte keinen Festnetz-Anschluss. Über die verschiedenen Zivilisierungsgrade der BRD weiß ich bestens Bescheid.
Bemalte Schädel waren bis ins 20. Jahrhundert in Österreich und der Schweiz weit verbreitet. Bestimmte Motive lassen sich einzelnen Dörfern und Tälern zuordnen. Dieser Kinderschädel stammt aus Hallstatt in Oberösterreich.{i}
KAPITEL EINS
Der helle Wahn. Ein erstes Aufräumen mit unerfreulichen rassistischen Gewohnheiten
»Rassismus« gibt es, wenn man deutschen Medien Glauben schenken mag, immer nur anderswo: in Südafrika, in den USA, in Frankreich. In Deutschland gibt es keinen Rassismus, unter anderem, weil Deutsche ja alle weiß sind. Schön praktisch. Aber Unsinn. Wissen Sie, was ich zu ungefähr achtzig Prozent als Erwiderung höre, wenn ich deutschen Rassismus erwähne? Genau: »Aber in England (wahlweise: Frankreich, USA) ist es doch viel schlimmer.«
Ja, wir sind nicht die Einzigen mit einem Rassismusproblem.
Nein, es ist keine Lösung, darauf zu verweisen, dass anderswo angeblich alles viel schlimmer sei, und zu hoffen, dass damit das Thema für Deutschland vom Tisch ist. Wenn ich jemandem den Arm gebrochen habe, kann ich die Konsequenzen auch nicht durch die Tatsache abwenden, dass mein Cousin jemandem ein Bein gebrochen hat.
Ja, wir müssen hinsehen.
Lassen Sie uns einen Deal machen: Ich führe Sie auf den folgenden Seiten durch einen zentralen Teil des in diesem Land herrschenden Weltanschauungskonsens – und Sie lesen jedes Mal weiter, sobald Sie sich wieder abgeregt haben.
Zuallererst machen wir einen Test, den ich bei der Soziologin Judith H. Katz abgekuckt und für unser Vorhaben ein wenig zusammengefasst habe:{ii}
Schreiben Sie auf ein Blatt Papier eine Liste, wie Sie sich eine rassistische Gesellschaft vorstellen würden. Fragen Sie sich: Wenn diese Gesellschaft rassistisch ist… Welche Gruppen gäbe es dann? Wer dürfte was und wer dürfte was nicht? Wer würde die Entscheidungen treffen? Wer würde wobei benachteiligt und bevorzugt? Wie würde der Besitz verteilt werden? Welche Gruppe würde die Vorsitzenden und Vorstände welcher Institutionen (Banken, Schulen, Universitäten, Polizei, Regierung usw.) stellen, und was würden diese mit der ganzen Macht unternehmen? Welche Gruppe hätte was genau unter Kontrolle? Wer würde bestimmen, welche Inhalte und Zustände offiziell anerkannt werden und welche nicht? Wer müsste wem Rede und Antwort stehen? Welche Gruppe müsste sich vor welcher Gruppe nicht erklären und rechtfertigen? Wie wäre die Gesellschaft hierarchisch geordnet, oder welche Arten von Unterdrückung würden in ihr vorkommen? Würde die rassistische Gesellschaft, die Sie erfinden, selbst zugeben, dass sie rassistisch ist, oder würde sie behaupten, nur alles so zu organisieren, wie es zum Wohl der öffentlichen Ordnung oder einfach »besser« oder »normal« sei?
Diese Überlegungen helfen Ihnen möglicherweise dabei, sich im Lauf der Lektüre dieses Buches zu verdeutlichen, was Rassismus für Sie ist. Ergänzen Sie die Liste immer, wenn Ihnen etwas Neues einfällt.
KLAPPE, DIE ERSTE: BEZEICHNUNGEN
Natürlich sollten wir alle Menschen immer genau so nennen, wie sie es selbst für sich ausgesucht haben (»Magic Superchamp«, »Spiderman« und »Führer« vielleicht mal ausgenommen). Wie eine Person sich selbst bezeichnet, soll eigentlich immer respektiert werden. Da es mir aber nicht möglich ist, in einem Buch alle so zu bezeichnen, wie sie es persönlich gut finden, benutze ich die politisch und akademisch etablierten Begriffe »Schwarz« und »weiß«. Dass »Schwarz« nachfolgend immer groß geschrieben wird, soll darauf aufmerksam machen, dass es kein wirkliches Attribut ist, also nichts »Biologisches«, sondern dass es eine politische Realität und Identität bedeutet. Auch hat »Schwarz« den Vorzug, dass es ein selbst gewählter Begriff ist und keine Zuschreibung. Diese Schreibweise hat sich im akademischen Umfeld und in Fachpublikationen etabliert. Bei »weiß« handelt es sich ebenfalls um eine Konstruktion. Da dieser Begriff aber im Gegensatz zu »Schwarz« keine politische Selbstbezeichnung aus einer Widerstandssituation heraus ist, wird er im Buch als Adjektiv klein geschrieben.
Ja, es ist schade, wenn gleich zu Anfang eines Buches die Welt in »weiß« und »Schwarz« eingeteilt wird. Zum einen ist es aber leider nicht möglich, Rassismus zu überwinden, ohne seine Konstrukte »Schwarze« und »Weiße« während dieses Prozesses zu benennen – mit dem hehren Ziel, dass wir das alles eines Tages nicht mehr nötig haben. Zum anderen wird die Welt auch in jedem anderen Buch, das bisher in Deutschland erschienen ist, in »Schwarze« und »Weiße« aufgeteilt, worüber Sie sich bisher womöglich weniger aufgeregt haben.
Jetzt, wo das gesagt wurde: Ja, dieses Buch wendet sich überwiegend an Weiße. Das soll aber nicht heißen, dass Schwarze Menschen nicht als Leser_innen infrage kommen, sondern dass sie über andere Erfahrungen verfügen. Da ich in dem Buch über Dinge informieren will, die der Mehrheit der weißen Deutschen bisher nicht klar sind, könnte es sein, dass Schwarze Menschen und People of Color sich vorkommen wie in einem Film, den sie schon zwölfmal gesehen haben. Als »Entschädigung« dafür gibt es eigens für uns das Kapitel »Liste dummer Sprüche, die wir nie wieder hören wollen« – mit praktischen Antwortvorschlägen. Und da Weiße es bekanntlich besonders toll finden, wenn man sich mit ihnen beschäftigt, hoffe ich, dass sich dadurch auch die Inhalte des Buches transportieren lassen. Los geht’s mit einem kleinen Definitionsteil, damit wir auch dieselbe Sprache sprechen.
KLAPPE, DIE ZWEITE: WICHTIGE BEGRIFFE
Schwarz
die politisch korrekte und vor allem selbst gewählte Bezeichnung für Schwarze Menschen.
weiß
die politisch korrekte Bezeichnung für weiße Menschen.
People (singular: Person) of Color, kurz: PoC
eine politische Eigenbezeichnung von und für Menschen, die nicht weiß sind. Das Konzept »People/Person of Color« bekräftigt solidarische Zusammenschlüsse zwischen Menschen, die über einige gemeinsame Erfahrungen in der weißdominierten Gesellschaft verfügen. Bündnisse unter PoC erwirken eine Auflösung weißer Einteilungen und greifen rassismusgespeiste »teile und herrsche«-Taktiken an.
Der Begriff People of Color wird im aktivistischen und akademischen Umfeld benutzt und ist in vielen englischsprachigen Ländern eine gängige Bezeichnung. In Deutschland hat sich das Wort noch nicht überall durchsetzen können, was daran liegen mag, dass es lang und englisch ist, oder auch daran, dass in Mehrheitsdeutschland die unterschiedlichen Lebensrealitäten von weißen Menschen sowie PoC weitestgehend ignoriert werden. Starke politische Begriffe, die verdeckte Hierarchien klar benennen, entlarven schließlich Machtgefüge...
So wichtig und wirkmächtig Koalitionen sind zwischen Menschen, die diverse negative Rassismuserfahrungen machen, so wichtig ist es, sich innerhalb jener Koalitionen zu vergegenwärtigen, dass auch diese sich nicht im diskriminierungsfreien Raum bewegen. Rassismus wirkt sich auf die durch ihn markierten Menschen und (konstruierten) Gruppen unterschiedlich aus. Er erzeugt Hierarchien und dadurch auch externe Wahrnehmungsmuster, die wiederum innerhalb der Bündnisse zutage treten. Rassismus wirkt verschieden und tritt in unterschiedlichen Konstellationen unterschiedlich auf. Die globalen rassistischen Abwertungsmarker, nach denen die Weltgesellschaft strukturiert ist, lösen sich in Bündnissen nicht von selbst auf, sondern sollten von ihnen enttarnt und angegriffen werden. Widerstandsarbeit, die sich dem stellt, hat am meisten Potenzial, Rassismus umfänglich entgegenzuwirken.
Da es gelegentlich Verwirrung um den Begriff »PoC« gibt, hier noch eine kurze Präzisierung: »ausländisch« meint nicht dasselbe, wie eine Person of Color zu sein, meint nicht dasselbe wie Schwarz zu sein. PoC schließt Schwarze Menschen mit ein, ist aber nicht gleichbedeutend mit Schwarz.
Und nicht vergessen: es gibt auch zahlreiche Schwarze türkische, Schwarze asiatische und Schwarze amerikanisch indigene Menschen.
»farbig«
eine koloniale Bezeichnung, die Menschen rassisch einordnen und kategorisieren möchte. »Farbig« soll eine Abgrenzung zu »weiß« und »Schwarz« als politischen Begriffen herstellen und ist ein Konstrukt aus der weißen Rassenlehre. Manche vorgeblich wohlmeinenden Leute beharren interessanterweise auf der Unterscheidung zwischen hellhäutigen und dunkelhäutigen Schwarzen Menschen und verteilen rassistische Komplimente wie zum Beispiel: »Och, du bist doch gar nicht richtig schwarz!« – ganz, als solle das als etwas Positives aufgefasst werden.
In einigen Ländern werden als Folge von Apartheid sogar heute noch ganz offiziell Unterschiede und Abstufungen hinsichtlich des Schwarzseins gemacht. Die einzelnen Bezeichnungen dafür, wie hell- oder dunkelbraun (wo ist die Grenze?) oder zu wie viel Prozent »rein« Schwarzer oder weißer »Abstammung« eine Person sei, sind Relikte aus der noch nicht sehr lange zurückliegenden Zeit der Rassentrennungspolitik und sind künstliche Unterscheidungskategorien. Diese Unterscheidungen gingen mit einer Politik unterschiedlicher »Wert-Einstufungen« von Menschen einher, eine Ideologie, die sich heute ein wenig subtiler fortsetzt. Die Folgen davon sind die Schwierigkeiten von heute.
Die Konstruktion von »Unterschieden« zwischen »hell-schwarz« und »dunkel-schwarz« ist für koloniale und neokoloniale Gesellschaften nützlich, weil sie die so Markierten teilt und damit einer Einheit im Kampf gegen rassistische Unterdrückung entgegenwirken kann.
Selbstverständlich sind die aus der Zeit der Versklavung und Kolonialisierung stammenden Einstufungen und Kategorisierungen von Menschen nicht nur wahllos, sondern auch gefährlich. Hellhäutigkeit ist dabei zumeist direkt verbunden mit mehr sozialen Privilegien, »besserer« Entsprechung der (weißen) Schönheitsideale und stellt damit eine Fortführung der kolonialen Einteilung von Menschen aufgrund ihres »phänotypischen« Aussehens dar. In manchen französisch kolonisierten Gebieten beispielsweise werden noch heute Schwarze Kinder, die ein weißes Elternteil haben und »hellhäutig genug« aussehen, »sauvé« genannt: »gerettet«.
Da bei weißen Menschen durchweg auf eine Beschreibung der Farbgebung (›beige mit Orangestich‹, ›hellrosa mit braunen Punkten‹, etc.) und damit einhergehende Identifizierung verzichtet wird, selbst wenn es sich etwa um gesuchte Verbrecher handelt und daher eine möglichst genaue Personenbeschreibung wichtig ist, stellt ›farbig‹ offensichtlich ein rassistisches Konstrukt dar. In der Regel erfolgt eine Erwähnung/»Beschreibung« der Körperfarbe nur einseitig auf Menschen bezogen, die nicht weiß sind, darüber hinaus zumeist reflexhaft und grundlos, und sie dient auch als Signal für koloniale Assoziationen. »Nicht ganz Schwarz«/»Ziemlich Schwarz«/»Ganz Schwarz«-Schubladen erwecken unmittelbar darauf abgestufte Behandlungen und Erwartungshaltungen.
Eine Aussage »Du bist doch gar nicht richtig schwarz« ist also eine koloniale Bevormundung, denn wer in unserer Gesellschaft sehr wohl als Schwarze_r wahrgenommen wird und dadurch mit diversen Widrigkeiten zu kämpfen hat, braucht bestimmt nicht obendrauf noch eine weitere Aussenansicht und Zuschreibung.
Selbstverständlich gibt es neben der Pigmentierung auch noch andere als »typisch Schwarz« geltende Merkmale, aufgrund derer noch heute versucht wird, »Rassen« zu kategorisieren, zu definieren und zu pauschalisieren.
Klar ist: Niemand hat das Recht, Menschen in »Nicht ganz Schwarz«/»Ziemlich Schwarz«/»Ganz Schwarz«-Schubladen mit den entsprechend darauf abgestuften Behandlungen und Erwartungshaltungen zu stecken, und wer anderen dies untersagt, wehrt sich zu Recht.
Es ist außerdem bemerkenswert, dass bei Einigen der Drang zu bestehen scheint, Schwarze Menschen generell zuallererst mit einem Sachwort zu bezeichnen, das Auskunft darüber gibt, von welchem »rassischen Reinheitsgrad« oder genauer »was« (!) sie seien: »Farbige(r)«.
»Farbig« wird in Deutschland noch häufig als eine angeblich »höflich gemeinte«, weil schwächere Form von Schwarz strapaziert. Damit soll »abgeschwächt« werden, dass eine Person Schwarz ist, und genau das ist das Problem: Wir haben es hier eindeutig mit einem Euphemismus zu tun. Ein Euphemismus ist eine stark beschönigende Bezeichnung für etwas, dessen ehrlicher Name uns zu verstörend erscheint. Also beispielsweise »entschlafen« statt »gestorben«, oder »vorübergehendes Unwohlsein« statt »Depression«. Euphemismen werden üblicherweise dann verwendet, wenn es etwas zu krasses zu verschleiern gibt. Das ist einer der Gründe, warum »farbig« bei vielen Menschen nicht besonders gut ankommt, denn es ist der Euphemismus von »Schwarz«, und das heißt, dass Schwarz als problematisch wahrgenommen wird und beschönigt werden muss. Ganz abgesehen vom Subtext, dass die so Benannten kein Selbstbenennungsrecht innehätten.
Und noch ein weiterer Grund dafür, dass der Begriff »farbig« nicht in Ordnung ist: Es klingt so, als sei weiß zu sein ein »Normalzustand«, die »Ausgangsposition«, und als seien »Farbige« so etwas wie »eingefärbte« Weiße (dass die evolutionäre Wirklichkeit wie auch die der Proportionalitäten der Weltpopulation eine ganz andere Sprache sprechen, ist hierzulande anscheinend noch nicht zu allen durchgedrungen). »Farbig« ist also das Konstrukt einer »Abweichung von Weiß«. Und das ist natürlich Unsinn.
»Halb Schwarz«
Ja klar, und als Nächstes halb blauäugig und Halbblut Apanatschi. Ich habe noch nie den Begriff »halb weiß« gehört. Was soll das sein? Rassenabstufungsdrang, schlecht getarnt.
»Mischling«/»Mulatte«
Ausdrücke wie »Mulatte« (zu Deutsch: »Mischung aus Esel und Pferd«) oder »Mischling« sind, da sie unverhohlen dem Tierreich entliehen sind, denkbar ungeeignet, um Menschen zu bezeichnen. Leider sind sie immer noch oft in Gebrauch, werden allerdings zunehmend als die überflüssigen und entwürdigenden Beleidigungen erkannt, die sie darstellen.
Es ist bei dem ganzen Thema tatsächlich denkwürdig, dass unsere Gesellschaft einen dermaßen verbissenen »Hautfarben-Kategorisierungsdrang« zeigt und sich einbildet, ohne »Rassenabstufungen« (denn darum geht es hier letztlich) nicht auszukommen.
Eine Biologielehrerin hat mal meiner versammelten Klasse erklärt, dass bei Hunden ja auch die »Mischlinge« intelligent seien und man das an mir schön sehen könne. Auf dieses hohlrassistische »Kompliment« hätte ich gut verzichten können.
Alle Menschen sind – wenn man sich zu diesem Unwort denn unbedingt versteigen will – »Mischlinge«, und zwar aus dem Erbgut von Papa und Mama. Genauso wenig wie Kinder von einer mit Schuhgröße 39 und einem mit Schuhgröße 43 als »Mischling« gelten (oder von einer mit blauen und einem mit grünen Augen), genauso wenig ist eine Person ein »Mischling«, nur weil ihre Eltern nicht wie Zwillinge aussehen.
Weiße sollten sich trotzdem nicht wundern, wenn Schwarze Menschen diese Bezeichnungen doch verwenden. Es ist immer noch ein großer Unterschied, wie Personen sich selbst bezeichnen und wie sie genannt werden. Einige mögen sich dagegen wehren, in welcher Form auch immer kategorisiert zu werden, sie wollen vielleicht überhaupt nicht als Schwarze bezeichnet werden. Auch das sollte respektiert werden. Es ändert jedoch wenig an den Vorgaben respektvollen sprachlichen Umgangs. Wenn vereinzelte weiße Blondinen gern mit »Baby« angesprochen werden, heißt das auch nicht, dass daraus eine legitime Bezeichnung für blonde weiße Frauen hergeleitet werden kann.
WER IST SCHWARZ, UND WER IST WEIß?
Ganz einfach: Alle Schwarzen Menschen, die den politischen Begriff »Schwarz« akzeptieren, bezeichne ich in diesem Buch als Schwarze, alle PoC, die diesen Begriff akzeptieren, als PoC und alle Weißen als Weiße.
Schwarz zu sein ist keine biologische Eigenschaft, sondern steht für bestimmte gemeinsame Erfahrungen in der globalen Gesellschaft. Weiße können daher nicht bestimmen, wer Schwarz ist und wer nicht.
Auch Schwarze Menschen, die nicht auf den ersten Blick als afrikanischstämmig zu erkennen sind, sind von Rassismus betroffen. Die eigene Familiengeschichte mit ihren Erfahrungen, Behandlungen der Eltern oder Großeltern in Zeiten kolonialer Propaganda sowie damit verbundene Traumata, Traditionen und Resilienzen werden durch das individuelle Aussehen nicht ausgelöscht.
Beachten Sie bitte, dass Sie sich nicht selbst als weiß betrachten oder definieren müssen, um zur Gruppe der Weißen zu gehören. Vielleicht lehnen Sie diese Bezeichnung für sich selbst ab und versuchen gerade, sich da irgendwie inhaltlich herauszuwursteln. Weshalb es wichtig ist, dass Sie genau das nicht schaffen, erkläre ich gleich. Bleiben Sie noch ein bisschen dabei.
Denken Sie jetzt immer noch: Aber die Bezeichnung »Schwarz« ist doch … irgendwie … nicht richtig?
Sie können aus verschiedenen Gründen »Schwarz« unangemessen finden:
weil Sie finden, Schwarz zu sein sei etwas Negatives (begeben Sie sich in betreute Biografieaufarbeitung)
weil Sie finden, Sie werden dazu gedrängelt, einen Begriff zu akzeptieren, den Sie selbst aber gar nicht wählen würden (das nennt sich Selbstbenennungsrecht, und Sie sind gewöhnt, es nicht respektieren zu müssen)
weil Sie glauben, dass ja niemand »echt Schwarz« ist, sondern eher … mehr so braun.
Hm, Weiße sind rosa, aber kein Mensch sagt ihnen deswegen, wie sie sich selbst zu nennen haben.
Bei der Einteilung der Menschen in »Hautfarben« geht es natürlich nie wirklich um die Farbe, auch nicht um eine genau definierbare Gruppe. Weder sind alle Weißen ein »Volk« noch sehen sie sich im Schnitt im Entferntesten ähnlich. Abgesehen von einigen durchschnittlichen äußerlichen Eigenheiten wie zum Beispiel häufig zwei Armen haben sie keinerlei Gemeinsamkeiten.
»Weiß« ist kein biologischer Begriff, und er hat auch nichts mit einer Nationalität zu tun, sondern ist eine gesellschaftspolitische Bezeichnung, die besagt: Diese Person wird zur Gruppe der Weißen gezählt.
Sie wurden aber noch nie zu irgendeiner weißen Gruppe oder so etwas gezählt?
Doch, jeden Tag. Man spricht nur nicht darüber.
Ob aber Sie oder ich jeweils in kurzen Hosen eine Nobelboutique betreten oder betrunken in einen Plenarsaal laufen, wird von der Umwelt sehr genau beobachtet und recht unterschiedlich eingeordnet.
Aber wie soll ich dann eine Frau nennen, die … »halb schwarz« ist?
Wie wär’s mit – »Tanja«?
Haben Sie schon mal in einem Café gesessen und, wenn Sie einen Weißen beschreiben wollten, gesagt: »Der Hellbeige da, neben dem Typen, der mehr so ins Orangene geht, mit den rosa Punkten auf dem Arm«?
Weiße haben die lustigsten Spektren an Hautfarben. Eigentlich müssten wir sie »Farbige« nennen, das würde auf alle Fälle mehr zutreffen. Wir benennen diese Farbnuancen aber trotzdem nicht, weil wir es so gelernt haben. Wir haben gelernt, eine weiße Person ungefähr so zu beschreiben: »Der Typ da hinten mit der langen Nase, den blondierten Haaren, den blauen Turnschuhen, Mitte 40.« Wir haben gelernt, nicht zu verkünden: »Der weiße Typ da.«
Wer sagt außerdem, dass die Person »halb Schwarz« sei? Genauso ließe sich behaupten, sie sei »halb weiß« oder »halb asiatisch«. Das haut aber nicht hin. Denn für Diskriminierung und Rassismus spielt es keine Rolle, ob der oder die Betreffende hell- oder dunkelbraun ist oder einen weißen Großeltern- oder Elternteil hat. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, etwa zu behaupten, Bob Marley sei »nicht richtig Schwarz« gewesen; er ist das weltweite Idol vieler Schwarzer Bewegungen geworden, ein Archetyp von »Black Power«, und hatte doch ein weißes Elternteil. Nur wer so aussieht, als ob er/sie ausschließlich weiße Vorfahren hätte, kann für die Öffentlichkeit weiß sein und entsprechend behandelt werden.
Derartige Schwarz/weiß-Kategorisierungen mögen überflüssig erscheinen und werden es hoffentlich eines Tages auch sein. Ganz sicher sind sie das Ergebnis eines langjährigen weißen »Rassen«-Differenzierungswunsches. Die ganze Palette gesellschaftlich erlernter Rollen, Erwartungen, Auflagen ist auf konstruierte Unterschiede zugeschnitten. Die Weißen sind der Angelpunkt, um den sich alles dreht. Die Gesellschaft wird eingeteilt in »weiß« (das damit zur Norm erhöht wird) und »nicht weiß« (das zur »Abweichung« konstruiert wird), und Erstere dürfen ungerechterweise mit ihrem Verhalten bestimmen, wer wo »dazugehört«. Da dies aber sowieso schon die ganze Zeit geschieht, bin ich dafür, diese Tatsache klar auszusprechen, damit sie geändert werden kann.
Sprache ist immer auch Definitionsmacht. Die Menschen zu benennen und eigenmächtig in Grüppchen einzuteilen, ist ein Privileg der Weißen; vielen von ihnen ist das jedoch gar nicht klar. Denn es wird erlernt, ohne dass es extra ausgesprochen werden muss. Im Kindergarten heißt es ja nicht: »So, Klausi, jetzt teil doch mal die Aische und den Charles in ein Grüppchen ein, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben, und such dir selber irgendeinen Oberbegriff für sie aus, wie zum Beispiel Ausländer, und tu dann so, als wäre das Ganze gar nicht willkürlich. Ihre Meinung dazu kann dir dann völlig egal sein, weil du darfst das ruhig.« Es geschieht vielmehr aus Nachahmung.
Viele weiße Menschen in Deutschland haben sich bisher gar nicht damit auseinandergesetzt, dass sie Weiße sind, also auch zu einer besonderen gesellschaftlichen Gruppe gehören. Dass es dabei um Macht geht, bemerken Menschen in der Regel erst, wenn sie dauernd auf eine Art benannt werden, die für sie nicht akzeptabel ist. Fremddefinition ist auch Fremdbestimmung, und wer ohne Diskriminierung bezeichnet werden will, muss sich auf einige Anstrengungen gefasst machen.
Ich schreibe über Rassismus gegenüber Schwarzen Menschen, denn damit kenne ich mich aus. Um es ganz deutlich zu sagen: Es geht bei Rassismus nicht um Diskriminierung etwa aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten oder »fremder« Kultur. Schwarz heißt nicht gleich »migrantisch« oder andersherum. Dass es auch nicht um »Fremdsein« geht, wird dadurch deutlich, dass Schwarze Deutsche von diesen Diskriminierungen ebenso betroffen sind.
Wenn Sie nicht weiß sind, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass Sie abwechselnd zur einen oder zur anderen Gruppe, die ich erwähne, gehören (wollen). Vielleicht wurde Ihnen ebenfalls beigebracht, dass Sie aufgrund einer diffusen Überlegenheitsannahme Schwarze Menschen nicht ernst zu nehmen brauchen. Gleichzeitig machen Sie aber im täglichen Leben vielleicht vielfältige Erfahrungen, die weiße Menschen nicht machen können: Sie werden womöglich beleidigt und dominiert aufgrund rassistischer Zuschreibungen, kennen sich mit Vorurteilen aus und haben Erfahrungen als Angehörige(r) einer Minderheit in Deutschland.
Ich denke, dass Sie sicher selbst wissen, wann Sie in welcher »Erfahrungsgruppe« sind. Dies gilt – ich wiederhole mich hier bewusst – allerdings nicht für weiße Deutsche. Sie können nicht selbst bestimmen, in welcher Gruppe sie in diesem Buch sein wollen. Denn das ist keine Frage der Selbsteinschätzung, sondern der Definition: Wenn Sie Angehörige_r der weißen Mehrheitsgesellschaft sind, müssen Sie es sich jetzt mal eine Zeit lang gefallen lassen, dass Sie benannt werden, statt sich selbst benennen zu dürfen. Nehmen Sie es als Erfahrung. Keine Sorge, nächste Woche sind Sie wieder die Bestimmer. Daran wird sich auch nichts ändern, wenn Sie verfilzte Haare, Baggy Pants oder Batikschals tragen …
WIE SPRACHLICHE AUSLAGERUNG MITHILFT, DEN RASSISTISCHEN STATUS QUO ZU ERHALTEN
Sie tun das zum Beispiel, wenn Sie den Begriff »Rassismus« nicht in den Mund nehmen, weil Sie bei dem Wort zusammenzucken. Wenn Sie so agieren, ist das ein Zeichen dafür, dass Sie Rassismus lieber ignorieren und nicht beim Namen nennen wollen. Das geschieht unter anderem immer dann, wenn die Vokabeln »ausländerfeindlich«, »fremdenfeindlich« und »rechtsradikal« gerade im Zusammenhang mit rassistisch motivierter Gewalt falsch verwendet werden.
Das Ignorieren oder Verdrängen von Rassismus ist aber eine große Hürde auf dem Weg zu seiner Überwindung. Daher nachfolgend ein paar Begriffsdefinitionen.
Ausländerfeindlich
Gewalt ist ausländerfeindlich motiviert, wenn das Opfer keinen deutschen Pass besitzt und wenn erkennbar und explizit die nicht deutsche Kultur der Angegriffenen als Motivation für den Übergriff benutzt wird. Dies gilt etwa für Opfer, die weiß sind, oder für Übergriffe auf europäische Kulturveranstaltungen. Eine Tat kann nicht als ausländerfeindlich bezeichnet werden, wenn die Feindseligkeit sich auf das Aussehen der angegriffenen Person bezieht, so etwa im Fall des Überfalls auf Ermyas M. in Potsdam.
Rassistisch (motiviert)
Gewalt ist rassistisch motiviert, wenn sie an Menschen verübt wird, die nicht weiß sind und wenn sie mit rassistischen Äußerungen einhergeht. Dies gilt auch für Opfer, die Deutsche sind, wie beispielsweise Ermyas M. Ausländerfeindlickeit und Rassismus sind nicht gleichzusetzen, und sie sind keine Synonyme.
Eine differenzierte Wortwahl benennt diese verschiedenen Hintergründe der Übergriffe genau und ermöglicht es so erst, die Wurzeln des Übels zu identifizieren und letztlich zu bekämpfen. Wer Angriffen auf Schwarze Deutsche pauschal eine »ausländerfeindliche« Motivation unterstellt, unterstellt, begeht den Fehler, zu kommunizieren, dass Schwarze Menschen keine Deutschen sein können (verhält sich damit übereinstimmend mit völkischem Gedankengut der NPD und AfD) und verschleiert zudem, dass Rassismus die Grundlage in dem spezifischen Fall ist. Dies dient vor allem dem Aufrechterhalten des rassistischen Status quo und ermöglicht es weiterhin, die wahren Hintergründe und Verantwortlichkeiten rassistisch motivierter Gewalt zu vertuschen und zu verharmlosen.
Fremdenfeindlich
Was ich zum Begriff »ausländerfeindlich« schrieb, gilt im selben Maß für »fremdenfeindlich«. Dieser Ausdruck wird ebenfalls noch oft als vermeintliches Synonym für die Vokabel »rassistisch« verwendet. Fremdenfeindlich ist eine Tat aber nur, wenn sie gegenüber Fremden verübt wurde, beispielsweise Touristen oder kürzlich Zugezogenen. Ein Politiker oder Lehrer, der seit fünf Jahren in der Gegend wohnt, ist kein Fremder (und dies unabhängig davon, ob er nun die deutsche Staatsbürgerschaft innehat oder nicht) und kann auch nicht so bezeichnet werden.
Der Ausdruck »fremdenfeindlich« birgt zudem die Gefahr, dass fälschlicherweise ein Zusammenhang zwischen »fremd sein« und der Gewalttat geknüpft wird, so dass unterschwellig der Eindruck vermittelt werden kann, schlimme Dinge passieren, weil eine Person fremd ist. In Wirklichkeit ist es jedoch selbstverständlich so, dass eine Gewalttat nicht verübt wird, weil das Opfer eine bestimmte Eigenschaft oder Herkunft hat, sondern weil der Täter eine bestimmte Einstellung hat.
Dies ist nicht nur Wortklauberei. Würde statt »fremdenfeindlich«, das zunächst impliziert, dass eine Person nichtzugehörig ist und daher die Täter nur darauf reagieren (genauer: einen falschen Zustand zu korrigieren versuchen), eine Begrifflichkeit gewählt, die zweifelsfrei das gesamte Defizit der Situation den Ausübenden der Gewalt zuschreibt, so könnte vieles in Debatten um derartige Übergriffe besser verstanden werden.
Menschen, die in der Region leben, können nicht aus Fremdenfeindlichkeit angegriffen werden.
Am Rande möchte ich bemerken, dass bereits Wörter wie »fremd« und »Ausländer« in diesem Zusammenhang in der Lage sind, etwas zu konstruieren, was mit den Taten in Wirklichkeit nichts zu tun hat. Grund für Übergriffe ist nicht, welchen Pass oder welche Herkunft die Angegriffenen haben.
Rechtsextremistisch
Gewalt hat einen rechtsextremistischen Hintergrund, wenn die Täter dies bekennen oder explizit rechtsextrempolitisches Gedankengut äußern und sich in spezifischen Vereinigungen organisieren. Gewalt aus Rassismus ist keine rechtsextremistische Tat und kann daher nicht rechtsextremistischen Bewegungen zugeordnet werden, sondern beruht auf der rassistischen Einstellung und Handlung derer, die die Gewalt ausüben.
Der oft durch unpräzise Wortwahl in den Medien bestärkte Automatismus, alle rassistisch, fremdenfeindlich oder ausländerfeindlich motivierten Gewalttaten pauschal Rechtsextremen zuzuordnen, hat zur Folge, dass das Gros unserer Gesellschaft sich nicht mit den eigenen alltäglichen ausländerfeindlichen oder rassistischen Tendenzen auseinandersetzen muss, da diese Taten einzelnen sogenannten »Randgruppen« zugeschoben und damit verbal aus der Mitte der Gesellschaft entfernt werden. Dass sich rechtsextremes und rassistisches Gedankengut aber sehr wohl quer durch die Gesellschaft zieht, belegen jüngere Studien und Phänomene eindeutig. Im Ergebnis gehen viele dann »gegen Nazis« auf die Straße, reagieren jedoch weiterhin kaum, wenn rassistische Tendenzen jenseits eines organisierten politischen Rahmenprogramms auftauchen: im deutschen Alltag.
Neonazi
Siehe »rechtsextremistisch«. Die Tat eines »Normalos« ohne ausreichenden recherchegestützten Hintergrund einer organisierten rechtsextremen Gruppierung zuzuschieben heißt, sie aus der Mitte der Gesellschaft, wo sie geschehen ist, auszublenden, und eine Verdrängung zu ermöglichen.
Weiße(r)
Bei rassistisch motivierten Gewalttaten, die weiße Menschen an Schwarzen Menschen verüben, kann durchaus auch das Weißsein der Täter erklärend genannt werden. Pauschal in diesen Fällen ausschließlich das Nichtweißsein und die »abweichende« Nationalität der Opfer anzugeben – wie es in unserer Presse derzeit noch andauernd geschieht –, mag Gewohnheit sein, entbehrt jedoch jeglicher Logik. Auch hier sollte nach dem Gleichheitsprinzip verfahren werden.
Es fällt außerdem auf, dass das Weißsein von Gewalttätern seitens deutscher Medien nur benannt wird, sobald es sich um rassistische Taten in Übersee handelt (beispielsweise um amerikanische Polizisten oder weiße südafrikanische Grundbesitzer), während das Weißsein europäischer Gewalt zumeist ausgeklammert wird. Nationalität und Zugehörigkeit von Verbrechern wird hierzulande nach wie vor nur thematisiert, wenn sie keine christlichen weißen Deutschen sind.
Woher will die Redaktion wissen, dass es dabei um »Rechtsextremismus« ging? Wurden vor der Tat etwa politische Debatten geführt? Waren die Täter Weiße? Warum schreiben sie das nicht dazu?{iii}
Das Verschleiern des Deutschseins und Weißseins von Tätern entspringt dem Wunsch, dass diese gesellschaftliche Gruppe unmarkiert bleiben soll, weil sie ansonsten einen Imageverlust zu befürchten hätte.
Stellen Sie sich vor, die deutsche Presse würde in der Berichterstattung über Verbrechen mit der Nennung weißer Deutscher aus christlichen Familien so verfahren, wie sie es derzeit mit PoC, Muslimen und Geflüchteten tut. Sie würden sich bald aus lauter Angst vor den ganzen Ehrenmorden, Raubdelikten und Betrügereien von weißen Deutschen christlicher Herkunft nicht mehr aus dem Haus trauen (gut wenn es für Sie ein Konjunktiv ist).
Gerade in Journalismus, Schule und Bildung Tätige (und ruhig auch alle anderen) sollten größere Sorgfalt auf ihre Wortwahl verwenden und sich bemühen, Stereotypisierungen und Exotisierungen zu vermeiden. Mit einer Art der Sprache, die ohne Vor-Ausgrenzung der Opfer und ohne Täterschutz auskommt, und die stattdessen die Dinge, Hergänge und Menschen differenziert benennt, kann es gelingen, rassistischen Tendenzen aktiv entgegenzuwirken. Unterlassen wir dies, so erreichen wir das Gegenteil.
Kleiner Exkurs am Rande
Der leitende Redakteur einer der einflussreichsten TV-Nachrichtensendungen Europas – ein weißer Deutscher – fragte mich einmal, ob ich ernsthaft der Auffassung sei, dass es in Deutschland wirklich Alltagsrassismus gebe. Unter anderem deswegen schreibe ich dieses Buch.
Etwas totzuschweigen, nur weil es uns nicht gefällt, hat schon in der Vergangenheit nicht funktioniert. Dass aber ein so einflussreicher Mensch wie derjenige, der Nachrichten macht, die unsere gesamte Gesellschaft beeinflussen, und dem jeden Tag umfassende Informationen zugänglich sind über alle möglichen Zustände und Geschehnisse, so eine blauäugige, realitätsferne Frage stellt, das hat mich dann doch stutzig gemacht. Dabei ist er – selbstverständlich – ein anständiger Mensch, ein netter Kerl und so weiter (viele Weiße, die ich kenne, sind wirklich gut ausgebildet und freundlich). Anscheinend hat es bei uns nicht mal die »Bildungselite« nötig, über die Gesichter des Rassismus im eigenen Land Bescheid zu wissen. Das ist schade, denn mit dieser Einstellung wird er uns wohl auch noch ein Weilchen erhalten bleiben.
Wenn ich gleich zu Anfang einen zugegebenermaßen frag würdigen Vergleich anstellen darf: Das Allgemeinwissen der weißen Deutschen hinsichtlich Rassismus ist im Groben vergleichbar mit dem »Wissen« der Männer um 1850 über die Rollen und die Behandlung von Frauen. Die einen wiegelten ab (»Ihr habt doch neuerdings diese und jene Rechte, das ist doch schon was«), die anderen waren irrational-verwirrt (»Aber der Platz der Frau ist naturgemäß zu Hause!«), der Rest wurde aggressiv und fand, Frauen, die Gleichbehandlung einforderten, müssten bestraft und auf »ihren Platz« verwiesen werden.
Damals waren Männer entweder verängstigt, was sie nicht laut sagen durften, weil es sich ja um Frauen handelte, von denen sie sich bedroht fühlten (ich kann nicht glauben, dass ich immer noch die Vergangenheitsform verwende), oder sie waren viel zu faul und arrogant, um sich mit dem Thema Frauenrechte ernsthaft auseinanderzusetzen, unter anderem, weil sie das ja gar nicht nötig hatten. Die Gesellschaft war währenddessen der festen Überzeugung, dass alles normal sei.
Bis Simone de Beauvoir einen Hype bekam, betrachteten Millionen und Abermillionen Menschen es als normal, dass, wann immer vom »Menschen« die Rede war, automatisch der Mann gemeint war... es sei denn, es wurde etwas anderes dazugesagt. In der Medizin ist das zum Teil heute noch so. Auch in unserer Sprache hat es sich erhalten: die »normale, allgemeingültige« Form ist das Maskulinum. Frauen sind die sprachliche Abweichung.
Noch in den 1970er Jahren legte die Fernsehsendung DerSiebteSinn Frauen nahe, sich im Fall einer Autopanne aufreizend mit geöffneter Motorhaube (retrospektive machen solche Analogien wenigstens Spaß) am Straßenrand zu postieren, um dadurch einen Mann™ dazu zu bewegen, anzuhalten und sich des Schadens anzunehmen. Dass die Motorhaube zu schließen und den ADAC zu rufen eine viel weniger verhaltensauffällige und dabei effektivere Sache wäre, ist uns allen anscheinend erst in den letzten paar Jahren klar geworden.
Es hat sich seitdem einiges getan. Der Prozess der Gleichberechtigung ist bei Weitem noch nicht beim Happy End angelangt – oder haben Sie schon mal gelesen, das Männer,