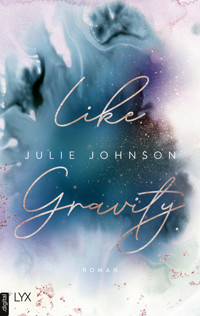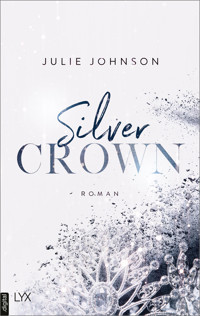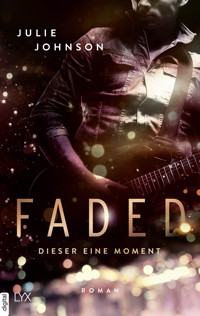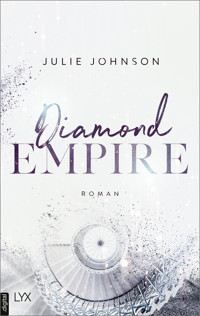
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Forbidden Royals
- Sprache: Deutsch
Muss sie ihre Liebe aufgeben, um die Krone zu behalten?
Durch ein tragisches Ereignis findet sich Emilia Lancaster viel zu früh in der Rolle wieder, in der sie sich selbst nie gesehen hat - als Königin von Caerleon. Doch auch wenn ihr eigenes Herz durch den Verlust ihres Vaters und den Verrat ihrer engsten Verbündeten in tausend Scherben liegt, muss sie ihre Pflichten erfüllen und nach außen hin Stärke zeigen. Denn Emilia steht vor ihrer größten Herausforderung: Sie muss für ihr trauerndes Volk da sein, ihren intriganten Feinden die Stirn bieten und vor allem versuchen, den Mann zu vergessen, der ihr einst mehr bedeutete als alle Kronjuwelen des Königreichs - Carter Thorne.
"Voll von starken Charakteren, verbotener Liebe, royalen Intrigen, Spannung, verblüffenden Wendungen und einer prickelnden magischen Atmosphäre." @mariesliteratur über Golden Throne
Abschlussband der FORBIDDEN-ROYALS-Trilogie von USA-TODAY- und PUBLISHERS-WEEKLY-Bestseller-Autorin Julie Johnson
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leserhinweis
Caerleonische Thronfolge
Das Geschlecht der Lancasters
Widmung
Vorwort
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Epilog
Playlist
Die Autorin
Die Romane von Julie Johnson bei LYX
Impressum
Julie Johnson
Diamond Empire
Roman
Ins Deutsche übertragen von Anika Klüver
ZU DIESEM BUCH
Wenn Emilia Lancaster in ihrer kurzen Zeit als Mitglied der königlichen Familie eins gelernt hat, dann dass sie für das Wohl des Volkes ihre eigenen Gefühle und Wünsche zurückstellen muss. Schon seit ihrem Einzug in den Palast wurde sie mit Intrigen und antiroyalistischen Angriffen konfrontiert – und nun ist Emilia viel zu früh zur Königin von Caerleon geworden. Doch auch wenn ihr Herz durch den Verlust ihres Vaters und den Verrat ihrer engsten Verbündeten in tausend Scherben liegt, muss Emilia für ihr trauerndes Volk da sein, ihren intriganten Feinden die Stirn bieten und ihren Anspruch auf den Thron verteidigen. Das Gewicht der Krone wird immer schwerer, und mehr als alles andere wünscht sie sich jemanden, der ihr hilft, diese Last zu tragen. Aber auch wenn eine royale Hochzeit viele ihrer Probleme lösen würde, ist der Mann, dem ihr Herz gehört, für sie unerreichbar. Denn in ihrer angreifbaren Position würde ein Bekenntnis ihrer Liebe zu ihrem Stief-bruder Carter Thorne das Ende ihrer Herrschaft bedeuten. Doch obwohl für Emilia alles auf dem Spiel steht, kann sie die Gefühle, die Carter in ihr auslöst, einfach nicht vergessen …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
CAERLEONISCHE THRONFOLGE
Non sibi sed patriae
DAS GESCHLECHT DER LANCASTERS
Für T. S.
VORWORT
Meine lieben Leser:innen,
alles hat einmal ein Ende.
(So heißt es zumindest.)
Ich würde lieber glauben, dass nichts je wirklich endet. Nicht wirklich. Wir mögen die Seite zu einem neuen Kapitel aufschlagen, wir mögen das Buch ganz schließen, aber die Geschichte selbst lebt weiter.
Daher … hoffe ich, dass, nachdem ihr diesen letzten Band über Emilias abenteuerliche Reise zu Ende gelesen habt, etwas davon in euch weiterlebt. Diese Reihe ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ich werde immer mit Freude und Dankbarkeit an die Zeit zurückdenken, in der ich daran geschrieben habe.
Ich mache keinen Hehl daraus, dass mir diese Geschichte vor etwa einem Jahr in den Sinn kam und mich einfach nicht mehr losließ, egal wie sehr ich versuchte, mich auf andere Projekte zu konzentrieren oder die Bücher zu schreiben, die ich ursprünglich geplant hatte. Eine Zeitlang kämpfte ich dagegen an, weil ich befürchtete, dass sich dieses finstere Märchen zu sehr von meiner sogenannten »Marke« unterschied. Dass ich mich damit zu weit von meinem üblichen Genre fortbewegen würde, um damit bei meinen Lesern je Anklang zu finden.
Nach vielen Überlegungen – Sollte ich unter einem Pseudonym veröffentlichen? Sollte ich die Bücher schreiben, sie aber nicht veröffentlichen? – beschloss ich, dieser neuen Figur nachzueifern, die ich ins Herz geschlossen hatte. Ich beschloss, wie Emilia zu sein: mich tapfer und furchtlos einer ungewissen Zukunft zu stellen.
Ich schrieb die verdammte Trilogie.
Nun, da ich die Angst überwunden habe, kann ich aufrichtigen Gewissens sagen, dass ich ausgesprochen froh darüber bin, es getan zu haben. Ich bin euch unglaublich dankbar dafür, dass ihr mir auf diese unerwartete Reise nach Caerleon gefolgt seid.
Bevor wir ein letztes Mal erneut in diese Welt eintauchen, möchte ich einfach nur Danke sagen. Dafür, dass ihr meine Träume unterstützt habt, dass ihr es mir ermöglicht, mit dem, was ich liebe, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, dass ihr wundervolle Rezensionen verfasst und euren Freund:innen von meinen Büchern erzählt.
Diese Welt ist groß, und das Leben ist kurz, also werden wir vielleicht nie die Gelegenheit haben, uns persönlich zu begegnen … aber ich hoffe, dass ihr wisst, wie unglaublich dankbar ich euch bin.
Ihr habt mein Leben verändert.
(Allerdings vielleicht nicht ganz so einschneidend, wie sich Emilias Leben gleich verändern wird …)
Oh.
Habe ich das nicht erwähnt?
Die Krone, die sie nun trägt, hat einen hohen Preis.
Das Drama ist noch nicht vorbei.
Es hat gerade erst angefangen.
Non sibi sed patriae,
Julie
PROLOG
Ich betrachte die Hochstaplerin auf dem Thron.
Die Knöchel elegant verschränkt.
Die Hände mit anmutiger Eleganz gefaltet.
Tief in ihrem Inneren stolpert ein betrogenes Herz.
Zerbröseln getrübte Hoffnungen.
Den Blick nicht auf die Trümmer der Vergangenheit, sondern unerschrocken auf die Zukunft gerichtet.
Auf ein gestohlenes Schicksal.
Auf ein zerrüttetes Reich.
Als ich etwa die Hälfte meines vierten Grundschuljahrs hinter mich gebracht hatte, machte meine Klasse einen Ausflug zu den mittelalterlichen Ruinen bei Easterly. Dort gibt es ein Schloss – oder besser gesagt, die Überreste davon. Wie sich herausstellte, ist nach tausendfünfhundert Jahren des Verfalls nicht mehr allzu viel davon übrig. In den Augen einer Neunjährigen sah es eher wie ein grasiger Hügel voller moosbedeckter Steine aus. Nur eine Mauer war noch erhalten. Der Rest war bereits vor langer Zeit eingestürzt. Zurück blieben nur grobe Puzzlestücke eines Spiels, das die Geister aus Caerleons Vergangenheit gespielt hatten.
Es war gelinde gesagt enttäuschend.
Wenn ich während der Busfahrt zu unserem Ausflugsziel dem ausgiebigen Vortrag unserer Geschichtslehrerin zugehört hätte, wäre ich vielleicht besser auf das vorbereitet gewesen, was uns erwartete. Doch statt meine Aufmerksamkeit auf Mrs Fiero zu richten, hatte ich die Zeit damit verbracht, mit Owen unsere Wochenendpläne für Abenteuerspiele in seinem Baumhaus zu schmieden. Dabei hatten wir uns ein geheimes Klopfzeichen ausgedacht, um unerwünschte Personen davon abzuhalten, das Baumhaus durch die Falltür zu betreten, genauer gesagt, seine lästigen keinen Schwestern, die es sich zur Gewohnheit gemacht hatten, sich in unsere Samstagnachmittage zu drängen, ob wir sie nun dabeihaben wollten oder nicht.
Meine Klasse strömte aus dem Bus und machte sich an den langsamen Aufstieg über einen Lehmpfad, der zu der historischen Stätte führte. Doch bei dem Anblick, der sich mir bot … löste sich all meine Erwartung in Luft auf. Schließlich hatte uns Mrs Fiero eine Festung versprochen. Ich hatte etwas Erhabenes erwartet. Ein gewisses königliches Flair. Ein richtiges Schloss mit vergoldeten Ballsälen und geheimnisvollen Buntglasfenstern, die im Licht der Frühlingssonne funkelten.
Ich hatte erwartet … Nun ja …
Ein Märchen zu sehen.
Ich war maßlos enttäuscht, diesen ganzen Weg hinter mich gebracht zu haben, in der Erwartung, ein echtes Zeugnis der Geschichte aus der Nähe betrachten zu können, nur um dann vor einem Haufen belangloser Trümmer zu stehen.
Im Schulbuch klang es verheißungsvoller, dachte ich ein wenig verbittert und trat mit meinen glänzenden Lackschuhen gegen ein paar Löwenzahnpflanzen. Kann das hier wirklich alles sein, was noch übrig ist?
Während sich der Rest der Klasse aufmachte, um an Picknicktischen auf dem angrenzenden Feld die mitgebrachten Lunchpakete zu verspeisen, blieb ich in der Nähe der Ruine, die mich seltsamerweise nicht losließ. Es war, als könnten mir die Steine etwas mitteilen, wenn ich sie nur intensiv genug betrachtete.
»Lass mich raten«, murmelte Mrs Fiero, die lächelnd neben mich trat. »Du hast dir etwas Beeindruckenderes vorgestellt?«
Ich errötete, weil es mir peinlich war, beim Schmollen erwischt zu werden. »Ich dachte nur …«
Sie zog die Augenbrauen hoch.
»Ich dachte, dass es mehr zu sehen gäbe. Mehr übrig wäre.«
»Warum? Weil die Menschen, die hier lebten, von königlichem Blut waren?«
Ich nickte.
»Nichts hat für immer Bestand, Emilia. Weder Schlösser, noch die einfachen Leute, die sie Stein um Stein errichteten. Noch die Soldaten, die ihre Mauern mit Speeren und Pfeilen verteidigten. Nicht mal die Könige und Königinnen, die in ihnen lebten. Irgendwann löscht die Zeit uns alle aus.«
»Das ist traurig.«
»Findest du?« Mrs Fiero verzog die Lippen. »Ich finde, dass es irgendwie in Ordnung ist. Egal wer man ist, egal was man hinterlässt, wenn man von dieser Erde verschwindet … Letztendlich ist doch nur wichtig, was man tut, solange man auf dieser Welt ist. Danach kann man eh nichts mehr ändern. Auch nicht an dem, was andere über einen erzählen. Die Geschichte ist für die Lebenden. Die Toten haben keine Verwendung mehr für sie.«
Ich runzelte die Stirn. »Also … sagen Sie, dass es keine Rolle spielt?«
»Was spielt keine Rolle?«
»Alles.« Ich zuckte mit den Schultern. »Wer wir sind, was wir tun. Weil am Ende doch nur ein Haufen Steine und Moos übrig bleibt.«
»Ganz im Gegenteil, Emilia. Was wir mit unserem Leben anfangen, spielt eine sehr große Rolle. Es ist wichtiger als alles andere. Denn egal ob man einen großen Eindruck oder aber nicht die geringste Spur in dieser Welt hinterlässt, die Zeit macht uns alle gleich. Sie kann ganze Reiche in Asche verwandeln und die größten Vermächtnisse in eine Fußnote auf einer vergessenen Seite in irgendeinem Geschichtsbuch reduzieren.«
Mrs Fiero lachte leise – nicht über mich, nicht so, dass ich mir dumm vorkam, sondern auf eine Art und Weise, die mir verriet, dass sie etwas über das Leben wusste, das ich selbst noch nicht gelernt hatte.
»Immer wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht genug tue, dass ich ein unbedeutendes Leben führe, dass sich niemand von Bedeutung an mich erinnern wird, weil ich nichts auch nur annähernd Wichtiges erreicht habe … rufe ich mir ins Gedächtnis, dass man nicht die ganze Welt verändern muss, um seine Spuren in ihr zu hinterlassen. Selbst das unbedeutendste Leben ist wertvoll. Denn wichtig ist nur, wie man dieses Leben führt. Nicht die Dinge, die man zurücklässt. Nicht das, was nach einem kommt, wenn man nicht mehr da ist.«
Von all den Lektionen, die mir Mrs Fiero je über große Kriege und uralte Fehden, über antike Städte und längst untergegangene Reiche beibrachte … sollte sich diese, die sie mir im Flüsterton an einem kühlen Frühlingsnachmittag neben einem Haufen alter Steine vermittelte, als die wichtigste herausstellen.
Zu meinem Unglück … Scheint man die wichtigsten Lektionen im Leben immer erst dann zu begreifen, nachdem man alles vollkommen verbockt hat.
Und genau so war es auch in meinem Fall …
1. KAPITEL
»Eure Majestät?«
Jemand räuspert sich leise zu meiner Linken. Ich gebe nicht zu erkennen, dass ich das Geräusch vernommen habe. Ich starre weiterhin an die vergoldete Decke des Thronsaals hoch über mir und betrachte mit zusammengekniffenen Augen die engelhaften Freskofiguren, die dort aufgemalt sind. Die Putten scheinen mich mit ihren heiteren Mienen zu verhöhnen. Sie lächeln unablässig auf mich herab und zupfen mit Wurstfingern an den Saiten ihrer goldenen Harfen.
»Eure Majestät … Es tut mir leid, Sie stören zu müssen, aber es ist schon recht spät …«
Ich zucke nicht einmal mit der Wimper.
Er schluckt hörbar. »Was … Was machen Sie hier?«
Oh Mann, wenn das mal nicht die Frage des Jahres ist …
Was zum Teufel mache ich, Emilia Victoria Lancaster, hier?
In diesem verfluchten Schloss?
In diesem verfluchten Leben?
Ein erneutes Räuspern ist zu vernehmen, dieses Mal lauter. Als wäre der Störenfried zu der Überzeugung gelangt, dass ich ihn einfach nicht gehört habe, anstatt von der deutlich offensichtlicheren Alternative auszugehen – dass ich mein Bestes tue, um seine Anwesenheit zu ignorieren.
»Kann ich Ihnen behilflich sein, Königliche Hoheit?«
Ich antworte nicht auf die zittrige Frage. Ich hebe nicht mal den Kopf von dem kalten Fußboden, auf dem ich liege. Ich habe alle viere von mir gestreckt und liege wie ein Seestern auf dem von silbernen Adern durchzogenen Marmor. Ich starre weiterhin an die Decke und auf diese Figuren, deren heitere Gelassenheit so gar nichts mit meiner Stimmung gemein hat. Um im schwachen Licht der Kronleuchter ihre feineren Einzelheiten auszumachen, kneife ich die Augen zusammen.
Zu dieser späten Stunde ist das Licht auf die niedrigste Stufe gedimmt. Die Wandleuchten sind vollständig erloschen. Was nicht weiter überraschend ist, da sich normalerweise um diese Uhrzeit niemand hier herumtreibt. Verdammt, die meisten Menschen sind um diese Uhrzeit nicht einmal mehr wach.
Ich höre, wie der Diener nervös von einem Fuß auf den anderen tritt. Ich bin mir sicher, dass er keine Ahnung hat, wie er mit dieser Situation umgehen soll. Ich kann ihm nicht wirklich einen Vorwurf machen. Er hat sich vermutlich ziemlich erschrocken, als er bei einem nächtlichen Botengang um die Ecke bog und mich in einer alten Freizeithose und einem dicken Kaschmirpullover hier in dem riesigen Thronsaal auf dem Boden liegen sah.
Das ist wirklich kein sehr königlicher Anblick.
Meine Berater wären von dieser Zurschaustellung von Unschicklichkeit mehr als entsetzt, wenn sie sie mitbekämen. Aber sie sind nicht länger hier, um mich zu tadeln, rufe ich mir ins Gedächtnis, während die Gesichter von Lady Morrell, meiner alten Benimmlehrerin, und Gerald Simms, dem ehemaligen Pressesprecher des Palasts, vor meinem inneren Auge aufblitzen. Dieses Recht haben sie verloren, als sie mir in den Rücken gefallen sind.
»E… Eure Majestät? Können … Können Sie mich hören? Geht es Ihnen gut?«
Der ist ganz schön hartnäckig, nicht wahr?
Ich kneife die Augen zu, als würde er dadurch verschwinden. Mir fehlt gerade einfach die Energie, die ich aufbringen müsste, um mich mit ihm auseinanderzusetzen. Ehrlich gesagt habe ich nicht mal genug Energie, um mich mit irgendetwas auseinanderzusetzen. In letzter Zeit betrachte ich es schon als Wunder, wenn es mir gelingt, bis zum Sonnenuntergang durchzuhalten, ohne vor lauter Verzweiflung unter dem Gewicht meiner eigenen Erschöpfung zusammenzubrechen.
Wann hat bloßes Existieren angefangen, so viel Energie zu kosten?
Mich jeden Morgen nach einer weiteren schlaflosen Nacht aus dem Bett aufzuraffen genügt schon, um meine ganze Kraft zu verbrauchen. Und die Außenwelt ist emotional sogar noch anstrengender. Jedes Mal, wenn ich auch nur die Spitze eines hochhackigen Schuhs vor die Tore des Palasts setze und dabei ein festgefrorenes Lächeln auf dem Gesicht trage, während die Kameras mit unnachgiebiger Harnäckigkeit klicken, spüre ich, wie ein wenig mehr von mir verschwindet.
Lächeln, winken, nicken.
Keine Schwäche zeigen.
Sei die Königin, die deine Untertanen brauchen.
Wenn ich nachts zurück unter die Bettdecke krieche, fühle ich mich jedes Mal wie ausgelaugt, eine leere Hülle, die nicht einmal mehr über den kleinsten Rest Gelassenheit verfügt. Dann bin ich zu schwach, um meine Erinnerungen in Schach zu halten. Selbst der Schlaf bietet mir keine Atempause, denn in meinen Träumen suchen mich die Schrecken meiner Vergangenheit heim. Sie lauern in den dunklen Ecken meines Unterbewusstseins und schlagen unbarmherzig zu, sobald mir die Augen zufallen.
Wenn ich zu dem Klang meiner eigenen heiseren Schreie aufwache, gibt es niemanden, der meine Albträume vertreibt und mich tröstet. Nicht mehr.
Dieser Mensch ist lange fort.
Und mit ihm all mein Trost.
Plötzlich verspüre ich eine Enge in meiner Brust, die dafür sorgt, dass mir die Luft wegbleibt. Ich presse die Schultern fester gegen den kühlen Steinfußboden und hoffe, dass mich dieser Kontakt in der Gegenwart verankert. Und das Bild himmelblauer Augen in die tiefsten Winkel meiner Seele verscheucht.
»Eure Majestät …« Der Page kommt ein paar Schritte auf mich zu geschlurft. »Soll ich Sie zurück zu Ihren Gemächern geleiten? Oder vielleicht nach Ihrer persönlichen Garde schicken?«
Ich reiße die Augen auf. Ich habe wirklich keine Lust darauf, mir eine erneute Standpauke von Galizia oder Riggs anzuhören, weil ich schon wieder eine nächtliche Wanderung durch den Palast unternommen habe. Ich hole tief Luft und zwinge mich dazu, mich aufzusetzen und mich auf den jungen Diener zu konzentrieren. Er muss ein Neuzugang beim Palastpersonal sein. Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen, und seine Uniform ist so heftig gestärkt, dass sie vermutlich von allein stehen könnte. Als sich unsere Blicke treffen, sieht er aus, als würde er sich jeden Moment in die Hose machen.
»Nein«, murmle ich sanft. »Schicken Sie nach niemandem.«
»Ja, Eure Majestät«, blökt er, während er rot anläuft. »Ich entschuldige mich, falls …«
»Es besteht kein Grund, sich zu entschuldigen. Gehen Sie einfach. Lassen Sie mich in Ruhe.« Ist das wirklich meine Stimme? Sie klingt so emotionslos. So leer. »Und falls jemand fragt … haben Sie mich hier nie gesehen. Verstanden?«
»J… Ja, Eure Majestät. Versprochen. I… I… Ich werde es niemandem verraten.«
Er lungert noch ein wenig herum, weil er sich vor Schreck nicht von der Stelle rühren kann, wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Ich ziehe die Augenbrauen hoch und weise mit dem Kinn in Richtung Tür.
»Raus.«
Er zuckt zusammen, deutet eine Verbeugung an und flieht förmlich aus dem Thronsaal. Ich lausche dem Klappern seiner Uniformschuhe auf dem Steinfußboden, bis es verklingt und nicht mehr zu hören ist. Als sich erneut Stille über mich legt wie ein Bettlaken, lehne ich mich wieder zurück, um weiter die Decke zu betrachten.
Dies ist die dritte Nacht in Folge, in der ich mich hier wiederfinde und zu dem Deckengemälde hinaufstarre. Ich bin mir nicht sicher, wonach ich suche. Nicht nach Antworten. Vielleicht nur nach einer vorübergehenden Ablenkung von der faden Eintönigkeit meines Lebens.
Letzte Woche war es die Bibliothek – ich verbrachte jede Nacht damit, zwischen den Regalen umherzuwandern und mit den Fingern über die Einbände von Büchern zu streichen, die bereits seit Jahrhunderten dort ihren Platz haben. In der Woche davor war es die Waffenkammer. Und davor waren es die Stallungen. Die Halle mit den königlichen Porträts. Das staubige Archivzimmer.
Mein jeweiliges Ziel ist immer willkürlich gewählt. Jede verlassene Ecke des Schlosses, die niemand mitten in der Nacht aufsuchen würde, ist mir recht. Solange es nur ein Ort ist, an dem mich niemand mit den immer gleichen Fragen belästigt.
Haben Sie etwas gegessen, Eure Majestät?
Wann haben Sie sich zuletzt ausgeruht, Eure Majestät?
Kann ich irgendjemanden rufen, um Ihnen zu helfen, Eure Majestät?
Eure Majestät?
Eure Majestät?
Eure Majestät?
Seit dem Attentat auf dem Vasgaard-Platz vor drei Monaten sind diese nächtlichen Erkundungszüge für mich zur Gewohnheit geworden. Statt zu schlafen, wandere ich in den leeren Fluren umher, während mich mein stets anwesendes Kontingent aus Wachen und Schlosspersonal mit wachsender Verwirrung und Besorgnis betrachtet. Niemand weiß, was er sagen soll, um mich aus diesem zombieähnlichen Zustand zu reißen, in den ich aufgrund des Schocks, den die Trauer und der Schmerz und der Verrat in mir ausgelöst haben, abgedriftet bin. Niemand weiß, wie er mir helfen soll.
Ich bin mir nicht sicher, ob mir überhaupt jemand helfen kann.
Den einzigen Menschen, der je eine Chance dazu gehabt hätte, habe ich weggeschickt.
Also wandere ich umher. Ich tigere durch den Palast. Von den Gästezimmern bis zu den Wintergärten. Die großen Treppen hinunter und vorbei an den Ritterrüstungen. Von Sonnenuntergang bis zum Morgengrauen hallen meine Schritte in der Dunkelheit der kalten Gemäuer wider. Sie wanken nicht. Sie beeilen sich nicht. Sie sind ruhig. Ohne Hast.
Warum sollte ich mich beeilen?
Ich kann nirgendwo anders hin.
Ich habe mal gehört, dass Strafgefangene die Entlassung mehr fürchten als die Vorstellung, für immer im Gefängnis zu bleiben. Dass die Welt, die draußen vor ihren vergitterten Fenstern und verschlossenen Türen existiert, für sie sehr viel furchterregender ist als die Aussicht darauf, sie nie wieder zu betreten. Denn die Abschottung bietet eine gewisse Sicherheit. In totaler Isolation liegt Sicherheit. Wenn man eingesperrt ist, gibt es keine unvorhergesehenen Ereignisse, denen man sich stellen muss und die selbst die sorgfältigsten Pläne durchkreuzen können.
Keine Angreifer, die das Leben Unschuldiger in Gefahr bringen.
Keine Freunde und Liebhaber, die die Wahrheit kunstvoll verdrehen, damit sie ihren eigenen Zwecken dient.
Keine Verbündeten, die zu Feinden werden, sobald man ihnen den Rücken zudreht.
Keine Eltern, die die Augen für immer vor einem verschließen.
Ich bin seit drei Monaten in diesem goldenen Käfig eingesperrt. Aber meine Einzelhaft ist selbst auferlegt. Ich möchte nicht entlassen werden. Ich verspüre nicht den Wunsch, auf Bewährung rauszukommen, und brauche auch niemanden, der mein Strafmaß herabsetzt. Ich bin mit dieser neuen Art zu leben recht zufrieden – obwohl ich mir, wenn ich ehrlich bin, nicht sicher bin, ob man es wirklich so nennen kann.
Leben.
Schließlich fühle ich mich an den meisten Tagen nur halb lebendig. Wie das Phantom einer Frau, die früher mal existierte. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal gelächelt oder gelacht oder irgendetwas anderes gemacht habe außer atmen.
Einatmen, ausatmen. Was einst ein automatischer Vorgang war, fühlt sich jetzt wie eine lästige Aufgabe an. So als könnte meine Lunge ohne ständige Überwachung einfach beschließen, ihre Funktion einzustellen.
Wie betäubt drifte ich durch die Abläufe meiner neuen Pflichten, die ich mit einer seltsamen Losgelöstheit akzeptiert habe, weil ich nur zu gut weiß, dass es keine Alternative gibt. Ich habe keine andere Wahl, als weiterzumachen. Zu viele Leute verlassen sich auf mich, und ich kann mich nicht von ihnen abwenden.
Eine Königin darf niemals Schwäche zeigen.
An manchen Tagen scheint die Last dieser Verantwortung auf meinen Schultern das Einzige zu sein, was mich noch mit meinem nicht wiederzuerkennenden Leben verbindet. Würde sie mich nicht nach unten drücken, würde ich womöglich vollständig verschwinden – mich einfach in Luft auflösen und im Wind verwehen.
»Müssen Sie es sich unbedingt zur Aufgabe erklären, die Pagen während ihrer ersten Arbeitswoche zu erschrecken?«
Die ironische Stimme drängt sich in meine Träumerei.
Verdammt.
Sie hat mich schon wieder gefunden. Das ist die dritte Nacht in Folge.
Ich drehe den Kopf nicht herum, weiß aber, dass ich, wenn ich es tun würde, eine große Blondine in Militärkleidung entdecken würde, die ein paar Schritte rechts von mir steht und mich mit verwirrter Missbilligung im Blick ansieht. Meine persönliche Wache – und persönliche Nervensäge – Oberleutnant B. Galizia, ranghöchste Offizierin der Königinnengarde. Ich habe nicht gehört, wie sie sich an mich herangeschlichen hat, aber das ist nicht weiter schockierend. Sie ist in sämtlichen Formen der Überlistung und Selbstverteidigung bestens ausgebildet.
Sie kommt näher, stellt sich über mich und starrt mir direkt ins Gesicht. »Wollen Sie die ganze Nacht lang hier herumliegen?«
»Vielleicht.«
Sie streckt eine Hand aus und wackelt mit den Fingern. »Kommen Sie schon. Hoch mit Ihnen.«
Ich seufze schwer, leiste aber keinen Widerstand. Es hat keinen Zweck, mit Galizia zu streiten, wenn sie mich doch immer wieder aufspürt und mich zurück in meine Gemächer bringt wie ein ungezogenes Kind, das sie nach der Ausgangssperre draußen erwischt hat. Ihre Hand ist warm und schwielig, als sie meine umfasst und mich auf die Füße zieht.
»Wie lange wollen Sie noch so weitermachen?«
Ich ziehe die Augenbrauen hoch. »Ich weiß nicht, was Sie meinen.«
»Bei allem Respekt, Eure Majestät … lassen Sie diesen Unsinn. Sie wissen sehr genau, was ich meine. Sie schlafen nicht. Sie essen kaum. Sie sprechen nicht einmal, es sei dann, Sie sind gezwungen, einen öffentlichen Auftritt bei einer Veranstaltung außerhalb des Schlosses zu absolvieren – und auch die sind in letzter Zeit rar gesät.«
»Das stimmt nicht.«
»Stimmt wohl. Wie lange sind Sie nicht mehr an der frischen Luft gewesen? Wann sind Sie zuletzt auf Ihrem Pferd ausgeritten? Oder auf dem Schlossgelände spazieren gegangen?«
Ich schweige trotzig.
»Wenn Sie sich nicht daran erinnern können, ist es zu lange her.« Sie schüttelt den Kopf. »Sie können sich nicht für immer hier einigeln. Das ist nicht gesund. Wenn Sie noch eine weitere Veranstaltung verpassen, wird diese neue Pressesprecherin, die Sie eingestellt haben, ausrasten.«
»Woher plötzlich diese übertriebene Sorge?«
»Nicht plötzlich. Wenn überhaupt, ist sie längst überfällig. Ich will schon seit Wochen etwas sagen. Seit Monaten sogar. Das gilt für uns alle. Aber wir dachten, dass es ausreichen würde, Ihnen ein wenig Zeit und Raum zu geben, um …«
Ich ziehe die Augenbrauen hoch, als sie verstummt. »Um was? Um mich wieder auf Linie zu bringen? Um mich vergessen zu lassen, was an jenem Tag auf dem Platz passierte? Um zu verhindern, dass sich in meinem Kopf immer wieder die Erinnerung an die neununddreißig Särge abspult, die einer nach dem anderen in die Erde hinuntergelassen wurden, und das an so vielen Tagen hintereinander, dass ich rückwärts und mit verbundenen Augen über die Friedhöfe von Vasgaard laufen könnte, weil ich sie so gut kenne?«
»Nein. Natürlich nicht. Ich versuche nicht zu bagatellisieren, was Sie durchgemacht haben, Eure Majestät.«
»Dann geben Sie mir ein wenig Raum, damit ich es verarbeiten kann, Galizia.«
»Es ist drei Monate her. Ich mache mir Sorgen, dass Sie vielleicht nie wieder zu uns zurückkehren werden, wenn wir Ihnen noch mehr Raum geben.«
»Sie blasen die Sache unverhältnismäßig auf.«
»Tue ich das?« Sie zieht die hellblauen Augen ganz leicht zusammen. »Sie haben doch einen Abschluss in Psychologie, also denke ich nicht, dass ich Ihnen erklären muss, was hier vor sich geht. Die Anzeichen sind sogar für mich als Laie mehr als offensichtlich.«
»Wollen Sie damit andeuten, dass ich unter einer Depression leide?«
»Ich will gar nichts andeuten. Ich sage Ihnen ganz klar und deutlich, dass sich die Leute Sorgen um Sie machen.«
»Wer? Sie?«
»Ja, ich«, schießt sie zurück. »Und so ziemlich jede andere Person, die in diesem Schloss arbeitet. Und wenn Sie nicht anfangen, besser auf sich Acht zu geben, wird sich bald auch der Rest der Welt Sorgen um Sie machen. Sie wissen doch, wie viele Augen auf Sie gerichtet sind, wenn Sie diese Mauern verlassen.«
»Dann werde ich drinnen bleiben. Urlaub zu Hause ist neuerdings total angesagt – haben Sie etwa noch nichts davon gehört?«
»Und wie lange genau wird das Ihrer Meinung nach funktionieren? Die Presse hat Ihnen für die Nachwirkungen des Anschlags … und nach dem Verlust Ihres Vaters eine Schonfrist erteilt. Aber Sie wissen, dass das Volk ein kurzes Gedächtnis hat. Es wird Sie nicht ewig trauern lassen.«
Ich beiße die Zähne fest zusammen, denn ich will das, was sie sagt, nicht an mich heranlassen. Ich will nicht zugeben, dass ich tief im Inneren weiß, dass sie recht hat. Die Presse ist immer ganz wild auf Neuigkeiten in Bezug auf die königliche Familie, aber in letzter Zeit hat sie sich besonders fanatisch verhalten.
Wenn Simms hier wäre, würde er sich darum kümmern.
Aber er ist nicht hier.
Ich hole tief Luft und versuche, ein wenig Überzeugung in meine Stimme zu legen. »Hören Sie, Galizia, ich weiß Ihre Sorge wirklich zu schätzen … aber es geht mir gut. Ich sperre mich hier nicht ein. Ich bin nicht mit Ginger ausgeritten, weil so viel Schnee liegt. Sobald er schmilzt, werde ich meine täglichen Ausflüge wieder aufnehmen. Sie werden sehen.«
»Mmm.«
»Ich fühle mich besser. Wirklich.« Ich kann die Worte kaum aussprechen, ganz zu schweigen davon, ein schwaches Lächeln zustande zu bringen. »Es besteht also kein Grund sich einzumischen. Was auch immer Sie und Riggs geplant haben.«
»Was?« Ihre Wangen laufen auf bezaubernde Weise rot an, als ich den Namen des Kommandanten erwähne. »Riggs und ich planen gar nichts.«
»Klar. Abgesehen von Ihrem gemeinsamen Glück zu zweit …«
»Das ist absurd. Eure Majestät, er …« Sie schüttelt den Kopf. »Er ist mein Vorgesetzter.«
»Mhm. Und hat Sie Ihr Vorgesetzter in letzter Zeit mal gefragt, ob Sie noch mal mit ihm ausgehen wollen?«
»Regelmäßig mit ihm auszugehen wäre absolut unangemessen vor dem Hintergrund unserer jeweiligen Positionen in der Königinnengarde. Ein Kommandant sollte niemals ein Verhältnis mit einem seiner Leutnants eingehen. Das widerspricht sämtlichen Vorschriften.«
»Das war jetzt nicht gerade ein Nein, Galizia.«
Jetzt errötet sie sogar noch heftiger, falls das überhaupt möglich ist. »Auch wenn er gefragt haben sollte, würde ich niemals einwilligen.«
»Also hat er Sie gefragt! Nicht wahr?«
Sie antwortet nicht – was auch wiederum eine Antwort ist.
»Werden Sie die Einladung annehmen?«, setze ich ihr weiter zu.
»Natürlich nicht.«
»Warum nicht?«
»Ich muss hier im Schloss sein und alles im Auge behalten.«
»Rund um die Uhr? Können Sie sich nicht mal eine halbe Stunde freinehmen, um bei einem Kaffee zu flirten?«
»Nein.«
»Oh, okay. Ich verstehe. Sie dürfen sich also einigeln, aber wenn ich das mache, bin ich eine Frau mit PTBS, die sich im Haus verkriecht.« Ich verdrehe die Augen. »Das klingt für mich nach Doppelmoral, Galizia.«
Sie schaut mich einen Moment lang schweigend an und murmelt dann: »Sie reden wirklich nur Müll.«
»Dürfen Sie so etwas zu Ihrer Königin sagen?«
»Keine Ahnung. Vermutlich nicht. Aber jemand muss es sagen, und zurzeit …« So etwas wie Mitgefühl huscht über ihr Gesicht. »Bin ich alles, was Sie haben.«
Ein Kloß bildet sich ganz hinten in meiner Kehle. Sie hat recht. Ich habe niemanden mehr. Zumindest niemanden, den ich als Freund bezeichnen kann. Ich bin ständig von Personal umgeben, und doch bin ich einsamer, als ich es in meinem Leben je zuvor gewesen bin.
»Vielleicht sollten Sie Ihre Schwester anrufen.«
Ich versteife mich angesichts des zaghaften Vorschlags. »Ich kann Chloe nicht anrufen.«
»Warum nicht?«
»Ich kann es einfach nicht, okay?«
Nicht, nach dem, was ich zu ihr gesagt habe. Nicht, nachdem ich ihr an den Kopf geworfen habe, dass sie schlimmer als ihre hinterhältige Mutter Octavia ist. Nicht, nachdem ich sie ohne Vorwarnung aus dem Palast habe werfen lassen.
Bedauern macht sich in mir breit und vermischt sich mit Scham, Schuld und Trauer. Ich bin ein einziges Durcheinander aus Emotionen, das von einer zerbrechlichen Eisschicht ummantelt ist. Ein Riss in meiner Fassade, und alles wird aus mir herausströmen.
»Eure Majestät.« Galizias Miene hat sich wieder in ihre übliche Maske der Professionalität verwandelt. »Bitte gehen Sie einfach zurück in Ihre Gemächer.«
»Wozu? Ich werde ja ohnehin nicht schlafen können.«
Ich schlucke schwer und starre auf meine nackten Füße hinunter. Sie sehen auf dem kunstvollen Boden klein und blass aus. Ich will mich nicht anstellen, es ist nur … für längere Zeit in meinem Zimmer zu sein löst in mir ein seltsam klaustrophobisches Gefühl aus. So als würden die Wände um mich herum immer näher rücken.
Wenn ich es wollte, könnte ich natürlich jede andere Suite im Schloss beziehen. Ein Fingerschippen von mir würde genügen, und schon würden die Diener meine Sachen in jedes von mir gewünschte Zimmer bringen. Genau genommen sollte ich im Südflügel wohnen, wo Caerleons Könige und Königinnen während ihrer Amtszeiten immer untergebracht waren. Aber ich kann mich nicht dazu durchringen, in die Räumlichkeiten meines Vaters zu ziehen. Ich kann mich ja nicht einmal dazu durchringen, sie zu betreten.
»Wer hat denn etwas von Schlafen gesagt?« Galizias seltsame Bemerkung lenkt meinen Blick wieder auf sie. Sie hat die Lippen zu einem schiefen Lächeln verzogen, das dafür sorgt, dass ich die Augenbrauen hochziehe. »Sie haben einen Besucher.«
Ich reiße die Augen auf. »Es ist nach Mitternacht.«
Sie sieht mich einfach nur an, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken.
»Sie lassen tatsächlich jemanden rein, damit er mich um diese Uhrzeit besuchen kann?«
»Ich bin diejenige, die ihn angerufen hat.«
»Galizia!« Ich starre sie finster an. »Sie wissen doch, dass ich niemanden sehen will.«
Sie zuckt mit den Schultern und bietet mir weder eine Erklärung noch eine Entschuldigung an.
»Verraten Sie mir wenigstens, wer es ist.«
»Das werden Sie sehen, wenn Sie zurück zu Ihrer Suite gehen«, erwidert sie diplomatisch.
»Soll das Ihr Ernst sein? Ich bin die Königin. Ich kann Sie für die Missachtung von Befehlen in den Kerker werfen lassen.« Ich halte inne. »Glaube ich.«
»Glauben Sie. Sollten Sie das nicht wissen?«
»Ich bin noch ziemlich neu in diesem Metier. Dieser ganze ›Ab mit ihren Köpfen‹-Kram ist mir immer noch fremd.«
»Tja, ich weiß ja nicht, wie es dem Rest Ihrer Feinde geht, aber ich zittere schon vor Angst«, verkündet sie trocken. »Jetzt lassen Sie uns gehen. Er wartet bereits seit fast einer Stunde, während ich herumlaufe, um nach Ihnen zu suchen.«
Er?
Mir stockt der Atem. In seinem eisigen Käfig schlägt mein Herz schneller. Nach so vielen Monaten der Taubheit fühlt es sich seltsam an, spürbare Neugier zu empfinden, die in mir zum Leben erwacht wie die glühende Asche eines Feuers, von dem ich gedacht hatte, dass ich es für immer gelöscht hätte.
Wer wartet auf mich?
Und was will er?
»Was auch immer«, sage ich und schlucke erneut schwer. »Mir ist das alles egal.«
»Klar.«
»Wer auch immer es ist, ich werde ihm einfach befehlen, von hier zu verschwinden.«
»Natürlich werden Sie das.«
Ich beiße mir auf die Lippe, um eine weitere, nicht überzeugende Erwiderung zurückzuhalten. Ich ignoriere ihren wissenden Blick und straffe die Schultern, während ich mich umdrehe und den Thronsaal hinter mir lasse. Meine Wache folgt mir pflichtbewusst, und ihre Belustigung ist mit Händen greifbar, während sie beobachtet, wie ich darum ringe, meine Scharade der Gleichgültigkeit aufrechtzuerhalten, indem ich versuche, langsam zu gehen, statt mit Vollgas zu meinen Gemächern zu rennen.
Jeder Schritt ist eine Qual. Zu langsam, zu klein. Das Schneckentempo reibt an meinen Nervenenden wie Sandpapier.
Ist er es?
Nein.
Er kann es nicht sein.
Es sei denn …
Nein!
Ich dachte, dass ich nie wieder etwas empfinden würde. Abgesehen von der Taubheit.
Aber dieses Gefühl in meiner Brust – diese aufgeregte, ungewohnte Vorfreude – wird zu stark, um es zu unterdrücken.
In der Hoffnung, dass es Galizia nicht auffällt, gehe ich ein klein wenig schneller. Ich umrunde die Biegungen der Flure ein wenig zu hastig und nehme auf der Treppe, die zu meinen Gemächern hinaufführt, immer zwei Stufen auf einmal. Mit jedem Schritt durch den Flur schlägt die Kriegstrommel meines gebrochenen Herzens einen vernichtenden Zapfenstreich.
Klopf-klopf.
Klopf-klopf.
Klopf-klopf.
Irgendwo in dem schmerzenden Hohlraum zwischen jedem Schlag blüht Hoffnung auf – unbezähmbar, unauslöschlich.
Er.
Er.
Bitte, oh bitte …
Lass es ihn sein.
2. KAPITEL
Als ich über die Schwelle meines Zimmers trete, schlägt mir das Herz bis zum Hals. Überraschung, Freude und ein winziges bisschen Enttäuschung verknoten sich in meinem Magen, als ich den Mann erblicke, der in der Nähe meines Balkons steht. Sein breiter Rücken füllt eine armeegrüne Jacke aus, und seine langen Beine stecken in einer ausgeblichenen Jeans.
Selbst im Profil sieht er so gut aus wie immer. So vertraut wie immer. Dieser wirre blonde Haarschopf fällt ihm ins Gesicht und müsste wie üblich dringend geschnitten werden. Seine von langen Wimpern umrahmten braunen Augen sind fest auf die Glasscheibe gerichtet, und er erweckt den Eindruck, als wäre er tief in Gedanken versunken.
Als er mich eintreten hört, dreht er sich um.
»Ems.«
Beim heiseren Ton seiner tiefen Stimme zerbricht etwas in mir. Vielleicht ist es das Eis, das mein Herz umgibt. Vielleicht ist es mein Herz selbst, das nicht länger in der Lage ist, sich zusammenzuhalten, weil es sich in der Gegenwart eines Mannes befindet, der mich besser kennt als jeder andere Mensch auf der Welt. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich in dem einen Moment in der Tür stehe und im nächsten bereits durchs Zimmer gestürmt bin und in seinen Armen liege.
Meine Wange trifft auf seine Brust, und seine Umarmung umfängt mich wie warmes Wasser nach einem Sprung in einen Pool. Ich kneife die Augen fest zu, um die Tränen zurückzuhalten, aber die Belegtheit meiner Stimme lässt sich nicht vertuschen – sein Name kommt als Schluchzer über meine Lippen.
»Owen.«
Er schlingt die Arme so fest um mich, dass ich kaum atmen kann. Ich habe den Eindruck, dass er sich zurückhält und mich am liebsten noch fester drücken würde, um sich zu vergewissern, dass ich wirklich hier in seinen Armen bin, wenn er dadurch nicht meine Rippen in Gefahr bringen würde.
Ich gebe mich stumm geschlagen und lasse mich von ihm halten, bis wir beide die Umarmung ausreichend ausgekostet haben und meine Neugier die Oberhand gewinnt.
»Was machst du hier?«, frage ich. Die Worte klingen am Stoff seines Oberteils gedämpft. »Ich habe seit Monaten nichts mehr von dir gehört. Ich müsste eigentlich verdammt wütend sein, wenn ich nicht so verdammt froh wäre, dich zu sehen.«
»Ich weiß. Tut mir leid. Glaub mir, Ems, ich wollte dich auch sehen. Ich wollte es so sehr, dass es mich fast umgebracht hätte.« Er legt die Arme wieder fester um mich, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. »Hast du auch nur eine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst habe?«
Meine Stimme ist kaum hörbar. »Ich dachte …«
»Was?«
»Ich dachte, dass du mich vielleicht nicht mehr sehen wolltest. Dass du …«
Dass du mich auch verlassen hättest.
Owen lässt mich los, um mir ins Gesicht zu schauen. »Ich habe zu dir gehalten, als du beim Buchstabierwettbewerb in der dritten Klasse die Reihenfolge der Buchstaben beim Wort CHARTREUSE durcheinanderbrachtest. Ich habe zu dir gehalten, als du nach dem Frühlingsball mit meinem Auto gegen den Zaun meiner Eltern fuhrst und ich deswegen den ganzen Sommer lang Hausarrest bekam. Denkst du wirklich, dass ich dich jetzt im Stich lassen würde, nur weil du ausgezogen bist, um dir einen königlichen Titel zuzulegen?«
»Warum hast du dann nicht auf meine Anrufe reagiert?« Ich schlage gegen seinen Arm und verziehe das Gesicht zu einer finsteren Miene. »Hast du auch nur die geringste Ahnung, welche Sorgen ich mir um dich gemacht habe, Owen Harding?«
»Es tut mir leid, Ems. So verdammt leid. Ich weiß, dass du in den letzten paar Monaten durch die Hölle gegangen bist. Ich wünschte, dass ich hier an deiner Seite hätte sein können. Aber ich musste das durchziehen. Ich konnte erst zurückkommen, als ich mir absolut sicher war, dass du nicht mehr in Gefahr schwebst.«
Ich ziehe die Augenbrauen hoch. »Also bedeutet deine Anwesenheit hier … dass die Bedrohung vorbei ist? Dass ich jetzt in Sicherheit bin?«
»Ich bin mir sicher, dass dich der neue Kommandant deiner Königinnengarde bereits über einen Teil davon informiert hat.« Owen bläht ganz leicht die Nasenflügel. »Der ist ganz schön überheblich.«
»Wer? Riggs?« Ich verziehe die Lippen, als Emmett Riggs’ konzentriertes, kantiges Gesicht vor meinem inneren Auge aufblitzt. »Er hat nur einen ausgeprägten Beschützerinstinkt. Mich am Leben zu erhalten ist gewissermaßen sein Daseinszweck.«
»Da hat er ja einen tollen Job gemacht. Du bist Haut und Knochen. Wann hast du das letzte Mal eine richtige Mahlzeit zu dir genommen?«
»Es geht mir gut.«
Er wirkt nicht überzeugt. »Du bist zu blass. Und du hast größere Ringe unter den Augen als während deiner Bewerbungsphase für das Praktikum in der psychiatrischen Klinik.«
»Es ist …« Ich schlucke. »Es ist nicht leicht gewesen, okay? Wie hätte ich mir Sorgen um mich selbst machen können, wenn …«
»Wenn du damit beschäftigt warst, dir Sorgen um alle anderen zu machen?«
Ich nicke schwach.
»Das wird sich jetzt ändern. Mir ist egal, ob du die Königin bist. In erster Linie bist du ein Mensch. Du musst besser auf dich achten.«
»Okay, Dad«, necke ich ihn automatisch und erstarre dann. Diese spezielle Wunde, dieses vatermäßige Loch in meinem Herzen ist immer noch so frisch und schlecht verheilt, dass es mir manchmal den Atem verschlägt, auch nur darüber nachzudenken. Das Wort »Dad« auszusprechen, selbst als Scherz, gibt mir das Gefühl, als hätte mir jemand einen unerwarteten Schlag in den Magen verpasst.
Owen kennt mich gut genug, um schnell das Thema zu wechseln. »Wie dem auch sei. Dein neuer Kommandant – Riggs, nicht wahr? – scheint ein fähiger Mann zu sein. Er hat zweifellos das nötige Selbstvertrauen für die Rolle. Er hätte mich heute Nacht beinahe nicht durch die Schlosstore gelassen. Ich glaube, er wäre sogar dazu übergegangen, mich zu foltern, wenn sich deine persönliche Wache nicht für mich verbürgt hätte.«
Ich nehme mir vor, Galizia später zu danken. »Du kannst Riggs keinen Vorwurf dafür machen, dass er dir gegenüber misstrauisch ist – du bist für ihn ein Fremder. Und du bist um Mitternacht hier aufgetaucht.«
Owen schnaubt unwirsch. »Wie ich schon sagte, ich bin mir sicher, dass er dich bereits über den Zustand des Landes informiert hat. Nach dem Anschlag auf dem Vasgaard-Platz und dem Tod des Königs kurz darauf ist ganz Carleon von einer Welle des Patriotismus überschwemmt worden. Die Leute umarmen die Monarchie. Verdammt, sie umarmen sich gegenseitig auf eine Weise, wie sie es seit den Hochzeiten im Königreich nicht mehr getan haben.« Er verzieht ironisch den Mund. »Du hast die Flaggen vor jedem Haus gesehen … die blauen Bänder, die um jeden Baum gebunden sind … die unglaublich zahlreiche Teilnahme der Bevölkerung bei der Beerdigung deines Vaters. Ich habe gehört, dass daran mehr Menschen teilgenommen haben als an jeder anderen königlichen Beisetzung in der Geschichte des Landes. Es tut mir leid, dass ich nicht dabei sein konnte, Ems. Ich habe mir die Trauerfeier in den Nachrichten angesehen. Du warst so stark. Ich war verdammt stolz auf dich.«
Ich huste leicht und versuche, den Kloß in meiner Kehle loszuwerden. In Wahrheit ist der Großteil des Tages, an dem ich meinen Vaters beerdigte, wie im Nebel an mir vorübergezogen. Ich war so sehr in meine Trauer versunken, dass ich der tiefen Trübsal, in die ich versunken war, keine Beachtung schenkte. Ich konnte noch nicht ausgiebig nach Luft schnappen und richtig durchatmen oder die Energie aufbringen, mich wieder auf das Licht zuzubewegen. Zu jenem Zeitpunkt erschien es mir vollkommen unmöglich, dass irgendwann ein Tag kommen könnte, an dem sich nicht mehr jeder Augenblick so anfühlen würde, als müsste ich ersticken.
Owen räuspert sich und zieht damit meine Aufmerksamkeit wieder auf sich. »Wenn du dir die Mühe gemacht hättest, eine richtige Krönungsfeier abzuhalten, anstatt dich in diesem Schloss zu verkriechen, hätten die Teilnehmerzahlen alle Rekorde gebrochen, da bin ich mir sicher.«
Ich zucke innerlich zusammen. »Ich war damit beschäftigt, den Trauerfeierlichkeiten der Opfer des Anschlags beizuwohnen. Da kam es mir nicht unbedingt angemessen vor, ein großes Fest zu Ehren meiner neuen Regentschaft abzuhalten.«
Es kam mir auch nicht angemessen vor, die Weihnachtszeit zu genießen, die ohne großes Aufhebens kam und ging. Oder meinen einundzwanzigsten Geburtstag zu feiern, der unbemerkt vorüberzog. Oder irgendetwas anderes zu tun, als einfach nur zu weinen, bis ich keine Tränen mehr übrig hatte, die ich vergießen konnte.
Weihnachten verbrachte ich zusammengekauert in meinem Bett. Ich rührte mich nicht von der Stelle und war nicht bereit, irgendjemanden zu sehen. Nicht mal die Diener, die mit Tabletts voller Essen und Wasserflaschen an meiner Tür auftauchten. Meinen Geburtstag und Silvester verbrachte ich auf ähnliche Weise.
»Das ist nicht fair«, sagt Owen und klingt ein klein wenig gekränkt. »Ich habe schließlich nicht gemeint, dass du im ganzen Königreich eine Runde Jelly Shots hättest ausgeben sollen, Ems. Ich wollte nur sagen, dass sich die Leute um dich geschart hätten. Dass sie dich unterstützt hätten. Dass sie dich getröstet hätten.« Er seufzt. »Wenn es je eine Zeit gegeben hat, in der Caerleon einen Neuanfang gebraucht hat … dann jetzt, wo wir an unserem absoluten Tiefpunkt angelangt sind.«
»Warum bist du dir so sicher, dass die Leute scharenweise herbeigeströmt kämen, um mich zu unterstützen? Soweit ich unterrichtet bin, ist ein Großteil dieses Landes nicht allzu glücklich mit dem Haus Lancaster.«
»Seit dem Tag des Anschlags auf dem Platz hat es keine einzige Demonstration mehr gegeben. Aber das weißt du ja sicher alles schon. Du wirst doch ständig über die Situation im Land auf dem Laufenden gehalten.«
Ich wende den Blick ab und atme geräuschvoll aus. Ich kann seine Behauptung nicht widerlegen. Es stimmt – die Demonstrationen der Monarchiegegner, die hauptsächlich von einer Gruppe angeführt wurden, die sich »Schwarze Bandanas« nennt, sind nach dem Attentat vor drei Monaten bezeichnenderweise ausgeblieben. Die Rädelsführer, deren Namen ich aus Respekt vor den Opfern nicht aussprechen werde, starben durch ihre eigene Hand.
Sie waren alle Feiglinge.
Ich wünschte, dass sie überlebt hätten, wenn auch nur, um dafür zu sorgen, dass sie so leiden wie die Familien derjenigen, deren Leben sie auslöschten. Wenn auch nur, um sie für die Gräueltaten, die sie begingen, angemessen zu bestrafen.
Aber das kann ich in einer Pressekonferenz nicht sagen. Mein Gefühl, dass ich um meine Rache betrogen wurde, wäre niemandem ein Trost – weder mir noch meinen Untertanen noch jenen, die direkt von dem Anschlag betroffen sind.
Andere können weinen und schreien und vor Wut toben. Sie können ihre Fäuste gen Himmel recken und Antworten von einem Gott verlangen, an den sie nicht länger glauben, während Tränen des Zorns und der Trauer über ihre geröteten Gesichter strömen. Sie haben die Freiheit, ihre Verzweiflung auf eine Weise öffentlich zum Ausdruck zu bringen, wie es mir niemals möglich sein wird.
Nicht der Königin.
Niemals der Königin.
Ich allein muss erhobenen Hauptes dastehen wie ein Leuchtfeuer der beständigen Stärke und des unerschütterlichen caerleonischen Stolzes. Ich allein muss diese Bürde auf meinen Schultern tragen, darf niemals straucheln und niemals zögern. Und die Last dieser Gewissheit – diese unermessliche, unerträgliche Last – drückt meine Füße so fest gegen den Boden, dass es mir an manchen Tagen schwerfällt, meine Knie davon abzuhalten, unter mir zusammenzubrechen.
Zeit und Raum bieten einen gewissen Grad an Trost. Die unermessliche Trauer lässt ein ganz kleines bisschen nach, wie ein Korsett, das man nach einem scheinbar endlosen Abend löst, um es den Rippen zu ermöglichen, wieder an ihren angestammten Platz zurückzugleiten, damit die eingezwängte Lunge wieder atmen kann. Diese ersten paar Atemzüge fühlen sich so frei an, dass es beinahe schmerzt. So als hätte die Lunge nach ihrer langen Gefangenschaft vergessen, wie sie ihre einzige Funktion ausübt.
Ah, endlich, denkt man und nimmt einen quälenden Atemzug. Luft.Einatmen, ausatmen.
Jetzt erinnere ich mich wieder daran.
Riggs, den ich gleich zu Beginn meiner Regentschaft zum Kommandanten befördert habe, hat es zu seiner persönlichen Mission erklärt, jeden Radikalen aufzuspüren, der auch nur im Entferntesten etwas mit dem Anschlag zu tun hatte. Er hat geschworen, dass sich so etwas nie wieder auf caerleonischem Boden ereignen würde. Sein Vorgänger in dem Amt, ein unsäglicher Despot namens Ramsey Bane, war deutlich weniger erfolgreich. Ganz zu schweigen davon, dass er ausgesprochen verärgert darüber war, einen Posten zu verlieren, den er seit Jahrzehnten innehatte, und für seinen langjährigen Dienst nicht mal einen Präsentkorb zu erhalten.
Owen schaut mir wieder tief in die Augen. »Wenn du nicht darüber reden willst, verstehe ich das. Aber …«
»Ich will es wissen. Alles.« Ich straffe die Schultern. »Das Einzige, was schlimmer ist, als zu wissen, warum es passiert ist, ist, es nicht zu wissen.«
Er nickt ernst. »Als wir das letzte Mal miteinander sprachen, erzählte ich dir, dass ich versuchen würde, die Schwarzen Bandanas zu unterwandern. Ich brauchte eine Weile, aber irgendwann gelang es mir, ihrer Gruppe beizutreten.«
»Ich weiß. Ich sah dich einmal bei ihnen, als die Demonstranten meinen Autokorso umzingelten.«
»Du warst in dieser Limousine?« Er schüttelt den Kopf. »Das tut mir leid, Ems. Das muss beängstigend gewesen sein.«
»Ich bin ein großes Mädchen. Ich kann damit umgehen.«
»Klar.« Er räuspert sich ein wenig verlegen. »In den letzten paar Jahren haben die Monarchiegegner eine Wiederauferstehung erlebt. Es gibt mehrere unterschiedliche Gruppierungen, die alle das Ziel verfolgen, in Caerleon eine richtige Demokratie einzuführen. Die Schwarzen Bandanas sind mit Abstand die umtriebigsten. Ganz zu schweigen davon, dass sie die aggressivsten sind.«
Ich greife an mein Gesicht, um mir einen imaginären Speichelklumpen von der Wange zu wischen – ein Abschiedsgeschenk von einem Mitglied der Schwarzen Bandanas während eines öffentlichen Auftritts vor einigen Monaten. Den Ausdruck, den dieser Mann in den Augen hatte, als ihn meine Wachen außer Sichtweite zerrten, werde ich niemals vergessen.
Lancaster-Abschaum!
Tod der Monarchie!
Es ist seltsam, so heftig für etwas gehasst zu werden, auf das man absolut keinen Einfluss hat. Für das Blut in den Adern und die DNA, die die Moleküle des eigenen Körpers verknüpft.
»Ich hatte gehofft, dass ich etwas über ihre Pläne herausfinden könnte, bevor etwas Schlimmes passieren würde, wenn ich nur nah genug an sie herankommen könnte«, fährt Owen fort, und auf seinem Gesicht zeichnet sich Reue ab. »Offensichtlich habe ich versagt. Der Angriff … Wenn ich darüber nachdenke, was passiert ist … ich schäme mich so sehr dafür, dass ich nicht in der Lage war, es zu verhindern.«
»Nein, Owen …«
»Ich war so nahe an ihnen dran! Es lag alles direkt vor meiner Nase, und irgendwie habe ich es doch übersehen.«
»Es ist nicht deine Schuld, Owen. Du hättest nichts von ihren Plänen wissen können. Und selbst wenn du etwas davon gewusst hättest, hättest du sie nicht aufhalten können, ohne dein Leben aufs Spiel zu setzen. Sie waren fest entschlossen, Krieg gegen die Lancasters zu führen, egal wie hoch der Kollateralschaden sein würde.«
»Ich hätte mehr tun müssen. Ich hätte mir ihr Vertrauen verdienen und mich tiefer in ihre Organisation einschleusen sollen. Dann hätte ich tatsächlich etwas bewirken und dir von Nutzen sein können.«
Mit schmerzendem Herzen strecke ich eine Hand aus und verschränke meine Finger mit seinen. Dann drücke ich so fest zu, wie ich kann. »Du hast getan, was du konntest. Du hast es versucht. Die meisten Leuten würden nicht mal halb so viel tun.«
Er erwidert mein Drücken, das in seinem starken Griff untergeht. »Ich wollte sofort herkommen, gleich nachdem es passiert war. Aber ich musste sichergehen, dass sie nicht noch etwas geplant hatten. Ich musste mich vergewissern, dass du in Sicherheit sein würdest, bevor ich es wagen konnte, hier aufzukreuzen.« Er hält inne. »Und ich dachte … dass du mir vielleicht vergeben würdest, dass ich es so furchtbar verbockt habe, wenn ich brauchbare Informationen liefern könnte.«
»Es gibt nichts zu vergeben. Ich bin einfach nur froh, dass du in Sicherheit bist. Ich mache mir nämlich Sorgen um dich, weißt du?«
»Ich wünschte, dass du das nicht tun würdest.«
»Pech gehabt, Harding. Wir sind beste Freude für alle Zeiten. Das bedeutet für immer. Also hast du mich offiziell an der Backe, bis wir beide alt und grau sind.«
Das Lachen, mit dem ich gerechnet hatte, bleibt aus. Stattdessen holt er tief Luft und scheint sich zu sammeln. »Nach dem Anschlag blieb ich bei den Schwarzen Bandanas. Zumindest bei dem Rest, der noch von ihnen übrig war. Ein Großteil der Gruppe löste sich auf, nachdem die Mitglieder von dem Angriff gehört hatten. Sie mögen unzufrieden mit der Monarchie sein, aber die meisten von ihnen sind keine Radikalen. Sie sind einfach nur ganz normale Leute. Sie wollen zwar Veränderungen in der Regierung, aber nicht mit Waffengewalt.« Er erschaudert ganz leicht. »Was an diesem Tag passierte … spaltete die gesamte Bewegung der Monarchiegegner. Die Täter mögen mit ihrem Attentat beabsichtigt haben, dass sich die Enttäuschung der Menschen in eine ausgewachsene Rebellion verwandelt, aber soweit ich das beurteilen kann, haben sie genau das Gegenteil erreicht. Ihre Anhänger haben sich in alle Winde zerstreut und sind nicht bereit, mit solch einer extremistischen Gruppierung in Verbindung gebracht zu werden. Plötzlich scheinen die Steuergelder zur Begleichung der einen oder anderen Ausgabe des Königshauses ein kleiner Preis zu sein für die Sicherheit im Land.«
»Im Moment vielleicht«, murmle ich. »Ihre Wut mag vorübergehend von dem Schrecken überlagert sein, der uns allen noch in den Knochen steckt … Aber sobald sich die Trauer und das Entsetzen erst einmal gelegt haben, werden all die Probleme, die dazu geführt haben, dass die Leute zu radikalen Maßnahmen greifen, wieder an die Oberfläche steigen. Diese Welle des Patriotismus ist nur eine vorübergehende Erscheinung.« Ich schüttle den Kopf und schaue an meinem Freund vorbei und lasse den Blick aus diesem Zimmer hinaus in die Ferne schweifen, in eine Zukunft, die es noch zu gestalten gilt. »Ich bin kein Experte, aber ich weiß, dass wir die Gegner der Monarchie nicht einfach ignorieren können in der Hoffnung, dass sie von selbst von der Bildfläche verschwinden werden. Wir können sie nicht weiterhin wie eine Plage behandeln, die man ausrotten muss. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen und den Grund für ihren Verdruss verstehen, damit wir dauerhaft etwas verändern können. Wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen, mit ihnen reden, von Angesicht zu Angesicht, bis wir zu einer Einigung gekommen sind. Ansonsten … fürchte ich, dass wir uns irgendwann wieder in einer ähnlichen Situation befinden werden – in sechs Monaten oder sechs Jahren. Und ich bin nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Nicht solange ich eine Krone auf dem Kopf trage und die Möglichkeit habe, dies zu verhindern.«
Owen lässt den Blick über mein Gesicht wandern und betrachtet es mit beinahe klinischer Sorgfalt.
»Was?«, frage ich und gehe in die Defensive. »Warum schaust du mich so an?«
»Du bist …«
Ich ziehe die Augenbrauen hoch.
»Du bist anders«, stellt er fest. »Du hast dich seit unserer letzten Begegnung so sehr verändert, dass mir regelrecht der Kopf schwirrt.«
»Ich bin immer noch dieselbe alte Emilia, mit der du aufgewachsen bist.«
»Du musst dich nicht rechtfertigen. Das ist nichts, wofür du dich schämen musst. Tatsächlich ist es sogar ziemlich beeindruckend. Das kleine Mädchen mit den schiefen Zöpfen und dem zerrissenen Overall, das nebenan wohnte, ist jetzt …«
»Ein nicht mehr ganz so kleines Mädchen mit einem schiefen Pferdeschwanz und einer ausgeleierten Jogginghose?«
»Ich wollte sagen: ein mitfühlendes, besonnenes Oberhaupt. Aber ja, das andere auch.«
Ich verziehe den Mund zu einem halben Lächeln, als er eine Hand ausstreckt und an einer verirrten Haarsträhne zieht. »Ich bin stolz auf dich, Ems. Habe ich dir das schon gesagt?«
»Werd nicht kitschig.«
Er hebt kapitulierend die Hände. »Keine Sorge, das hatte ich nicht vor. Ich bin nur ehrlich. Ich weiß, dass du eine harte Zeit hinter dir hast. Ich weiß, dass es für dich nicht leicht gewesen ist, diese neue Rolle einzunehmen. Aber ich wäre ein ziemlich schlechter Mensch, wenn ich dir nicht sagen würde, dass du das alles meiner Meinung nach besser gemeistert hast, als es jeder andere gekonnt hätte. Du … Ich denke, dass du schon immer dazu bestimmt warst, hier zu landen.«
»Wer bist du und was hast du mit Owen gemacht?«, ziehe ich ihn auf und versuche, einen Teil des Schmerzes, den seine Worte in meiner Brust ausgelöst haben, abzuwenden. »Bist du derselbe Mann, der mir vor einer Weile befahl, aus seinem Leben zu verschwinden und nie wieder einen Blick zurückzuwerfen? Als ich dir damals erzählte, dass ich vorhätte, die Rolle der Thronerbin anzunehmen, hast du mir praktisch den Kopf abgerissen. Verdammt, du hättest dich beinahe mit …« Ich halte inne, bevor mir Carters Name über die Lippen kommt.
Owen öffnet den Mund, um etwas zu erwidern, aber er muss wohl noch mal über das, was er sagen wollte, nachgedacht haben, denn er klappt den Mund wieder zu, ohne auch nur eine Silbe von sich zu geben.
»Ich schätze, dass ich einfach nur überrascht bin, dass du mich unterstützt«, murmle ich leise. »Du warst von Anfang an entschieden dagegen, dass ich eine Lancaster werden sollte. Dass ich ein Mitglied der Königsfamilie werden sollte.«
»Ich habe wohl kaum eine Wahl, oder?« Er zuckt mit den Schultern. Es ist eine beiläufige Geste, mit der er die Steifheit seiner Schultern jedoch nicht überspielen kann. »Das ist dein Leben. Wenn ich ein Teil davon sein will, muss ich gewisse Dinge wohl einfach akzeptieren.« Seine Stimme wird ein wenig rauer. »Das Mädchen, das ich kannte, existiert nicht mehr. Emilia Lennox gibt es nicht mehr. Und so sehr ich das auch verdammt noch mal hasse … so sehr mir das auch widerstrebt … ist das hier das, was du jetzt bist.«
Ich zucke angesichts der unverkennbaren Verachtung, die aus seinen Worten spricht, zusammen. Das Wort »hassen« rauscht durch meinen Kopf wie eine Abrissbirne und zerstört das Fundament der Freundschaft, von der ich dachte, dass sie nach all der Zeit gegen jegliche Bedrohung immun wäre.
Das hier ist das, was du jetzt bist.
Owen muss den Ausdruck auf meinem Gesicht bemerkt und den Schmerz erkannt haben, den er mir gerade unbeabsichtigt zugefügt hat.
»Tut mir leid. Das kam schroffer rüber als gewollt.«
»Nein«, flüstere ich und schlucke schwer. »Ich denke, das kam genau so rüber, wie du es gemeint hast.«
»Ems …«
»Ist schon gut. Ich weiß, wie du über die Monarchie denkst. Ich werde es nicht persönlich nehmen.«
Das ist natürlich eine Lüge.
Wie könnte ich die Tatsache, dass mein bester Freund die Rolle, die ich nun ausfülle, nicht leiden kann, nicht persönlich nehmen? Die Tatsache, dass er sich wünscht, dass ich nicht Emilia Lancaster, sondern immer noch Emilia Lennox wäre?
Ich versuche, gegen die Tränen anzukämpfen, versage aber auf der ganzen Linie. Owen sieht, wie sie in meinen Augen aufsteigen, und seine Gesichtszüge fallen nach unten.
»Verdammt, Ems, ich hätte nicht …« Er fährt mit einer Hand durch seinen wirren Haarschopf. »Es tut mir leid. Ich bin ein Idiot. Ich nehme es zurück. Okay?«
Ich schüttle den Kopf und bin nicht in der Lage, etwas zu erwidern. Ich befürchte, dass ich lediglich ein Schluchzen zustande bringen werde, wenn ich den Mund öffne.
Das Mädchen, das ich kannte, gibt es nicht mehr.
Mit einem gequälten Seufzen streckt Owen die Hände aus und zieht mich in seine Arme. Ich wehre mich nicht dagegen. Mein Gesicht trifft auf seine Brust, und ich kralle die Hände in den Stoff seines Oberteils. Für einen sehr langen Moment hält er mich einfach nur fest an sich gedrückt, während sein Herz gleichmäßig an meiner Wange pocht. Ich sauge seine Kraft in mich auf wie ein stärkendes Elixier, wie einen Balsam für Wunden, die so tief liegen, dass man sich nur schwer eine Behandlung vorstellen kann, die zu ihrer Heilung führen würde. Nun, da meine Augen in seiner Halsbeuge vergraben sind, gestatte ich es mir, ein paar Tränen zu vergießen, während ich mich die ganze Zeit über dafür tadele, dass ich vor ihm zusammenbreche.
»Oh, Ems.« Er streicht mit einer Hand über mein Haar. »Es tut mir leid. Ich meinte es nicht so. Es tut mir leid. Okay?«
»Mmm.«
»Ich fühle mich schrecklich.«
»Ist schon gut.« Ich schniefe. »Mach dir deswegen keine Gedanken.«
»Also verzeihst du mir?«
»Natürlich verzeihe ich dir.« Meine Stimme klingt ganz belegt von all den Tränen. »Du bist mein bester Freund.«
Eine deutliche Pause entsteht. Ich warte darauf, dass er entsprechend reagiert und meine Aussage erwidert, aber sie hängt einfach in der Luft – wie ein Staffelstab, der zwischen zwei Läufern überreicht wird, die vollkommen unterschiedliche Ziellinien im Sinn haben.
»Owen?«
Ein Zittern geht durch seinen Körper, während er scharf einatmet und dann einen Schritt zurücktritt – er lässt die Arme sinken und ballt die Hände an den Seiten zu Fäusten. Als ich ihm über die plötzliche Kluft zwischen uns hinweg in die Augen schaue, überkommt mich ein seltsames Gefühl: dass dies die letzte Umarmung ist, die wir je teilen werden, dass dies das letzte Mal ist, dass ich mich an diese vertraute Brust schmiegen kann, um mir die Augen so auszuweinen, wie man es nur vor jemanden tun kann, dem man vorbehaltlos vertraut.
»Emilia.« Ich weiß, dass er es ernst meint, wenn er mich bei meinem vollständigen Namen nennt. »Ich bin dein bester Freund. Ich werde immer dein bester Freund sein. Aber trotz dieser Tatsache … oder vielleicht gerade wegen dieser Tatsche … muss ich dir die Wahrheit sagen.« Seine braunen Augen sind ernster, als ich sie je zuvor gesehen habe, voller Aufrichtigkeit und ohne jegliche Verstellung. »Ich betrachte dich schon sehr, sehr lange nicht mehr nur als meine Freundin.«
Ich erstarre – mein Körper, mein Verstand und mein Herz stellen alle gleichzeitig ihre Funktion ein, so als hätte mich jemand in einen Bottich mit Eiswasser geworfen. Ich bin wie festgefroren.
»Ich weiß nicht, wann es angefangen hat«, fährt er betreten fort. »Vor Jahren. Vermutlich schon bevor mir überhaupt klar war, dass es passierte. Ich ging immer davon aus, dass es sich schon von allein regeln würde, wenn ich nur lange genug warten würde. Dass wir, wenn ich geduldig sein und dich nicht bedrängen würde, irgendwann zusammenkommen würden. So wie es uns schon immer vorherbestimmt war. So wie es gekommen wäre, wenn … das alles hier nicht passiert wäre.«
Ich stehe mit offenem Mund da und starre ihn ungläubig und fassungslos an. Ich versuche, mich zusammenzureißen, aber es ist zu spät. Er hat meinen schockierten Gesichtsausdruck bereits gesehen.
»Owen …«
Er unterbricht mich, bevor ich die Chance habe, seinen Namen vollständig auszusprechen. »Nicht. Du musst nichts sagen. Du musst mich deswegen nicht trösten. Ich weiß, dass ich ein Idiot bin.«
»Du bist kein Idiot!«
»Doch, das bin ich. Weil ich das hatte, was ich auf der Welt am meisten wollte, und es durch meine Finger gleiten ließ.« Er stößt ein herzzerreißendes Lachen aus, das ihm im Hals stecken bleibt. Mit einer Hand greift er nach oben, um durch sein dichtes blondes Haar zu fahren – so wie er es immer macht, wenn er nervös ist. »Ich meine, wie verflucht dumm ist das? Auf den richtigen Zeitpunkt zu warten? Davon auszugehen, dass sich das Universum schon fügen würde, nur weil ich es so wollte?«
»Owen …«
»Nicht. Es ist nicht deine Schuld, es ist meine. Ich kann nur mir selbst einen Vorwurf machen.« Er schüttelt den Kopf. »Für den Rest meines Lebens werde ich es bereuen, dass ich damit gewartet habe, dich für mich zu gewinnen. Ich wollte nur, dass du weißt, wie ich empfinde. Nur ein einziges Mal. Denn wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte … wenn ich alles anders machen könnte … Gott, Ems, ich würde jede verdammte Uhr auf der Welt zurückdrehen, wenn das bedeuten würde, dass ich unser mieses Timing in Ordnung bringen könnte.«