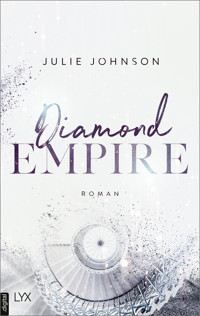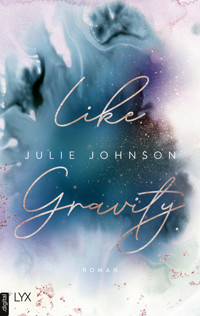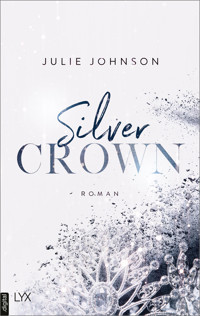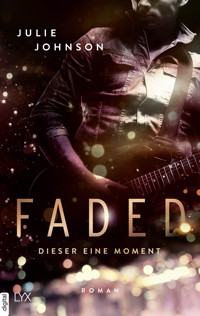9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Anymore-Duet
- Sprache: Deutsch
Wenn deine Gefühle wie ein tosender Sturm über dich hereinbrechen ...
Ein Jahr ist vergangen, seit Josephine Valentine ihrem besten Freund Archer Reyes ihre wahren Gefühle offenbarte und dieser ihr das Herz brach. Was Josephine nicht weiß: Archer hat gelogen, um sie zu schützen. Und hat sich damit genauso sehr verletzt wie sie. Um den Schmerz hinter sich zu lassen, fügte sich Josephine dem Wunsch ihrer Eltern und arbeitete im Ausland für das Familienunternehmen - weit weg von ihren Erinnerungen. Aber nun ist sie zurück in Cormorant House und nimmt an, dass Archer längst als BaseballStar am College gefeiert wird. Niemals hätte sie erwartet, dass sie ihn in einem Sturm mitten auf dem Meer wiedersehen würde, als er erneut ihr Leben rettet ...
"WE DON’T TALK ANYMORE besteht aus so viel mehr als nur aus Worten und Buchstaben, die Geschichte ist voller Leidenschaft, Trauer, Einsamkeit, Echtheit, Liebe. Diese Geschichte ist einfach voller Leben." @ ZWISCHENZEILENUNDGEDANKEN
Zweiter Band des ANYMORE-Duetts
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Epilog
Playlist
Die Autorin
Die Romane von Julie Johnson bei LYX
Impressum
Julie Johnson
We don’t lie anymore
Roman
Ins Deutsche übertragen von Anika Klüver
Zu diesem Buch
Ein Jahr ist vergangen, seit Josephine Valentine ihrem besten Freund Archer Reyes ihre wahren Gefühle offenbart hat. Ein Jahr, seit sie ihm gesagt hat, dass sie ihn liebt, und er ihr eiskalt das Herz gebrochen hat. Josephine ahnt nicht, dass Archer sie nur belogen hat, um sie zu retten. Und dass er sich damit genauso sehr verletzt hat wie sie. Um die schmerzhaften Erinnerungen hinter sich zu lassen, gab Josephine dem Wunsch ihrer Eltern nach und arbeitete ein Jahr lang in der Schweiz für das Familienunternehmen. Doch nun ist sie zurück in Cormorant House, bereit, sich dem Ort zu stellen, an dem sie so viele glückliche Momente mit Archer verbracht hat. Josephine rechnet damit, dass dieser schon längst an einem College als BaseballStar gefeiert wird. Schließlich weiß sie nichts von seinem Unfall und davon, dass er die Stadt nie verlassen hat. Aber als sie plötzlich allein auf dem Meer in Lebensgefahr gerät, ist es Archer, der sie rettet. Und trotz allem, was zwischen ihnen steht, sind die Gefühle, die über die beiden hereinbrechen, so überwältigend und mitreißend wie ein tosender Sturm …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
Du hättest es besser wissen sollen.
1. KAPITEL
Josephine
Das weitläufige steinerne Anwesen ragt vor mir auf wie ein Unheil verkündender Schatten, der immer größer wird, während die Limousine langsam die kreisförmige Einfahrt hinaufrollt. Ich schließe die Augen, konzentriere mich auf das Geräusch – Reifen, die auf importiertem Erbsenkies knirschen – und versuche, um den Kloß herumzuatmen, der in meiner Kehle feststeckt.
Ich bin zu Hause.
Ein Jahr an einem anderen Ort hätte genügen sollen, um die schmerzhaften Erinnerungen, die untrennbar mit diesem Anwesen verbunden sind, verblassen zu lassen. Doch als mir der Chauffeur vom Rücksitz hilft und mein Gepäck die Stufen zum eindrucksvollen Haupteingang von Cormorant House hinaufträgt, wird mir klar, dass kein noch so langer Zeitraum jemals genügen wird. Weder ein Jahr, noch ein Jahrzehnt, noch ein ganzes Leben.
Die Narben sind einfach viel zu tief.
»Werden Sie ganz allein in diesem zugigen alten Kasten zurechtkommen, Miss?«, fragt mein Fahrer. Er runzelt in väterlicher Sorge die Stirn, während er sich umschaut.
Ich folge seinem Blick und betrachte das vertraute Anwesen. Trauerweiden wiegen sich im Wind. Die frühen Sommerblätter hängen schwer an ihren Ästen. Makellos gepflegte Formschnitthecken stehen entlang der Einfahrt Spalier wie grüne Wächter in der Nacht. Der Rasen, der sich den Hügel hinab in Richtung Meer erstreckt, ist in blasses silbriges Mondlicht getaucht. Selbst aus dieser Entfernung kann ich hören, wie die Wellen sich an den Felsen brechen wie ein melancholisches Metronom.
Das Anwesen ist wunderschön, aber kalt.
Farblos.
Wie ein dunkler Wald aus einem finsteren Märchen.
Ich hole tief Luft, um mich zu sammeln, und wende mich an den Fahrer. »Ich werde zurechtkommen.«
»Wenn Sie das sagen.« Er pfeift leise. »Hier draußen an den Klippen ist es ziemlich dunkel, deswegen habe ich gefragt. Aber ich schätze, dass Sie daran gewöhnt sind, wenn Sie hier aufgewachsen sind …« Seine Wangen nehmen einen leichten Rotton an. »Entschuldigen Sie mein dummes Geschwätz. Sie müssen nach dem langen Flug erschöpft sein. Ich werde mich dann mal wieder auf den Weg machen. Es sei denn, Sie wollen, dass ich Ihnen das Gepäck ins Haus trage …«
»Nein, das schaffe ich schon.«
»Sind Sie sicher? Am Telefon betonte Mr Beaufort mit allem Nachdruck, dass ich Sie sicher nach Hause bringen soll …«
»Und das haben Sie getan.« Ich lächle mit zusammengepressten Lippen, greife in meine schwarze Lederclutch von Yves Saint Laurent und hole einen nagelneuen Fünfzigdollarschein heraus. »Danke.«
Er nickt respektvoll, bevor er das Trinkgeld einsteckt und die Stufen hinunter zur Limousine zurückgeht. Ich warte, bis die Rücklichter am anderen Ende der Einfahrt verschwinden. Dann tippe ich den Zugangscode für die Haustür ein und betrete die gewölbeartige Eingangshalle. Meine Schritte hallen laut auf dem Marmorboden wider. Die Rollen meines Koffers singen in der Dunkelheit einen unheilvollen Refrain.
Dieses Haus hat sich für mich schon immer so angefühlt, als würde es hier spuken, allerdings selten so sehr wie in diesem Augenblick, in dem ich von mit weißen Laken bedeckten Möbeln umgeben bin und sich die Schatten von draußen dicht an jede Fensterscheibe pressen. Hinter jeder Ecke scheinen Geister zu lauern – sie sind jedoch nicht das Ergebnis paranormaler Aktivität, sondern die Bruchstücke meiner eigenen schmerzhaften Erinnerungen, die unsichtbar, aber doch eindeutig vorhanden im Raum hängen.
Erinnerungen an ein Leben, das ich einst führte.
An ein Mädchen, das ich früher einmal war.
Ich lasse mein Gepäck in der Nähe der Tür stehen und gehe von Zimmer zu Zimmer, um überall das Licht anzuschalten und die leere Villa mit Helligkeit zu fluten. Staub wirbelt auf, als ich die Laken von den Möbeln zerre und eine Ansammlung kunstvoll gearbeiteter Antiquitäten zum Vorschein bringe. Hier in Cormorant House wurde der Form schon immer mehr Bedeutung beigemessen als der Funktion – ein Sofa, das man aus der Ferne bewundert, auf dem man sich aber so gut wie nie wohlfühlt, wenn man tatsächlich darauf Platz nimmt; ein Perserteppich, der so kunstvoll gewebt ist, dass man sich kaum traut, einen Fuß daraufzusetzen, und nur mit leichten Schritten darüberhuscht; Teetassen aus Porzellan, die viel zu zerbrechlich sind, um gedankenverloren aus ihnen zu trinken. In diesem Haus herrscht keine heimelige Atmosphäre, keine Gemütlichkeit. Hier herrscht nur eine allgegenwärtige Leere, die mit klammen Fingern über die Haut kriecht.
Die einzige Wärme, über die dieser Ort je verfügte, kam von dem Haushälterpaar, das in dem kleinen Cottage am Rand des Grundstücks wohnte. Flora und Miguel Reyes – meine persönlichen Heizkörper in der Ecke eines Eisschlosses. Rückblickend hätte ich mein Überleben vermutlich nicht von etwas anhängig machen sollen, das sich so leicht entwurzeln und umsiedeln lässt. Mir hätte klar sein müssen, dass die Menschen, die ich einst als Ersatzeltern ansah, in keiner Weise dazu verpflichtet waren, für immer bei mir zu bleiben.
Trotzdem …
Sie hätten sich wenigstens verabschieden können.
Ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, dass das selbst nach all diesen Monaten nicht immer noch wehtäte. Die lapidare Erklärung, die mir meine Mutter letzten Sommer lieferte, beschwichtigte mich kaum – und konnte auch meine verletzten Gefühle nicht lindern.
Miguel hat ein Jobangebot in seiner alten Heimat Puerto Rico angenommen, teilte Blair mir gleichgültig mit, ohne auch nur den Blick von ihrer Zeitung zu heben. Sie sind bereits fort. Sie haben ihre Sachen gepackt und Cormorant House letzten Monat verlassen. Oh, nun schau doch nicht so missmutig drein, Liebling. So ist es für alle am besten. Und jetzt iss deine Frittata, bevor sie kalt wird. Wir haben in zwanzig Minuten eine Besprechung mit dem Marketingteam von VALENT.
Ich wusste, dass eine Rückkehr hierher ohne die Familie Reyes nicht das Gleiche sein würde. Ich dachte, dass ich damit umgehen könnte. Aber in der verlassenen Küche zu stehen, ohne dass Floras sanftes Summen die Leere ausfüllt, ohne dass mir Miguel kurz zuzwinkert, um mir ein Lachen zu entlocken … macht mir klar, wie sehr ich mich geirrt habe. Die Schwermut ist allumfassend. Meine Einsamkeit ist rasiermesserscharf. Sie scheint mit jedem Atemzug in meinen Brustkorb zu schneiden.
Ich drehe den Wasserhahn am Spülbecken auf, streiche mir das lange blonde Haar aus meinem Gesicht zurück, beuge mich vor und trinke Wasser direkt aus dem Hahn. Ich stille meinen Durst mit verzweifelten Schlucken. Wenn meine Mutter hier wäre, würde mein Mangel an Manieren sie regelrecht entsetzen. Allerdings wäre sie wohl nicht ganz so entsetzt, wie sie es sein wird, wenn sie erfährt, dass ich die Schweiz – und meine Praktikumsstelle – ohne Vorankündigung verlassen habe.
In diesem Fall hatte ich jedoch kaum eine andere Möglichkeit. Wenn ich meine Eltern über meinen Plan, nach Manchester-by-the-Sea zurückzukehren, informiert hätte, hätten sie alles in ihrer Macht Stehende getan, um ihn mir auszureden. Um mich noch für einen weiteren Sommer in Genf zu behalten, damit ich an ihrer Seite für ihre Organisation VALENT arbeite. Ich weiß genau, mit welcher Überzeugungskraft sie ans Werk gehen können – hätte ich ihnen die Gelegenheit gegeben, hätten sie womöglich erreicht, dass ich meinen Studienbeginn an der Brown University ein weiteres Mal aufschiebe und ein zweites Brückenjahr einlege, statt mit dem Studium zu beginnen.
Aber das kann ich nicht zulassen.
Das werde ich nicht zulassen.
Nicht, dass die vergangenen zwölf Monate nicht gut gewesen wären. Mitunter waren sie sogar toll. Genf ist eine umwerfende Stadt voller Geschichte, Kultur, internationaler Geschäfte, Kunst … und, völlig unerwartet, Liebe. Durch die Zusammenarbeit mit Vincent und Blair bei VALENT habe ich zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich das Gefühl gehabt, mir ihre Zuneigung verdient zu haben. Sie haben mir im letzten Jahr mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht als in den gesamten achtzehn Jahren zuvor.
Doch so gut die Dinge auch sein mögen, so glücklich ich mir auch einrede zu sein … ist da doch diese hartnäckige, kleine Stimme in meinem Hinterkopf, die mir ständig zusetzt – die mir die Frage stellt, wie ich nur so weit weg von zu Hause landen konnte, so weit weg von allem, von dem ich dachte, dass ich es wollte. Diese Stimme flüstert mir tief in der Nacht zu, dass dieses neue Leben nicht das ist, was ich für mich selbst gewählt hätte, wenn ich die Chance gehabt hätte.
Was ist mit dem College?
Was ist mit dem Modedesignstudium?
Was ist mit den großen Träumen, eines Tages dein eigenes Label zu gründen?
All diese Fragen sind unbeantwortet geblieben und haben sich von einem gedämpften Summen zu einem lauten Gebrüll entwickelt, das mich keuchend aus dem tiefsten Schlaf aufschrecken lässt. Das plötzliche klaustrophobische Gefühl, das die aktuellen Umstände meines Lebens in mir auslösen, lastet mittlerweile so schwer auf mir, dass mir an manchen Tagen sogar das Atmen schwerfällt. Das Lachen. An solchen Tagen gehe ich durchs Leben wie ein Roboter oder eine Maschine auf Autopilot.
Ich brauche eine Pause von alldem – von den Vorstandssitzungen und den Familienabendessen, von der erdrückenden Last der Erwartung auf meinen Schultern. Ich brauche ein wenig Abstand, um mir über meine eigenen Wünsche klar zu werden, ungeachtet dessen, was alle anderen für mich und von mir wollen.
Meine Eltern.
Der Vorstand von VALENT.
Oder Oliver.
Als hätte er meine Gedanken gehört, summt mein Handy plötzlich in den Tiefen meiner Clutch. Ich ziehe es heraus und blicke auf den Namen OLIVER BEAUFORT, der über seinem Foto auf meinem Display aufblinkt. Er hat sandblondes Haar, dunkelblaue Augen und einen gepflegten Bart. Für einen Augenblick spiele ich mit dem Gedanken, seinen Anruf auf die Mailbox gehen zu lassen.
Wenn du nicht drangehst, wird er sich Sorgen machen, ermahne ich mich und tippe mit einer knappen Bewegung meines Fingers auf die Taste, um den Anruf entgegenzunehmen. Sei nicht egoistisch, Jo.
»Hi.«
»Hey, Liebes.« Seine warme Stimme mit dem leichten Südstaatenakzent strömt in meinen Gehörgang. »Dann bist du also sicher zu Hause angekommen?«
»Ich stehe gerade in der Küche.«
»Wie war der Flug?«
»Lang. Unspektakulär.« Ich lehne mich nach hinten gegen die Kante der Küchentheke. »Ich habe fast die ganze Zeit über geschlafen.«
»Ich wünschte immer noch, dass du den Jet genommen hättest. Wenn du mich fragst, ist es absoluter Schwachsinn, einen Flug zu buchen wie jeder normale Bürger, wenn deine Eltern eine Gulfstream besitzen.«
Ich kneife mir in den Nasenrücken. »Ich will nicht schon wieder darüber diskutieren, Ollie.«
»Schön, wie du meinst.« Er seufzt tief und erinnert sich zweifellos an die heftige Auseinandersetzung, die wir vor meiner Abreise wegen genau dieses Themas hatten. »Ich will nicht schon wieder davon anfangen. Ich will nur das Beste für dich.«
»Das weiß ich.«
»Du klingst müde, Liebes.« Er hält inne. »Bist du sicher, dass es dir gut geht?«
»Natürlich. Nur … nach all der Zeit im Ausland wieder zu Hause zu sein. Daran muss ich mich erst gewöhnen.«
»Das kann ich mir vorstellen. Ist alles so, wie du es in Erinnerung hast?«
»Ein wenig staubiger, aber ich werde schon klarkommen.«
»Ich dachte, dass ihr auf dem Anwesen Personal hättet, das sich um die Instandhaltung kümmert.«
»Das hatten wir früher mal. Sie sind …« Ich habe Mühe, meine Stimme unter Kontrolle zu halten, während Floras und Miguels Gesichter vor meinem inneren Auge aufblitzen. »Sie sind nicht mehr da. Sie sind gegangen.«
»Das war mir nicht klar. Die Vorstellung, dass du dort ganz allein bist, gefällt mir nicht.«
»Ich habe hier ein hochmodernes Sicherheitssystem, Ollie. Mehr brauche ich nicht.«
»Tatsächlich? Ein Sicherheitssystem wird dich aber nachts nicht warm halten.«
»Flirten Sie mit mir, Mr Beaufort?«
»Immer.« Ich kann das Lächeln in seiner Stimme hören. »Du solltest dich ein wenig ausruhen. Bei dir muss es schon spät sein.«
Ich werfe einen Blick auf die Standuhr im Flur neben der Küche. Die kunstvoll gearbeiteten goldenen Zeiger kriechen langsam über das Ziffernblatt und markieren jede verstreichende Sekunde mit einem hörbaren Ticken.
»Fast zwei.«
»Mmm.« Ich höre die gedämpften Geräusche klimpernder Schlüssel und einer zufallenden Tür. Ich stelle mir vor, wie er in seiner luxuriösen Wohnung in Eaux-Vives den Riegel vorschiebt und auf den Kai hinaustritt, der am See entlang verläuft. Ich sehe vor mir, wie die Morgensonne auf den Strähnen seines blonden Haars funkelt, während er einen Schluck von seinem Kaffee trinkt. »Hier ist es noch nicht ganz acht, aber ich bin bereits auf dem Weg ins Büro. Ich treffe mich in zwanzig Minuten mit deinem Vater. Du weißt ja, wie er zu Unpünktlichkeit steht.«
»Ja, leider weiß ich das.«
»Er wird heute in guter Stimmung sein, wenn man bedenkt, dass seine einzige Tochter quasi über Nacht aus dem Land geflohen ist. Ich gehe davon aus, dass sie mittlerweile wissen, dass du weg bist, oder?«
»Ich habe ihnen eine Nachricht hinterlassen.«
Er schnaubt. »Blair muss rasend vor Wut sein. Das sollte für eine wundervolle Arbeitsatmosphäre sorgen.«
»Tut mir leid.«
»Das muss es nicht. Ich bin ein großer Junge. Ich kann mit den Reaktionen deiner Eltern umgehen. Du weißt, dass ich deine Entscheidung, dir ein wenig Zeit für dich zu nehmen, voll und ganz unterstütze.« Er hält inne. »Nicht, dass ich etwas dagegen hätte, wenn du es dir anders überlegen und zurückkommen würdest …«
Ich schaue zur Decke hinauf und betrachte das dekorative Kranzprofil. Genau wie der Rest des Hauses ist es fast zweihundert Jahre alt. »Ich habe dir doch erklärt, dass ich ein wenig Zeit brauche, um mir Klarheit darüber zu verschaffen, was ich in Zukunft machen möchte.«
»Wie lange wird das dauern?«
»Ich fahre im Laufe der Woche nach Providence runter, um mich an der Brown mit einer Studienberaterin zu treffen und über meine Optionen zu sprechen. Danach werde ich ein klareres Bild von der Zukunft haben.«
»Von einer Zukunft, von der ich immer noch ein Teil sein werde, wie ich doch hoffe.«
Ich kneife die Augen zu. »Ollie …«
»Okay, okay, ich werde aufhören, dich zu bedrängen. Ich vermisse dich nur, das ist alles.«
»Ich bin doch noch nicht mal einen Tag lang weg.«
Er schweigt sehr lange. So lange, dass ich denke, dass die Verbindung womöglich abgebrochen ist. Schließlich sagt er mit leiser Stimme: »Es ist nur … Ich will bloß sichergehen, dass ich dich an diesem einen Abend neulich nicht verschreckt habe … mit der Sache mit dem Schlüssel …«
Er verstummt und ist eindeutig nervös. Das ist untypisch für ihn. Oliver Beaufort ist einer der eloquentesten Männer, denen ich je begegnet bin. In den zehn Monaten, die ich ihn nun schon kenne, ist er nicht ein einziges Mal um Worte verlegen gewesen – nicht an dem warmen Herbstnachmittag, an dem wir uns im einem Konferenzraum bei VALENT das erste Mal begegnet sind, nicht an dem trüben Novemberabend, an dem er mich nach einer späten Marketingbesprechung zum Abendessen einlud, und auch nicht am Silvesterabend, als er mir gestand, dass er sich in mich verliebt habe, während am sternenübersäten Himmel Feuerwerkskörper explodierten, mit den schneebedeckten Schweizer Alpen als malerischem Hintergrund für diesen besonderen Moment.
Zu hören, wie er um die richtigen Worte ringt, ruft in mir unangenehme Schuldgefühle hervor, die mir schwer im Magen liegen. Stille dröhnt aus der Leitung. Sie wird nur von den Hintergrundgeräuschen an seinem Ende unterbrochen – lachende Touristen im Park, eine Straßenbahn, die kreischend zum Stehen kommt, das schrille Tröten einer Taxihupe. Ich rufe mich selbst zur Räson, dass ich etwas sagen sollte, irgendetwas, um ihn zu beruhigen.
Natürlich bist du ein Teil meiner Zukunft.
Natürlich bin ich in dich verliebt.
Natürlich werde ich bald zurück sein.
Doch aus irgendeinem Grund, den ich mir nicht erklären kann, weigert sich mein sturer Mund, die Worte auszusprechen.
»Josephine«, murmelt er in den Hörer. Sein leichter Südstaatenakzent, ein Überbleibsel seiner Kindheit in North Carolina, zupft an jedem Vokal. »Für eine Weile vor deinen Pflichten davonzulaufen ist in Ordnung. Ich verstehe das. Solange du nicht vor mir davonläufst.«
»Ich habe dir doch gesagt, dass ich ein wenig Zeit brauche.« Ich beiße die Zähne zusammen. »Dabei geht es nicht um dich – oder um uns. Es geht allein um mich.«
»Okay, Liebes. Wie du meinst.« Wieder macht sich Stille zwischen uns breit. »Ruf mich morgen an, nachdem du dich ein wenig ausgeruht hast.«
»Das werde ich.«
»Ich liebe dich.«
Ich zwinge meine Zähne auseinander. »Ich dich auch.«
Erst nachdem ich das Gespräch beendet habe, wird mir bewusst, dass ich die Hände an den Seiten so fest zu Fäusten geballt habe, dass meine Knöchel ganz weiß geworden sind.
2. KAPITEL
Archer
Noch bevor der Morgen dämmert, fahre ich aufs Meer hinaus und habe die Ausläufer des Hafens von Gloucester bereits weit hinter mir gelassen, als die Sonne im Osten über den Horizont lugt. Die Oberfläche des Ozeans ist blutrot gefärbt, und im Westen ist der Himmel immer noch in eine dichte graue Wolkendecke gehüllt. Wir tuckern in Richtung Norden an der zerklüfteten Felsenküste von Cape Ann entlang und halten auf Rockport und Ipswich zu. Das gleichmäßige Brummen des Bootsmotors summt in meinen Ohren.
Die meisten Leute am Ufer schlafen immer noch tief und fest in ihren Betten, aber ich bin schon seit Stunden wach. Ich habe Fässer mit frischen Ködern von den Zulieferungsdocks an Bord geladen, den Dieseltank aufgefüllt und ein paar kaputte Fallen repariert. Die Ebenezer – das senfgelbe Hummerboot, das unter mir grummelt – ist älter als ich, und ihr Alter zeigt sich in jedem Glasfaserriss und jeder Planke, von der die Farbe abgeplatzt ist. Selbst nach all diesen Monaten habe ich immer noch nicht all ihre Eigenarten entdeckt.
»Gib ein bisschen Gas, Kleiner«, befiehlt eine barsche Stimme links von mir. »Ich bezahle dich nicht dafür, dass du mich mit auf eine Kaffeefahrt nimmst.«
»Mir war nicht klar, dass du mich überhaupt bezahlst, wenn man bedenkt, dass meine letzten zwei Lohnschecks auf rätselhafte Weise auf dem Postweg verloren gingen«, murmle ich vor mich hin. Ich lege die linke Hand fester um das Steuerrad und drücke mit der rechten den Gashebel in einen höheren Gang.
»Wie war das?«, knurrt Tommy.
»Nichts.«
»Hmpf.« Er macht es sich auf dem erhöhten Sitz auf der Backbordseite des Steuerhauses bequem und starrt durch die salzverkrusteten Scheiben auf den Atlantik hinaus, der sich vor uns erstreckt. »Wir haben heute eine lange Strecke vor uns. Wie müssen hundert Fallen überprüfen. Da dürfen wir keine Zeit verschwenden.«
»Ich weiß.«
»Freut mich zu hören, dass wenigstens etwas in deinen Dickschädel vordringt.«
Ich knirsche mit den Zähnen und versuche, meinen Boss nicht anzublaffen. Nicht, dass er es nicht verdient hätte. Tommy Mahoney ist ein richtiger Griesgram. Er arbeitet schon sein Leben lang als Hummerfischer und fängt die Krabbelviecher aus dem Meer bereits länger, als ich auf dieser Erde weile. Es würde mich nicht wundern, wenn in seinen Adern kein Blut, sondern salziges Ozeanwasser fließt. Er ist noch nicht ganz sechzig, aber nachdem er dieser zermürbenden Arbeit jahrzehntelang nachgegangen ist, gleicht sein Körper dem eines sehr viel älteren Mannes – sein Rücken ist gebeugt und immer ein wenig gekrümmt, seine Hände sind arthritisch, weil er ihnen im Lauf der Jahre zu viel zugemutet hat, und das wenige Haar, das unter seiner Mütze hervorlugt, ist weiß wie Salz.
Wenn man der See etwas nimmt, holt sie sich ihren Teil zurück.
Tommy behandelt mich die Hälfte der Zeit über wie einen Schwachkopf und verbringt den Rest des Tages damit, mich zu ignorieren. Ich versuche, es nicht persönlich zu nehmen. Er verhält sich gegenüber jedem, der ihm in die Quere kommt, gleich unfreundlich. Die meisten Kapitäne ziehen es vor, mit einem Achtermann zu arbeiten – einem Mann fürs Grobe, den sie herumkommandieren und an den sie für einen Hungerlohn als Entgelt die Kniffe des Hummerfanggeschäfts weitergeben können. Wenn man die Fangkörbe zu zweit einholt, geht die Arbeit leichter von der Hand. Auf diese Weise ist der Knochenjob, die Fallen zu überprüfen, etwas einfacher zu bewältigen.
Aber nicht für Tommy Mahoney.
Am Hafen erzählt man sich, dass er stets lieber allein rausgefahren ist, anstatt sich der Qual menschlicher Gesellschaft auszusetzen. Er heuerte mich letzten Herbst aus reiner Notwendigkeit an, als er sich endlich eingestehen musste, dass er nicht länger in der Lage ist, den Anforderungen des Jobs gerecht zu werden. Die meiste Zeit über arbeiten wir in mürrischem Schweigen nebeneinanderher und führen unsere jeweiligen Aufgaben aus, ohne mehr als das Notwendigste miteinander zu reden.
Geh runter vom Gas.
Boje an Backbordseite.
Diese Falle braucht einen frischen Köder.
Ich nehme einen Schluck warmen Kaffee aus einer Thermoskanne, und mein Atem kondensiert in der Luft. So früh am Tag ist es draußen auf dem Wasser noch kalt – sogar im Juni. Der Hummerfang ist nichts für Morgenmuffel. Mein Wecker klingelt um vier Uhr in der Frühe. Lange bevor die Sonne über den Horizont kriecht, bin ich bereits am Hafen. Trotz der frühen Stunde herrscht am Hafen von Gloucester stets eine emsige Betriebsamkeit, vor allem in den Sommermonaten. Als einer der geschäftigsten kommerziellen Fischereihäfen in Massachusetts ist er der Ausgangspunkt für Hunderte Hummerfischer.
Unsere Kameraden.
Unsere Konkurrenten.
Immerhin sind Hummer eine begrenzte Ware. Es gibt nur eine gewisse Anzahl an Käufern, die bereit sind, sie zum Marktpreis zu erwerben, und ebenso gibt es nur eine gewisse Anzahl an hummerlatztragenden Touristen, die bereit sind, dafür zu bezahlen. An manchen Tagen fühlt sich die Atlantikküste mehr wie der wilde Westen an – ein gesetzloses Land maritimer Banditen, die Teile des Meeres als ihre Gebiete abstecken.
Zusammen mit uns ist noch eine Handvoll vertrauter Boote auf dem Kanal in Richtung Ozean unterwegs. Sie alle biegen irgendwann zu ihren bevorzugten Fangstellen ab. Ein gewaltiges, küstennahes Fangschiff stößt eine stinkende Wolke aus Abgasen aus, während es auf den Horizont zutuckert, um in tiefere Gewässer vorzudringen. Seine Schleppnetze hängen aufgerollt an zwei Auslegern und sind bereit für den Einsatz. Hinter uns am Hafen erwacht die erste Fähre des Tages brummend zum Leben und stößt ein kehliges Brüllen aus wie ein Löwe, der aus einem tiefen Schlaf erwacht und sich schüttelt.
Wir umrunden die Küste von Straitsmouth Island, als ich eine der Bojen der Ebenezer entdecke – sie ist komplett schwarz und auf beiden Seiten mit einem senfgelben X markiert. Sie treibt vor dem Steuerbordbug und wippt im Wasser auf und ab. Jedes aktive Boot benutzt ein einzigartiges Farbmuster, um seine Bojen von denen der anderen zu unterscheiden. Ein Wappen der Arbeiterklasse sozusagen.
Ich gehe vom Gas und spüre, wie das Boot daraufhin langsamer wird. Ohne ein Wort nimmt Tommy meinen Platz hinter dem Steuer ein. Ich tue so, als würde ich die Steifheit seiner Hände nicht bemerken, während er seinen Griff anpasst. Auch sein leichtes Zucken, als er sich mit gekrümmtem Körper auf dem Kapitänsstuhl niederlässt, übersehe ich geflissentlich. Ich trinke den letzten Schluck Kaffee aus meiner Thermoskanne und schnappe mir ein paar dicke Neoprenhandschuhe aus der Ausrüstungskiste. Hummer sind angriffslustig, und man will sich nicht auf der falschen Seite ihrer kräftigen Scheren wiederfinden. Und seien wir mal ehrlich, meine Hände haben nach dem Unfall im vergangenen Sommer schon genug Schaden erlitten. Ein weiterer gebrochener Knochen ist das Letzte, was ich gebrauchen kann.
Tommy steuert uns langsam neben die schwarz-gelbe Boje. Ich lehne mich über die Reling und benutze einen langen Landungshaken, um die unter Wasser liegende Leine zu packen und an Bord zu ziehen. Meine Hände bewegen sich wie ferngesteuert. Ich führe die durchnässte Leine in den automatischen Flaschenzug ein und lege den Schalter um, um sie einzuholen. Der Motor ächzt und müht sich ab, die aneinandergebundenen Fallen vom Meeresgrund nach oben zu holen. Es dauert nicht lange – die meisten unserer Fallen liegen in felsigen Untiefen, etwa sechs bis neun Meter unter der Wasseroberfläche, wo es jede Menge Hummer gibt.
Als der gelbe Käfig die Wasseroberfläche durchbricht, schalte ich den Flaschenzug aus und beuge mich vor, um ihn an Bord zu ziehen. Im Inneren meines Handschuhs zuckt meine rechte Hand ein wenig aufgrund der Anstrengung. Ich überspiele den vertrauten Schmerz mit einem Ächzen. Meerwasser ergießt sich auf meine Gummistiefel und spritzt auf den Latz meiner wasserdichten Hose. Über mir kreisen Möwen in der Luft und stoßen kehlige Schreie aus. Sie haben ihre aufmerksamen, kugelförmigen Augen auf uns gerichtet und warten auf den richtigen Augenblick, um sich nach unten zu stürzen und sich weggeworfene Köderreste zu schnappen.
»Wie sieht’s aus?«, ruft Tommy. Er schaltet das Boot in den Leerlauf und verlässt das Steuerhaus, um sich mir achtern anzuschließen. »Irgendwas dabei?«
»Eine Handvoll.«
Ich öffne die Klappe an der Oberseite der Falle und lehne mich vor, um den Inhalt zu begutachten. Mehrere opportunistische Krabben klammern sich an den Seiten fest. Ich werfe sie zurück in die Wellen. Acht Hummer kriechen auf dem Boden der Falle umher und klappern mit ihren gezackten Scheren in der Luft herum. Ein leerer Köderbeutel hängt schlaff am hinteren Ende der Falle. Mit routinierter Leichtigkeit überprüfe ich bei jedem Hummer Größe und Geschlecht, um sicherzugehen, dass der Fang legal ist. Bei denjenigen, die wir behalten, binden wir die Scheren zusammen und werfen sie dann in ein Belebungsbecken. Zu kleine Exemplare oder solche, die gerade ihren Panzer abgeworfen haben, entlassen wir zurück in die Freiheit, damit sie weiterleben können.
Der letzte Hummer in der Falle ist ein Weibchen – Tausende winzige schwarze Eier bedecken ihre Unterseite.
»Ein tragendes Weibchen«, brummt Tommy mürrisch und lehnt sich über meine Schulter. »Wirf sie zurück.«
»Das hatte ich vor«, erwidere ich verärgert. Obwohl ich nun schon seit Monaten als sein Achtermann arbeite, behandelt er mich immer noch, als hätte ich keine Ahnung – als wäre ich einfach nur irgendein dummer Junge, der leichtsinnig genug ist, ein schwangeres Weibchen einzusacken und ihn so seine Lizenz zu kosten.
Tommy setzt eine finstere Miene auf. »Spar dir deine frechen Bemerkungen, Junge.«
»Mach mir nicht ständig Vorschriften, alter Mann.«
»Das hier ist mein Boot. Wie wäre es, wenn du mal ein bisschen Respekt zeigst?«
»Wie wäre es, wenn du ihn dir verdienst?«
Er spannt den Kiefer an. »Pass bloß auf. Sonst suche ich mir einen anderen Gehilfen.«
»Viel Glück dabei, jemanden zu finden, der bereit ist, sich mit deinen Marotten herumzuschlagen.«
Wir funkeln einander böse an, während wir uns einen Schlagabtausch liefern, aber dem Wortwechsel fehlt jegliche Schärfe. Tatsächlich erfolgt er ohne innere Anteilnahme. Beinahe oberflächlich, wie das mit Auseinandersetzungen eben oft so ist. Lediglich ein weiterer Teil unserer täglichen Routine.
Bojen einholen.
Scheren zusammenbinden.
Köderbeutel wiederauffüllen.
Streiten.
Obwohl wir so oft aneinandergeraten, bezweifle ich tief im Inneren, dass auch nur einer von uns in der Lage ist, die nötige Leidenschaft für einen richtigen Streit aufzubringen. Ehrlich gesagt scheint es mir in letzter Zeit so gut wie unmöglich zu sein, Leidenschaft für irgendetwas aufzubringen. Die Teilnahmslosigkeit in meinem Inneren ist wie ein unablässiger Gezeitenstrom, der stark genug ist, alles andere auszulöschen – Freude, Wut, Angst, Hoffnung. Diese Gefühle sind wie leichte Strömungen unter der Oberfläche, aber sie sind zu schwach, um das Eiswasser in meiner Brust, das sich an der hohlen Stelle befindet, an der einst ein warmes Herz schlug, aufzurütteln.
Eine aufgeladene Sekunde des Schweigens lässt die Luft erstarren. Tommy zieht die dunkelgrauen Augen zusammen und starrt damit in meine. Dann wirft er die Hände in die Luft und wendet sich mit einem märtyrerhaften Seufzen ab.
»Füll einfach den Köderbeutel wieder auf, ja? Wir müssen noch weitere Fallen kontrollieren und haben nicht den ganzen Tag Zeit.«
Ich drehe mich herum, um zu tun, was er verlangt. Das kurze Aufflackern von Verärgerung, das seine Worte in mir hervorriefen, hat sich bereits verflüchtigt wie ein Stein, der unter die Oberfläche des Ozeans gleitet. Stattdessen empfinde ich nun gar nichts. Ich bin einfach nur taub. Aber das ist in Ordnung, soweit es mich betrifft.
Taub ist besser als gebrochen.
Ich stelle Blickkontakt mit dem Barkeeper her, indem ich über den Rand meines Glases schaue, während ich es leere. Auf diese Weise signalisiere ich ihm, dass er mir nachschenken soll. Der Whiskey brennt kaum merklich, als er meine Kehle hinunterfließt.
»Mach langsam, Junge«, sagt Harvey und beäugt mich scharf, während er mir zwei Finger breit Jack Daniel’s in mein leeres Glas gießt. »Ich will dir nicht schon wieder den Hahn abdrehen müssen.«
Ich brumme zustimmend, hebe das frisch gefüllte Glas aber bereits an meine Lippen. Harvey schüttelt einfach nur den Kopf und geht davon. Mittlerweile weiß er, dass er mit einer Predigt bei mir nur auf taube Ohren stoßen wird. Nicht, dass er falsch daran täte, über mich zu urteilen. Das hier ist mein drittes Glas. Tief im Inneren, irgendwo unter dem Rausch des Jack Daniel’s in meinen Adern, ist mir bewusst, dass mein Alkoholkonsum für einen Dienstagabend – oder jeden anderen Abend – vermutlich ein wenig übertrieben ist. Aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass es ein seltenes Ereignis ist. Ich bin einer von Harveys besten Kunden. Fast jeden Nachmittag, sobald ich mit meiner Schicht auf der Ebenezer fertig bin, finde ich den Weg in seine Bar.
Das Biddy’s ist eine dunkle, heruntergekommene Spelunke am Rande des Gewerbehafens. Es ist die Art von Ort, an den Leute gehen, um unterzutauchen. Touristen kommen nicht hierher. Verdammt, nicht einmal die Ortsansässigen verlaufen sich hierhin. Die Gäste sind ausschließlich Hummer- und Langstreckenfischer, die nach Makrelen riechen, schwielige, raue Hände haben und teils noch ihre Gummistiefel tragen, während sie billiges lokales Bier hinunterkippen und sich gegenseitig mit den gleichen Sticheleien aufziehen, die sie bereits seit Jahrzehnten austauschen.
Tommy brachte mich gleich nach meiner ersten Schicht her. Er setzte mich auf einen der abgenutzten Holzhocker, drückte mir ein gut gefülltes Glas Whiskey in die Hände und kippte dann den Inhalt seines eigenen in einem langen Zug hinunter. Daraufhin nickte er dem Barkeeper zu, knallte einen Zwanzigdollarschein auf die Theke, um den Deckel zu bezahlen, und ließ mich zurück, um allein weiterzutrinken. Ich vermute, dass das seine Version einer freundschaftlichen Annäherung war.
Nach diesem ersten Abend hat Tommy sich nie wieder hier blicken lassen, aber das hat mich nicht davon abgehalten, allein aufzukreuzen. Ich bin mir sicher, dass Harvey, der Besitzer, weiß, dass ich noch nicht volljährig bin, aber das Biddy’s scheint strikt nach der Devise »Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß« vorzugehen. In den sechs Monaten, die ich nun schon in diese Bar komme, um zu trinken, hat er mich nie nach meinem Ausweis gefragt oder gezögert, mir Hochprozentiges einzuschenken. Für ihn bin ich einfach nur eine weitere Hafenratte, die nach einem langen Tag auf See nach flüssiger Vergessenheit sucht.
»Hey«, unterbricht eine biergeschwängerte Stimme links von mir meine Gedanken. Sie gehört einem rotwangigen Mann in einem ausgeblichenen Flanellhemd. Er hat ein Bud Lite in der Hand, und ich bezweifle stark, dass es sein erstes ist. Oder sein fünftes. »Du kommst mir bekannt vor, Kleiner. Kenne ich dich von irgendwoher?«
Und schon geht es los.
»Das bezweifle ich«, erwidere ich tonlos.
»Nein, nein, ich bin mir sicher.« Der Mann betrachtet mein Gesicht genauer und versucht, einen besseren Blick auf mich zu ergattern. »Warte, jetzt weiß ich es! Du bist dieser erstklassige Pitcher, nicht wahr? Von der Exeter Academy.«
»Sie irren sich«, murmle ich mit einem Mund voller Whiskey.
Der Mann lässt sich nicht abschrecken. »Mein Sohn spielt für die Gloucester High. Er ist ziemlich mies – der Junge kann kaum einen Ball fangen –, aber ich versuche, es zu all seinen Spielen zu schaffen. Die meisten sind langweilig. Im Gegensatz zu dem Exeter-Gloucester-Spiel in der letzten Saison. Wie du da den Ball geworfen hast … So was habe ich noch nie gesehen! Ich dachte, ich würde dem nächsten Roger Clemens zuschauen.«
In mir kocht langsam etwas hoch, das heftig genug ist, um die tiefen Gewässer der Gleichgültigkeit aufzuwühlen, in denen ich das vergangene Jahr über ertrunken bin. Etwas, das dafür sorgt, dass mein Puls schneller schlägt und mir der Atem in der Kehle stockt. Es ist so lange her, dass ich überhaupt etwas empfunden habe, dass ich einen Augenblick brauche, um das Gefühl zu benennen.
Wut.
Sie ist rein und unverfälscht. Sie strömt von meiner Brust in meine Gliedmaßen. Meine Finger legen sich fester um das Glas und packen es so grob, dass ich Angst habe, es könne zerbrechen, während ich es an meine Lippen hebe und den Rest des Inhalts mit einem großen Schluck in mich hineinkippe.
»Also, was ist passiert, hm?« Der Mann sieht mich immer noch prüfend an und scheint die Wut, die plötzlich in mir Fahrt aufnimmt, nicht zu bemerken. »Spielst du jetzt Baseball am College?«
Ich huste, als der Alkohol auf meinen Magen trifft und meine Augen brennen. Ich stelle das leere Glas auf die Theke, rutsche auf meinem Hocker nach hinten und stehe taumelnd auf. Mit einem Nicken verabschiede ich mich von Harvey und werfe ein paar Scheine auf die Theke, bevor ich mich in Richtung Tür bewege.
»Hey! Wo gehst du hin, Kleiner?«
Ich ignoriere die lallenden Rufe des Mannes, während ich nach draußen in die Gasse trete. Die warme, feuchte Luft des frühen Abends umfängt mich. Ich blinzle angesichts der plötzlichen Helligkeit und gehe an den Docks entlang in Richtung Stadt. Dabei versuche ich, dem Sturm in meinem Inneren mit jedem Schritt ein wenig mehr Herr zu werden. Aber die Wut will keine Ruhe geben – nicht als ich die Stufen zu meiner heruntergekommenen Wohnung am Hafen hochsteige. Nicht als ich mich auf das Bett mit dem quietschenden Metallrahmen fallen lasse und dem Geschrei meiner Nachbarn lausche, das durch die Bodendielen zu mir heraufdringt. Nicht als ich auf den hässlichen Anblick meines rechten Handgelenks starre, wo tiefrote Narben das Fleisch verunstalten und sich über die Haut ziehen wie die Ausläufer eines Flussdeltas.
Ich kneife die Augen zu, um den Anblick auszusperren. Aber die Verletzung wirkt selbst in der Dunkelheit nach. Sie schwimmt unter meiner Haut wie Gift in meinem Blutkreislauf. In manchen Nächten erwische ich mich dabei, wie ich mir wünsche, dass das Gift stark genug wäre, um mich von meinem Elend zu erlösen, um mich von der armseligen Existenz zu befreien, durch die ich mich Tag für Tag kämpfe.
Ich hege keine Selbstmordgedanken.
Ich suche nicht absichtlich nach dem Tod.
Aber das bedeutet nicht, dass ich ihn nicht mit offenen Armen empfangen würde.
Welchen Sinn hat das Leben, wenn all deine Träume gestorben sind?
3. KAPITEL
Josephine
Das Summen des äußeren Tors lässt mich aus dem Schlaf hochschrecken.
Blinzelnd nehme ich mit einem Stöhnen zur Kenntnis, dass mir die Mittagssonne durch das Fenster meines Kinderzimmers direkt in die Augen scheint. Nachdem ich mich die ganze Nacht lang herumgewälzt habe, bin ich erst vor wenigen Sekunden eingeschlafen, nur um nun auf so schroffe Weise wieder geweckt zu werden. Das war nicht mal ansatzweise genug Schlaf, um den Jetlag loszuwerden, der mir immer noch in den Gliedern steckt und sie bleischwer macht. Meine innere Uhr ist aus dem Takt und um sechs Stunden verstellt.
Der Toralarm ertönt erneut – ein beharrliches Summen, das nach Einlass verlangt.
Wer zum Teufel steht da vor meiner Tür, frage ich mich verwundert, während ich die Decke mit einem frustrierten Ruck zurückschlage. Niemand weiß, dass ich mich überhaupt wieder auf diesem Kontinent befinde.
Ich gähne ausgiebig, rutsche aus dem Bett und mache mich auf den Weg nach unten. Die Staubschicht auf den Fußböden ist so dick, dass ich auf dem Weg in die Eingangshalle eine Spur aus Fußabdrücken hinterlasse, die aussieht, als wäre ich durch frisch gefallenen Schnee gelaufen. Ich werde etwas gegen den verschmutzten Zustand dieses Hauses unternehmen müssen, sobald ich mich gründlich mit Koffein versorgt habe.
Als ich die Vordertür erreiche, schalte ich auf die Kamera für das äußere Tor um. Eine mir unbekannte Frau mit grauem Haar, das am Hinterkopf zu einem ordentlichen Knoten zusammengebunden ist, starrt mich durch die Fischaugenlinse an. Ich weiß, dass sie mich nicht sehen kann, aber ihr scharfer Blick sorgt trotzdem dafür, dass ich mich etwas aufrechter hinstelle. Ich ziehe den Saum meines übergroßen Schlafshirts ein wenig fester über meine frei liegenden Pobacken, bevor ich die Gegensprechanlage aktiviere.
»Ähm. Ja?«
Sie räuspert sich. »Miss Valentine, nehme ich an?«
»Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?«
»Mein Name ist Agatha Weatherby Granger. Ihre Eltern haben mich als neue Haushälterin für Cormorant House eingestellt.«
Ich weiche zurück. Haushälterin?
Wohl eher Babysitterin. Ich hätte wissen müssen, dass Blair und Vincent mein Bedürfnis nach Unabhängigkeit nicht respektieren würden. Ich frage mich, wie schnell sie damit anfingen, nach potenziellem Personal Ausschau zu halten, sobald ihnen klar wurde, dass ich Genf den Rücken gekehrt hatte. Vermutlich dauerte es nur wenige Sekunden.
»Ich warte nun schon seit einer ganzen Weile hier«, informiert mich die Frau pikiert. »Ich dachte schon, dass der Türsummer defekt wäre.«
»Tut mir leid, ich habe ihn nicht gehört. Ich habe noch geschlafen.«
»Es ist schon nach Mittag.« Sie klingt regelrecht entsetzt angesichts der Vorstellung.
»Stimmt …« Ich presse die Lippen zusammen. »Ich habe einen leichten Jetlag. Ich bin erst spät gestern Nacht hier eingetroffen.«
Dazu äußert sie sich nicht, aber das ist auch nicht nötig – ihre Missbilligung ist so stark, dass sie keiner Worte bedarf.
»Hören Sie«, sage ich und versuche, nicht genervt zu klingen. »Ich weiß es zu schätzen, dass Sie den ganzen Weg hierhergefahren sind, aber da scheint ein Missverständnis vorzuliegen. Ich benötige zurzeit keine Haushälterin.«
Mrs Agatha Weatherby Grangers ausdruckslose Miene lässt nicht einmal ein Zucken erkennen. »Bei allem Respekt, Sie waren nicht diejenige, die mich eingestellt hat, Miss Valentine. Und nun würde ich es sehr zu schätzen wissen, wenn Sie so freundlich wären, mich ins Haus zu lassen, damit wir die Einzelheiten dieser neuen Regelung auf zivilisiertere Weise besprechen können.«
Ich seufze.
Zum Teufel mit meinen Eltern und ihrem unerträglichen Bedürfnis, mein Leben in jeglicher Hinsicht zu organisieren.
Da mir mittlerweile klar ist, dass das hier ein Kampf ist, den ich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gewinnen kann, drücke ich den Finger auf den entsprechenden Knopf, damit Mrs Granger mit ihrem kompakten hellbraunen Auto das äußere Tor passieren kann. Ich reibe mir die müden Augen und lehne mich mit dem Rücken an eine nahe gelegene Säule. Erst als ich den kühlen Marmor an meinen nackten Oberschenkeln spüre, wird mir bewusst, dass ich keine Hose trage – was vermutlich nicht der erste Eindruck ist, den ich auf eine kühle, sittsame Haushälterin machen will, die mit alarmierender Geschwindigkeit die Einfahrt hochgebraust kommt.
Die Tatsache, dass ich gestern Nacht nach meiner langen Reise zu faul war, mein Gepäck wegzuräumen, erweist sich nun als Glücksfall, denn es steht immer noch in der Vorhalle, wo ich es zurückgelassen hatte. Ich wühle schnell durch die oberste Reisetasche und schnappe mir die erstbesten Jeans, die ich in die Finger bekomme. Ich habe sie kaum zugeknöpft, als auch schon ein Klopfen an der Vordertür ertönt. Drei deutliche, schnell aufeinanderfolgende, energische Klopfer.
»Mrs Granger«, sage ich atemlos und zerre mit einer Hand die schwere Eichentür nach innen auf, während ich mit der anderen krisselige Haarsträhnen aus meinem Gesicht streiche. »Bitte kommen Sie herein.«
Sie tritt ein – ihre Stummelabsätze klackern auf dem Boden, und sie hält ihre Handtasche vor sich wie einen Schild. Sie schürzt missbilligend die Lippen, während sie den Blick durch den Raum schweifen lässt und bei den Haufen aus staubigen Laken verweilt, die ich gestern Nacht von den Möbeln gezogen und dann einfach auf den Boden geworfen habe. Dann reckt sie den dürren Hals, um den kristallenen Kronleuchter zu begutachten, der über ihr hängt. Seine Pracht wird von den zahllosen Staubpartikeln, die sich in den durch das Oberlicht hereinströmenden Sonnenstrahlen verfangen haben, ein wenig gedämpft.
Nach einem ausgedehnten Moment der Stille richtet sie ihre prüfenden Augen schließlich auf mich. Sie begutachtet mein zerknittertes T-Shirt, mein vom Schlaf zerzaustes Haar und meine nackten Füße mit der gleichen Unerschütterlichkeit, mit der sie das Haus inspiziert hat.
»Wie es scheint, benötigen Sie sehr wohl eine Haushälterin, Miss Valentine«, sagt Mrs Granger gedehnt, als würde sie mit einem Kind reden. »Ihre ehemalige Haushaltshilfe hat hier ein regelrechtes Chaos hinterlassen.«
»Hier hat ein Jahr lang niemand gewohnt. Es bestand keine Notwendigkeit, hierfür weiterhin Personal zu beschäftigen.«
»Mmm. Zum Glück sind die Außenanlagen in einem deutlich besseren Zustand als das Innere des Hauses. Ihre Eltern haben einen Landschaftsgärtner engagiert, der sich während Ihrer Abwesenheit um den Rasen und die Blumenbeete gekümmert hat. So wie ich es verstanden habe, werden der Pool, die Tennisplätze und die Anlegestellen für die Boote einmal pro Woche von einem ortansässigen Mann aus der Bootsgemeinschaft gewartet – zumindest bis eine dauerhaftere Regelung getroffen werden kann.« Die Art, wie sie »Bootsgemeinschaft« ausspricht, lässt es so klingen, als würde es sich um ein rückständiges Provinznest handeln, das nicht in einem Atemzug mit Cormorant House genannt werden sollte.
»Toll«, sage ich müde. Mein Kopf fängt an zu pochen. Wieder einmal haben Blair und Vincent mit den Fingern geschnippt und meine Welt in die ihrer Meinung nach angemessene Ordnung gebracht. Ich senke die Stimme zu einem leisen Brummeln. »Gott bewahre, dass ich mal irgendwas selbst mache.«
»Wie war das, Miss Valentine?«
»Nichts.« Ich kneife mir mit zwei Fingern in den Nasenrücken und versuche, meine Gedanken zu ordnen. »Haben Sie irgendwelches Gepäck?«
»Gepäck?«
»Ich bin davon ausgegangen, dass Sie auf dem Anwesen wohnen werden, im Gull Cottage …« Ich schaffe es, meine Stimme bemerkenswert ruhig zu halten, wenn man bedenkt, dass der bloße Gedanke daran, dass jemand anders als die Familie Reyes in dem kleinen Angestelltenhaus am Rande des Grundstücks wohnen könnte, dafür sorgt, dass sich meine Kehle verkrampft. »Ich werde Ihnen gern den Weg dorthin zeigen und Ihnen dabei helfen, sich häuslich einzurichten …«
»Ah.« Mrs Granger schickt sich an, ihre Handtasche auf einem nahe gelegenen Tisch abzustellen, sieht dann aber die Staubschicht, die die Oberfläche überzieht, und überlegt es sich schnell anders. »Ich weiß das Angebot zu schätzen, aber es ist nicht nötig, Miss Valentine. Ich werde während der Zeit meiner Beschäftigung in Cormorant House nicht in den Angestelltenquartieren wohnen – es sei denn, Sie haben etwas dagegen. Ich wohne nur zwanzig Minuten von hier entfernt in Beverly Farms, falls Sie außerhalb der Arbeitszeiten meine Unterstützung benötigen sollten.«
Erleichterung durchflutet mich. »Ich habe absolut nichts dagegen.«
»Ausgezeichnet. Ich werde während der Woche vom Frühstück bis zum Abendessen zu Ihrer Verfügung stehen. Falls Sie mich an den Wochenenden brauchen, müssen Sie mich lediglich drei Tage im Voraus informieren.«
»Ich bin mir sicher, dass ich Sie an den Wochenenden nicht brauchen werde. Tatsächlich werde ich auch unter der Woche nicht viel Hilfe benötigen.«
»Sie wird Ihnen dennoch zuteilwerden.« Sie zieht die Augen zusammen – ein deutlicher Kontrast zu ihrer höflichen Miene. »Wenn man Ihren Hang zum späten Aufstehen bedenkt, bin ich mir sicher, dass wir uns kaum über den Weg laufen werden.«
Ich verkneife mir eine wenig höfliche Erwiderung. Mein Lächeln fühlt sich verkrampft an, eher wie eine Grimasse denn wie ein Grinsen, aber ich erhalte es trotzdem aufrecht. Blair und Vincent haben mir gute Manieren eingebläut, seit ich alt genug war, meinen Kopf aufrecht zu halten.
Mrs Granger dreht eine langsame Runde durch die Vorhalle und verbucht im Geiste jede schmutzige Oberfläche und jede schmierige Scheibe. Als sie zu mir zurückkehrt, hält sie nur gerade so lange genug inne, um angesichts meines unordentlichen Aufzugs die Nase zu rümpfen. »Werden Sie Kaffee trinken wollen, sobald Sie sich angekleidet haben?«
»Höchstwahrscheinlich.«
»Dann werde ich eine Kanne aufsetzen. Man darf wohl vermuten, dass die Küche ebenso dringend einer gründlichen Reinigung bedarf wie die Eingangshalle …«
»Das darf man.«
»Dann werde ich keine Zeit verschwenden. Es gibt viel zu tun. Aber keine Sorge, Miss Valentine, ich werde Cormorant House in Nullkommanichts zu seiner alten Pracht zurückführen.«
Dieses Haus verfügt über keinerlei Pracht, will ich ihr entgegenhalten. Hier gibt es nur Schmerz.
Ich spare mir die Mühe. Ich lächle einfach nur weiterhin mein steifes Lächeln, während sie ihre Handtasche fester umklammert und auf ihren Stummelabsätzen kehrtmacht, um den Raum mit dem Selbstvertrauen einer Person zu verlassen, die schon tausendmal hier gewesen ist. Sie braucht – oder will – eindeutig keine Führung durch das Haus. Nachdem ihre Schritte verklungen sind, stehe ich einen Augenblick lang allein da und bin so sehr in meinen Gedanken gefangen wie die Staubpartikel, die überall um mich herum in den Sonnenstrahlen hängen.
Agatha Weatherby Granger ist keine Flora Reyes, so viel ist sicher. Fünf Minuten in ihrer Gegenwart haben mir deutlich zu verstehen gegeben, dass sie in etwa so mütterlich wie eine verwilderte Katze am Fischereihafen von Gloucester ist. Sie wird mich nach einem langen Tag nicht in die Arme schließen oder leise spanische Wiegenlieder vor sich hin summen, während sie ihrer Arbeit nachgeht, oder mir meinen Lieblingshühnereintopf kochen, wenn ich mich nicht gut fühle. Sie wird nicht einen Blick auf mich werfen und wissen, wie es mir geht oder was ich denke, ohne dass ich es ihr erklären muss. Und sie wird auch nicht wissen, wie sie ein Problem, das ich habe, in Ordnung bringen kann.
Sie wird nicht die Mutter sein, die ich nie hatte.
Das fühlt sich nach Absicht an – wie ein kalkulierter Schachzug von Blair und Vincent, mit dem sie etwas, das in ihren Augen ein Fehler war, auf übertriebene Weise korrigieren wollen. Ich kann den Verlauf ihrer Unterhaltung beinahe in meinem Kopf hören.
Josephine hing viel zu sehr an unserer ehemaligen Haushaltshilfe. Sorg dafür, dass du dieses Mal jemanden findest, der eiskalt ist, Liebling. In Cormorant House muss die Etikette gewahrt werden.
Ich blinzle Staub aus meinen Augen – sicher keine Tränen, denn ich habe keinen wirklichen Grund zum Weinen – und mache kehrt, um nach oben zu gehen und mich für den Tag anzuziehen.
Ich überlasse Mrs Granger ihren Aufgaben, ohne sie zu stören, und spaziere den Rasen hinunter in Richtung Ozean. Meine ledernen Flip-Flops klatschen bei jedem Schritt leicht gegen meine Fußsohlen. Ich gerate ins Wanken, als hinter der letzten Biegung das Bootshaus in Sichtweite kommt. Der Anblick sorgt dafür, dass ich wie angewurzelt stehen bleibe. Es ist so schön wie eh und je – ein architektonisches Meisterwerk aus Stein, das halb über das Wasser hinausragt. Das Gebäude beherbergt die Hinckley-Jacht meines Vaters. Aber ich kann die Schönheit, die ihm innewohnt, nicht mehr sehen. Ich kann nur noch die Geister meiner Vergangenheit sehen.
Zwei Zehnjährige, die nebeneinander unter den Dachsparren sitzen und die Beine baumeln lassen, während sie am Nachthimmel nach Sternbildern Ausschau halten.
Diese drei hellen sind der Oriongürtel, Jo. Siehst du sie?
Zwei Zwölfjährige, die anhand ausgefranster Bootsleinen lernen, Schifferknoten zu binden.
Tu so, als wäre dein Seil ein Kaninchen, Archer. Durch das Loch, um den Baum herum und wieder zurück ins Loch. Und dann festziehen!
Zwei Achtzehnjährige, die in der Dunkelheit an Knöpfen und Gürtelschnallen herumfummeln, während ihre Finger vor Lust zittern.
Das könnte wehtun, Jo, warnt der Junge sanft. Wenn es wehtut, sag mir einfach, dass ich aufhören soll.
Ich vertraue dir, Archer, erwidert das Mädchen flüsternd.
Gott, was für eine verliebte Idiotin ich war. Ich reichte Archer alles auf einem Silbertablett – nicht nur meinen Körper und meine Jungfräulichkeit, sondern auch mein überschäumendes, pochendes Herz. Und er nahm es alles nur zu gerne an … bloß um dann am nächsten Morgen aus meinem Leben zu verschwinden und mir nicht mehr als einen halbherzig hingekritzelten Brief zu hinterlassen, den er mir nicht einmal persönlich überreichen konnte, weil er dafür nicht Manns genug war.
Bevor ich letzten Sommer in die Schweiz aufbrach, riss ich diesen Brief in Stücke und warf ihn Fitzel für Fitzel in den Ozean. Ich schaute zu, wie die Wellen ihn komplett verschlangen und das Papier sich auflöste. Ich konnte es nicht ertragen, ihn zu behalten – ich wusste, dass ich ihn sonst nur immer und immer wieder lesen, die schrägen Buchstaben seiner Handschrift nachziehen und in all seiner emotionslosen Zurückweisung nach verborgenen Bedeutungen suchen würde.
Leider war das Zerstören der Nachricht letztendlich nicht von Erfolg gekrönt. Seine Worte sind für immer in mein Gedächtnis eingebrannt wie ein schmerzhaftes Brandmal, das ich nicht auslöschen kann. Sie werden in einer Endlosschleife meiner Erinnerung abgespielt.
Liebe Jo, schieb er mit einer steifen Förmlichkeit, die normalerweise verbindlichen Brieffreunden und ungelenken Bekanntschaften vorbehalten ist. Ich dachte, dass es leichter wäre, alles aufzuschreiben, damit es nicht zu irgendwelchen Missverständnissen kommt.
Mein Puls nimmt Tempo auf und pocht gefährlich schnell, während die Worte durch meinen Verstand rauschen.
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, wurde mir sofort klar, dass wir einen schrecklichen Fehler begangen haben.
Ich bin mir sicher, dass du das auch so siehst.
Ich schüttle heftig den Kopf in dem Versuch, ihn frei zu bekommen. In dem Versuch, die Worte aufzuhalten, aber sie bahnen sich unaufhaltsam ihren Weg in meinen Gedanken.
Ich hoffe, dass du weißt, dass mir unsere Freundschaft sehr viel bedeutet.
Zu viel, um sie wegen eines bedeutungslosen One-Night-Stands aufs Spiel zu setzen.
Ich schließe die Augen und versuche, die Tränen, die sich in ihnen sammeln, zurückzuhalten.
Ich wünsche dir einen schönen Sommer.
Ich verspüre einen Schmerz in der Brust, als hätte mir jemand einen Schlag direkt in die Rippen verpasst.
Alles Gute
Archer
Und das war alles. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Kein einziges Wort. Keinen Anruf, keine Textnachricht, keine E-Mail. Nicht mal einen verdammten Brief mit der Schneckenpost.
Sein Schweigen spricht lauter, als es Worte je könnten. Seine Abwesenheit verrät mir alles, was ich wissen muss. Er wachte an jenem Morgen nach unserer Liebesnacht nicht voller Freude auf. Jene Augenblicke, die wir vergangenen Juni in der Dunkelheit miteinander geteilt hatten, waren nicht alles überragend, überschäumend, strahlend. Für ihn war die Tatsache, dass wir miteinander geschlafen hatten, einfach nur …
Ein Fehler.
Bedauernswert.
Eine Fehlentscheidung.
Ich recke den Kopf zum klaren blauen Himmel empor, um zu verhindern, dass ich mich in ein weinerliches Wrack verwandle. Schon lange hatte ich mir vorgenommen, keine Gefühle der Trauer mehr an diesen Jungen zu verschwenden. Aber, Gott, wie kann es immer noch so wehtun? Wie kann sich der Schmerz seiner Abwesenheit so frisch anfühlen wie an jenem Morgen, an dem ich allein auf blutigen Laken aufwachte, sein Geruch noch an meiner Haut klebte und meine Lippen immer noch von den Küssen geschwollen waren, die er bei Tageslicht betrachtet bereute?
Tief im Inneren kenne ich die Antwort auf diese Fragen. Selbst nach all dieser Zeit … nach so viel Abstand … nach all der Stille … weigert sich mein dummes, störrisches Herz, den Schmerz loszulassen, den es in sich trägt. Archer ist wie eine ausgefranste Narbe, die nicht heilen will, eine Glasscherbe, die sich direkt durch den Stoff meiner Seele gebohrt hat.
Wenn er jemand anders wäre – einfach irgendjemand –, wäre ich vielleicht in der Lage zu vergessen, dass zwischen uns je etwas passiert ist. Es ist mir nicht einmal vergönnt, ihn vergessen zu können – nicht ohne Teile von mir selbst auszulöschen. Bis letzten Sommer waren unser beider Leben so eng miteinander verwoben, dass es mir schwerfällt, das Mädchen, das ich war, von dem Jungen, den ich liebte, zu trennen. Es fällt mir schwer, mich an einen einzigen wichtigen Augenblick meines Lebens zu erinnern, der nicht auch ihn miteinschloss und in dem er nicht an meiner Seite war.
Es gibt keine Josephine Valentine ohne Archer Reyes.
Ich gehe am Bootshaus – und all den Geistern, die es beherbergt – vorbei und trotte ein paar Stufen hinunter zu dem privaten Steg, der sich in eine kleine felsige Bucht hinaus erstreckt. Mein Herz wird leichter, als ich die Cupid entdecke, mein sechs Meter langes rotes Alerion-Segelboot, das am Ende des Stegs fröhlich im Wasser auf und ab wippt. Es sollte mich nicht überraschen, dass man sich während meiner Abwesenheit gut um sie gekümmert hat – das Haus mag verstaubt und verwahrlost sein, aber mein Vater würde niemals zulassen, dass die Boote ein ähnliches Schicksal erleiden. Ich bin mir sicher, dass seine Hinckley-Jacht an ihrem Platz im Bootshaus in tadellosem Zustand ist.
Wer auch immer sich um die Boote gekümmert hat, scheint – ungeachtet Mrs Grangers abfälligen Kommentars – seine Sache gut zu machen. Die Leinen der Cupid sind zu ordentlichen Spulen aufgewickelt. Ihre Segel sind perfekt aufgetakelt. Ihre hölzernen Sitze sind frisch lackiert. Ihr mohnblumenroter Anstrich wurde so gründlich poliert, dass er schimmert und glänzt.
Ich schüttele meine Flip-Flops ab und klettere an Bord. Das Boot schwankt leicht unter meinem Gewicht, während ich mich auf die enge Steuerkabine zubewege. Ich bin es nicht mehr gewohnt, auf dem Wasser zu sein, und meine Beine sind ein wenig aus der Übung – mein letzter Segelausflug ist eine ganze Weile her. Aber das Muskelgedächtnis zahlloser vergangener Tage auf dem Wasser kehrt schließlich zurück, als ich die Fallen hochziehe und die Leinen von ihren Klampen losbinde. Ich umfasse die Ruderpinne und hisse die Segel, bis sie den Wind einfangen. Die Cupid nimmt Fahrt auf, während ich ihren Bug auf die kleine Bucht und das offene Wasser richte.
Es ist ein perfekter Sommertag – eine stetige Brise bei minimalem Wellengang. Ich spüre, wie sich meine Laune sofort hebt, als ich Kurs nach Süden in Richtung Salem Sound nehme. Die Sonne schimmert auf der Wasseroberfläche und kreiert funkelnde goldene Kräuselwellen, die so schön sind, dass es mir den Atem verschlägt. Mit dem Wind im Gesicht und der wärmenden Sonne auf meiner Haut fühle ich mich so lebendig wie schon lange nicht mehr. Lebendig und frei. Die Schweiz konnte mein Herz trotz all ihrer alpinen Schönheit nie so ganz erobern, wie es dem wilden Atlantik mit solcher Leichtigkeit gelingt.
Beim Gedanken an Genf verrutscht mein Lächeln ein wenig. Ich frage mich, wie meine Eltern mit meiner plötzlichen Abreise zurechtkommen. Wahrscheinlich besser als Ollie, der mir allein heute Morgen zwei Sprachnachrichten hinterlassen und sechs Textnachrichten geschickt hat, um mich zu fragen, wie ich klarkomme. Ich habe es noch nicht gewagt, meine E-Mails zu überprüfen, aber ich bezweifle nicht, dass ich mindestens eine Nachricht von [email protected] in meinem Postfach haben werde, wenn ich es tue.
Das ist lieb von ihm, rede ich mir ein und umfasse die Ruderpinne fester. Und nicht im Geringsten erdrückend.
Die meisten Mädchen wären überglücklich, einen attraktiven Freund zu haben, der so sehr um ihr Wohlergehen besorgt ist. Die meisten Mädchen würden sich nicht bedrängt fühlen, vor allem dann nicht, wenn man bedenkt, dass zurzeit mehrere Tausend Kilometer Entfernung zwischen uns liegen. Die meisten Mädchen würden nicht in die Zukunft schauen und zwei Wege sehen, die in unterschiedliche Richtungen weisen – links die Unabhängigkeit an der Brown University, rechts eine frühe Verlobung und familiäre Akzeptanz bei VALENT. Bei beiden Wegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich sie mit dem nötigen Selbstvertrauen beschreiten könnte.
Ich halte mein Gesicht in den Wind und gestatte der frischen, salzigen Luft, diese Gedanken aus meinem Kopf zu fegen. Ich konzentriere mich auf die Gegenwart, während ich über den Teil des Meeres kreuze, der an Beverly grenzt. Schon bald kommen die Misery Islands in Sicht. Trotz ihres recht unattraktiven Namens – sie verdanken ihn einem glücklosen Schiffsbauer, der dort in den 1620ern während eines Sturms für drei elende Tage strandete – sind Great Misery und Little Misery beide auf ihre wilde, unbewohnte Art recht schön. Mehrere andere Segelboote sind in der Bucht an der nordöstlichen Seite der größeren Insel vor Anker gegangen, und die Leute haben sich mit ihren Schlauchbooten an Land begeben. Das sind höchstwahrscheinlich Tagesausflügler, die ganz versessen darauf sind, die Wanderwege zu erkunden und die schöne Aussicht auf die zerklüftete Küste von Massachusetts zu genießen.
Die Inseln zu umrunden kostet mich einen Großteil meines Nachmittags. Bevor ich weiß, wie mir geschieht, senkt sich die Sonne bereits in Richtung des westlichen Horizonts. So verlockend es auch ist, noch ein paar Stunden länger hier draußen zu bleiben, ist die Cupid nicht für nächtliche Segeltörns oder starken Seegang ausgestattet.
Es wird weitere Segeltage geben, tröste ich mich und steuere das Boot widerwillig nach Norden. So viele, wie ich bekommen kann, bevor ich diesen Ort wieder verlasse.
Während ich an der Spitze von Little Misery vorbeinavigiere, verweilt mein Blick für einen Moment auf einem senfgelben Hummerboot, das um die felsigen Untiefen herumtuckert. Die Männer an Bord sind zu weit entfernt, als dass man sie deutlich erkennen könnte, sie sind nur zwei ferne Gestalten in orangefarbenen Gummioveralls. Der eine wirkt älter und kauert in leicht gebeugter Haltung am Steuer, der andere ist stark und breitschultrig und überprüft an achtern die Fallen.
Ich hatte seit Ewigkeiten keinen Hummer mehr.
Bei dem Gedanken knurrt mein Magen laut und vernehmlich. Nach einem ganzen Tag in der Sonne und der salzigen Luft bin ich vollkommen ausgehungert. Ich ziehe die Ruderpinne in Richtung meiner Brust und ducke mich tief, während das Boot eine scharfe Halse vollführt und der metallene Baum über meinen Kopf hinweg von backbord nach steuerbord schwingt. Der Bug ist nach Norden ausgerichtet, und ich wende den Blick in Richtung Heimat und lasse mich von den milden Nachmittagswinden an der Küste entlangschieben. Meine Gedanken kreisen um köstliche Visionen von dampfendem Hummer mit frischem Krautsalat und einer großen Portion geschmolzener Butter.
Ich bin so abgelenkt, dass ich den Moment verpasse, in dem sich der junge Hummerfischer von seiner Aufgabe abwendet und einen Blick auf die mohnblumenrote Schiffshülle der Cupid erhascht, die durch die sanften Wellen gleitet. Ich sehe nicht, wie sein Gesicht blass wird, als er das Boot erkennt, und auch nicht, wie seine Finger mit dem Köderbeutel herumfummeln, den er in Händen hält. Ich höre nicht, wie er geräuschvoll den Atem ausstößt, und begreife nicht, dass ich gerade eine Kette von Ereignissen in Gang gesetzt habe, die unser beider Schicksal für immer verändern wird.
Ich bin mit meinen Gedanken viel zu sehr mit dem Abendessen beschäftigt.
4. KAPITEL
Archer
Sie ist zurück.
Die Worte laufen in Endlosschleife durch meine Gedanken und vertreiben alles andere aus meinem Kopf. Seit ich Jo letzte Woche beim Segeln sah, habe ich an nichts anderes mehr denken können. Ich kann nicht essen, ich kann kaum schlafen. Selbst Whiskey kann die Gedanken an sie nicht übertünchen. Das genügt, um einen Mann in den Wahnsinn zu treiben.
In der Sekunde, in der ich das kleine rote Segelboot sah, wusste ich es. Noch bevor ich den Namen Cupid in goldenen Lettern auf dem Rumpf sah. Noch bevor ich den Blick nach oben richtete, um das blonde Haar zu betrachten, das im Wind flatterte, die schmalen Schultern unter dem dünnen Baumwollpullover, die zarten Hände, die die Ruderpinne so selbstbewusst umfasst hielten. Noch bevor ich spürte, wie mein Magen wie ein Klumpen Blei aufs Deck krachte.
Sie ist endlich zurück.
Für einen aberwitzigen Augenblick wollte ich zu ihr gelangen. Ich wollte Tommy das Steuer aus den arthritischen Händen reißen und über den Ozean hinter ihr herjagen, bevor sie aus meinem Sichtfeld verschwinden würde. Doch die kalte Realität traf mich schon bald wie ein Schlag.
Wenn ich zu ihr gelangen würde, was zum Teufel sollte ich dann sagen?