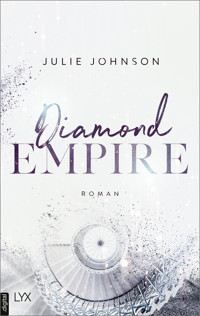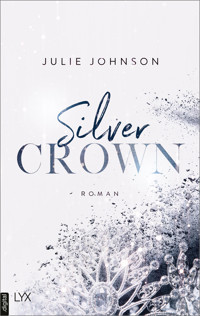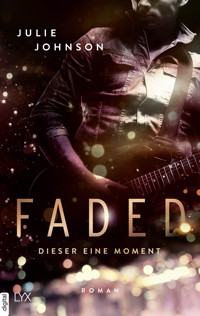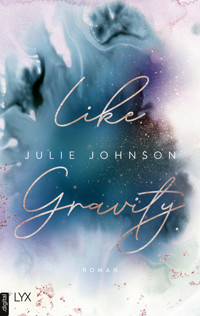
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Manchmal ist die Anziehungskraft zu stark, um gegen sie anzukämpfen
Brooklyn Turner hat jahrelang schützende Mauern um ihr Herz errichtet - Mauern, die mittlerweile unüberwindbar scheinen. Denn seit Bee als Sechsjährige den Mord an ihrer Mutter mitansehen musste, fehlt ihr der Mut, sich emotional auf einen anderen Menschen einzulassen. Doch als auf einmal Finn Chambers in ihr Leben tritt, verschreckt ihn Bees abweisende Art nicht. Ganz im Gegenteil: Er scheint absolut fasziniert von ihr und je mehr Zeit Bee in Finns Nähe verbringt, desto stärker spürt auch sie die Anziehungskraft zwischen ihnen. Aber kann Bee es wagen, Finn zu vertrauen und ihr Herz für ihn zu öffnen?
"Julie Johnsons Bücher lassen mein Herz höher schlagen, nur um es im nächsten Moment in tausend Teile zu zerbrechen. Und doch kann ich keine ihrer Geschichten jemals wieder vergessen." TESSA von @BLUETENZEILEN
Der neue Roman von Julie Johnson!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Playlist
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Epilog
Danksagungen
Die Autorin
Die Romane von Julie Johnson bei LYX
Impressum
Julie Johnson
Like Gravity
Roman
Ins Deutsche übertragen von Anika Klüver
Zu diesem Buch
Brooklyn Turner hat jahrelang schützende Mauern um ihr Herz errichtet – Mauern, die mittlerweile unüberwindbar scheinen. Denn nachdem sie als Sechsjährige den Mord an ihrer Mutter mitansehen musste, hat Bee sich nicht mehr sicher gefühlt. Daher tut sie alles, um andere Menschen auf Abstand zu halten. Doch als plötzlich Finn Chambers in ihr Leben tritt, verschreckt ihn Bees abweisende Art nicht. Ganz im Gegenteil: Er scheint absolut fasziniert von ihr und je mehr Zeit Finn in ihrer Nähe verbringt, desto stärker spürt auch Bee die Anziehungskraft zwischen ihnen. Doch immer noch fehlt ihr der Mut, sich emotional auf einen anderen Menschen einzulassen – zu groß ist die Angst, erneut einen Verlust zu erleiden. Aber als plötzlich eine dunkle Bedrohung in Bees Leben tritt, wird sie dazu gezwungen, sich mit den schmerzhaften Erinnerungen ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und während all die Angst, die verdrängten Gefühle und Ereignisse Bees Schutzmauern bröckeln lassen, muss sie sich die Frage stellen, ob sie es tatsächlich wagen kann, Finn ihr ungeschütztes Herz anzuvertrauen oder ob sie sich dadurch verwundbarer macht als je zuvor in ihrem Leben …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
Dieser Roman ist allen gewidmet, die je gegen die Last der Schwerkraft ankämpfen mussten, in der Hoffnung, eines Tages die Sterne zu erreichen.
Playlist
Musik spielt in Like Gravity immer wieder eine wichtige Rolle. Dies sind die Lieder, die Brooklyns und Finns Geschichte am stärksten inspirierten:
Crash Into Me – Dave Matthews
Head Over Feet – Alanis Morissette
Blackbird – The Beatles
The Scientist – Coldplay
The Only Exception – Paramore
In My Veins – Andrew Belle
Skinny Love – Birdy
Love, Love, Love – Of Monsters and Men
Home – Edward Sharpe & the Magnetic Zeros
I and Love and You – The Avett Brothers
Can’t Help Falling in Love – Ingrid Michaelson
Fix You – Coldplay
The One That Got Away – The Civil Wars
Slow Dancing in a Burning Room – John Mayer
Same Old, Same Old – The Civil Wars
Gravity – Sara Bareilles
Prolog
Vierzehn Jahre vorher
»Mommy, kann ich das rosa Kaugummi haben? Bitte!« Ich hielt die Rolle hoch, damit sie einen Blick auf die runde BubbleTape-Box werfen konnte, die ich in meiner kleinen Hand hielt. BubbleTape war die beste Sorte Kaugummi. Jeder Erstklässler wusste das. Mommy antwortete nicht. Sie summte, und ein kleines Lächeln umspielte ihre Lippen, während sie der Kassiererin all die Teile aus unserem Einkaufswagen reichte.
Ich richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf das Kaugummi und verschränkte meine dünnen Ärmchen vor meiner Brust, während ich die Auswahl an anderen Süßigkeiten begutachtete. Die Schlange an der Kasse war immer mein liebster Teil beim Einkaufen, weil man sich dort die ganzen bunt verpackten Süßigkeiten anschauen konnte.
»Mommy!«, sagte ich, dieses Mal lauter und fest entschlossen, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen.
»Mmmm, was Liebling?«, murmelte sie gedankenverloren.
»Kann ich bitte die rosa Kaugummirolle haben? Alle Mädchen in meiner Klasse kauen sie nach dem Mittagessen.«
»Klar, Bee. Hier, gib sie der netten Dame, damit wir sie bezahlen können, okay?«
IchstrecktedieHandüberdenKopf,umderKassiererindasKaugummizureichen.SelbstaufZehenspitzenfielesmirschwer,ihrGesichtzusehen.Sielehntesichvor,ummirdenBehälterausderHandzunehmen,undlächelteaufmichherab.AufihrenZähnenwarenrosafarbeneStreifenvonihremLippenstift,undihrGesichtwarschrumpeligwieeinalterApfel,abersiewirktenett.
»Und wie alt bist du?«, fragte sie.
»In ein paar Monaten werde ich sieben«, prahlte ich. »Ich bin in der ersten Klasse.«
»Oh! Wie schön.« Sie strahlte. »Sie können mächtig stolz sein«, fügte sie an Mommy gewandt hinzu.
»Oh ja, natürlich«, sagte Mommy lächelnd und reichte der Dame das letzte Teil aus dem Einkaufswagen.
Während Mommy bezahlte, spazierte ich nach vorne zu unserem vollen Einkaufswagen und lugte in der Hoffnung, den verräterischen fuchsiafarbenen Kaugummibehälter zu entdecken, in die durchsichtigen Einkaufstüten aus Plastik.
»Komm schon, Brooklyn«, sagte Mommy und lenkte den Wagen mit einer Hand in Richtung Parkplatz. Die andere Hand hielt sie mir hin, damit ich sie ergreifen konnte. Sie zog mich dicht an ihre Seite, während wir durch die Automatiktüren traten und zu unserem Auto gingen. Ich ließ meine Hand in ihre gleiten und drückte fest zu. Sie lächelte auf mich herunter und schwang sanft unsere verschränkten Finger vor und zurück.
Die spätsommerliche Luft war stickig und feucht, und mein rosafarbenes Hello-Kitty-T-Shirt schien mit meiner Haut zu verschmelzen, während wir über den Parkplatz gingen. Die Räder an unserem Einkaufswagen funktionierten nicht richtig – sie quietschten laut und sperrten sich, während Mommy damit zu kämpfen hatte, den Wagen gerade zu halten.
Ihre Bemühungen entlockten mir ein Kichern.
Sie hielt meine Finger fest umklammert, bis wir den SUV erreichten. Sie ließ den Einkaufswagen vor dem Kofferraum stehen und hob mich hoch, um mich gnadenlos an den Seiten zu kitzeln. Ich kreischte und wand mich in ihrem Griff und genoss jedes bisschen ihrer Zuwendung.
»Du denkst also, dass es in Ordnung ist, deine Mommy auszulachen, wenn sie mit dem Einkaufswagen kämpft, was?«, fragte sie lachend. »Jetzt ist es nicht mehr so lustig, nicht wahr, Bee?«
»Tut mir leid!«, quiekte ich atemlos und kicherte selbst dann noch, als die Kitzelfolter nachließ. Sie trug mich zur hinteren Tür und setze mich auf meinen Kindersitz.
»Uff! Du wirst langsam zu schwer für mich. Ich kann dich nicht mehr dauernd herumtragen«, beschwerte sie sich. »Schon bald wirst du den Kindersitz nicht mehr brauchen, so groß wie du geworden bist.« Sie legte mir den Sicherheitsgurt um, befestigte ihn und zog noch einmal prüfend daran, um sicherzugehen, dass er fest war. Dann gab sie mir einen flüchtigen Kuss auf die Stirn.
»Ich muss noch schnell die Einkäufe in den Kofferraum packen, aber wie wäre es, wenn wir uns dann auf dem Heimweg ein wenig Eiscreme besorgen, meine kleine Bee?«, fragte Mommy und benutzte erneut ihren Lieblingskosenamen für mich.
»Ja!«, rief ich und hatte bereits einen Schokoladeneisbecher mit einem Berg Schlagsahne und bunten Streuseln darauf vor Augen.
»Okay, ich bin gleich wieder da, Liebling.« Sie lächelte und zerzauste mir noch ein letztes Mal mein dunkles Haar, bevor sie die Tür schloss. Sie ging zurück nach hinten zum Einkaufswagen, und ich konnte sie summen hören, während sie die Einkäufe in den SUV lud. Plötzlich fiel mir mein Kaugummi ein. Ich drehte mich auf meinem Sitz herum und schaute in Richtung Kofferraum.
»Mommy, kann ich jetzt mein Kaugummi haben?«, rief ich und zerrte den engen Sicherheitsgurt von meinem Hals weg, um besser atmen zu können.
Als sie nicht antwortete, schnallte ich mich ab, drehte mich auf dem Kindersitz nach hinten und sah über den Kofferraum hinweg zu der Stelle, wo sie stand. Sie hatte mitten beim Einräumen der Einkäufe innegehalten, stand wie erstarrt da, die Hände in die Luft gehoben. Ohne ihr fröhliches Summen wirkte alles zu still, zu ruhig. Sie wirkte verängstigt – und Mommy wirkte nie verängstigt, nicht mal dann, wenn ich ihr erzählte, dass in meinem Schrank oder unter meinem Bett Monster waren.
Irgendetwas stimmte nicht.
Ich wollte gerade fragen, was los war, als ich den Mann entdeckte. Er stand ein paar Schritte von Mommy entfernt. Der Einkaufswagen voller Lebensmittel befand sich zwischen ihnen.
»Geben Sie mir die Schlüssel«, verlangte er in barschem Tonfall. Seine Stimme klang gedämpft, weil er eine schwarze Maske übergestülpt hatte, die seinen Mund bedeckte. Seine Augen waren der einzige Teil seines Gesichts, den die Maske nicht verdeckte, und sie blickten finster drein.
Er klang gemein, so wie einer der Bösewichte in den Zeichentrickfilmen, die ich samstagmorgens immer schaute. Ich mochte ihn nicht und konnte sehen, dass Mommy ihn auch nicht mochte. Er umklammerte mit einer Hand eine schwarze Reisetasche und trat von einem Fuß auf den anderen. Sein Blick wanderte immer wieder zu dem Schnapsladen hinter ihm, in dem Mommy manchmal die Flaschen mit dem Wein kaufte, den sie zum Abendessen trank. Ich durfte den nicht trinken. Sie sagte, dass das ein Getränk für Erwachsene sei.
Mommy schaute flüchtig zum Rücksitz und sah für eine kurze Sekunde in meine weit aufgerissenen Augen. Sie schüttelte kaum merklich den Kopf, und ich wusste, dass sie mir mitteilen wollte, dass ich mich ganz still und leise verhalten sollte. Ich wollte sie fragen, was hier passierte und wer dieser wütende Mann war, aber ich tat, was sie von mir verlangte.
»Sind Sie taub, verdammt noch mal? Ich sagte: Geben Sie mir die Schlüssel! Sehe ich aus, als würde ich Scherze machen?« Der Mann brüllte jetzt und trat näher. Er wirkte noch sehr viel wütender als zuvor. Sie löste ihren Blick von mir, straffte die Schultern und schaute den Mann wieder an.
»Nein«, sagte sie mit trauriger Stimme.
Warum war sie so traurig?
»Wie Sie wollen«, sagte er, hob eine Hand und richtete eine Waffe auf Mommys Gesicht. Bevor ich einen Laut von mir geben konnte, feuerte er eine einzelne Kugel in ihre Stirn und sah stumm zu, wie sie auf dem Betonboden in sich zusammensackte.
»Dämliches Miststück«, murmelte er.
Ich saß wie erstarrt da und war nicht in der Lage, den Blick abzuwenden, als sie blutend auf dem Parkplatz lag. Mit weit aufgerissenen Augen beobachtete ich, wie er ihr den Schlüsselbund aus der Hand nahm und den Kofferraum zuschlug.
Er rannte um den SUV herum, sprang auf den Fahrersitz und ließ schnell den Motor an. Ohne auch nur einen Blick auf die Blutlache hinter sich zu werfen, fuhr er vom Parkplatz. Ich drehte mich langsam auf meinem Kindersitz herum und zitterte vor Angst und Fassungslosigkeit. Ich sah zu, wie er die Waffe neben sich auf den Beifahrersitz warf und gleich darauf eine Reisetasche folgen ließ, aus der zerknüllte Geldscheine hervorquollen. Tränen ließen meine Sicht verschwimmen und liefen langsam über mein Gesicht, aber ich erinnerte mich daran, wie Mommy den Kopf geschüttelt hatte, und schaffte es irgendwie, still zu bleiben.
Für sie.
Der Mann schaute nicht ein einziges Mal nach hinten und bemerkte deswegen auch nicht das kleine Mädchen, das weinend auf dem Rücksitz saß und dessen Welt gerade in sich zusammengebrochen war.
1
Der karge Mond
Der panische Schrei, der sich meiner Kehle entrang, war der Tribut an ein lange zurückliegendes traumatisches Erlebnis, das die Zeit nicht geschmälert hatte. Die Sechsjährige in mir schrie verzweifelt auf, als ich aus dem Albtraum gerissen wurde. Der Traum war seit vierzehn Jahren mein nächtlicher Begleiter, eine ständige Erinnerung an den Tag, an dem sich alles in meinem Leben verändert hatte.
Als hätte ich das vergessen können.
Die Ereignisse würden zweifellos auf ewig in meine Erinnerung eingebrannt sein, eine unerwünschte Tätowierung, um die ich nicht gebeten hatte und die ich niemals würde löschen können, selbst wenn die Albträume ein Ende nähmen. Aber irgendwie wusste ich, dass sie niemals enden würden. Wenn überhaupt, wurden sie nur schlimmer und mit jedem Jahr, das verging, immer intensiver und häufiger.
Ich wischte mir die Schweißtropfen von der Stirn, die sich dort angesammelt hatten, band mein feuchtes Haar zu einem lockeren Pferdeschwanz zusammen und zog die zerknüllten Laken von meinen Beinen. Der sanfte Schein des Nachtlichts neben meinem Bett wehrte die Schatten ab, die andernfalls gedroht hätten, mich zu verschlingen. Ich konzentrierte mich auf das warme, sanfte Licht und versuchte, die Erinnerungen aus meinen Gedanken zu verdrängen. Obwohl ich viel Übung darin hatte, die nächtlichen Schrecken zu vertreiben, kostete es mich mehr Mühe, als ich zugeben wollte, meine Gedanken zu beruhigen und meinen Herzschlag daran zu hindern, in meiner Brust zu donnern wie ein gottverdammter Kavallerieangriff.
Ich atmete zitternd ein, schwang die Beine auf den Boden und tapste aus meinem kleinen Zimmer. Die eiskalten Bodenfliesen in der Küche fühlten sich unter meinen nackten Füßen unangenehm an, und ich holte mir schnell ein wenig Wasser aus dem Hahn, um dann auf Zehenspitzen zurück in mein warmes Bett zu kriechen.
Nachdem ich wieder unter der Decke lag, trank ich das Wasser und suchte nach dem Buch, das ich immer in Reichweite auf meinem Nachttisch liegen hatte. Jegliche Hoffnung, heute Nacht noch in den Schlaf zu finden, war vergebens. Immer wenn der Albtraum wieder einmal gnadenlos zugeschlagen hatte, konnte ich mich nie hinreichend entspannen, um wieder einzuschlafen. Manchmal hatte ich Glück und der Traum hob sein scheußliches Haupt erst kurz vor Tagesanbruch, sodass ich ein paar Stunden Schlaf am Stück fand. In anderen Nächten, wie in dieser, hatte ich nicht so viel Glück.
Ein Blick auf mein Handy verriet mir, dass es erst zwei Uhr siebenunddreißig war, was bedeutete, dass es noch fast sechs Stunden dauern würde, bis mein erster Kurs des neuen Semesters anfing. Das sind wirklich tolle Voraussetzungen, das zweite Studienjahr zu beginnen, Brooklyn, dachte ich verbittert. Übermüdet und mürrisch. Oh, und dunkle Ringe unter den Augen sind dieses Jahr total angesagt.
Normalerweise hatte ich die beinahe ständigen blutergussartigen Ringe unter meinen Augen dank eines hochwertigen Grundierungs-Make-ups ganz gut im Griff. Die meisten Leute bemerkten sie gar nicht, und diejenigen, denen sie doch auffielen, würden niemals etwas über ihren Ursprung erfahren. Andere Leute auf Abstand zu halten war nicht besonders schwer und ersparte allen langfristig eine Menge unnötigen Kummer und Herzschmerz. Ich war noch nie jemand gewesen, der sich um die Gesellschaft und den Trost anderer Menschen bemühte. Diejenigen, die sich in meinem sozialen Umfeld bewegten, waren entweder zu sehr mit sich selbst beschäftigt oder einfach nicht an meiner Vergangenheit interessiert. Jeden, der mich bedrängte, um mehr über mich zu erfahren, wurde ich los wie eine schlechte Angewohnheit.
Ich würde nicht wirklich behaupten, dass ich Freunde hatte –
Bekannte vielleicht, aber keine Freunde. Freunde wollten normalerweise persönliche Dinge erfahren. Sie stellten gerne Fragen. Und das machte Freunde zu etwas, das ich mir nicht dauerhaft leisten konnte.
Für diese Regel gab es eine Ausnahme, und das war Lexi. Andererseits hielt sich Lexi auch an keine der Regeln, die sie für ihr eigenes Leben aufstellte, also war es nicht weiter verwunderlich, dass sie auch meine brach. Sie war wie ein Wirbelwind in mein Leben gestürmt und hatte auf ihrem Weg alles weggefegt und die zerbrechliche Illusion von Normalität, die ich nach der Ermordung meiner Mutter versucht hatte zu errichten, in ein Chaos verwandelt. An meinem ersten Tag in der zweiten Klasse an einer neuen Schule hatte Lexi verkündet, dass sie meinen blauen glitzernden Rucksack schön fand und wir Freundinnen sein würden.
Und so kam es dann auch.
Lexi bekam nur selten nicht das, was sie wollte. Die Leute fühlten sich von ihr magisch angezogen, als würde sie irgendeine unsichtbare Kraft ausstrahlen, der man sich nicht entziehen konnte und die es einem unmöglich machte, ihr irgendetwas abzuschlagen. Sie war groß und hatte feuerrotes Haar und hellblaue Augen, aus denen ständig der Schalk blitzte. In vielerlei Hinsicht war sie das komplette Gegenteil von mir.
Während sie fast eins achtzig groß war, brachte ich es selbst in meinem höchsten Paar Stilettos kaum auf eins fünfundsechzig. Ihre strahlende kupferfarbene Mähne umgab ihre Schultern wie ein Heiligenschein, wohingegen meine dunkelbraunen Haare mir in lose fallenden Wellen beinahe bis zur Taille reichten. Ihre von Sommersprossen übersäte Haut schimmerte blass, ganz im Gegensatz zu meinem von Natur aus olivfarbenen Teint, der dafür sorgte, dass ich sogar im tiefsten Winter gebräunt aussah.
Doch der größte Unterschied zwischen uns war nicht auf Anhieb erkennbar. Denn unter der Oberfläche, dort, wo niemand einen Blick hinwerfen konnte, war in mir etwas zerbrochen. Oder vielleicht nicht zerbrochen, sondern es fehlte definitiv.
Verdammt, vielleicht hatte ich es überhaupt nie besessen.
Denn es war nicht zu leugnen, dass Lexi warm und strahlend und lebhaft war und in ihren Augen dieser unauslöschliche Lebensfunke tanzte. Ich hingegen war kalt, und mir fehlte dieser innere Glanz. Es war mir einfach unmöglich, meine smaragdgrünen Augen nicht leblos und misstrauisch wirken zu lassen. Lexi mit mir zu vergleichen war, als würde man die Sonne mit dem Mond vergleichen: Sie war ein warmer, vor Leben sprühender Stern, um den herum sich alle drehten, ich war ein einsamer, karger Mond, der nur durch das Licht anderer erhellt wurde und voller Krater war.
Mit einem resignierten Seufzen zog ich mich aus der Abwärtsspirale aus depressiven Gedanken zurück, in deren Sog ich geriet, wann immer ich mich mit Lexi verglich. Sie war seit meinem achten Lebensjahr meine beste Freundin – meine einzige Freundin. Wir hatten uns sogar zusammen auf dem College eingeschrieben, und nach einem elenden ersten Jahr in den Studierendenunterkünften auf dem Campus mit zufällig zugeteilten Mitbewohnerinnen standen wir jetzt kurz davor, unser zweites Jahr zu beginnen, in dem wir nun auch endlich unsere eigene kleine Studierendenwohnung hatten.
Unsere Wohnung mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern nahm den kompletten ersten Stock in einem uralten heruntergekommenen Haus im viktorianischen Stil ein, das grob unterteilt worden war, damit man es an Studierende vermieten konnte. Ja, es war eine Bruchbude, und ja, das heiße Wasser kam nur selten problemlos aus der Leitung. Aber wir hatten die Wohnung ganz für uns allein, und die Miete betrug nur vierhundertfünfzig Dollar pro Monat, womit die Unterkunft deutlich günstiger war als die schickeren Neubauten, die das studentische Wohnviertel übersäten.
Die Nachbarn unter uns blieben für sich. Wir hatten sie noch nicht kennengelernt, obwohl wir bereits vor einem Monat eingezogen waren. Praktischerweise mussten wir nicht durch ihre Wohnung gehen, um zum Treppenhaus zu gelangen, denn unser Vermieter hatte eine klapprige, steile Außentreppe errichtet, die zum Balkon im ersten Stock hinaufführte. Sie war aus Sperrholz zusammengezimmert und vermutlich nicht der sicherste Zugang, aber sie erfüllte ihren Zweck.
Staatliche Universitäten zogen normalerweise alle möglichen Typen an – Sportler, Streber, Außenseiter, Prinzessinnen. Unter den beinahe zwanzigtausend Studierenden auf dem Campus gab es sicher einige, die sich verloren fühlten und unter dem Druck des Studiums litten. Doch während sich andere möglicherweise einsam fühlten, genoss ich die Anonymität. Hier hatte ich keine Vergangenheit. Niemand kannte meine Geschichte. Falls ich den Drang verspürte, in der Menge zu verschwinden und zu einer gesichtslosen Person ohne jegliche Verbindungen zu werden, würde niemand sich bemüßigt fühlen, den Blick auf mich zu lenken, um es zu bemerken. Es war das genaue Gegenteil meiner Erfahrungen auf der Highschool, und es war alles, was ich mir bei meiner Einschreibung erhofft hatte.
Ich kroch zum Fußende des Betts hinunter und schob das Fenster auf, um die feuchte Luft Virginias hereinzulassen. Die späte Augustnacht war dunkel und still. Die Bars hatten schon vor Stunden geschlossen, und niemand lungerte auf der Straße herum. Die meisten würden morgen früh aufstehen, um voller Eifer das neue Semester zu beginnen. Nach etwa einer Woche regelmäßiger Teilnahme an allen Kursen und ausführlicher Notizen würde das, was ich als »Guter-Student-Syndrom« bezeichnete, bei den meisten Kommilitonen schnell abflauen. Das Nachlassen des Eifers, der zu Beginn des Semesters herrschte, markierte normalerweise den Start in die Partysaison und damit auch das Ende der ruhigen Nächte in meiner mit Bars gespickten Straße.
Also nutzte ich die ungestörte Nacht und kletterte langsam aus meinem Bett und auf das Schieferdach hinaus, das sich direkt unter meinem offenen Fenster erstreckte. Das Dach war so gut wie flach und so breit, dass ich mit meinen voll ausgestreckten, zugegebenermaßen kurzen Beinen dort liegen konnte. Eigentlich diente es als Schutz für die umlaufende Veranda unter uns und schirmte sie von den unerbittlichen Eskapaden ab, die das Wetter in Virginia zu bieten hatte. Aber ich stellte mir gerne vor, dass das Dach einzig und allein für mich errichtet worden war. Es war mein besonderer Platz, mein privates Refugium – der einzige Ort, an dem ich den Rest der Welt aussperren und mich sicher fühlen konnte.
Sicher.
Ich denke, dass dieser Zustand nicht so unerreichbar erscheinen sollte. Für normale Menschen ist es das wohl auch nicht. Aber ich hatte mich bereits vor langer Zeit damit abgefunden, dass ich weder normal war, noch es jemals sein würde. Nach dem Zwischenfall vor vierzehn Jahren war ich in die Obhut des Staates gekommen, bis mein leiblicher Vater informiert werden konnte. Meine Mutter hatte nie etwas mit ihm zu tun haben wollen, und da er sich längst auf und davon gemacht hatte, als sie feststellte, dass sie mit mir schwanger war, hatte sie nie versucht, ihn aufzuspüren. Ich verbrachte die ersten sechs Jahre meines Lebens in dem Glauben, dass es immer nur uns beide geben würde – und dass wir keinen Mann bräuchten, um eine Familie zu sein. Und in den Jahren danach war ich zu der Ansicht gelangt, dass ich gar keine Familie bräuchte.
Da sie meinen Erzeuger nie über seine väterlichen Pflichten informiert hatte, gab es nach dem Tod meiner Mutter Unklarheit darüber, was mit mir geschehen sollte. Das Jugendamt brauchte beinahe sechs Monate, um den Mann aufzutreiben, dessen Name auf meiner Geburtsurkunde stand. Die Verzögerung, die offenbar einer langwierigen Geschäftsreise nach Peking geschuldet war, sorgte dafür, dass ich monatelang keinen Vormund hatte. Und da meine Mutter keine lebenden Verwandten hatte, kam ich in ein Kinderheim, bis sich mein Vater endlich die Mühe machte, mich abzuholen.
Auf die meisten Erinnerungen aus dieser Zeit hatte ich keinen Zugriff. Ich war mir nicht sicher, ob ich sie mit Gewalt verdrängte oder unfreiwillig unterdrückte, aber was auch immer der Fall war, diese Zeit meines Lebens blieb für mich ein verschwommener Fleck.
Manche Bilder waren klarer als andere. Ich konnte beinahe immer noch die mitfühlenden Stimmen der Sozialarbeitenden und der Ärztin hören, die mir erklärten, dass das Leben, wie ich es gekannt hatte, vorbei sei. Die abgrundtiefe Verzweiflung, die ich angesichts des Todes meiner Mutter empfunden hatte, war nie wirklich von mir gewichen.
Ich weiß, dass ich nach dem Vorfall monatelang mit niemandem sprechen wollte. Die Pflegemutter, die sich um mich kümmern sollte, sorgte dafür, dass ich mich jeden Tag anzog und etwas aß. Eine Psychologin kam mehrmals die Woche, um meine Fortschritte in ihrem kleinen, vom Staat zur Verfügung gestellten Notizbuch festzuhalten. Sie versicherte mir, dass alles gut würde. Aber was hätte sie sonst auch sagen sollen?
Nichts war gut. Ich war ein sechsjähriges Mündel des Staates, das den gewalttätigen Mord an der einzigen Quelle von Liebe, die es je gekannt hatte, mit ansehen musste. Nichts würde je wieder gut sein, auch wenn mir die Seelenklempnerin das immer wieder versicherte.
Im Laufe der Jahre waren unzählige Therapeuten, Psychologen und Psychiater an mir vorbeigezogen, die alle gleichermaßen darauf erpicht waren, einen Blick in meine verkorkste, jugendliche Seele zu werfen. Diese Termine liefen immer nach dem gleichen Schema ab – ich wurde aufgefordert, über mein »Kindheitstrauma« zu reden, während ich auf einem leicht unbequemen Ledersessel saß und in grüblerischem Schweigen auf die Uhr starrte. Nach den ersten paar Sitzungen voller unnachgiebiger Verschlossenheit wurde mein jeweiliger Seelenklempner unweigerlich frustriert und warf mir vor, dass ich meine Gefühle unterdrücke. Jeder stellte die Prognose auf, dass meine Seele dauerhaften Schaden davontragen würde, wenn ich nicht bereit wäre, irgendeinen bescheuerten inneren Kampf auszufechten.
Was ich während all dieser Wochen des Schweigens nicht gesagt hatte, war, dass keine noch so ausführliche Seelenerforschung meine Vergangenheit in Ordnung bringen könnte. Es gab kein magisches Pflaster, das ich auf mein Herz kleben könnte, und auch keinen speziellen Kleber, den ich benutzen könnte, um mich wieder zu einem Ganzen zusammenzufügen. Ich war in Stücke zersplittert wie eine zerbrechliche Vase, die auf Beton gefallen war. Ein paar der Scherben konnte man notdürftig wieder zusammenkleben, aber viele meiner lebenswichtigen Teile hatten sich einfach in Staub verwandelt. Sie waren pulverisiert und vom erstbesten Windstoß davongetragen worden.
Ich lehnte mich nach hinten, schloss die Augen und atmete tief durch die Nase ein. Die sommerliche Nachtluft roch nach frisch gemähtem Gras und einem schwachen Hauch von nahendem Herbst. Die Brise, die die Blätter des Ahornbaums ganz in der Nähe unseres Hauses rascheln ließ, war ein klein wenig kühl und jagte mir eine Gänsehaut über die Arme. Ich rieb sie geistesabwesend und schaute von den elegant geschwungenen Ästen des Ahorns auf die ruhige Straße hinunter.
Mist! Was zum Teufel ist das? Korrektur – wer zum Teufel ist das?
Sofort begann mein Puls in meinen Adern zu pochen, während meine Augen bestätigten, dass dort tatsächlich jemand auf der schwach beleuchteten Straße stand.
Und mich beobachtete.
Meine Muskeln spannten sich an, und ich erstarrte wie ein Reh im Scheinwerferlicht – eine naive Beute, die in der Höhle des Raubtiers gefangen war.
Es war definitiv ein Mann. Obwohl ich nur einen Umriss erkennen konnte, da die nächste funktionierende Straßenlaterne einen halben Block entfernt war, sah ich, dass die Schultern zu breit und der Körperbau zu groß für eine Frau waren. Nein, die Person war eindeutig männlich.
Oder handelt es sich womöglich um eine dieser Schwimmerinnen aus dem chinesischen Olympiateam, die verbotene Steroide nehmen?, dachte ich und musste angesichts des Gedankens beinahe laut lachen. Ja, Brooklyn, das ist total wahrscheinlich.
Der kurze Moment der Leichtigkeit war schlagartig vorüber, und ein irrationales Gefühl der Angst überkam mich. Ich verharrte in meiner Position, denn ich war mir nicht sicher, ob ich ins Haus zurückkehren sollte. Konnte er mich sehen? Beobachtete er mich? Zweifellos war es so dunkel, dass ein Fremder eine relativ kleine Frau, die mitten in der Nacht auf einem Dach hockt, nicht bemerken würde.
Ich konnte die winzige rot glühende Spitze seiner Zigarette aufleuchten sehen, als er sie an seinen Mund führte, um einen Zug zu nehmen. Der Rest der Straße blieb leer, und doch lehnte der Mann weiterhin an seinem Motorrad, dem Aussehen nach eine Harley, und schien auf jemanden oder etwas zu warten.
Eindeutig wartete er nicht auf mich, und er beobachtete mich auch nicht, redete ich mir ein. Ich hatte ihn noch nie zuvor gesehen. Obwohl ich sein Gesicht in der Dunkelheit nicht erkennen konnte, wusste ich allein aufgrund seines Körperbaus, seiner Wahl des Fortbewegungsmittels und des Rauchs, den er in seine Lunge saugte, dass wir uns nicht wirklich in denselben gesellschaftlichen Kreisen bewegten.
Trotzdem würde ich nicht mitten in der Nacht allein in dem knappen Tanktop und den Baumwollshorts, in denen ich geschlafen hatte, hier draußen sitzen, während ein fremder Mann vor meinem Haus herumlungerte. Es war an der Zeit, ins Haus zurückzukehren, vorzugsweise ohne übermäßige Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen.
Ich beschwor die Sydney Bristow in mir herauf und schob die Hände zurück, bis meine Fingerspitzen die Kante der Fensterbank ertasteten. Nur sehr langsam bewegte ich meinen Körper nach hinten und behielt den Blick dabei fest auf den im Schatten verborgenen Mann gerichtet. Als er keinerlei Reaktion auf meinen heimlichen Rückzug zeigte, spürte ich, wie das Gefühl der bleiernen Panik in meiner Brust nachließ. Er hatte mich nicht bemerkt. Er schaute nicht mal in meine Richtung.
Bond, Brooklyn Bond.
Mit gesteigertem Selbstvertrauen drehte ich mich herum und ließ die Beine durch die Fensteröffnung gleiten. Meine Knie sanken auf die flauschige Daunendecke. Ich warf noch einmal einen Blick auf den Mann unten auf der Straße, während ich mich daranmachte, auch den Rest von mir nach drinnen zu hieven. Dabei stützte ich mich mit den Händen an der Fensterbank ab.
Ich hatte das Gefühl, dass sich unsere Blicke in der Dunkelheit begegneten. Nicht dass ich seine Augen tatsächlich sehen konnte, aber irgendwie wusste ich, dass er damit direkt in meine starrte.
So viel zu der Theorie, dass er mich nicht sehen kann.
Ich sah zu, wie er ein letztes Mal an seiner Zigarette zog, eine Hand an seine Stirn hob und einen spöttischen Gruß zu mir nach oben sandte, so als wolle er mein Verlassen des Dachs quittieren. Ich folgte der Bewegung seiner Hand mit den Augen. Das Glühen der Zigarette sorgte dafür, dass ich sie problemlos erkennen konnte. Hastig verzog ich mich nach drinnen und verriegelte das Fenster hinter mir.
Was für ein unheimlicher Typ.
In der Sicherheit meines Schlafzimmers verflog meine Angst relativ schnell. Wer auch immer er war, er fand eindeutig Gefallen an der Tatsache, dass es ihm gelungen war, in mir ein solches Unbehagen hervorzurufen, indem er einfach nur dort draußen herumlungerte. Vermutlich war das nur irgendein dämlicher Typ von einer dieser Studentenverbindungen, der darauf wartete, dass sein Gegenstück aus der Studentinnenverbindung nach draußen gestolpert kam, damit sie sich für ein nächtliches Techtelmechtel treffen konnten. Das hatte nichts mit mir zu tun.
Zumindest redete ich mir das ein, als ich eine Minute später einen Blick aus dem Fenster warf und sah, dass das Motorrad spurlos verschwunden war.
Ein paar Stunden später saß ich auf einem der Barhocker an unserer Kücheninsel und schlürfte gierig meinen Kaffee. Ah, Koffein. Köstlicher Nektar der Götter. Das schwache Licht der Morgensonne fiel durch das Oberlicht herein und erhellte unsere Schränke und nicht zusammenpassenden Möbel, von denen die Farbe abblätterte. Geistesabwesend strich ich mit den Fingern über die abgenutzte Arbeitsfläche und zog eine Ansammlung aus Kratzern nach, die die Mieter der letzten zehn Jahre hinterlassen hatten.
Lexi kam in die Küche geschlurft. Ihr rotes Haar war vom Schlaf noch ganz zerzaust, und ihre Füße steckten in einem Paar scheußlicher grüner Hausschuhe in Froschform.
»Kaffee«, murmelte sie.
Lexi war nicht unbedingt jemand, den man als Morgenmenschen bezeichnen würde.
»Ist bereits fertig aufgebrüht«, berichtete ich und verbarg mein Lächeln hinter der Kaffeetasse, während ich ihre struppige Bettfrisur und ihren zerknautschten Schlafanzug musterte.
»Du bist ein Engel«, sagte sie, ließ sich auf den Barhocker neben mir sinken, schenkte sich eine Tasse dampfenden Kaffee ein und sog den Duft tief in sich hinein.
»Ich dachte, dass wir beschlossen hätten, diese Hausschuhe nach der siebten Klasse zusammen mit deiner Beanie-Babies-Sammlung und deinen N’Sync-Postern zu verbrennen«, bemerkte ich sarkastisch. Lexi warf mir einfach nur einen finsteren Blick zu und war nicht bereit, sich zu einer Antwort herabzulassen.
»Wie kannst du es wagen, bereits angezogen und perfekt zurechtgemacht zu sein? Ich muss noch duschen, bevor um acht der Unterricht losgeht. Wie spät ist es überhaupt?«, fragte sie.
»Was deine erste Frage betrifft: Ich war die ganze Nacht wach und hatte jede Menge Zeit, mich anzuziehen. Und was die zweite Frage anbelangt …« Ich warf einen Blick auf die digitale Uhr an der Mikrowelle. »Es ist sechs Uhr siebenundfünfzig.«
Lexi verzog mitfühlend das Gesicht angesichts der Vorstellung, dass ich mir eine schlaflose Nacht um die Ohren geschlagen hatte. Andererseits könnte diese Frau fünfzehn Stunden am Tag schlafen, und es wäre vermutlich immer noch nicht genug für sie. Ihr Bett war wahrscheinlich für sie der liebste Ort auf der Welt.
»Warte! Mist! Es ist schon sieben?«, rief Lexi aus. Sie sprang von ihrem Barhocker auf und kippte dabei beinahe ihren Kaffee um. »Ich werde niemals rechtzeitig fertig sein! Perfektion erzielt man nicht im Handumdrehen, das braucht Zeit, Brooklyn. Ich schätze, dass ich zu spät zu meinem ersten Kurs kommen werde. Mist!«, fluchte sie erneut und rannte aus der Küche.
»Der Dozent wird vermutlich ohnehin nur den Lehrplan vorstellen! Da wird heute noch nichts Wichtiges passieren!«, rief ich ihr in den Flur hinterher.
Nicht dass das eine Rolle gespielt hätte, denn egal ob sie fünf oder vierzig Minuten hatte, Lexi konnte immer einen wie aus dem Ei gepellten Look zusammenstellen, den die meisten von uns nur mit der Hilfe eines ausgebildeten Stylisten hinbekämen. Irgendwie gelang es ihr sogar, ihre Bettfrisur attraktiv aussehen zu lassen. Verdammt, wenn Lexi mit diesen verdammten Froschhausschuhen an den Füßen zum Unterricht erscheinen würde, würde die Hälfte der weiblichen Studierenden innerhalb einer Woche ebenfalls welche tragen.
Die Tatsache, dass ich dank meiner schlaflosen Nächte Stunden hatte, um mich fertig zu machen, obwohl ich für meine Haare und mein Make-up nur selten länger als zehn Minuten brauchte, kam mir ironisch vor. Was die Auswahl der Klamotten anging, war ich noch nie jemand gewesen, der seine Outfits und Accessoires bis ins kleinste Detail abstimmte. Normalerweise zog ich einfach meine Standardkombination aus Jeans, Tanktop und Flip-Flops an. Danach musste ich nur noch meine dunklen Augenringe verdecken, einen Hauch Wimperntusche und Lipgloss auftragen und meine dunklen Haare in Wellen über meine Schultern fallen lassen und schon war ich fertig.
Ich hatte keine Ahnung, was in aller Welt bei Lexi so lange dauern konnte. Im Laufe der Jahre war sie wegen meines mangelnden Interesses an Klamotten, Schminke und Einkaufstouren immer wieder frustriert gewesen. Da ich es als beste Freundin als meine Pflicht betrachtete, hatte ich jahrelang als Publikum für ihre Garderobe fungiert, während sie unermüdlich die Vor- und Nachteile bestimmter Kleider oder Stöckelschuhe gegeneinander abgewogen hatte. Wenn sie jedoch Klamotten für mich aussuchen wollte, war bei mir Schluss. Mode war ihr Spezialgebiet, also versuchte sie ständig, mich von meinem langweiligen »Mädchen von nebenan«-Look wegzubringen, aber mir war einfach schleierhaft, was für einen Sinn das haben sollte. Meine Klamotten waren vollkommen in Ordnung, selbst wenn sie nicht mit Designeretiketten versehen waren oder über avantgardistisches Flair verfügten.
Ich spielte mit dem Gedanken, mir eine weitere Tasse Kaffee einzuschenken, entschied mich aber dagegen. Zwei Tassen waren mein Limit – alles, was darüber hinausging, hätte lediglich zur Folge, dass ich für den Rest des Tages zittrig und nervös sein würde. Ich kehrte in mein Schlafzimmer zurück und vergewisserte mich noch einmal, dass ich ein paar leere Kladden und eine Kopie meines Kursplans in meinem ordentlich gepackten Rucksack hatte.
Drei Kurse standen heute auf dem Plan: Strafrecht, Soziologie und Rhetorik. Welche Freude. Das Vorbereitungsprogramm der Universität für die Rechtswissenschaftliche Fakultät beinhaltete eine breite Auswahl an Kursen, von denen die meisten ausgesprochen langweilig und voller streitlustiger Arschkriecher waren, die sich als angehende Juristinnen und Juristen aufspielten.
Ich kann es kaum erwarten. Ich verdrehte die Augen. Zweites Studienjahr, ich komme.
Auf dem Weg von unserer Wohnung zum Campus deckte mich Lexi am laufenden Band mit Kommentaren zu den modischen Ausrutschern der Vorbeigehenden ein. Ich hörte die meiste Zeit einfach nur zu und versuchte, keine Miene zu verziehen.
»Was trägt diese Frau da? Das ist ein Faltenrock!«, flüsterte Lexi voller Empörung, wobei sie nicht gerade subtil auf die Frau deutete, die ein paar Schritte vor uns ging. »Das sieht aus, als wäre Rory direkt vom Set von Gilmore Girls gekommen!« Sie schüttelte fassungslos den Kopf.
»Du hast dir wieder die Wiederholungen auf ABC Family angesehen, was?«, warf ich ihr vor.
»Ach, Brooke. Soll das ein Scherz sein? Ich besitze die komplette Sammelbox.«
»Deine Probleme möchte ich haben.«
»Ich weiß, aber genau deswegen liiiebst du mich!«, trällerte sie und schlang einen Arm um meine Schultern, um mich schneller über den Bürgersteig zu schleifen.
»Ähm, Lex, deine Beine sind mindestens fünfzehn Zentimeter länger als meine«, protestierte ich, während ich mich abmühte, mit ihrem Tempo Schritt zu halten.
»Ich weiß, aber ich glaube, dass ich da vorne Finn sehe«, sagte sie und starrte über Rorys Schulter, um einen Blick auf den Kerl zu erhaschen, der ihre Aufmerksamkeit erregt hatte.
Offensichtlich genügte ihr das, was sie sah, noch nicht, denn sie zerrte mich an der Gilmore mit dem Faltenrock vorbei und schleuderte mich beinahe mit dem Gesicht voran gegen ein Schild, weil sie sich selbst dann noch weigerte, langsamer zu gehen, als ich protestierend quiekte und versuchte, mich aus ihrem Griff zu befreien. Sie schenkte meinen Bemühungen keinerlei Beachtung, und nachdem ich einsehen musste, dass jeglicher Fluchtversuch zum Scheitern verurteilt sein würde, gab ich einfach auf und ließ mich von ihr mitschleifen. Mit einem gepeinigten Seufzer ergab ich mich meinem Schicksal.
»Und wer, wenn ich fragen darf, ist Finn?«
Das erregte ihre Aufmerksamkeit. Sie riss den Kopf so ruckartig herum, dass ich sofort an die Kopfdrehszene aus Der Exorzist denken musste.
»Was meinst du damit? Wie kannst du nicht wissen, wer er ist? Hörst du mir überhaupt je zu, wenn ich rede? Warte, nein, sag nichts.« Sie sah wütend auf mich herunter und legte dabei immer noch ein halsbrecherisches Tempo vor. »Er ist nur der attraktivste Vertreter des männlichen Geschlechts auf diesem Campus! Der Traum der schlaflosen Nächte einer jeden Studentussi!«
»Studentussi?«
»Die Kontamination aus Studentin und Tussi. Ganz schön genial, oder?« Lexi lächelte für eine Sekunde, setzte dann aber sofort wieder ihr strengstes Stirnrunzeln auf, um mich zu maßregeln. »Herrgott, Brookie. Ich weiß, dass du dich nicht für Klatsch interessierst, aber du musst doch wenigstens die Männer auf dem Campus kennen, die es wert sind, dass man ihretwegen weiche Knie bekommt! Denn die sind nun mal rar gesät.«
»Tut mir leid. Bitte, fahr damit fort, einen Lobgesang auf diesen attraktivsten Vertreter des männlichen Geschlechts zu singen«, bat ich mit unverhohlenem Sarkasmus.
»Tja, er ist umwerfend. Und natürlich absolut unerreichbar. Ich meine, versteh mich nicht falsch, er hat ständig Affären. Aber er bleibt nie länger mit einer Frau zusammen. Soweit ich gehört habe, lässt er sich nur auf One-Night-Stands ein«, schwärmte sie. »Er ist schon im letzten Studienjahr und wechselte letztes Jahr hierher.«
Lexi behielt weiterhin den Bürgersteig vor uns im Blick, um das schwer fassbare Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Offenbar waren wir jetzt zu Stalkerinnen geworden. Kein Wunder, dass dieser Typ nie lange mit einer Frau zusammenblieb. Wenn Lexis Verhalten symptomatisch war, hatten die Frauen an dieser Uni wirklich keinen Sinn für Grenzen.
»Das ist er definitiv, direkt da vorne«, quietschte sie. Ihre Stimme war mindestens drei Oktaven höher als normalerweise.
Ich konnte nicht über die Köpfe der drei Frauen hinwegschauen, die direkt vor uns gingen, daher wurde mir der Blick auf Lexis Objekt der Begierde verwehrt.
»Was wirst du tun, wenn du ihn tatsächlich einholst, du Genie?«, keuchte ich ein wenig außer Atem.
Statt zu antworten, zerrte mich Lexi zur Seite und schleuste mich erfolgreich an einer Gruppe Frauen vorbei, die uns entgegenkamen. Dabei geriet ich jedoch auf Kollisionskurs mit einem Hydranten, den keiner von uns gesehen hatte. Ich zuckte zurück, stemmte die Fersen in den Boden und versuchte verzweifelt, mein Tempo zu drosseln, doch Lexis Schwung machte es mir unmöglich, den drohenden Zusammenstoß zu verhindern.
Ich krachte mit voller Wucht gegen den Hydranten. Der Aufprall trieb mir die Luft aus der Lunge, und ich wurde nach hinten geschleudert. Ich hatte gerade noch Zeit genug, um die Hände vor mein Gesicht zu heben und die Augen zuzukneifen, bevor der Bürgersteig auf mich zuraste, um mich in Empfang zu nehmen.
2
Karmapunkte
Etwas Nasses tropfte in meine Augen und an der Seite meines Gesichts hinunter. Es war dunkel. Meine Augen fühlten sich schwer an, so als wären sie zugeklebt. Ich versuchte, tief einzuatmen, und zuckte zusammen, als Luft in meine schmerzende Lunge strömte.
»Atme erst mal nicht so tief ein. Das war ein ziemlich heftiger Aufprall«, sagte eine tiefe Stimme leise in der Nähe meines Ohrs.
Das ist definitiv nicht Lexi.
Vorsichtig nahm ich einen kleinen Atemzug durch die Nase und hielt die Luft in meiner Lunge an. Erleichtert stellte ich fest, dass dieses Mal kein schmerzhaftes Brennen auftrat. Ich atmete aus und kam langsam wieder zu mir. Der kalten harten Fläche unter mir nach zu urteilen, lag ich immer noch auf dem Bürgersteig, aber mein Kopf ruhte auf etwas Weichem.
»Kannst du die Augen öffnen?«, fragte die heisere Stimme.
Ich zwang langsam meine Lider auseinander, woraufhin ich einen schmalen Streifen Himmel sah. Ich griff nach oben, um das feuchte Haar aus meinem Gesicht zu streichen, und stellte überrascht fest, dass Blut an meinen Fingern klebte.
»Du hast eine Platzwunde an der Schläfe. Sie sieht nicht allzu tief aus, aber selbst oberflächliche Kopfverletzungen können stark bluten. Das wird schon wieder«, versicherte mir die Stimme. »Das wird allerdings eine beachtliche Beule werden.«
Ich versuchte, mich aufzusetzen, und bereute die Entscheidung sofort, als sich die Welt um mich herum zu drehen begann. Hände legten sich um meine Oberarme und zwangen mich behutsam zurück nach unten, bis ich an der breiten Brust meines Retters ruhte.
»Versuch nicht, dich aufzurichten. Du könntest eine Gehirnerschütterung haben. Du musst still liegen bleiben, bis der Krankenwagen hier ist.«
»Krankenwagen?«, krächzte ich. Meine Stimme war vor Panik ganz kratzig.
»Deine Freundin, die Rothaarige, ruft gerade einen.«
»Sag ihr, dass sie das lassen soll«, flehte ich. »Bitte, ich muss nur ins Studentische Gesundheitszentrum. Ich brauche keinen Krankenwagen.« Ich drehte den Kopf nach oben und schaute endlich in die dunklen Augen meines Retters. »Bitte«, wiederholte ich und sah mit meinen grünen Augen in die blausten Augen, die ich je gesehen hatte. Sie waren von einem unglaublich dunklen Kobaltblau, das sich kaum von den schwarzen Pupillen abhob. Ausgesprochen ungewöhnliche Augen.
»Ich halte nicht viel von … Krankenhäusern«, verkündete ich und wandte mich von seinem durchdringenden Blick ab.
»Meinetwegen. Wie du meinst«, stimmte er ein wenig unsicher zu und runzelte die Stirn, während er mit einem Arm meine Schultern umfasste. Er schlüpfte aus seiner schwarzen Lederjacke und knüllte sie zu einem behelfsmäßigen Kissen zusammen. Dann hob er meinen Kopf behutsam von seiner Brust und legte ihn auf die Jacke.
Ich folgte ihm mit den Augen, als er aufstand und zu Lexi hinüberging, um ihr das Handy abzunehmen. Er sprach schnell hinein und schaute dabei mehrere Male in meine Richtung, bevor er schließlich auflegte. In meinem halb benommenen Zustand nahm ich nur seinen großen Körper und sein dunkles Haar wahr. Dann ließ ich zu, dass sich meine Augen wieder schlossen.
»Hey, lebst du da unten noch?«, fragte er mit seiner tiefen Stimme und lachte.
Ich stöhnte eine unverbindliche Antwort.
»Ich werde dich jetzt hochheben und zum Gesundheitszentrum tragen. Das ist nur ein Stück weiter die Straße runter. Okay?«, fragte er, wartete aber nicht erst eine Antwort ab, sondern legte einfach sanft die Arme unter meine Knie und hob mich hoch wie ein Kind. »Wenigstens hast du dir einen praktischen Ort ausgesucht, um bewusstlos zu werden.« Ich spürte sein Gelächter, das durch seinen Körper grollte, während er mich trug. Mein Gewicht schien ihm nicht das Geringste auszumachen.
Ich schmiegte mich an seine Brust und öffnete die Augen, um nach Lexi Ausschau zu halten. Sie ging direkt neben uns her und hatte die Augen auf mein Gesicht gerichtet. Sobald sie sah, dass meine Augen geöffnet waren, kamen die Entschuldigungen nur so aus ihr herausgesprudelt. Die Sturzflut aus Worten löste in meinem ohnehin schon schmerzenden Kopf ein heftiges Pochen aus.
»Oh mein Gott, Brooklyn, geht es dir gut? Es tut mir so, so, so, so leid. Ich stehe tief in deiner Schuld. Bitte stirb nicht. Ich werde dir einen Monat lang so viele Getränke bei Starbucks kaufen, wie du willst – so viele Venti Chai Lattes, wie du trinken kannst. Ich schwöre dir, dass ich das nicht wollte! Dieser Hydrant kam wie aus dem Nichts. Und du bist einfach durch die Luft geflogen! Oh mein Gott, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so viel Angst. Und du hast eine Platzwunde am Kopf! Keine Sorge, sie ist direkt am Haaransatz. Die kannst du problemlos mit deinem Pony verdecken … Bist du sicher, dass es dir gut geht?«
Das alles sagte sie, ohne auch nur einmal Luft zu holen. Das wäre vielleicht beeindruckend gewesen, wenn ich nicht aus einer Kopfwunde geblutet und mit ziemlicher Sicherheit eine Gehirnerschütterung gehabt hätte.
»Ich bin mir sicher, dass es ihr besser gehen wird, sobald du aufhörst, sie vollzujammern«, schimpfte die Stimme des Typen über mir.
»Oh … Klar«, flüsterte Lexi und wirkte plötzlich zerknirscht. »Es tut mir so leid, Brookie. Ich werde jetzt still sein. Versprochen.«
»Es geht mir gut, Lex«, murmelte ich, wandte mein Gesicht vom grellen Sonnenlicht ab und schmiegte es an die Schulter meines Retters. Als ich einatmete, nahm ich einen Hauch seines Parfüms oder Rasierwassers wahr. Es war ein berauschender Duft, der an Herbstlaub und knackige Äpfel erinnerte. Er roch nach Herbst, meiner liebsten Jahreszeit. Der Gedanke entlockte mir ein Kichern. Sofort wurde mir klar, dass ich vermutlich fantasierte und aller Wahrscheinlichkeit nach eine Gehirnerschütterung erlitten hatte.
Plötzlich gingen wir Stufen hoch und durch eine doppelflügelige Glastür. Die Mitarbeiterin am Empfang warf einen Blick auf uns und rief dann sofort eine Schwester über die Gegensprechanlage. Gleichzeitig schickte sie uns in einen Bereich des Raums, der mit einem Vorhang abgetrennt war. Der Kerl legte mich sanft auf eine Liege, strich mir das Haar aus den Augen und schaute grinsend auf mich herunter. In seiner Wange erschien ein Grübchen.
»Tja, damit habe ich mein jährliches Soll an guten Taten definitiv erfüllt«, scherzte er. »Zumindest denke ich, dass es zählt, wenn man jemandem hilft, der so unaufmerksam ist, über einen Hydranten zu stolpern.« Um seine Augen herum bildeten sich Lachfältchen, während er Witze auf meine Kosten machte.
Wie unhöflich.
»Pass lieber auf«, warnte ich und wedelte mit einem Finger vor ihm herum. »Wenn man Witze auf Kosten von Leidtragenden macht, werden einem definitiv wieder ein paar Karmapunkte abgezogen.«
»Das Risiko gehe ich ein. Du hast übrigens mein Lieblingsoberteil vollgeblutet«, sagte er und deutete zerknirscht auf den roten Fleck, der das Bandlogo auf seinem dunkelgrauen T-Shirt verunstaltete. »Ich meine, ich wusste, dass Reden und Laufen gleichzeitig ein Risiko für euch Studentinnenverbindungsmädels darstellt, aber in Zukunft solltest du wenigstens versuchen, Hydranten aus dem Weg zu gehen – du weißt schon, diese leuchtend roten Dinger. Denkst du, dass du das hinkriegst, Süße?«, neckte er.
Im Handumdrehen verpuffte jegliche Dankbarkeit, die ich diesem Fremden gegenüber empfunden hatte, und wurde durch Wut und mehr als nur ein wenig Verlegenheit ersetzt. Er hatte nicht nur meine Intelligenz beleidigt, sondern mich auch noch mit einer, wie Lexi es nennen würde, Studentussi verglichen!
»Oh, das tut mir jetzt echt leid. Wenn ich das nächste Mal aus einer Kopfwunde blute, werde ich daran denken, jemand anders mit meinem Blut zu besudeln!«, blaffte ich mit vor Empörung zitternder Stimme.
»Da wäre ich dir sehr verbunden«, gab er schlagfertig zurück. »Tja, das hier hat großen Spaß gemacht, aber ich muss jetzt wirklich los. Pass auf die Hydranten auf, Kleine. Beim nächsten Mal bin ich vielleicht nicht in der Nähe, um dich zu retten.«
Kleine? Für wen zum Teufel hielt sich dieser Kerl?
»Ich erinnere mich nicht daran, um deine Hilfe gebeten zu haben!« Ich bedachte ihn mit einem eisigen Blick. »Normalerweise würde ich mich bedanken, aber mittlerweile denke ich, dass ich es vorgezogen hätte, auf der Straße zu verbluten!«
»Gern geschehen«, sagte er und grinste mich an, während er sich rückwärts in Richtung Tür bewegte. Dabei blitzte erneut dieses aufreizend niedliche Grübchen auf. Als er sich herumdrehte, entdeckte er Lexi, die mit einer Schwester im Schlepptau schnurstracks auf meine Liege zusteuerte.
»Viel Spaß mit dem Rotfuchs. Ich glaube nicht, dass ich je im Leben jemanden so schnell habe reden hören«, bemerkte er und zog dabei eine Augenbraue hoch. »Oh, und bevor ich es vergesse – du schuldest mir ein dunkelgraues T-Shirt von Apiphobic Treason. In Größe L.«
Er zwinkerte mir noch ein letztes Mal zu, drehte sich auf dem Absatz um und ging auf die gläsernen Eingangstüren zu. Bevor ich auch nur über eine Erwiderung nachdenken konnte, war er schon nach draußen verschwunden. Ich lag wie betäubt da und verarbeitete nur allmählich die Tatsache, dass er einfach abgezogen war und mich mit nichts als seiner T-Shirt-Bestellung zurückgelassen hatte.
So ein Idiot!
Der Schock, den ich bei dem Zusammenprall erlitten hatte, legte sich allmählich. Vor lauter Wut über diesen unverschämten Kerl hatte ich nicht einmal bemerkt, dass auch der Kopfschmerz allmählich nachgelassen hatte. Die Schwester stellte schnell fest, dass ich tatsächlich keine Gehirnerschütterung hatte – sondern nur eine äußerst unattraktive Beule an der Schläfe und eine kleine Platzwunde am Haaransatz. Mit einer Geschicklichkeit, die nur auf eine jahrelange Erfahrung im Zusammenflicken unbesonnener Collegestudierender zurückzuführen war, reinigte die Schwester mein Gesicht von Blut, klebte ein kleines Pflaster auf die Wunde und schickte mich mit einer mit Eis gefüllten Kompresse, die die Schwellung lindern sollte, prompt in den Unterricht.
Meine Begegnung mit dem Tod würde nicht mal dafür sorgen, dass ich zu spät zum Strafrechtkurs kam.
Verdammt.
In einem seltenen Augenblick des Schweigens traten Lexi und ich nach draußen und kehrten mit langsamen Schritten zur Unfallstelle zurück. Mein Rucksack, den wir in der Hektik zurückgelassen hatten, lag vergessen auf dem Bürgersteig. Als ich mich hinabbeugte, um ihn aufzuheben, bemerkte ich etwas Dunkles, das unter meinen Rucksack gestopft worden war. Ich schlang mir den Gurt meiner Buchtasche über die Schulter und griff nach dem zusammengeknüllten Etwas, das sich als die schwarze Lederjacke entpuppte.
Mist.
»Finns Jacke«, klärte Lexi mich auf. »Er hat sie als Kissen unter deinen Kopf gelegt, nachdem du gefallen warst.«
»Nachdem ich gefallen war? Das ist also die Version, an die du dich halten willst?«
»Tja, ich schätze, dass es irgendwie ein ganz klein wenig meine Schuld gewesen sein könnte«, gab sie kleinlaut zu, und ihre Wangen liefen rot an.
»Ein ganz klein wenig? Lexi, willst du mich auf den Arm nehmen? Du hast mich voll und ganz … Warte. Hast du gerade gesagt, dass der Kerl, der mich getragen hat, Finn war? Also … der Finn, dem du hinterhergejagt bist, und mich dabei beinahe umgebracht hättest?«, hakte ich einigermaßen geschockt nach.
»Ja«, murmelte Lexi verzückt. »Ist er nicht ein wahrer Gentleman?«
»Mir würden da noch ein paar andere treffende Bezeichnungen für ihn einfallen. Zum Beispiel Arschloch, Vollidi…«
»Brooklyn!«
»Was? Er hat sich mir gegenüber absolut unverschämt verhalten!«
»Er hat dir das Leben gerettet!« Sie starrte mich empört an und stemmte die Hände fest in die Hüften, um ihrer Aussage Nachdruck zu verleihen.
»Lex, ich habe mir den Kopf gestoßen. Das war nicht wirklich lebensgefährlich«, hielt ich dagegen.
»Du bist unmöglich«, schnaubte sie. »Nur du könntest buchstäblich von dem attraktivsten Mann auf dem Campus umgehauen werden und komplett unbeeindruckt bleiben. Weißt du, manchmal glaube ich, dass du ein Alien bist.«
Sie legte den Kopf schief und starrte mit zusammengezogenen Augen auf mich herunter, als würde sie darüber nachdenken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sein könnte, dass ich tatsächlich eine Außerirdische war. Ich zuckte lediglich mit den Schultern und machte mich auf den Weg zum Campus, da ich wusste, dass sie mir schon folgen würde.
Lexi hatte meinen Umgang mit Männern noch nie verstanden. Es war also höchst unwahrscheinlich, dass sie jetzt damit anfangen würde. Ich sah einfach keinen Sinn darin, mich verletzlich zu machen, nur um jemandem nahe zu sein. Oder noch schlimmer, irgendeinem Kerl gegenüber Gefühle zu zeigen, nur damit er sie unweigerlich mit Füßen treten würde. Das war es einfach nicht wert. Die meisten von Lexis Beziehungen gingen immer so weit, dass ihr jeweiliger Freund des Monats im Grunde genommen kurz davor war, sein Revier zu markieren. Und aus irgendeinem Grund fand sie das auch noch romantisch.
Andererseits glaubte Lexi fest an Dinge wie Seelenverwandtschaft, wahre Liebe und Happy Ends.
Ich war da anders.
Menschen waren nicht dafür gemacht, monogame Wesen zu sein. Die meisten Leute würden das vermutlich anders sehen, aber die meisten Leute würden auch über die ständig steigende Scheidungsrate und zunehmende Fälle von Untreue hinwegsehen. Warum man sich dafür entscheiden sollte, sich Hals über Kopf in eine Beziehung zu stürzen, die mit fünfzigprozentiger Wahrscheinlichkeit zum Scheitern verurteilt war, war mir unbegreiflich.
Ich für meinen Teil zog es vor, mich an meine eigene Definition zu halten:
Ehe (Substantiv): die Hälfte seiner Besitztümer darauf verwetten, dass man einen anderen Menschen für immer lieben wird.
Auf der Highschool hatten mich mehrere Jungs um eine Verabredung gebeten, und ich war mit ihnen ausgegangen – hauptsächlich um Lexi zu beschwichtigen. Doch nach einer Weile hatten sie alle erkannt, dass ich ihnen niemals das geben konnte, wonach sie suchten. Ich würde niemals zu ihnen gehören – niemals ihre Lederjacken tragen oder im Flur mit ihnen Händchen halten oder ihre Spinde an dem Tag schmücken, an dem ein wichtiges Spiel anstand –, weil ich niemals genug in Versuchung geraten würde, mich emotional auf sie einzulassen.
Ich verstand die Vorteile von reiner körperlicher Anziehung absolut. Es schien, als ob mir das Schicksal oder die Evolution einen grausamen Streich gespielt hätte – ich war vermutlich eine der wenigen Frauen auf der Welt, die nicht wollte, dass ein Mann sich an sie band, und doch schien jeder Kerl, mit dem ich ausging, das Gegenteil von mir zu erwarten.
Ich hatte schon oft versucht, es Lexi zu erklären, aber sie verstand es nicht. Für sie war jede Aussicht auf Liebe, auch wenn sie noch so gering war, es wert, verfolgt zu werden. Zu meinem Pech spiegelte ihre Einstellung die der Mehrheit der Highschoolschüler wider, und ich hatte mir bei den Jungs schnell die charmante Bezeichnung »Ice-Queen« eingehandelt. Zumindest bei denen, die erfolglos versucht hatten, mit mir auszugehen. Die Mädchen in meiner Klasse tendierten dazu, mir sogar noch weniger schmeichelhafte Spitznamen zu verpassen, aber mir war vollkommen egal, dass sie mich für ein Flittchen hielten.
Lexi murmelte immer noch fassungslos vor sich hin, wie undankbar ich mich Finn gegenüber erwiesen hatte, als sich unsere Wege vor dem Gebäude für Kriminalwissenschaften trennten. Als einzige Frau auf dem Campus, die sich in seinen Händen nicht in Wachs verwandelte, war ich offenbar dazu bestimmt, allein und umgeben von Tausenden von Katzen zu sterben. Zumindest war ich mir ziemlich sicher, dass Lexi genau das murmelte, als sie in Richtung des Kunstateliers davonschlenderte.
Als ich den Seminarraum betrat, wurde mir bewusst, dass ich Finns Lederjacke immer noch fest umklammert in der rechten Hand hielt. Da ich nicht wusste, was ich sonst damit machen sollte, stopfte ich sie in meinen Rucksack. Sie passte nur knapp hinein und war so klobig, dass ich den Reißverschluss kaum noch zubekam. Ich betrachtete das Ganze skeptisch und seufzte. Ich wusste, dass ich mit der Lederjacke im Rucksack wie der typische Erstsemesterstudierende aussehen würde, den man daran erkennen konnte, dass er am Anfang des Semesters überfüllte Taschen voller Bücher mit sich herumschleppte.
Nachdem ich die Vor- und Nachteile dieses unangenehmen Szenarios abgewogen hatte, holte ich hastig die Notizbücher aus meinem Rucksack, sodass sich nur noch die Jacke darin befand. Viel besser, stellte ich fest und atmete erleichtert aus. Dann suchte ich mir einen Platz in der Mitte des großen Hörsaals.
Der Rest des Tages verlief ohne Zwischenfälle. Abgesehen von ein paar neugierigen Blicken, die das Pflaster an meiner Schläfe auf sich zog, gelang es mir, größtenteils unbemerkt zu bleiben. Meine Kurse bestanden wie erwartet aus langweiligen Vorstellungen des Lehrplans und einer Diskussion über die Erwartungen, die wir an den Kurs stellten.
Für Strafrecht und Soziologie hatten sich jeweils mehrere Hundert Studierende eingeschrieben, und die Benotung erfolgte nach dem Prinzip der Normalverteilung, also würde ich darin problemlos gut abschneiden. Mit dem Rhetorikseminar sah das etwas anders aus – da es in diesem Kurs nur zwanzig Studierende gab, machte die Dozentin deutlich, dass es keine Option war, sich ganz hinten in der letzten Reihe zu verstecken. Sie hatte uns sogar gezwungen, alberne Papierschildchen zu falten und unsere Namen daraufzuschreiben, um sie dann gut sichtbar auf unseren Tischen zu platzieren, so als wären wir in der zweiten Klasse. Natürlich fiel ihr meins sofort auf und sie beschloss, mich vor dem kompletten Kurs zu quälen. Es war eben einfach einer dieser Tage.
»Ihr Name ist Brooklyn?«, fragte sie mit künstlichem Interesse in der Stimme. »Wie ungewöhnlich! Hat das irgendeine Bewandtnis?«
Diese Frage war mir nicht neu – in der Grundschule hatten mich die Lehrenden das ebenfalls jedes Jahr gefragt. Irgendwie war ich einfach davon ausgegangen, dass ich das hinter mir gelassen hätte, als ich aufs College ging.
»Oh ja, ich denke schon«, erwiderte ich und zuckte mit den Schultern. Die neugierigen Blicke meiner Kommilitonen lösten bei mir Befangenheit aus. »Meine Mutter nannte mich Brooklyn, weil sie und mein Vater sich dort kennengelernt haben.« Klartext: dort hat er sie geschwängert.
Ich nannte ihr absichtlich so wenige Einzelheiten wie möglich, da ich wusste, dass es am besten war, weitere Fragen über meine Eltern frühzeitig zu unterbinden. Enttäuscht runzelte sie ganz leicht die Stirn und wandte sich dann an jemand anders, um ihn auszufragen. Ich entspannte mich, schaute auf die Uhr über der Tür und fuhr damit fort, die Minuten bis zum Ende des Unterrichts zu zählen.
Als ich an diesem Abend wieder in meiner Wohnung war, säuselte John Mayer aus meinen Lautsprechern, während ich tanzend und singend durch die Küche hüpfte und die Zutaten fürs Abendessen zusammentrug. Die Wohnungstür öffnete sich, und Lexi kam hereinspaziert, in jeder Hand einen Becher von Starbucks.
»Ein Venti Chai Latte mit fettarmer Milch, wie versprochen«, sagte Lexi lächelnd, während sie mir den dampfenden Becher reichte. »Verzeihst du mir?«
»Ich verzeihe dir«, erwiderte ich und nippte an meinem Chai.
»Was gibt es zum Abendessen?«
»Wie wäre es mit einer vegetarischen Lasagne?«
»Klingt perfekt. Was macht dein Kopf?«, wollte sie wissen und verzog dabei leicht das Gesicht.
»Dem geht es gut. Ich habe eine Schmerztablette genommen, und das Pochen ist kaum noch zu spüren.«
»Toll! Dann gehen wir heute Abend aus«, verkündete Lexi.
»Heute ist Montag. Ich habe morgen zwei Veranstaltungen, Lex. Ich werde nicht ausgehen.«
»Biiiitte«, bettelte sie und schaute mich mit großen Hundeaugen an. »Im Styx spielt heute Abend eine Band, und die soll unglaublich toll sein! Wir müssen da hingehen.«
»Du gehst doch noch nicht mal gerne auf Konzerte, und das Styx magst du erst recht nicht«, bemerkte ich und erinnerte mich an ihre Reaktion auf den dunklen, überfüllten Club, als wir das erste und einzige Mal dort gewesen waren. »Also, wer ist er?«, fragte ich beiläufig zwischen zwei Schlucken Chai.
»Wer ist wer?«, fragte sie und tat ganz unschuldig.
»Wer ist der Kerl, der dich dazu überredet hat, heute Abend auszugehen?«, führte ich meine Frage aus und machte damit deutlich, dass ich ihr auf die Schliche gekommen war. Ich wusste, dass ich einen Treffer gelandet hatte, als ihre Wangen so rot anliefen, dass sie farblich exakt zu ihren Haaren passten.
»Okay, schön! Du hast mich entlarvt«, gab sie zu, schaute mir aber nicht in die Augen. »Da ist dieser Kerl in meinem Kurs über amerikanische Literatur. Er hat irgendwie angedeutet, dass er heute Abend dort sein wird.«
»Aber warum muss ich dich begleiten?«, beschwerte ich mich.
»Brooklyn Grace Turner! Du weißt sehr gut, dass ich da nicht allein hingehen kann! Du bist meine tatkräftige Unterstützung. Außerdem willst du doch nicht, dass ich hinterher allein nach Hause gehen muss, oder?«, appellierte sie an mein Gewissen und klimperte mit ihren Wimpern. »Ich werde dir einen riesigen Gefallen schulden!«
»Du hättest mich heute Morgen fast umgebracht! Du schuldest mir bereits einen Gefallen, Lex«, rief ich ihr ins Gedächtnis.
»Ja, aber das hast du mir längst verziehen! Biiiitte komm mit, Brooke.« In ihren babyblauen Augen schimmerten falsche Tränen.
»Selbst wenn ich einwilligen würde, dich zu begleiten – was ich definitiv nicht getan habe –, gibt es da immer noch das Problem mit dem riesigen Bluterguss auf meiner Stirn.«
»Die Schwellung ist mittlerweile komplett zurückgegangen, und ich werde dir eine perfekte Frisur und ein tolles Make-up zaubern. Wenn ich mit dir fertig bin, wird den blauen Fleck niemand mehr bemerken«, versprach sie.
»Meinetwegen«, murmelte ich, da ich wusste, dass ich das Unvermeidliche nur hinauszögerte, indem ich mich weigerte. Sobald sich Lexi etwas in den Kopf gesetzt hatte, war es so gut wie unmöglich, sie davon abzubringen.
»Ja! Du bist wirklich die Beste«, quietschte sie und schlang ihre Arme um meinen Hals. »Du wirst das nicht bereuen, das schwöre ich!«
»Ich weiß«, stimmte ich zu und lächelte, als mir ein Gedanke in den Sinn kam. »Denn jede Runde geht auf dich.«
3
Kleine Päckchen
»Wie heißt dieser Kerl überhaupt?«, brüllte ich in Lexis Ohr in dem Versuch, mich über den wummernden Bass hinweg verständlich zu machen.
Die Band war noch nicht aufgetaucht, und die künstlichen Töne elektronischer Musik dröhnten durch das Styx. Die Tanzfläche war voller Körper, und Lexi und ich bahnten uns einen Weg durch die Menge zur Bar. Der Barkeeper war total überlastet und rannte hin und her, um die Getränkebestellungen zu erfüllen.
»Was hast du gesagt?«, rief Lexi zurück. Sie strich ihren roten Bob glatt und zupfte dann an ihrem Ausschnitt herum, bevor sie versuchte, den Barkeeper zu uns zu winken. Als sie es endlich schaffte, seine Aufmerksamkeit zu erlangen, bestellte sie zwei Wodka Cranberry und knallte einen Zehner auf die Theke.
»Das Wechselgeld kannst du behalten«, sagte sie und zwinkerte ihm zu, als er die Drinks vor sie stellte.
Sie reichte mir einen und führte mich zum vorderen Bereich der Tanzfläche. Dort würden wir der Bühne so nah wie nur irgend möglich sein. Als wir unser Ziel erreichten, hob sie ihren Becher, um mir zuzuprosten.
»Prost, Kleine! Auf unser zweites Studienjahr«, verkündete sie und stieß mit ihrem Becher an meinen.