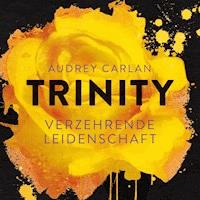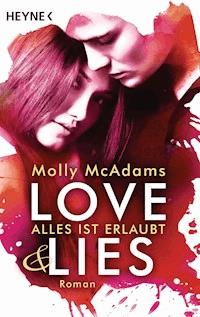Die achte Farbe des Regenbogens – ein queerer New Adult Roman über interkulturelle Liebe, Selbstfindung und die Verletzlichkeit hinter männlichen Rollenbildern E-Book
Davyd Neubauer
9,00 €
Mehr erfahren.
Nach außen wirkt Tom stark. Doch sein Inneres ist verletzt, gezeichnet von alten Wunden und einem frischen Trauma. Als er Rami begegnet – einem charmanten Taxifahrer, Sohn einer traditionsbewussten libanesischen Familie –, beginnt ein gefährliches Abenteuer: Aus einer Begegnung wird eine zarte, verbotene Liebe. Rami erwidert Toms Gefühle, lebt aber in ständiger Angst, dass seine Liebe zu einem Mann entdeckt wird. Zwischen Trauma, Homophobie und familiärem Druck drohen nicht nur ihre Gefühle, sondern auch ihr Leben aufgerieben zu werden. Gemeinsam schreiben sie ihre eigenen Regeln, brechen mit festgefahrenen und selbstgewählten Rollenbildern – auch innerhalb der queeren Community. Sie machen sich auf die Suche nach der achten Farbe des Regenbogens: ein Symbol für Liebe, Widerstand und Hoffnung. Eine emotionale, New Adult Romance mit psychologischem Tiefgang über Selbstbestimmung, die emotionale Wahrheit hinter männlichen Stereotypen und Heilung. Bist auch du bereit, Grenzen zu überschreiten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Davyd Neubauer
Die achte Farbe des Regenbogens
oder
Die Geschichte von Rami und Tom
New Adult Romance
© 2025 Davyd Neubauer
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH
Heinz-Beusen-Stieg 5
22926 Ahrensburg
Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Covergestaltung und Bildmaterial: Das Coverbild wurde mithilfe künstlicher Intelligenz generiert und anschließend vom Autor digital bearbeitet.
Content Warning
Dieser Roman behandelt sensible Themen wie Homophobie, familiären Druck, emotionale Verletzungen und die Androhung von Gewalt. Außerdem enthält er erotische Szenen. Bitte lies achtsam, wenn dich solche Inhalte persönlich betreffen.
Danksagung
Mit Geschichten ist es wohl wie mit Kindern: Man sagt, es brauche ein ganzes Dorf, um sie großzuziehen. Und tatsächlich gibt es in meinem Dorf viele Menschen, denen ich unendlich dankbar bin – dafür, dass meine Geschichte geboren wurde, laufen lernte und nun erwachsen ist.
Zuerst danke ich meinen Eltern. Ihr habt den Grundstein gelegt, meinen eigenen Weg durchs Leben zu finden. Eure Unterstützung und euer Vertrauen haben mich geprägt.
Meiner lieben Schwester danke ich für ihren unerschütterlichen Glauben an mich und für die vielen tiefgründigen Gespräche über Vergangenheit und Zukunft, die mir Mut und neue Perspektiven geschenkt haben.
Mein Dank gilt auch all jenen, die meinen Weg gekreuzt und mich begleitet haben. Mit euch habe ich gelernt, wie schön das Leben sein kann, aber auch, an welche Abgründe es uns führt. Besonders danke ich dir, Christiane. Du warst mir während meiner Berliner Zeit eine enge Vertraute.
Und schließlich danke ich meinem wunderbaren Mann. Dir widme ich diese Geschichte. Während der gesamten Zeit, in der ich an diesem Buch gearbeitet habe, warst du meine größte Stütze. Du hast mir den Rücken freigehalten und mir Tag für Tag gezeigt, was es bedeutet, zu lieben und geliebt zu werden.
Ich danke euch allen, dass ihr Teil meines Dorfes seid.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Danksagung
01 Spiegelwesen
02 Nachtfahrt
03 Nur keine Gefühle
04 Lange Schatten
05 Wie eine Nadel im Heuhaufen
06 Zwei Botschaften
07 Wetterleuchten
08 Zwischen Baum und Borke
09 Tanz auf dem Vulkan
10 Ein Bumerang kommt selten allein
11 Der Schleier fällt
12 Funkstille
13 Nicht meine Welt
14 Glaube nicht alles, was du denkst
15 Alles auf Anfang
16 Schritte über Gräben
17 Zurück ins Leben
18 Ohne Netz und doppelten Boden
19 Zeit, dass sich was dreht
20 Abstand und Nähe
21 Zwischen den Jahren
22 Von einem, der auszog, um anzukommen
23 Ein Platz in der Welt
24 Ein guter Anfang
25 Feuerpause
26 Die achte Farbe
Die achte Farbe des Regenbogens – ein queerer New Adult Roman über interkulturelle Liebe, Selbstfindung und die Verletzlichkeit hinter männlichen Rollenbildern
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Danksagung
26 Die achte Farbe
Die achte Farbe des Regenbogens – ein queerer New Adult Roman über interkulturelle Liebe, Selbstfindung und die Verletzlichkeit hinter männlichen Rollenbildern
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
Alle Personen und Handlungen dieses Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen, lebenden oder verstorbenen Personen oder existierenden Orten wäre rein zufällig und nicht beabsichtigt
01 Spiegelwesen
Ich stand am Waschbecken und ließ das Wasser über meine Hände laufen. Beobachtete, wie sich der Strahl brach, Tropfen bildete, auseinanderfaserte und schließlich im Abfluss verschwand. Es war nur Wasser – und doch wünschte ich mir, der lauwarme Strom könnte nicht nur meine Hände reinigen, sondern auch diesen misslungenen Abend mitnehmen.
Ich drückte den Hebel des Seifenspenders. Sofort stieg mir der künstliche Zitrusduft in die Nase, legte sich wie eine dünne Maske über den Geruch, der diesen Ort definierte. Doch gegen die Mischung aus Urin, Schweiß, Bier und billigem Reinigungsmittel hatte der Seifenduft keine Chance. Jeder Atemzug erinnerte mich daran, wo ich war.
Hinter der Tür pulsierte die Geräuschkulisse der Bar: wummernde Bässe, das Klirren von Gläsern, Stimmengewirr. Alles verwob sich zu einem undurchdringlichen Teppich aus Möglichkeiten, Missverständnissen und Männerparfüm – ein Universum, in dem man sich verlieren oder finden konnte. Oft beides zugleich.
Lange hatte ich genau das gesucht. Jedes Wochenende war ich durch die Clubs gezogen, hatte es genossen, begehrt zu werden, mich von Blicken und Berührungen tragen zu lassen. Es ging mir nie um schnellen Sex – aber wenn er sich ergab, warum hätte ich Nein sagen sollen?
Dann hatten meine nächtlichen Streifzüge abrupt geendet. Aus einem Grund, über den ich nicht reden wollte. Zwei Monate lang mied ich Bars und Clubs, bis ich schließlich zurückkehrte. Ich redete mir ein, man begegne der Angst am besten, indem man ihr direkt in die Augen sieht – wie ein Schauspieler, der nach einem verpatzten Auftritt wieder auf der Bühne steht. Vielleicht war es aber auch ein viel profanerer Grund: dieses Kribbeln in der Magengrube, das nie ganz verschwindet. Eine Mischung aus Sehnsucht, Neugier und dem leisen Traum von einem Abenteuer, das mehr sein könnte als nur eine Nacht.
Deshalb war ich heute losgezogen – in den „Hangar“, Hausnummer 69. Eine Bar, bekannt für alles jenseits von „Vanilla“. Über die Jahre hatte sich dort ein eigener Stil entwickelt: ein rauer Mix aus Leder, Army und Streetwear – eher Haltung als strikter Dresscode.
Doch irgendwann am Abend wurde mir klar, dass ich heute nicht bereit war, mich auf die Angebote einzulassen, die mir meine Umgebung zuspielte. Frustriert hatte ich mich in den Waschraum zurückgezogen. Ich brauchte Abstand.
Das Licht dort war schummrig, ließ die Haut krank und wächsern wirken, erfüllte aber seinen Zweck: hell genug, um das Nötige zu erkennen, dunkel genug, um das Unnötige zu überblenden. Die senkrechten Neonröhren neben den Spiegeln setzten Akzente in kaltem Blau und flackerndem Rot – Letzteres vermutlich das Ergebnis altersschwacher Technik.
Langsam hob ich den Blick. Der Mann im Spiegel war mir vertraut und fremd zugleich: Mitte zwanzig, klar geschnittenes Gesicht, dunkles, fast schwarzes Haar – die Seiten kurz, das Deckhaar länger, mit Gel lässig geformt. Ein Look, der mühelos wirken sollte. Doch nur ich wusste, wie lange er dafür gebraucht hatte. Seine Augen waren wachsam, ihre Farbe irgendwo zwischen Grau, Grün und Braun. Darüber Augenbrauen, die jedem Zweifel Ausdruck verliehen, noch bevor er ihn aussprach.
Das schwarze, leicht abgewetzte T-Shirt lag eng, aber nicht straff am Körper. Die Muskeln darunter erinnerten den Träger daran, wie sehr er ihn im Job brauchte. Eine Panzerkette lag kühl auf der gebräunten Haut, Ergebnis der Nachmittage am Badesee. Der Gürtel hielt eine ausgewaschene Jeans, die Hosenbeine leicht hochgekrempelt, um das Paar Markensneaker sauber in Szene zu setzen. Das Outfit war eine zweite Haut – Tarnung und Rolle zugleich. Ich spielte den Proll, den Kämpfer, den Mann ohne Angst, der sich souverän durch die Menge bewegte.
Ich zog die Schultern zurück, formte eine „Ey, Alter, läuft bei dir?“-Pose. Das Zittern meiner Finger schob ich auf den Alkohol – eine meiner leichtesten Übungen in der Kategorie „Selbstbetrug“.
Hinter mir fiel eine Kabinentür ins Schloss. Ein Typ tauchte auf – Mitte dreißig, Bart, Lederweste. Sein Blick streifte mich zu lang, um neutral zu sein. Ich erwiderte ihn regungslos. Hier konnte jede Geste ein Angebot sein. Der Mann verschwand durch die Tür zur Bar.
„Die Evolution war da wohl gerade Kreide holen“, murmelte ich. Händewaschen wäre auch für ihn eine Option gewesen.
Die Spülung rauschte. Aus derselben Kabine trat ein anderer Mann – älter, ruhige Bewegungen. Er stellte sich neben mich, hielt kurz die Hände unter den Wasserstrahl, strich sich übers Gesicht. In seiner linken Gesäßtasche steckte ein hellblaues Tuch. Er sah mich im Spiegel an, zwinkerte, lächelte wissend – und war verschwunden.
Mein Blick glitt zu den Fliesen neben dem Spiegel. Eine Sammlung aus Nummern, Sprüchen und Zeichnungen – verblasst wie die Erinnerungen an die Nächte, in denen sie dorthin gekritzelt worden waren.
„Sven, du schuldest mir noch ’n BJ – du weißt schon.“ Klappenromantik: roh, kitschig, ehrlich.
Ich sah wieder in den Spiegel. Vieles, was heute selbstverständlich schien, hatte ich mir auf Umwegen und mit Rückschlägen erkämpft. In der Schule war ich der Außenseiter, immer der Letzte, der in eine Mannschaft gewählt wurde, und der Letzte, der ins Ziel kam.
Ich erinnerte mich an meinen Sportlehrer, Freund neonfarbener Trainingsanzüge und flotter Sprüche: „19,9 Sekunden, Thomas. Nicht mal mehr auf meiner Liste. Ungenügend. Aber immerhin nicht tot umgefallen.“
Gelächter.
Es war keine Unsportlichkeit, sondern Protest – gegen ein Umfeld, in das ich nicht passte, gegen Mitschüler, die spürten, dass etwas an mir anders war. Während sie den Mädchen hinterhersahen, beobachtete ich Jungs – und hatte Angst, dass es jemand bemerkte. Was mir blieb, waren versteckte Blicke, unausgesprochene Wünsche und eine Verletzlichkeit, die mich zur Zielscheibe machte.
Nach der zehnten Klasse wurde aus Thomas einfach Tom, Azubi zum Veranstaltungstechniker. Der Job faszinierte mich von Anfang an. Schon in der Schule hatte ich Licht und Sound für die Theater-AG gemacht – sehr zum Leidwesen meiner Lehrer, die sich über meine Tagträume beschwerten, während ich für meine Mitschüler der Technik-Nerd war. Aber es war genau dieses Engagement, das mir später den Ausbildungsplatz verschaffte.
Der Job war hart: schleppen, aufbauen, schwitzen. Ein Fitnessstudio brauchte ich nicht – die Arbeit reichte, um meinen Körper zu spüren. Er wurde mein Werkzeug und mein Schutzpanzer. Ich begann, auf ihn zu achten. Aß gesünder, fuhr mit dem Rad statt mit Bus oder Bahn. Meine Erscheinung veränderte sich – und mit ihr die Wirkung auf meine Mitmenschen. Ich stand nicht länger am Rand. Die Kassiererin im Supermarkt lächelte ein wenig zu lange, wenn sie mir das Wechselgeld gab. Ich erwiderte ihre Geste stets freundlich, verschwieg ihr jedoch, dass mich nur Männer interessierten. Deren Aufmerksamkeit suchte ich anderswo – in den Bars des Szeneviertels.
Ich nahm Papier aus dem Spender, trocknete die Hände und warf es weg. Das flackernde Neonlicht zog mich in seinen Bann. Der Raum schien zu atmen – Licht an, Licht aus, an, aus … Mein Herz geriet aus dem Takt, ein Schlag zu schwer, der nächste zu schnell.
Dann kamen sie – Bruchstücke, verschwommene Bilder, fremde Sinneseindrücke: Dunkelheit. Kalte Berührung auf nackter Haut. Ein beißender Gestank nach Lösungsmittel. Etwas Hartes an meinen Schultern. Mit jedem Bild stieg Ekel in mir auf.
Trotz der dumpfen Wärme kroch Kälte meinen Rücken hoch. Ich bekam Gänsehaut, begann zu zittern. Meine Finger klammerten sich an den Rand des Waschbeckens. Im Spiegel überlagerte sich mein Gesicht mit einem anderen – ein Lächeln, das ich nicht mehr ertragen konnte.
„Bitte nicht. Nicht hier. Nicht jetzt.“
Ich zwang mich zur Atemtechnik, die ich aus dem Internet kannte: einatmen – zwei Sekunden, halten – vier Sekunden, ausatmen – zwei Sekunden, halten – vier Sekunden. Wieder und wieder. Mit geschlossenen Lidern versuchte ich, das Lächeln in die dunkelste Ecke meines Hirns zu drängen. Es gelang mir nicht.
Wie lange ich so dastand, wusste ich nicht. Als ich die Augen öffnete, stand jemand neben mir, den ich nicht hatte kommen hören.
„Hey … alles okay bei dir?“ Seine Stimme klang besorgt.
Ich kannte ihn vom Sehen: offenes Hemd, dunkle Locken, freundlicher Blick. Kein Aufreißer, eher einer, der am Rand blieb. Ich zwang meine Mundwinkel zu einem Lächeln.
„Klar … alles gut.“
Er sah mich zweifelnd an.
„Kam mir aber gerade nicht so vor. War dir schwindelig?“
„Zu warm“, log ich.
Er nickte langsam. „Na gut – aber pass auf dich auf.“
„Mach ich.“
Einen Moment schien er noch etwas sagen zu wollen, doch dann ging er. Ich atmete auf – dankbar für jede Geschichte, die nicht erzählt werden musste. Aber er hatte mich zurückgeholt. Die Bilder verblassten, der Aufruhr in meinem Körper legte sich. Ich wiederholte die Atemübung, bis meine Finger ruhig wurden. Dann ließ ich mein Spiegelbild zurück.
Als ich in das Chaos der Bar zurückkehrte, fühlten sich meine Beine noch schwer an. Ich schob mich durch die tanzenden Körper, gegen den Beat, bis ich den Tresen erreichte. Der Barkeeper erkannte mich sofort.
„Noch ’n Drink, Hübscher?“
„Nee, zahlen bitte.“
Er verzog das Gesicht in gespielter Empörung, tippte auf seinem Gerät herum.
„Zwei Bier, ein Wodka-Cola … vierzehn fünfzig.“
Ich legte einen Zwanziger hin. „Stimmt so.“
Er grinste. „Du weißt, wie man sich beliebt macht. Alles klar, Tom. Komm gut heim.“
„Danke“, murmelte ich und stieß mich vom Tresen ab.
Die Bässe vibrierten in meinem Brustkorb, während ich mich dem Ausgang näherte. Samstag, kurz nach zwei. Da legte sich eine Hand auf meinen Arm.
„Hey, Tom“, rief eine Stimme durch den Lärm.
Denny – einer der anderen Tresenjungs.
„Gehst du schon? Ich hab um vier Schluss. Wir könnten nachher noch ’n bisschen Spaß haben.“ Er legte seine Hand fester auf meinen Unterarm – mehr Forderung als Versprechen. Ich lächelte, versuchte, locker zu wirken, während ich innerlich Mauern gegen meine Erinnerungen errichtete.
„Mal sehen, was noch so geht“, sagte ich ausweichend.
„War keine Frage, Süßer“, lachte er und verschwand.
Denny war Szene pur – einer, der wusste, wie er wirkte. Wir hatten schon einmal miteinander geschlafen. Es war perfekt getaktet gewesen, wie ein House-Track: präzise, rhythmisch, kontrolliert. Doch heute fühlte sich der Gedanke falsch an. Mein Leib vibrierte noch – elektrisiert von etwas, das ich nicht benennen wollte. Ich hatte kein Bedürfnis, jemanden zu spüren.
Sorry, Denny.
Ich warf einen letzten Blick durch den Raum: Männer auf der Suche – nach jemandem oder nach sich selbst. Tanzend, lachend, flüsternd. Die Bar war Bühne und Zuflucht zugleich. Ich ließ Geräusche, Licht und Gerüche an mir abperlen wie Regen an Glas. Dann trat ich hinaus in die Nacht. Keine Ahnung, ob ich flüchtete oder einfach ging – vielleicht beides.
02 Nachtfahrt
Die Luft auf der Straße war warm und schwül – wie eine stehende Umarmung. Der Wetterbericht hatte Regen versprochen, doch er blieb aus, als hielten selbst die Wolken den Atem an.
Vor dem „Drunter & Drüber“ herrschte noch Leben. Eine Gruppe Feiernder hatte sich versammelt – mitten in einer ausufernden Verabschiedung oder bei der Planung der weiteren Nacht. Ihr Lachen wurde zwischen den Hauswänden hin und her geworfen.
Insgeheim war ich erleichtert, mich für eine Wohnung am Stadtrand entschieden zu haben. Manche Freunde hatten nur verständnislos den Kopf geschüttelt: „Warum ziehst du nicht ins Zentrum? Da hättest du jede Party direkt vor der Haustür.“ Abgesehen von den Mieten, Leute – genau deshalb.
Ich kam an „Sultan’s Kebab“ vorbei. Im grellen Neonlicht saßen zwei Typen an einem der wenigen Tische. Beide starrten auf ihre Handys, versunken in ein Spiel – vermutlich zockten sie gegeneinander. Der eine lachte triumphierend, der andere runzelte die Stirn. Dann ein schneller, spitzer Blick – Na, warte, gleich hab ich dich.
„Döner mit alles, extra scharf – für Kevin!“, brüllte der Mann hinter der Theke. „Wo ist der Junge? Ich schwör, wenn der nicht gleich aufkreuzt, ich ess das Ding selber.“
„Der ist pissen, kommt gleich“, rief einer der Typen zurück, ohne aufzusehen.
Ich musste lächeln und ging weiter. Der Duft nach Falafel und frischem Fladenbrot hing mir noch einen Moment in der Nase.
Am Taxistand warteten fünf Wagen. Ich steuerte auf das erste in der Reihe zu – eine alte E-Klasse. Fairness halber, dachte ich. Der Fahrer hatte am längsten gewartet, und ich eine längere Strecke vor mir.
Mein Shirt klebte am Rücken. Die Anspannung aus der Bar saß mir noch in den Schultern – wie eine Erinnerung, die nicht loslässt. Ich holte tief Luft und öffnete die Tür.
Ein dumpfer, angenehmer Duft schlug mir entgegen – holzig, mit einer Spur von Orange. Ich ließ mich auf die Rückbank sinken. Das Leder der Sitze glänzte speckig, an den Nähten hatten sich Risse gebildet. Wie viele Geschichten dieser Wagen wohl schon erlebt hatte?
Der Fahrer sah mich im Rückspiegel an: abgeklärtes Gesicht, Drei-Tage-Bart, Undercut, Schatten unter den Augen. Er musterte mich aufmerksam. Ein Mann in seinen Zwanzigern, der die Nacht kannte.
„Hi, wohin soll's gehn?“ Seine Stimme klang sonor, die Frage routiniert, aber nicht gleichgültig.
Ich nannte meine Adresse am Stadtrand.
Er grinste. „Du wohnst echt weit draußen. Aber passt, ich fahre dich sauber.“
„Danke dir.“
Wieder dieser prüfende Blick im Spiegel. Als versuchte er, mich zu lesen.
„Siehst aus, als hättest gefeiert“, bemerkte er schließlich. „Bar oder Club?“
Mein Herz stolperte kurz, als hätte es die Orientierung verloren. Ich ließ das Seitenfenster ein Stück herunter.
„Bar“, erwiderte ich. „Und – ehrlich gesagt, hab ich da noch ein Date.“
„Hm.“ Eine Falte erschien auf seiner Stirn. „Warum hockst du dann hier bei mir und nicht bei deiner Lady?“
Verdammt! Warum habe ich das jetzt überhaupt erwähnt?
Da war er wieder, der schmale Grat, auf dem so viele schwule Männer balancieren. Wie offen durfte man sein, ohne dass alles kompliziert wurde? Das echte Leben war eben keine endlose Pride-Parade.
Ich dachte an Jonas aus der Nachbarschaft, für den ich immer nur „die Schwuchtel“ gewesen war. Er und seine Clique hatten mir das Leben schwer gemacht. Später, in der Ausbildung, war es Leon mit seinen Sprüchen gewesen – nicht brutal, aber zermürbend. Nur weil ich weder halbnackte Models in meinen Spind klebte noch mit meiner „unwiderstehlichen Wirkung“ auf Frauen hausieren ging.
Diese Erfahrungen hatten mich gelehrt, abzuwägen, wem ich wissen ließ, dass ich schwul war. Es kam einer stillen Kosten-Nutzen-Rechnung gleich: Wer musste es wissen? Freunde, Familie, Kollegen, mit denen ich oft zusammenarbeitete – ja. Dort bedeutete Ehrlichkeit Freiheit. Aber darüber hinaus? Heteros trugen ihre Orientierung schließlich auch nicht wie eine Fahne vor sich her. Ich spielte kein Theater mehr – ich wählte meine Auftritte.
Vom Rücksitz aus sah ich eine Gebetskette mit grünen Perlen am Spiegel baumeln, auf dem Armaturenbrett ein Sticker mit arabischen Schriftzeichen. Sehr wahrscheinlich war der Fahrer muslimisch. Viele in seinem Umfeld lehnten Homosexualität vermutlich ab. Vielleicht auch er. Wie also reagieren?
Auf Stress hatte ich keinen Bock. Eine Notlüge würde nur neue Lügen nach sich ziehen. Das war anstrengend. Außerdem war ich sicher, dass er mit der Szene vertraut war – die Codes, die Gesichter, die Wege der Nacht kannte. Schließlich wartete er mitten im queeren Kiez auf Fahrgäste. Aber machte das auch tolerant? Selbst wenn nicht, ich würde ihm nach dieser Fahrt nie wieder begegnen.
Und außerdem war es Nacht. Sie ließ Stimmen anders klingen, Masken verrutschen und Wahrheiten hervortreten, die tagsüber nicht einmal gedacht wurden. Mein Pendel zwischen Vorsicht und Offenheit entschied sich für die Wahrheit.
„Die Lady … äh, ist eigentlich keine. Eher einer der Jungs vom Tresen im ‚Hangar‘. Aber ich steh nicht auf ihn.“
Seine Miene blieb regungslos. Ihn schien nichts mehr zu überraschen. Doch dann bemerkte ich sein spitzbübisches Grinsen – plötzlich strahlte sein Gesicht lebendig, offen, versprühte einen fast jungenhaften Charme.
„Der Typ vom Tresen – Geschmack hat der. Und, also, dich würd ich auch nicht von der Bettkante schubsen.“ Er lachte und schüttelte den Kopf, als wäre er selbst erstaunt über seine Offenheit.
Okay. Das Leben hatte beschlossen, mich an diesem Abend zu überraschen. Wie hoch war eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei Schwule mitten in der Nacht ein Taxi teilten? Ich rechnete im Kopf: fünf Prozent schwule Männer, etwa eins zu vierhundert. Nicht besonders groß.
Eine Ampel sprang auf Rot. Das Taxi stoppte.
„Weiß deine Familie Bescheid?“, wollte ich wissen.
Er schnaubte, trommelte mit dem Finger aufs Lenkrad. „Nee, meine Family kommt aus dem Libanon. Muslimisch. Bei uns redet man nicht drüber. Du machst halt, was du machen musst.“
Eine Pause.
„Meine Mum, ey, die nervt immer, wann ich endlich heirate. Sie sagt: ‚In Deutschland bist du zu frei, vergisst, was wichtig ist.‘ Bla, bla. Hör ich schon gar nicht mehr.“
Dann wurde seine Stimme leiser, fast ein Murmeln.
„Nachts … na ja, da mach ich mein Ding. Cruisen, Kino, schnelle Nummern – kurz frei, ohne dass jemand was merkt.“
Hinter der Ruhe seines Blickes lag ein Konflikt, den ich nur allzu gut kannte: der zwischen den Erwartungen von außen und den eigenen Bedürfnissen.
Die Ampel sprang wieder auf Grün.
„Das muss krass sein – so zu leben, zwischen zwei Welten“, sagte ich.
Er zuckte die Schultern. „Gewöhnst du dich dran.“
Im Rückspiegel fing sein Blick meinen auf. Er nahm mich wahr – nicht nur als Fahrgast, sondern als Mann und Mensch.
„Wie heißt du?“, fragte ich.
„Rami.“
„Tom.“
„Schöner Name. Passt zu dir, Bruder.“
Ich grinste. Mein Herzschlag fand einen anderen Rhythmus.
Rami war ein echter Turn-on: dunkle, ausdruckstarke Augen, gebräunte, leicht behaarte Arme, ein silberner Reif am rechten Handgelenk, Stoffbänder am linken und eine sportliche Statur – soweit ich das im Halbdunkel erkennen konnte.
Doch da gab es mehr als nur Äußerlichkeiten. Rami hatte etwas, das blieb. Seine ruhige, schnörkellose Art, die Souveränität in jeder Bewegung – sie wirkten wie Balsam auf meine überreizten Nerven. Auf dieser Fahrt hatte er etwas in mir berührt, das sonst schwer zu erreichen war: Das Gefühl von Vertrautheit.
Zu meinem Bedauern bogen wird kurze Zeit später in meine Straße ein. Er bremste sanft vor meinem Haus. Das Taxameter blinkte.
„Fünfunddreißig achtzig.“
Rami schaltete die Innenbeleuchtung ein, trübes Licht füllte den Wagen. Ich zog den Fünfziger aus meiner Tasche, den ich für diese Fahrt eingesteckt hatte und reichte ihm den Schein. „Mach vierzig.“
Er drehte sich zu mir, lächelte: „Ehrenmann. Danke dir.“ Dann, mit einem Augenzwinkern: „War ’ne coole Fahrt. Vielleicht sieht man sich mal wieder.“
Er griff ins Handschuhfach, zog eine Visitenkarte hervor.
„Hier die Nummer vom Laden, für den ich fahre. Gehört meinem Onkel. Falls du mal einen Wagen brauchst.“
Er reichte sie mir – eine ganz alltägliche Geste, die sich wie eine Einladung anfühlte.
„Danke. Kann ja nie schaden“, sagte ich und steckte die Karte ein.
Auf dem Weg zur Haustür spürte ich seinen Blick im Rücken. Als ich mich umdrehte, rollte das Taxi gerade an, das Schild auf dem Dach leuchtete wieder gelb. Rami war bereit für die nächste Fahrt.
Drinnen ließ ich die Tür leise ins Schloss fallen, das Wechselgeld landete auf dem Sideboard. Ich griff in die rechte Gesäßtasche, dann in die linke – und erstarrte.
Fuck … die Karte! Die muss ich im Taxi verloren haben.
Vermutlich hatte ich sie mit dem Geldschein herausgezogen. Ich lief nervös hin und her, zwang mich dann aber zur Ruhe.
„Okay, erst mal sperren. Alles andere später.“
Also suchte ich die Notfallnummer der Bank heraus , arbeitete mich durch ein schier endloses Menü einer künstlichen Intelligenz und landete schließlich bei einer übermüdeten Callcenter-Stimme.
Als ich aufgelegt hatte, war es zwanzig nach drei. Mein Blick fiel auf die Visitenkarte: schwarzer Druck auf weißem Karton. CityScout – Taxiunternehmen, darunter: ein Name, Logo und eine Telefonnummer.
Was, wenn sie die Karte nicht fanden? Ich musste den Betrieb erreichen, Rami auf die Karte aufmerksam machen – und insgeheim hoffte ich, ihn wiederzusehen.
Ich wählte die Nummer. Zwei Freizeichen, dann sprang die Mailbox an: „Sie erreichen CityScout Taxi außerhalb der Bürozeiten…“ – Piiiep.
„Hallo, ich bin heute Nacht mit einem Ihrer Taxis gefahren und hab dabei meine Bankkarte verloren. Falls der Fahrer was gefunden hat, wär’s super, wenn sich jemand meldet. Er heißt Rami.“
Ich nannte noch die Fahrstrecke, meinen Namen und sicherheitshalber meine Nummer – dann legte ich auf.
Erleichterung und Enttäuschung mischten sich. Eigentlich hatte ich gehofft, irgendjemand könnte mir sagen, wie ich Rami erreichen würde. Aber CityScout war offensichtlich ein kleiner Familienbetrieb und hatte kein Nachtbüro wie die großen Zentralen. Vielleicht hörte das ganze Wochenende niemand meine Nachricht ab. Rami wiederzufinden war offenbar schwerer als gedacht.
03 Nur keine Gefühle
Das Handy auf dem Nachttisch vibrierte. Kurz darauf ertönte der Marimba-Klingelton. Es war später Vormittag. Noch verschlafen setzte ich mich auf, griff nach dem Gerät und schaute auf das Display. Die Nummer sagte mir nichts.
„Hallo?“, meldete ich mich.
„Guten Morgen, hier ist CityScout Taxi. Spreche ich mit … Tom?“, fragte eine freundliche Frauenstimme.
„Ja, das bin ich.“ Jetzt war ich wach.
„Sie haben gestern Nacht auf unseren Anrufbeantworter gesprochen. Es ging um eine verlorene Bankkarte.“
„Ja, danke, dass Sie zurückrufen. Ich habe die Karte schon sperren lassen, aber ich würde sie trotzdem gerne wiederhaben.“
„Kein Problem. So etwas kommt bei uns öfter vor“, sagte die Frau. „Sie können die Karte bei uns im Büro abholen oder wir schicken Ihnen einen Fahrer vorbei. Dann müssten Sie allerdings die Fahrt bezahlen.“
Ich zögerte.
Irgendeinen Fahrer? Nein! Ich will nur einen Bestimmten wiedersehen. Ich brauche einen Plan.
„Wann hat das Büro auf?“, fragte ich vorsichtig.
„Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr.“ Sie nannte mir die Adresse.
„Hm. Ich arbeite meist ziemlich lange und müsste auch noch zu Ihnen fahren – unter der Woche ist das nicht möglich.“
Egal, was du sagst – die Zeiten würden mir sowieso nie passen.
„Wir könnten die Karte per Post schicken“, schlug sie vor.
Warum denn per Post? Gibt es keine andere Lösung? Moment – heute ist Sonntag. Rami ist bestimmt noch nicht im Büro gewesen.
„Hat Rami sie denn schon bei Ihnen abgegeben?“
„Nein, noch nicht. Er hat Bescheid gesagt, aber sie ist noch bei ihm.“
Jup. Das ist die Lösung.
„Wissen Sie was? Dann machen wir das so: Die Karte ist gesperrt, also ist es nicht so dringend. Am besten bleibt sie bei Rami, und er bringt sie mir vorbei, wenn er mal eine Fahrt in meine Gegend hat. Er weiß ja, wo ich wohne. Das spart Ihnen den ganzen Umstand mit der Post und mir den Weg zu Ihrem Büro – Finderlohn gibt’s natürlich auch.“
Finderlohn … ja, den gibt’s. Muss ja nicht unbedingt in bar sein.
Am anderen Ende entstand eine kurze Pause.
„Ich sage ihm Bescheid. Darf ich Ihre Telefonnummer weitergeben, damit er Sie – falls notwendig – anrufen kann?“ Sie klang, als lächelte sie.
Ich wechselte das Handy in die andere Hand und ballte kurz die Faust. Bingo.
„Klar, kein Problem. – Wann fängt er normalerweise an?“
„Abends zwischen fünf und sechs.“
„Perfekt, ich bin meistens nach sechs daheim. Wenn nicht, kann er die Karte auch einwerfen – wir haben Außenbriefkästen.“
Warum sage ich das? Natürlich werde ich zu Hause sein!
Wir tauschten noch ein paar Höflichkeiten aus, dann legte ich auf. Die Sonntagsruhe kehrte zurück. Die Bankkarte war für mich längst mehr als nur ein Stück Plastik. Sie war der letzte Faden zu Rami – der einzige offizielle Grund, seinen Namen erneut ins Spiel zu bringen. Er wusste nun, dass ich ihn wollte. Jetzt lag es an ihm.
Nach dem Telefonat hatte ich ein spätes Frühstück und fuhr dann zum See – mit dem Rad kaum mehr als zehn Minuten entfernt. Doch Entspannung wollte sich nicht einstellen. Jedes Mal, wenn mein Handy vibrierte, hoffte ich, es könnte Rami sein. Selbst Antonia, meiner Kollegin und besten Freundin, war das aufgefallen: „Sag mal, bist du enttäuscht, dass nur ich anrufe?“
„Wieso?“
„Na ja, du antwortest nur mit Ja oder Nein. Klingt so, als wolltest du mich loswerden.“
Antonia war direkt, immer ehrlich, aber nie verletzend.
Gegen Abend war wieder zu Hause. Die Hitze des Tages lag noch in der Luft. Der Holzboden unter meinen nackten Füßen knarrte, als ich in die Küche ging, um mir eine Cola zu holen. Da klingelte es an der Wohnungstür.
Ein Nachbar? Was kann der von mir wollen?
Ich öffnete – und da stand er. Lässig, als gehöre ihm der Türrahmen: orangefarbenes Hemd und schwarze Jeans. Auf dem Kopf saß eine Cap, leicht aus der Mitte gedreht und etwas nach hinten gezogen, sodass seine dunkelbraunen Augen frech hervorblitzten – mühelos, selbstbewusst, als hätte er sie nur eben aufgesetzt. Zwischen zwei Fingern hielt er meine Bankkarte, als sei es ein Zettel mit seiner Nummer.
„Na, alles cool? Die lag noch bei mir im Wagen. Wär fast in den Schredder gewandert“, grinste er breit.
„Hi.“ Ich war etwas verdutzt, denn normalerweise war die Eingangstür unten verschlossen. „Wie bist du überhaupt reingekommen?“
„Ist grad’ einer raus. Tür war offen. Easy.“
Ich nahm ihm die Karte ab. Für den Bruchteil einer Sekunde berührten sich unsere Finger. Ein elektrischer Impuls jagte durch meinen Körper, bis tief in den Bauch.
„Danke. Habe nicht so schnell mit dir gerechnet.“
„Kein Stress, Bro. War eh in der Ecke unterwegs.“ Seine Antwort klang beiläufig, doch seine Augen verrieten etwas anderes. „Komm rein. Oder musst du gleich weiter?“
„Nee, habe nichts Großes vor.“
Er trat in die Diele, beugte sich hinunter, zog die Sneaker aus und stellte sie ordentlich nebeneinander.
„Musst du nicht“, sagte ich überrascht.
Sein Lächeln wurde schmaler. „Alles gut, Digga. Mach ich immer so. Straße bleibt draußen.“
Ich nickte. Die reflexartige Geste – so voller Respekt – sagte mehr über ihn als jedes Geständnis.
Langsam ging er den Flur entlang, musterte die Wände und Möbel, als wollte er mein Leben wie eine Landkarte lesen. Ich folgte ihm in die Küche, die kompakt und funktional eingerichtet war: matt-graue Küchenzeile, Brotkasten, Wasserkocher, Messerblock, alte Kaffeemaschine auf der Arbeitsfläche. Ein offenes Regal mit etwa ein Dutzend Teedosen und anderen Vorräten. Am Kühlschrank Post-its mit Terminen und kleinen Bildern von Festivals, die mich mit Kollegen und Künstlern zeigten. Auf der Fensterbank ein Kräutertopf, frisch und duftend. Rechts ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen; ein benutztes Geschirrtuch hing über einer Lehne. An der Wand über dem Tisch hing ein Festivalposter mit bunten Lichteffekten.
„Ich wollte mir gerade eine Cola holen. Magst du auch eine?“
„Kommt drauf an. Normale – oder dieser Light-Mist?“ Rami lehnte mit der Schulter gegen den Türrahmen, seine Hände tief in den Hosentaschen vergraben.
„Normale.“
„Korrekt. Gib rüber.“
Ich holte zwei Dosen aus dem Kühlschrank, reichte ihm eine. Er musterte sie. „Oha, sogar klassisch. Du bist so ’n Retro-Typ, stimmt’s?“
„Nenn es beständig.“
„Safe, passt zu dir. Du tust so auf Kontrolle, aber ich schwör, da drin ist bei dir mehr los, als du zugibst.“ Er tippte auf seine Brust.
Ich zog an der Lasche meiner Cola-Dose. Die Kohlensäure entwich mit einem Zischen. Gleich darauf spürte ich, wie sich der feuchte Nebel auf meinem Handrücken absetzte.
„Und du? Gerade Linie oder eher Chaos?“ Ich nahm einen Schluck.
„Kommt drauf an, wer guckt.“
„Und du willst, dass ich gucke, oder?“
Er hob die Dose an die Lippen, stellte sie dann auf dem Küchentisch ab.
„Keine Ahnung. Du meintest doch, ich kriege Finderlohn.“ Ein vielsagendes Grinsen. „Cola reicht da nicht, Digga.“
Ich spürte, wie mir heiß wurde.
„Und wenn ich heute Abend gar nicht da gewesen wäre?“ „Dann wär ich wieder abgezogen – vielleicht.“
„Und jetzt? Bist du da, wo du sein willst?“
„Nein“, entgegnete er. „Jetzt stehe ich hier, und du guckst mich an, als würd’s dich jucken, aber tust so, als wüsstest du nicht, was du willst.“
„Vielleicht weiß ich’s wirklich nicht.“ Ich stellte meine Dose auf der Arbeitsfläche ab.
„Na, dann ist’s ja gut, wenn ich’s weiß.“
Er trat näher, so nah, dass ich seinen Atem spüren konnte.
„Weißt du, was mich bei dir verrückt macht? Deine Augen. Die sagen: ‚Verzieh dich.‘ Und gleichzeitig: ‚Komm, nimm mich endlich.‘ Das killt mich, echt.“
Ein holzig-herber Duft stieg mir in die Nase, warm, eigen, wie seine Signatur.
Zwei Finger glitten unter meine Perlenkette aus dunklem Holz und Lavastein, verweilten in der empfindlichen Mulde zwischen den Schlüsselbeinen.
„Heute ’ne andere“, bemerkte er.
„Gestern – das war ‚Hangar‘-Style.“
„Wusste ich’s doch. In dir brodelt’s.“
Er zog mich zu sich. Seine Lippen trafen meine, sanft, entschlossen. Er drehte seine Cap nach hinten. Eine Hand legte sich warm in meinen Nacken. Die Küsse wurden intensiver, stürmischer.
Plötzlich wich er einen Schritt zurück, fixierte meine Augen.
„Zieh dein Shirt aus“, forderte er heiser.
Ich griff nach dem Saum, zog es mit einer fließenden Bewegung über den Kopf und ließ es zu Boden fallen. In seinen Augen funkelte stumme Anerkennung. Dann glitten seine Finger über meine Rippen, die Brust und die leise Anspannung meiner Bauchmuskeln – wie ein Tier vor dem Sprung.
Ich lehnte mich zurück, stützte mich an der Arbeitsfläche ab und öffnete mich seinen Berührungen. Die Luft zwischen uns knisterte. Seine Hände fanden den Bund meiner Sweatpants. Mit einem festen Griff wollten er mich näher zu sich ziehen, als ich unkontrolliert zusammenzuckte – ein spontaner Reflex, den ich gerade noch abfangen konnte. Auf die Lust, die meinen Körper durchströmte, traf jäh eine Welle aus Bildern, die dicht unter der Oberfläche lauerten, und Panik, die nach außen drängte.
Tom, du bist in deiner Küche.
Der Gedanke war wie ein Anker, den ich auswarf.
Rami ist hier. Ich will ihn. Ich vertraue ihm. Es besteht keine Gefahr.
Ein zweiter Anker.
In mir tobte kurz ein Kampf gegen die Erinnerung, die sich wie ein gähnender Abgrund vor mir auftat – doch diesmal blieb ich stehen, stürzte nicht hinein. Die Welle schlug an mir hoch, doch sie brach und überspülte mich nicht.
Rami spürte meine Irritation. Er ließen den Hosenbund los. Sein Blick suchte meinen. „Alles gut bei dir, Bro?“
„Ja. War nur ein Krampf, habe heute wohl zu viel Sport gemacht.“
Zur Bekräftigung zog ich ihn wieder näher an mich, spürte seine Härte. „Wo waren wir noch gleich stehengeblieben?“
„Hier.“ Rami legte seine Hände auf meine Schultern und lenkte mich sanft nach unten. „Geh runter.“
Bereitwillig ließ ich mich auf die Knie sinken.
Nun nahm er seine Cap ab, ließ sie neben sich fallen. Dann zog auch er sein Hemd aus. Der Stoff glitt über seine gleichmäßig getönte, straffe Haut, die im Abendlicht warm schimmerte. Erst jetzt entdeckte ich das Tattoo an seiner Seite: Schwarze arabische Schriftzeichen, streng und zugleich geschwungen, zogen sich an seiner Rippenlinie entlang – wie ein geheimnisvoller Schwur, der in seinem Körper eingeschrieben war.
Mein Blick wanderte weiter zu der Linie dunkler Härchen entlang der angedeuteten Rinne, die seinen Oberkörper teilte. Ich ließ meine Daumen diesem Weg nachspüren, glitt über die tätowierte Haut, fühlte seine Wärme, seine Stärke, die gleichmäßige Spannung seiner Muskeln unter meinen Händen. Als ich den Bund seiner Jeans erreichte, hob ich den Kopf, suchte seinen Blick – gleichsam eine stumme Bitte um Erlaubnis, weitergehen zu dürfen.
Er sog hörbar die Luft ein, nickte und schloss die Augen. Langsam öffnete ich die Knöpfe seiner Jeans und ließ sie nach unten gleiten. Seine Shorts kamen zum Vorschein, unter denen sich sein Körper deutlich abzeichnete. Ich wollte weitergehen, doch mit einem sanften, aber bestimmten Griff hielt er meine Handgelenke fest.
„Nicht so schnell. Zeig mir, wie sehr du’s willst.“ Seine Stimme – eine Mischung aus Provokation und Verheißung.
Ich beugte mich vor und ließ meine Hingabe sprechen, während er jede meiner Bewegungen beobachtete. Er reagierte sofort auf jede Berührung, legte seine Hand fester um meinen Nacken. Mein Verlangen wuchs mit jeder Sekunde. Neugierig bewegte ich mich näher, forderte ihn heraus. Er lächelte überlegen, vielleicht sogar leicht spöttisch. Aber das gehörte zu unserem Spiel. Er schenkte mir den Raum, dem ich folgte, in dem ich spielte und variierte, bis sein Körper sich spannte und er den Kopf in den Nacken legte. Ich hörte sein Stöhnen, spürte seinen Höhepunkt. Fast gleichzeitig durchfuhr auch mich derselbe wohlige Schauer – eine Entladung der Anspannung, die sich in mir aufgestaut hatte, seitdem ich Rami in der Nacht zuvor zum ersten Mal begegnet war.
Als wir uns wieder ankleideten, spürte ich, dass sich etwas zwischen uns verschoben hatte. Ramis Präsenz wirkte noch immer kraftvoll, zugleich aber weicher.
„Stabil, Bro“, sagte er schließlich, während er das orangefarbene Hemd wieder überstreifte. Sein Gesichtsausdruck war gelöst, beinahe feierlich. „Richtig stabil. Mehr als das.“