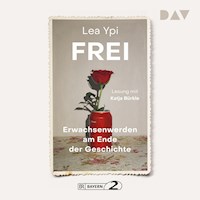21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Vernunft ist ein vielfältiges Vermögen. Ein vernünftiges Wesen erkennt, wie die Dinge sind; zugleich kann es sich vorstellen, was sein soll, und entsprechend handeln. Wie aber können zwei scheinbar so verschiedene Fähigkeiten – Erkennen und Handeln – als Teile desselben Vermögens begriffen werden? Lea Ypi geht der Einheit der Vernunft in einem oft vernachlässigten Kapitel von Kants Hauptwerk nach: der »Architektonik der reinen Vernunft«. Die Vernunft gleicht hier einem Bauwerk, dem ein Plan zugrunde liegt, der jedem Bestandteil seinen festen Platz zuweist. Doch ihr theoretischer und ihr praktischer Teil werden von einem fragilen Bindeglied zusammengehalten, an dem sich die Stabilität des Ganzen entscheidet. Diesem spürt dieses meisterhafte Buch nach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cover
Titel
3Lea Ypi
Die Architektonik der Vernunft
Zweckmäßigkeit und systematische Einheit in Kants Kritik der reinen Vernunft
Aus dem Englischen von Antonia Grunert
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
The architectonic of reason. Purposiveness and Systematic Unity inKant’s Critique of Pure ReasonDie Originalausgabe in englischer Sprache, die dieser Übersetzung zugrunde liegt, erschien erstmals 2021 bei Oxford Publishing Limited
eBook Suhrkamp Verlag 2024
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2438
© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024© Lea Ypi 2021
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-77914-9
www.suhrkamp.de
Widmung
5A Paola e Mario
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Andrea Kern Analytischer Deutscher Idealismus. Vorwort zur Buchreihe
Die Architektonik der Vernunft Zweckmäßigkeit und systematische Einheit in Kants ›Kritik der reinen Vernunft‹
Abkürzungsverzeichnis der Werke Kants
Danksagung
Einleitung: Das Gebäude der Vernunft
1. Der Schulbegriff und der Weltbegriff der Philosophie
2. Systematische Einheit in der »Architektonik der reinen Vernunft«
3. Die Vernunft als Organismus
4. Die theoretische Vernunft und die Rolle der Ideen
5. Die Deduktion der transzendentalen Ideen
6. Die Rolle der Ideen aus praktischer Perspektive
7. Das Reich der Zwecke
Fazit: Jenseits der ›Kritik der reinen Vernunft‹
Literaturverzeichnis
Register
Fußnoten
Informationen zum Buch
3
5
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
9Andrea Kern
Analytischer Deutscher Idealismus
Vorwort zur Buchreihe
Die Philosophie des Deutschen Idealismus – und damit meinen wir die Philosophie von Kant bis Hegel – scheint vielen durch die analytische Philosophie überholt. Nicht selten wird sie als Gegenprojekt zu dieser Tradition der Philosophie verstanden. Mit der Buchreihe Analytischer Deutscher Idealismus wollen wir sichtbar machen, dass die Philosophie des Deutschen Idealismus keinen Gegensatz zur analytischen Philosophie darstellt, sondern umgekehrt ihr Maßstab und Fluchtpunkt ist.
Die Reihe antwortet auf eine intellektuelle und gesellschaftliche Herausforderung, die durch die Renaissance des Naturalismus in den Wissenschaften erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist. Sie liegt in der für uns grundlegenden Frage, wie wir es verstehen können, dass wir geistbegabte Tiere sind, die einerseits das, was sie tun, aus Freiheit tun, deren Leben aber andererseits durch Gesetzmäßigkeiten bestimmt ist, die sie nicht selbst hervorgebracht haben. Es ist offenkundig, dass man diese Frage nicht beantworten kann, indem man ihre eine Seite – die Freiheit des Menschen – leugnet. Eine Naturalisierung des Geistes, die leugnet, dass all das, was das menschliche Leben ausmacht – Denken, Sprechen, Handeln, soziale Institutionen, religiöser Glaube, politische Ordnungen, Kunstwerke etc. –, Gegenstände sind, die, um mit Kant zu sprechen, dem Reich der Freiheit angehören, löst das Problem nicht, sondern kapituliert vor ihm. Doch auch wenn jeder sieht, dass diese Leugnung, die der Szientismus unablässig predigt, nicht das Resultat einer Erkenntnis sein kann, sondern vielmehr Ausdruck einer intellektuellen Hilflosigkeit ist, führt uns diese Reaktion ebenso vor Augen, dass die Frage nach der Einheit von Geist und Natur eine echte Frage ist, bei deren Beantwortung unser Selbstverständnis als geistige Wesen auf dem Spiel steht.
Die beschriebene Situation ist indes nicht neu. Blicken wir ins 18.Jahrhundert zurück, erkennen wir eine ähnliche intellektuelle Lage. Auch damals war es der Fortschritt der modernen Natur10wissenschaften, der unser Selbstverständnis als geistbegabte Tiere herausgefordert hat. Der Deutsche Idealismus antwortet auf diese Herausforderung, indem er die Philosophie explizit durch die Frage nach der Einheit von Geist und Natur definiert. Im Angesicht der modernen Naturwissenschaft ringt die Philosophie von Kant bis Hegel darum, die zwei Seiten des Menschen zusammenzubringen: dass er ein Tier ist und doch ein geistiges Wesen, dass er Natur ist und doch Gesetzen unterliegt, die von anderer Art sind als die Gesetze der Natur: Gesetzen der Freiheit. Die Philosophie des Deutschen Idealismus ist von dem Bewusstsein durchdrungen, dass das Begreifen dieses Verhältnisses – des Verhältnisses von Geist und Natur, wie Hegel es zu Anfang seiner Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften formuliert – die bestimmende Aufgabe der Philosophie ist. Wenn wir daher mit der Buchreihe Analytischer Deutscher Idealismus die Philosophie des Deutschen Idealismus stärken wollen, dann weil wir meinen, dass der Deutsche Idealismus für die intellektuelle Herausforderung, der wir uns gegenübersehen, die maßgebliche Orientierung ist. Der Deutsche Idealismus liegt nicht hinter uns, sondern vor uns. Damit meinen wir, dass die Art und Weise, wie der Deutsche Idealismus seine grundlegenden Begriffe und Ideen, allen voran die Begriffe der Freiheit, der Vernunft und der Selbstbestimmung, entwickelt und artikuliert, dem gegenwärtigen philosophischen Bewusstsein vielfach unbekannt und verstellt ist. Das liegt teilweise daran, wie die Philosophie in Westdeutschland nach 1945 mit diesem philosophischen Erbe umgegangen ist. Sie hat ihre durch den Nationalsozialismus verursachte Verstümmelung viel zu wenig als solche erfasst und zu heilen gesucht. Damit hat sie sich in eine Lage gebracht, in der sie aus sich heraus nicht mehr die Mittel schöpfen konnte, um die Begriffe und Ideen, in denen sie zu Recht ihre Bedeutung sah, so zu artikulieren, dass sie als Maßstab der systematischen Arbeit erscheinen konnten. Für einen großen Teil der Jüngeren wurde dieser Maßstab stattdessen die analytische Philosophie angloamerikanischer Prägung.
So wichtig diese Erneuerung der Philosophie war, so entstand dadurch doch der falsche Eindruck, die analytische Philosophie und die Philosophie des Deutschen Idealismus seien Gegensätze, nämlich Orientierungen und Vorgehensweisen, die nicht nur nichts miteinander zu tun haben, sondern einander ausschließen. Die Bücher dieser Reihe möchten darum auch sichtbar machen, dass der 11Deutsche Idealismus von Kant bis Hegel nicht nur kein Gegensatz zur analytischen Philosophie ist, sondern eine Form, und zwar eine maßgebliche Form, der analytischen Philosophie. Der Deutsche Idealismus, als analytische Philosophie, ist eine Reflexion auf elementare Formen des Denkens und damit auf die Quelle unserer grundlegenden Begriffe, die diese Begriffe zugleich als notwendig ausweist. Philosophie ist, so sagt es Hegel, der Versuch, das Denken aus sich selbst zu begreifen. Sie ist ein Begreifen des Denkens, das von keinen »Voraussetzungen und Versicherungen« abhängt, wie er sagt, eine radikal voraussetzungslose Untersuchung der Voraussetzungen des Denkens. Darin liegt der gemeinsame Zug der Philosophie des Deutschen Idealismus: dass die Begriffe, die sie durcharbeitet, von nirgendwoher – von keiner Wissenschaft und keinem Common Sense – übernommen werden, sondern diese Begriffe nur so weit verwendet werden, wie sie als notwendig für das Denken erkannt werden. Diese Einsicht, dass die Philosophie ihre Begriffe nur aus dem Denken selbst nehmen kann, macht den radikalen Anspruch des Deutschen Idealismus aus. Und so ist die Idee der analytischen Philosophie, die Idee der Philosophie als logischer Analyse der grundlegenden Formen des Denkens und der Aussage, nirgends so streng durchgeführt worden wie im Deutschen Idealismus.
Unter dem Label Analytischer Deutscher Idealismus versammelt die Buchreihe Texte und Bücher, die auf exemplarische Weise Philosophie als analytische Aufklärung verstehen, im Geist und mit den Begriffen des Deutschen Idealismus. Die analytische Philosophie kommt erst da zu sich selbst, wo sie sich nicht von der idealistischen Philosophie abwendet, sondern auf diese ausgerichtet ist: in ihren Grundbegriffen und in der Radikalität ihrer Methode. Das mag manchen als provokante These anmuten, doch es gibt viele Beispiele, die ihr entsprechen. Gottlob Freges Begriffsschrift, die vielen als Gründungsdokument der analytischen Philosophie gilt, ist kein Gegenprojekt zum Deutschen Idealismus, sondern eine Weiterführung der kritischen Philosophie Kants. Und wenn wir uns zwei andere große Werke der analytischen Philosophie vergegenwärtigen, Wilfrid Sellars’ Empiricism and the Philosophy of Mind (dt.: Der Empirismus und die Philosophie des Geistes) und Peter Strawsons The Bounds of Sense (dt.: Die Grenzen des Sinns), sehen wir, dass sich die herausragenden Repräsentanten der analytischen Philosophie niemals vom Deutschen Idealismus abgewendet, sondern 12stets dessen Nähe gesucht haben. Das offizielle Selbstverständnis der analytischen Philosophie, in dem sie sich dem Empirismus verschreibt und sich damit dem Deutschen Idealismus entgegensetzt, ist ein Selbstmissverständnis. Der Empirismus, der sich für aufgeklärt hält, weil er die empirischen Wissenschaften zum Maß der Erkenntnis erklärt, ist in Wahrheit der Widersacher der analytischen Philosophie, nämlich der radikalen, der grundlegenden Analyse der Formen unseres Denkens und Verstehens. Soweit der Empirismus die analytische Philosophie dominiert, verdeckt er deren eigentliche Orientierung, die dieselbe ist wie die des Deutschen Idealismus.
Der vorliegende Band von Lea Ypi, Die Architektonik der Vernunft, ist der siebte Band dieser Buchreihe, die 2015 durch den Band Wiedererinnerter Idealismus von Robert B. Brandom eröffnet wurde. Wie in allen Bänden der Reihe steht auch in diesem Band die Frage nach dem Wesen der Vernunft und der Freiheit des Menschen im Zentrum.
Lea Ypi ist Professorin für Politische Theorie an der London School of Economics. Sie nähert sich dieser für unser Selbstverständnis so zentralen Problemstellung aus der Perspektive Kants, der in der Frage «Was ist der Mensch?« die Grundfrage aller Philosophie sah. Die These des vorliegenden Bandes ist es, dass die Antwort auf diese Frage mit einem bestimmten Verständnis der Einheit der Vernunft verbunden ist. Wie können wir die Vernunft als ein einheitliches Vermögen verstehen, das für uns Menschen charakteristisch ist? Auf den ersten Blick scheint sie ein vielfältiges Vermögen zu sein. So erkennt ein vernünftiges Wesen einerseits kraft seiner Vernunft, wie die Dinge sind; zugleich kann es kraft seiner Vernunft vorstellen, was sein soll, und dementsprechend handeln. Das aber wirft die Frage auf, wie wir zwei scheinbar so verschiedene Fähigkeiten – Erkennen und Handeln – als Teile desselben Vermögens begreifen können. Für Lea Ypi steckt das Rätsel der Einheit der Vernunft in einem oft vernachlässigten Kapitel von Kants Hauptwerk, in der »Architektonik der reinen Vernunft«. Die Vernunft ist hier ein Bauwerk, dem ein Plan zugrunde liegt und in dem jeder Teil seinen Platz hat. Dabei werden ihr theoretischer und ihr praktischer Teil von einem fragilen Bindeglied zusammengehalten, an dem das Gebäude zu zerbrechen droht und dem Lea Ypi in diesem Band nachspürt.
Die Buchreihe wird von einem internationalen Forschungs13zentrum getragen, dem Forschungskolleg Analytic German Idealism (FAGI), das 2012 an der Universität Leipzig gegründet wurde und dessen Arbeit durch ein international besetztes Gremium unterstützt wird (siehe 〈www.sozphil.uni-leipzig.de/institut-fuer-philosophie/fagi〉). Ziel des FAGI ist es auch, die Stimme des Analytischen Deutschen Idealismus in die außerakademische Öffentlichkeit hineinzutragen und ihr Gewicht in den Debatten über unser Selbstverständnis zu stärken.
15Die Architektonik der Vernunft Zweckmäßigkeit und systematische Einheit in Kants Kritik der reinen Vernunft
16Abkürzungsverzeichnis der Werke Kants
ApH
Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, AA 7 (1798)
Bew
Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, AA 2 (1763)
BBM
Bestimmung des Begriffs einer Menschenrasse, AA 8 (1785)
BW
Briefwechsel, AA 10 (1747-1788)
DR
Danziger Rationaltheologie in Vorlesungen über Metaphysik und Rationaltheologie, AA 28 (1783/1784)
FM
Welches sind die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit Leibnitzens und Wolf’s Zeiten in Deutschland gemacht hat? AA 23 (1793/1804)
IaG
Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, AA 8 (1784)
KrV
Kritik der reinen Vernunft, AA 3 (1781, 1787)
KpV
Kritik der praktischen Vernunft, AA 5 (1788)
KUEE
Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft, AA 20 (1789)
KU
Kritik der Urteilskraft, AA 5 (1790)
LB
Logik Blomberg, AA 24 (ca. 1771)
LD
Logik Dohna-Wundlacken, AA 24 (1792)
LJ
Logik Jäsche, AA 9 (1800)
MM
Metaphysik Mrongovius, AA 29 (1782-1783)
Nachlass
Reflexionen aus dem Nachlaß, AA 14-23
Ped
Immanuel Kant über Pädagogik, AA 9 (1803)
Prol
Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, AA 04 (1783)
RH
Recensionen von J. G. Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, AA 08 (1785)
RM
Recension von Moscatis Schrift: Von dem körperlichen wesentlichen Unterschiede zwischen der Structur der Thiere und Menschen, AA 02 (1771)
RP
Religionslehre Pölitz, AA 28 (1817)
Rel
Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, AA 6 (1793)
TPP
Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie, AA 8 (1788)
VM
Vorlesungen über die Metaphysik, AA 28 (1760-1790)
VRM
Von den verschiedenen Rassen der Menschen, AA 2 (1775, 1777)
WhDO
Was heißt: Sich im Denken orientiren? AA 8 (1786)
WL
Wiener Logik, AA 24 (1780)
ZeF
Zum ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf, AA 8 (1795)
Alle Verweise beziehen sich auf Kants Gesammelte Schriften, Ausgabe der Preußischen (später Deutschen) Akademie der Wissenschaften [=AA], Berlin Georg Reimer, später Walter de Gruyter, 1902-.
17Danksagung
Mit der Arbeit an diesem Buch habe ich vor sehr langer Zeit begonnen, vor mehr als zwanzig Jahren. Ich befand mich mitten in meinem Philosophiestudium an der Universität La Sapienza in Rom, wo ich mich nach einigen Jahren des Studiums der formalen Logik der Geschichte der Philosophie zuwandte. Ich war fasziniert vom Deutschen Idealismus und interessierte mich zudem aus einer Reihe persönlicher und politischer Gründe für Marx und seine Religionskritik. Als ich aber begann, mich mit Marx zu beschäftigen, stellte ich fest, dass ich für ein wirkliches Verständnis von Marx zunächst einmal Hegel begreifen musste. Und als ich mich Hegel zuwandte, erschienen mir seine Texte übermäßig schwer verständlich, ohne zunächst Kant gelesen zu haben, insbesondere seine Kritik der Urteilskraft, die weithin als »Lösung« des Problems des Verhältnisses von Natur und Freiheit zu gelten schien. Daher beschloss ich, meine Dissertation über die Idee der systematischen Einheit in Kants dritter Kritik zu schreiben. Im Zuge meiner Analyse der Entwicklung von Kants Theorie der Urteilskraft und ihrem Verhältnis zu seinen restlichen Werken stolperte ich über die einzigen früheren Seiten, in denen Kant explizit das Problem der Einheit des Systems diskutiert: »Die Architektonik der reinen Vernunft«. Mir schien dies ein wichtiger, tiefgründiger und komplizierter Abschnitt der ersten Kritik zu sein, und der Umstand, dass über eine so rätselhafte Passage nur so wenig (damals noch weniger als heute) geschrieben worden war, ließ schließlich mein Projekt, zu verstehen, was Kant hier zu tun versuchte, ein Eigenleben entwickeln.
Meine Gedanken und meine Beziehung zu Kant haben sich im Laufe der Zeit entwickelt, aber man kann mit Recht sagen, dass alles, was ich glaube – über Philosophie, Wissenschaft, Moral, Geschichte, Politik und das Verhältnis all dieser Bereiche zueinander –, seine Wurzeln in der »Architektonik« und meiner Interpretation derselben hat. Keiner dieser Gedanken wäre das, was er ist, ohne die inspirierenden Gespräche, herausfordernden Diskussionen und intelligenten Kommentare meiner Freundinnen und Mentoren in Rom, und ich bin insbesondere Renato Caputo, Filippo Gonnelli, Mario Reale und Paola Rodano dankbar. Dieses Projekt verdankt ihnen mehr, als ich sagen kann.
18Das Projekt hatte eine sehr lange Entstehungszeit, so lang, dass ich mich nicht nur einmal fragte, ob es je zu einem Ende kommen würde. Dass es dazu kam, ist auch das Verdienst einer Reihe von Freunden und Kolleginnen, die ihren Enthusiasmus für Kant und ihr Wissen über seine Werke mit mir teilten. Besonders dankbar bin ich Sorin Baiasu, Luigi Caranti, Francesco Cori, Silvia De Bianchi, Karin De Boer, Katrin Flikschuh, Rainer Forst, Paul Guyer, Stefan Gosepath, Pauline Kleingeld, Michela Massimi, Jennifer Mensch, Sasha Mudd, Peter Niesen, Alessandro Pinzani, Gennaro Sasso, Andrew Stephenson, Francesco Valentini, Marcus Willaschek, Garrath Williams, Howard Williams und Tamara Jugov für ihre hilfreichen bibliographischen Vorschläge, für das Lesen und Kommentieren verschiedener Teile des Buchs und für viele anregende Gespräche über das Thema. Auch bin ich Bob Goodin sehr dankbar für seine unermüdliche Unterstützung meiner Arbeit.
Das Manuskript, auf dem dieses Buch basiert, war Gegenstand eines intensiven eintägigen Workshops an der LSE, und ich möchte der politikwissenschaftlichen Fakultät für die Unterstützung des Workshops sowie insbesondere Angela Breitenbach, Luigi Filieri, Gabriele Gava, Jakob Huber, Sofie Møller, Paola Romero und Thomas Sturm für ihre Teilnahme und ihre unglaublich hilfreichen und konstruktiven Hinweise danken. Außerdem danke ich meinem OUP-Lektor Peter Momtchiloff für sein Vertrauen in mein Projekt, drei anonymen Gutachterinnen für ihre exzellenten Kommentare, Marta Lorimer für ihre redaktionelle Unterstützung und Rainer Forst, Sandra Palermo und Garrath Williams für das Lesen eines vollständigen Entwurfs.
Das Buch wurde mit Mitteln des Instituto Italiano di Studi Storici in Neapel, der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, von einem Leverhulme-Preis und einem »Kant in South America«-Horizon-2020-Stipendium der Europäischen Kommission gefördert. Ich bin diesen Institutionen sehr dankbar für die Ermöglichung der Forschung, auf der dieses Buch basiert.
Meine Familie – Arbien, Rubin, Hana, Jonathan, Doli, Lana und Noana – ist eine unerschöpfliche Quelle der Liebe und Unterstützung, der ich mehr verdanke, als es für eine Kantianerin zuzugeben angebracht wäre.
Paola Rodano und Mario Reale bin ich besonders dankbar dafür, dass sie mich an die Philosophie glauben ließen, als ich meine Reise 19begann, dass sie (mehr als einmal) sicherstellten, dass ich über die materiellen Mittel verfügte, um mich weiterhin in der Welt der Ideen aufzuhalten, und dass sie auf jedem Schritt meines Weges an meiner Seite waren. Dieses Buch ist ihnen gewidmet.
20Einleitung: Das Gebäude der Vernunft
Dieses Buch handelt von der Einheit der Vernunft in der Kritik der reinen Vernunft. Es versucht zu erklären, warum eine solche Einheit notwendig ist, wie Kant die Idee einer solchen Einheit verteidigt und warum das Projekt letztlich scheitert. Das Hauptargument ist, dass die Einheit der Vernunft in einem transzendentalen Prinzip der Zweckmäßigkeit begründet ist, das unabdingbar für die systematische Integration des theoretischen und praktischen Gebrauchs der Vernunft ist, zugleich aber die für Kants Projekt wesentliche Trennung von Kritik und Metaphysik bedroht. Autorinnen, die sich mit der Rolle der Einheit der Vernunft in der ersten Kritik beschäftigen, konzentrieren sich zumeist entweder auf den Beitrag der Zweckmäßigkeit zur systematischen Einheit der theoretischen Erkenntnisse oder ihren Beitrag zur Verwirklichung der praktischen Zwecke der Vernunft. Nur selten betrachten sie, inwiefern die theoretische Einheit die Verwirklichung von Zwecken beeinflusst und zugleich von ihr abhängt, und was beide Aspekte zusammengenommen uns über das Schicksal des gesamten kritischen Projekts verraten.
Dies ist nicht überraschend. Der einzige Teil der Kritik der reinen Vernunft, in dem Kant die organische Integration verschiedener Arten des Gebrauchs der Vernunft untersucht, ist die »Architektonik der reinen Vernunft«. Dieser Abschnitt ist einer der dichtesten, rätselhaftesten, ja zuweilen geradezu undurchdringlichen Texte in Kants gesamtem veröffentlichten Werk. Man kann kaum umhin, mit den vielen Kommentatoren zu sympathisieren, deren Frustration mit dem Text einen massiven historischen Boykott herbeigeführt zu haben scheint. Selbst nach hunderttausenden von Seiten, die in den 250 Jahre seit der Veröffentlichung der ersten Kritik über Kants systematisches Projekt geschrieben wurden, gibt es nur eine Handvoll Menschen, die sich explizit mit der »Architektonik« befassen – und noch weniger, die dies auf wohlwollende Weise tun.
Indem es die Rolle des Prinzips der Zweckmäßigkeit für Kants Analyse der Einheit der Vernunft untersucht, bietet dieses Buch eine Interpretation der »Architektonik der reinen Vernunft«, die die Zentralität dieses Abschnitts für Kants philosophisches Projekt 21wiederherstellt. Es betont die Bedeutsamkeit und Einzigartigkeit der »Architektonik« für das Verständnis der Notwendigkeit der Einheit der Vernunft, der Rolle des Prinzips der Zweckmäßigkeit für die Integration des theoretischen und praktischen Gebrauchs der Vernunft und der Relevanz der Auseinandersetzung mit Kants Problemstellung für das Nachdenken über das philosophische Problem der systematischen Einheit im Allgemeinen. Obwohl Kants Verteidigung der Einheit der Vernunft in der ersten Kritik scheitert, weil es Kants eigene Trennung von Kritik und Metaphysik gefährdet, ist dieses Scheitern produktiv. Im Gegensatz zur großen Mehrheit der Kommentatorinnen, die die »Architektonik« schlichtweg verworfen haben, versuche ich zu zeigen, dass ihr Fokus auf die Einheit der Vernunft entscheidend ist, um einige der wichtigsten Ideen Kants zu erhellen. Dazu gehören unter anderem der Übergang vom System der Natur zum System der Freiheit, das Verhältnis von Glauben und Wissen, die philosophische Verteidigung des historischen Fortschritts und die Rolle der Religion.
Diese Fragen haben bekanntlich die nachfolgende deutsche philosophische Tradition maßgeblich geprägt, von den ersten Reaktionen Jacobis, Reinholds, Schulzes und Maimons über die partielle Integration ihrer Analysen in den Idealismus Fichtes oder Hegels bis hin zu Marx’ Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie.[1] Im Zentrum ihrer Anliegen steht immer dasselbe Problem: Woher kommt die Autorität der Vernunft? In welchem Verhältnis steht sie zur Natur? Wie ordnet die Vernunft die verschiedenen Schlüsse, die sie über die Welt zieht? Sie alle münden in einem Versuch, nicht nur das Verhältnis zwischen verschiedenen philosophischen Behauptungen in den Gebieten der Wissenschaft, Moral, Politik und Religion zu erklären, sondern auch ihren Zweck zu verstehen – welche Werte sie befördern. Kant präsentiert seine Verteidigung der Einheit der Vernunft in der »Architektonik« als weitere Ausführung dreier fundamentaler Fragen: »Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen?« (KrV, A 805/B 833). Zusammen konvergieren sie in einer vierten, die Kant zufolge die Philosophie im Ganzen motiviert: »Was ist der Mensch?« (VM, 533-534; LJ, 25).
22Was ist der Mensch? Dieses Buch legt nahe, dass Kants Antwort auf diese Frage an eine bestimmte Darstellung der Vernunft gekoppelt ist, die deren zweckmäßigen Charakter betont. Doch wie die folgenden Seiten zeigen werden, ist das Konzept der Zweckmäßigkeit, das Kant in der ersten Kritik vertritt, ein Konzept der »Zweckmäßigkeit als Design«, das sich von dem der »Zweckmäßigkeit als Normativität«, das in seinen späteren Werken eine zentrale Rolle spielt, stark unterscheidet. Im ersten Fall, Zweckmäßigkeit als Design, ist die Beziehung zwischen Vernunft und Natur in der Idee Gottes verankert. Im zweiten Fall, Zweckmäßigkeit als Normativität, ist sie im Begriff der reflektierenden Urteilskraft verwurzelt und durch transzendentale Freiheit begründet. Gott bleibt zwar Teil des Systems, spielt aber eine zunehmend marginale Rolle, eine, die nachfolgenden Autoren wie Marx und Hegel den Weg zu einer Geschichtsphilosophie ebnete, die ihn schließlich gänzlich überflüssig werden ließ.
In der »Architektonik der Vernunft« spielt das Prinzip der Zweckmäßigkeit, das mit der Verteidigung der Ideen der Vernunft verbunden ist, eine zentrale Rolle im Projekt der Vereinigung. Wie ich aber ebenfalls zu zeigen versuche, ist nur ein Konzept von Zweckmäßigkeit, das in transzendentaler Freiheit wurzelt, mit der Verpflichtung zur Kritik, wie sie in Kants früheren Werken dargelegt wurde, vereinbar. Da ein solches Konzept der Freiheit in der ersten Kritik noch nicht verfügbar ist, ist es schwierig, Kants Legitimation der Zweckmäßigkeit von der früheren metaphysischen Tradition zu trennen. Insbesondere ist es Kant unmöglich, einen Begriff von Zweckmäßigkeit zu finden, der sich deutlich von der Vorstellung eines »intelligenten Designs« abgrenzt, auf die seine Vorgänger aus dem 17. und 18.Jahrhundert ihre Überlegungen über die Ordnung der Natur gründeten. Dies stellt ihn vor ein Problem. Entweder ist das Projekt der Integration der verschiedenen Arten des Gebrauchs der Vernunft zum Scheitern verurteilt, oder man entwirft eine alternative Konzeption der Zweckmäßigkeit, die frei von dogmatischen Annahmen über das Vorliegen von Ordnung in der Natur ist. Das Verständnis dieses Übergangs hat wichtige Implikationen sowohl für Kants späteres Werk als auch für seine Rezeption in der nachfolgenden deutschen philosophischen Tradition. Nur durch Kants reflexive Konzeption des Prinzips der Zweckmäßigkeit konnten die geschichtsphilosophischen Theorien, die das 19.Jahrhundert 23bestimmten, Kants kritische Verpflichtungen teilen. Wenn sie zur Metaphysik zurückkehrten, dann zu der kritischen Metaphysik, die Kant begründet zu haben hoffte.
Die »Architektonik der reinen Vernunft« verdient es, ernst genommen zu werden, weil sie der einzige Teil der ersten Kritik ist, der sich ausdrücklich mit der Einheit der Vernunft befasst und durch den wir die zentrale Bedeutung eines transzendentalen Prinzips der Zweckmäßigkeit für dieses Projekt verstehen. Sie hilft uns aber auch, zu verstehen, welche Form Annahmen über die Ordnung der Natur annehmen müssen, um dem Schicksal der dogmatischen Metaphysik zu entgehen. Obwohl das Projekt letztlich scheitert, ist dieses Scheitern lehrreich. Die »Architektonik der reinen Vernunft« enthält sowohl die Lösung als auch das Rätsel des Problems der Einheit der Vernunft. Die Beschäftigung mit diesem Abschnitt und die Integration seiner Ergebnisse in Kants weiteres philosophisches System helfen uns, die Evolution des Prinzips der Zweckmäßigkeit zu illustrieren und die revolutionären Implikationen der Abgrenzung dieses Prinzips von der Idee des »intelligenten Designs« zu verstehen, die Kants späteres Werk bestimmt.
***
Um die Bedeutung von Kants architektonischem Projekt zu erkennen, müssen wir am Anfang beginnen, mit den Seiten der Kritik der reinen Vernunft, die die Wichtigkeit der Einheit der Vernunft für unser Verständnis von Kants Gesamtprojekt hervorheben. Dies wird zunächst durch eine seltsame, aber kaum überraschende Metapher verdeutlicht: Die Summe der theoretischen Erkenntnisse der Vernunft wird mit dem Material verglichen, das für den Bau eines Gebäudes benötigt wird, dessen Art, Festigkeit und Höhe Kant im ersten Teil dieses Werks bestimmt zu haben behauptet. Obgleich die Vernunft ursprünglich angestrebt habe, einen majestätischen, bis zum Himmel reichenden Turm zu errichten, reiche das entdeckte Material nur für ein Wohnhaus, ausreichend für die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse. Die verbleibende Aufgabe der Kritik, die ihrer »Methodenlehre«, bestehe darin, den Plan zu entwerfen, nach dem dieser Bau vollendet werden solle (KrV, A 707/B 735).
Kants methodologisches Vorgehen wird hier durch einen im24pliziten, aber deutlichen Verweis auf den Mythos des Turmbaus zu Babel eingeführt. Er vergleicht sein eigenes Unternehmen mit früheren Darstellungen der Vernunft, deren Ambitionen das ihnen zur Verfügung stehende kognitive Material überstiegen und die deshalb daran scheiterten, die Philosophie auf festen Boden zu stellen. Diese gescheiterten Versuche sollen allen philosophischen Projekten, die die menschlichen kognitiven Kapazitäten übersteigen, als Warnung dienen. Da aber eine einheitliche Beschreibung der Vernunft auch für die Befriedigung ihrer besonderen Bedürfnisse notwendig sei, müsse sich dieser Herausforderung im Rest der ersten Kritik gestellt werden. So jedenfalls erklärt es Kant.
Die Verwendung gebäudebezogener Metaphern zur Einführung von Fragen der philosophischen Methode war bei Philosophen des 17. und 18.Jahrhunderts sehr beliebt. Um nur das bekannteste Beispiel zu nennen: In einem der ersten Kapitel von Descartes’ Abhandlung über die Methode wird mithilfe der Gebäudemetapher erklärt, warum der Autor die Notwendigkeit sah, von der scholastischen Untersuchungsmethode abzuweichen und sie durch eine radikalere Prüfung der ersten Prinzipien menschlichen Wissens zu ersetzen. Die Methode des Philosophen, so Descartes, gleiche der eines Baumeisters: Ein Baumeister, der ein Haus auf festen Grund bauen möchte, müsse zunächst den Boden untersuchen, das Terrain einschätzen und alles hinderliche Material entsorgen. Auf ähnliche Weise müsse der Philosoph, der sein Denken auf neuen und sicheren Grund stellen wolle, sich vergewissern, dass das Territorium untersucht, alles überflüssige Material entsorgt und Hindernisse aus dem Weg geschafft wurden, bevor er den Grundstein legen könne.[2]
Zugegeben, so betont Descartes, sei dies nicht die Art von Unternehmung, mit der sich Philosophen oder Baumeister typischerweise beschäftigen, und selbst wenn sie es täten, nähmen solche Aktivität selten die Form einer radikalen Zerstörung aller bisherigen Errungenschaften an. Dennoch komme es durchaus vor, dass einzelne bestehende Bauwerke durch passendere Gebäude ersetzt werden, wenn die Fundamente schwach sind und die Häuser zu zerfallen drohen. Auch wenn es also zunächst unvernünftig klingen möge, ein ganzes System zu zerstören, nur um es von Grund auf 25wieder neu zu errichten, könne es auch für einen Philosophen zuweilen sinnvoll sein, sein Urteil über spekulative Dinge zunächst zurückzuhalten und zu versuchen, alle bestehenden Überzeugungen zu prüfen.[3]
Kants Aufnahme der Gebäudemetapher zur Erklärung der Relevanz methodologischer Überlegungen in der Kritik der Vernunft knüpft an eine Tradition an, die insbesondere durch die Schriften von Leibniz und Wolff vermittelt wurde. Leibniz betonte, dass die Arbeit des Philosophen, der die Verbindung verschiedener Elemente innerhalb eines kohärenten Glaubenssystems zu begründen versuche, der Arbeit eines Architekten gleiche: Um ein Gebäude in einem Gebiet voll instabilem, staubigem Material zu errichten, müsse dieser tiefer graben, bis eine solide Grundlage gefunden sei.[4] Auf ähnliche Art vergleicht Wolff die methodologische Aufgabe des Philosophen mit der eines Architekten, der Teile der Pläne von früheren und bereits bestehenden Gebäuden wiederverwendet, um sein eigenes in Übereinstimmung mit dem Satz vom zureichenden Grund zu errichten.[5]
Doch Kants Wiederaufgreifen der architektonischen Metapher in der »Methodenlehre« und an anderen Stellen ist gegenüber der früheren metaphysischen Tradition zugleich zutiefst innovativ. Um diese Innovation zu sehen, ist es wichtig, den einzigartigen Charakter der Verteidigung der Vernunft in der ersten Kritik in den Blick zu nehmen, die zwei Kämpfe zugleich ausficht: den Kampf 26gegen den Dogmatismus und den gegen den Skeptizismus.[6] Anders als etwa bei Descartes gehen Kants Verteidigung der Vernunft und seine Abhandlung über die Methode dem Sammeln des nötigen Materials für das kritische Projekt nicht voraus, sondern folgen ihm nach. Während ferner für Descartes die Konstruktionsaufgabe eine Soloaufgabe ist, die für die individuelle Auseinandersetzung des Philosophen mit seinen eigenen Überzeugungen und Irrtümern notwendig ist, ist sie bei Kant das Ergebnis einer kollektiven, gemeinschaftlichen Anstrengung.[7] Ein letzter, wichtiger Unterschied besteht darin, dass Descartes bei der Aufstellung praktischer Regeln verspricht, bestehende Normen und Konventionen zu akzeptieren und einzuhalten. Über die Entwicklung einer Moraltheorie wird in der Abhandlung über die Methode nicht einmal nachgedacht. Bei Kant hingegen sind die Zwecke der Vernunft entscheidend für die Richtung, die das gesamte kritische Unterfangen einschlagen soll.
Diese wichtigen Unterschiede, zusammen mit Kants Verteidigung der Vernunft und der Bedeutung der Methode für die Bewerkstelligung dieser Aufgabe, werden weithin anerkannt und gewürdigt.[8] Kants eigener »discours de la méthode«, so wird oft gesagt, umreißt eher die Konstruktion eines Prozesses als die Herstellung eines feststehenden Produkts. Die Kritik der reinen Vernunft beweist weder die ewige Gültigkeit irgendeines metaphysischen Satzes noch gesteht sie dem Relativisten zu, dass demzufolge alles ungewiss sei. Im Gegenteil: Die Autorität der Vernunft wird bejaht, indem sie in den Mittelpunkt eines konstruktiven Projekts gestellt wird, das rekursiven und öffentlichen Charakter hat. Die Kohärenz ihrer Prinzipien wird durch einen Prozess der Bewertung menschlichen Wissens hergestellt, dessen kumulative Ergebnisse mit einem 27fortlaufenden Gespräch konfrontiert werden, dessen Regeln prinzipiell jeder zustimmen kann.[9] Die Einheit der Vernunft wird deshalb als auf moralischen oder sogar politischen Gründen beruhend betrachtet.[10] Wenn wir das Projekt auf diese Weise begreifen, können wir sehen, was Kant dazu befähigt, das kritische Projekt der Begründung der Metaphysik als Wissenschaft in der ersten Kritik zu vollenden.
Das Verdienst der neueren konstruktivistischen Interpretationen der ersten Kritik besteht darin, ihre Analyse weg von einem reinen Interesse an den theoretischen Dimensionen der kritischen Philosophie und hin zu einer integrierten Darstellung der Einheit der Vernunft zu lenken, die ihre praktischen Interessen mit einbezieht. Aber diese Interpretationen lesen die erste Kritik oft rückwärts, im Lichte dessen, was wir über die Natur der praktischen Vernunft auf der Grundlage von Kants nachfolgenden Werken wissen, und nicht auf der Grundlage dessen, was die Kritik selbst über die systematische Einheit der Erkenntnis und die Rolle der praktischen Interessen der Vernunft hergibt. Dies ist an sich kein großer Fehler: Die Ziele dieser Interpretationen sind oft eher rekonstruktiv als exegetisch, sie sind enger auf die Metaethik bezogen und zögerlich in der Zustimmung zu Kants Metaphysik.[11] Ich hoffe jedoch, zeigen zu können, dass mithilfe eines Einblicks in die Entwicklung von Kants »Architektonik« und einer kontextualisierten Analyse des ihr zugrundeliegenden Prinzips der Zweckmäßigkeit eine Darstellung der Vernunft entwickelt werden kann, die nicht nur mit verschiede28nen strukturalistischen Neuinterpretationen vereinbar ist, sondern womöglich auch den Beitrag einer richtig formulierten kantischen Metaphysik zu ihrem Projekt (oder zumindest einigen Versionen desselben) erhellen kann.[12] Obwohl meine Methode eindeutig textbezogener ist als die vieler konstruktivistischer Interpretinnen, gilt unser gemeinsames Interesse Kants Verteidigung der Vernunft gegen den doppelten Vorwurf des Dogmatismus und des Skeptizismus. Doch damit diese Verteidigung gelingen kann, ist es lehrreich, sich mit Kants Werdegang auseinanderzusetzen, mit seinem Fauxpas, seinem Zögern und seinen Durchbrüchen. Und obwohl die »Methodenlehre« dafür einen wesentlichen Ausgangspunkt darstellt, ist es wichtig, zugleich die Gründe für Kants eigene Unzufriedenheit mit den Ergebnissen seines architektonischen Projekts nach der Veröffentlichung der ersten Kritik einzusehen.
Dass es eine Art Neubewertung der »Methodenlehre« gab, ist offensichtlich, wenn wir das Schicksal von Kants architektonischen Plänen in dem Werk, das unmittelbar auf die erste Ausgabe der ersten Kritik folgte, in den Blick nehmen: die Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Hier scheint Kant sehr wenig Lust auf konstruktive Tätigkeiten zu haben: »Hohe Thürme und die ihnen ähnliche metaphysisch große Männer«, so schreibt er in einer Fußnote, »sind nicht für mich« (Prol, 373).
Man könnte meinen, dass diese Aussage lediglich die Position der ersten Hälfte der Kritik der reinen Vernunft zusammenfasst, ohne ihr etwas hinzuzufügen. Aber diese Interpretation wäre unvollständig. Wie schon betont wurde, werden Kants vorsichtige Aussagen im ersten Teil der ersten Kritik durch seine ehrgeizigeren Aussagen in der »Methodenlehre« und danach ergänzt. Doch in den Prolegomena scheint Kant diese konstruktiven Ambitionen wieder aufgegeben zu haben. Es fällt schwer, in diesem Werk auch nur Hinweise auf eine bescheidenere Art von Tätigkeit zu finden, die die Erkenntnisse der Kritik in Richtung einer Begründung der Metaphysik als Wissenschaft weiterentwickelt. Statt in Kontinuität 29mit Wolffs methodischen Vorgaben eine bestimmte Art von Gebäude abzureißen, um es durch ein adäquateres zu ersetzen, besteht die Aufgabe der kritischen Philosophie hier lediglich darin, einen Überblick über die Grundlagenarbeit zu liefern. Es gibt keinen Hinweis auf einen »neuen Plan«: Der konstruktive Enthusiasmus der Vernunft wird durch den Appell gebremst, das Projekt auf seinen kritischen Teil zu beschränken.
Die skeptische Interpretation der Prolegomena wird dadurch erhärtet, dass Kants Vorsicht gegenüber allen auf die Begründung der Metaphysik als Wissenschaft abzielenden Bemühungen mit einem hohen Lob für das Werk von David Hume und einer unmissverständlichen Anerkennung seines Einflusses auf das eigene Denken gepaart wird.[13] Die Prolegomena sind sehr klar in Bezug auf die Priorität einer Kritik, die in allen ihren systematischen Teilen vollständig sein müsse, bevor die Metaphysik auch nur eine »entfernte Hoffnung« werden könne (Prol, 261). Dies macht es schwierig, die Einwände derjenigen zu entkräften, die die Aufgabe der Kritik als verschieden von der Mission der Umwandlung der Metaphysik in eine Wissenschaft interpretieren. Selbst wenn Kant einmal ein flüchtiges Interesse an einer solchen Umwandlung gehabt haben sollte, so argumentieren die Skeptiker, hat er es wohl recht schnell wieder aufgegeben.[14]
Was also sollen wir der Kraft skeptischer Interpretationen der kritischen Aufgabe entgegensetzen?[15] Eine Betrachtung der nach30folgenden Entwicklung von Kants System kann womöglich eine Antwort liefern. Diese legt nahe, dass die Einheit der Vernunft ein unvollendetes systematisches Projekt bleibt, das Kant bis zur Kritik der Urteilskraft beschäftigt, wo schließlich das zweckmäßige Prinzip der reflektierenden Urteilskraft eine einheitliche Darstellung der Beziehung zwischen dem theoretischen und dem praktischen Gebrauch der Vernunft ermöglicht.[16] Das Problem ist einerseits, dass die Argumentation abgesehen davon, dass sie eine leicht stilisierte Version der drei Kritiken präsentiert (in der Die Kritik der reinen Vernunft von den Bedingungen der Möglichkeit theoretischen Wissens, Die Kritik der praktischen Vernunft von den Bedingungen der Möglichkeit praktischen Handelns und Die Kritik der Urteilskraft31vom Verhältnis der beiden zueinander handelt), den zahlreichen Verweisen auf die Einheit der Vernunft in mehreren früheren Werken nicht gerecht wird.[17] Andererseits wurden die wenigen Autoren, die sich dieser Interpretation widersetzen und auf Kants Einheitstheorie der Vernunft in früheren Werken aufmerksam machen, dafür kritisiert, dass sie lediglich auf die funktionalen Analogien zwischen der theoretischen und der praktischen Vernunft als Teile desselben philosophischen Systems hinweisen, ohne wirklich zu zeigen, wie eine organische Integration beider Arten des Gebrauchs der Vernunft erreicht wird.[18] Wenn wir aber annehmen, dass Kants Theorie der Einheit der Vernunft schon zur Zeit der ersten Kritik vollständig war, warum hat er dann die Aufgabe der Vereinigung als Projekt für die Zukunft bezeichnet statt als etwas bereits Vollendetes?[19]
Um den zweideutigen Status der Einheit der Vernunft in der Kritik der reinen Vernunft zu erkennen, müssen wir uns der Beschreibung der Metaphysik in ihrer Einleitung zuwenden. Das Schicksal der Metaphysik wird hier sowohl in durch und durch negativen als auch in überraschend optimistischen Worten beschrieben. Einerseits macht der düstere Ton von Kants Bemerkungen über die unvermeidbare Niederlage, die der Vernunft in jedem Versuch des Fortschreitens in metaphysischen Fragen bevorstehe, es schwer zu sehen, wie eine Wiederbelebung dieser untergegangenen Wissenschaft möglich sein soll, ohne dabei in die Fehler der Vorgänger zu verfallen. Andererseits stellt sich die Kritik der reinen Vernunft die Aufgabe, den »Kampfplatz dieser endlosen Streitigkeiten« (KrV, A VIII), der sich heute Metaphysik nennt, in einen sicheren Weg zu verwandeln, auf dem die Vernunft ohne Furcht vor dogmatischem Despotismus oder anarchischem Skeptizismus voranschreiten kann. Die Notwendigkeit der Metaphysik, so be32tont Kant auch in den Prolegomena, hänge mit dem »Interesse der allgemeinen Menschenvernunft« zusammen. Dafür sei es nötig, zuzugeben, dass »eine völlige Reform, oder vielmehr eine neue Geburt derselben nach einem bisher ganz unbekannten Plane unausbleiblich bevorstehe« (Prol, 257, meine Hervorhebung).
Bei der Analyse dieser Bemerkungen bestehen mehrere Interpretationen der ersten Kritik auf der Rolle des praktischen Interesses der Vernunft und darauf, dass die scheinbare Beschränkung des spekulativen Gebrauchs der Vernunft eine wichtige Erweiterung in ihrem »schlechterdings notwendigen praktischen Gebrauch« (KrV, B XXV) mit sich bringe. Ohne eine solche Einschränkung, so betont Kant, könnte die praktische Vernunft sich nicht über die Grenzen der Vernunft hinauswagen, ohne auf die Hindernisse der spekulativen Vernunft zu stoßen und mit sich selbst in Widerspruch zu geraten (KrV, B XXV). Aber welche Form nimmt die Rechtfertigung der Legitimität des praktischen Vernunftgebrauchs in der ersten Kritik an? Wie trägt die Behauptung der Einheit der Vernunft zur Klärung des Verhältnisses von Kritik und Metaphysik bei? Welche Begriffe ermöglichen die Verwirklichung der systematischen Einheit? Und wo findet Kant die philosophischen Mittel, um seine Darstellung der Einheit des Systems gegen die Einwände zu wappnen, auf die seine metaphysischen Vorgänger stießen?
In der neueren Literatur wird die Bedeutung der »Einheit der Vernunft« für Kants kritisches Projekt hervorgehoben und die Aufmerksamkeit auf die systematische Rolle der Ideen der Vernunft gelenkt. Viele Autorinnen haben argumentiert, dass die zweckmäßige Natur der Ideen und die Wichtigkeit der Verwirklichung des höchsten Gutes uns helfen zu verstehen, wie Kants kritische Mission sowohl als »negativ« als auch als »positiv« verstanden werden kann: Einerseits begrenzt der praktische Gebrauch der Vernunft die unzulässige Ausdehnung der spekulativen Vernunft auf Gegenstände, die in der sinnlichen Erfahrung nicht gegeben sind. Andererseits zeigt sie, wie das richtige Verständnis des reinen praktischen Gebrauchs der Vernunft den Glauben an metaphysische Begriffe wie Gott, Freiheit und die Unsterblichkeit der Seele begründen kann.[20]
33Das Ziel dieses Buches ist es, diese Interpretation in Frage zu stellen. Mein Argument ist, dass in der Kritik der reinen Vernunft zwar die Einheit der Vernunft durch die zweckmäßige Funktion der Ideen der Vernunft erreicht wird, das Projekt aber gleichwohl letztendlich daran scheitert, Kants eigenen kritischen Standards gerecht zu werden. Es scheitert, wie ich zu zeigen hoffe, weil die praktische Vernunft in der ersten Kritik kein eigenes Gebiet für ihre Gesetzgebung und keine notwendige Verbindung zur transzendentalen Freiheit hat: Dies ist etwas, das erstmals in der Grundlegung auftaucht, in der Kritik der praktischen Vernunft weiterentwickelt wird und Kants Analyse der Zweckmäßigkeit in der Kritik der Urteilskraft prägt. Es scheitert auch daran, dass Kant in Ermangelung dieser Verbindung das Prinzip der Zweckmäßigkeit weiterhin mit der Idee des »intelligenten Designs« statt mit der besonderen praktischen Normativität der Vernunft verbindet. Kants Rückkehr zum Status der Zweckmäßigkeit als Normativität in der Kritik der Urteilskraft muss im Lichte der Probleme bewertet werden, denen sich die Zweckmäßigkeit als Design in der ersten Kritik gegenübersah.
Nichts davon sollte überraschen. Als Kant an der Kritik der reinen Vernunft arbeitete, rechnete er noch nicht damit, eine separate Kritik der praktischen Vernunft und eine weitere Kritik der Urteilskraft zu schreiben.[21] Im Gegenteil: In dem berühmten Brief an Markus Herz aus dem Februar 1772 verkündete er, »daß es mir, was das wesentliche meiner Absicht betrifft gelungen sey, und ich itzo im Stande bin eine Critick der reinen Vernunft, welche die Natur 34der theoretischen so wohl als practischen Erkentnis, so fern sie blos intellectual ist, enthält vorzulegen« (BW, 132). Wie die Einleitung der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft zudem betont, dachte Kant zu diesem Zeitpunkt, dass »nicht eine einzige metaphysische Aufgabe« ungelöst geblieben sei (KrV, A XIII). Der Teil der ersten Kritik, in dem dieses Projekt zu Ende geführt wird, ist die »Architektonik der reinen Vernunft«. Sie ist der einzige Abschnitt des Buchs, in dem die Vernunft in ihrer Komplexität unter dem Gesichtspunkt des organischen Zusammenhangs zwischen ihrem theoretischen und praktischen Gebrauch analysiert wird. Das ausdrückliche Ziel des Abschnitts ist es, zu zeigen, in welcher Weise der praktische und der theoretische Gebrauch der Ideen nicht nur funktional analog sind, sondern durch ein Prinzip der zweckmäßigen Einheit integriert werden, das den Übergang von der Natur zur Freiheit ermöglicht.
Die Analyse der Entwicklung des Projekts der Einheit der Vernunft in der ersten Kritik, der Forderungen, die es auslösen, und der Schwierigkeiten, auf die es stößt, helfen uns, die radikal neue Richtung zu erhellen, die das Projekt in Kants späterem Werk annimmt. Die »Architektonik der reinen Vernunft« ist essenziell, um zu sehen, wie das Projekt der Einheit der Vernunft in der ersten Kritik ausgeführt wird, aber auch um Kants spätere Unzufriedenheit mit ihm zu erklären. Dies ist nicht nur aus einem Interesse für die Entwicklung von Kants Gedanken heraus wichtig, sondern auch, um einige Unklarheiten über die Beziehung zwischen Zweckmäßigkeit und der Idee Gottes zu klären, die spätere Kritiken von Kants Werk beeinflusst haben und die von ihm geprägte deutsche philosophische Tradition auszeichnen.
***
Dieses Buch lässt sich in drei Teile gliedern. Der erste Teil, der dem allgemeinen Problem der Einheit der Vernunft gewidmet ist, untersucht bestehende Interpretationen dieser Frage und verteidigt die Relevanz der »Architektonik« zur Erklärung des Verhältnisses zwischen dem theoretischen und praktischen Gebrauch der Vernunft. Das erste Kapitel hebt die Zentralität des Prinzips der Zweckmäßigkeit für das Projekt der Vereinigung hervor und stellt Kants Bemerkungen zur Architektonik in ihren historischen Kontext, wobei 35insbesondere das Verhältnis zwischen Kant und den architektonischen Projekten von Leibniz, Baumgarten, Wolff und Lambert untersucht wird. Es zeigt, dass Kant sich bestehende historische Quellen aneignete, um sein eigenes Projekt der Begründung der Metaphysik als Wissenschaft voranzutreiben und über eine vereinheitlichte Vision der Philosophie zu reflektieren, die eine scholastische und eine weltliche/weltbürgerliche Perspektive beinhaltet. Mit dieser Unterscheidung betont Kant die Wichtigkeit von Systematizität und Zweckmäßigkeit als Eigenschaften der menschlichen Vernunft und appelliert an die Notwendigkeit eines zweckmäßigen architektonischen Prinzips, um die spekulativen Erkenntnisse der Vernunft mit ihrem praktischen Interesse zu verbinden. Dieser Begriff der Zweckmäßigkeit, an dem sich die »Methodenlehre« orientiert, so argumentiert das Kapitel, wurde in vielen Interpretationen übersehen, ist aber hilfreich, um die Zentralität der »Architektonik der reinen Vernunft« in Kants gesamtem kritischen System wiederherzustellen.
Das nächste Kapitel untersucht die einleitenden Absätze der »Architektonik der reinen Vernunft« und vergleicht Kants Verständnis der Architektonik als »die Kunst der Systeme« mit den Projekten einiger seiner Vorgänger, darunter Leibniz, Wolff, Baumgarten und insbesondere Lambert. Die Analyse der Analogien und Unterschiede zwischen Kants Begriff der Architektonik und dem seiner historischen Gesprächspartner hilft, das Verhältnis zwischen »Ideen« und »Zwecken der Vernunft«, an das Kant in diesem Abschnitt und in den Vorlesungen zur Logik aus derselben Zeitperiode appelliert, zu verstehen. Das Kapitel endet mit dem Vorschlag, dass wir, um das Problem und die systematischen Implikationen des Prinzips der Zweckmäßigkeit in der ersten Kritik besser zu verstehen, untersuchen müssen, wie die »Architektonik« Kants Darstellung des theoretischen und praktischen Gebrauchs der Ideen, die wir in früheren Teilen dieses Werks finden, integriert und vervollständigt.
Der zweite Teil des Buchs ist der Analyse der Einheit der Vernunft aus theoretischer Perspektive gewidmet. Kapitel drei bietet eine Interpretation des Verhältnisses zwischen »Ideen« und »Zwecken der Vernunft«, die in der Analogie zwischen »System« und »Organismus« wurzelt, wie Kant sie in der »Architektonik« anführt. Durch die Identifizierung einiger Kontinuitäten und Diskontinui36täten zwischen Kants Position hier und seiner Position in der Einleitung der Kritik der Urteilskraft können wir die Verschiedenheit der Vorstellung von Zweckmäßigkeit in den beiden Werken besser verstehen. Eine Analyse von Kants Theorie der »Keime« zur Erklärung der Entwicklung organischer Wesen erklärt, wie die erste Kritik mit seiner frühen Philosophie der Biologie, insbesondere den Schriften zur Bestimmung des Begriffs der Menschenrasse, verbunden ist. Das Kapitel zeigt, dass die Funktion des Prinzips der Zweckmäßigkeit an dieser Stelle der Kritik noch immer mit der Idee von Zweckmäßigkeit als Design verbunden ist und sich aus einer präformistischen, von Leibniz und Bonnet inspirierten Entwicklungstheorie ableitet. Dieselbe Darstellung findet sich auch in anderen Schriften aus derselben Zeit, insbesondere in Kants Essay zur allgemeinen Geschichte. Der Vergleich ist insbesondere hilfreich, um seine Bemerkungen zur Bedeutung einer zweckmäßigen Konzeption der Geschichte mit seinen Forderungen nach systematischer Einheit in der »Architektonik« zu verbinden.
Kapitel vier versucht, ein vertieftes Verständnis des im Zentrum der »Architektonik« stehenden transzendentalen Prinzips der Zweckmäßigkeit zu entwickeln, indem die Wurzeln der Funktion und des Gebrauchs von Ideen in der ersten Kritik untersucht werden. Trotz des Fehlens eines systematischen Beweises, der die Legitimität zweckmäßiger Prinzipien zeigt (das heißt einer »Deduktion«, in Kants Begriffen), ist es möglich, Kants Bemerkungen über den Schematismus in der »Architektonik« mit seinen Beobachtungen über den legitimen Gebrauch von Ideen im »Anhang zur transzendentalen Dialektik« zu verbinden. Das Kapitel untersucht diese Verbindung, indem es die Funktion von Ideen und ihr Verhältnis zu den Verstandesbegriffen analysiert. Außerdem versucht es, Kants Bemerkungen zum hypothetischen Gebrauch der Ideen mit ihrer logischen Funktion und der Beziehung zwischen logischen und transzendentalen Prinzipien zu verbinden. Ich schlage vor, dass der »Anhang« am besten als (fehlgeschlagener) Versuch gelesen wird, dieselbe Art von Deduktion eines Prinzips der Zweckmäßigkeit anzubieten, das wir auch im Zentrum des Vereinigungsprojekts der dritten Kritik finden. Ich versuche aber auch zu zeigen, dass die Schwierigkeiten der Identifikation der genauen Natur des Verhältnisses zwischen einem Prinzip der Zweckmäßigkeit und der Annahme einer zweckmäßigen Ordnung der Natur die Unterschei37