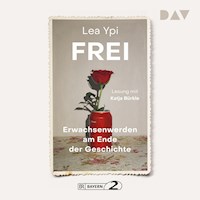13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Albanien 1989 – es herrschen Mangelwirtschaft, die Geheimpolizei und das Proletariat. Für die zehnjährige Lea ist dieses Land ihr Zuhause: ein Ort der Geborgenheit, des Lernens und der Hoffnung. Alles ändert sich, als die Mauer fällt. Jetzt können die Menschen wählen, wen sie wollen, sich kleiden, wie sie wollen, anbeten, was sie wollen. Aber die neue Zeit zeigt bald ihr hartes Gesicht: Skrupellose Geschäftemacher ruinieren die Wirtschaft, die Aussicht auf eine bessere Zukunft löst sich auf in Arbeitslosigkeit und Massenflucht. Das Land versinkt im Chaos, und Lea beginnt sich zu fragen, was das eigentlich ist: Freiheit.
In hinreißender Prosa erzählt die Autorin ergreifend über das Erwachsenwerden im poststalinistischen Albanien und in einer schillernden Familie, die vom Sturm der Geschichte erfasst wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cover
Titel
3Lea Ypi
Frei
Erwachsenwerden am Ende der Geschichte
Aus dem Englischen von Eva Bonné
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Titel der Originalausgabe:Free. Coming of Age at the End of History
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 5.Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 2024.
© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022© der Originalausgabe Copyright © Lea Ypi, 2021
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
nach Entwürfen von Olfa Kominek
eISBN 978-3-518-77243-0
www.suhrkamp.de
Widmung
7In Erinnerung an meine Großmutter Leman Ypi (Nini), 1918-2006
Motto
8»Die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken, aber sie machen sie selbst.«
– Rosa Luxemburg
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
5Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Motto
Inhalt
Teil
I
1. Stalin
2. Der andere Ypi
3. 471: eine kurze Biografie
4. Onkel Enver hat uns für immer verlassen
5. Coca-Cola-Dosen
6. Genossin Mamuasell
7. Sie riechen nach Sonnenmilch
8. Brigatista
9. Ahmet hat seinen Abschluss gemacht
10. Das Ende der Geschichte
Teil
II
11. Graue Socken
12. Ein Brief aus Athen
13. Alle wollen weg
14. Wettbewerbsspiele
15. Ich hatte immer ein Messer dabei
16. Das gehört alles zur Zivilgesellschaft dazu
17. Das Krokodil
18. Strukturreformen
19. Nicht weinen
20. Wie der Rest von Europa
21. 1997
1. Januar 1997
9. Januar
14. Januar
27. Januar
7. Februar
10. Februar
13. Februar
14. Februar
15. Februar
24. Februar
25. Februar
26. Februar
27. Februar
28. Februar
1. März
2. März
8:00 Uhr
10:00 Uhr
3. März
4. März
13:40 Uhr
5. März
7. März
12:30 Uhr
20:40 Uhr
8. März
9. März
10. März
11. März
13. März
14. März
9:50 Uhr
15:30 Uhr
17:00 Uhr
18:00 Uhr
15. März
12:30 Uhr
20:50 Uhr
16. März
17. März
18. März
19. März
20. März
25. März
29. März
6. April
22. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern
Epilog
Danksagung
Fußnoten
Informationen zum Buch
3
7
8
5
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
331
332
333
9Teil I
1.
11Stalin
Ich habe mich nie gefragt, was Freiheit bedeutet, nicht bis zu dem Tag, als ich Stalin umarmte. Aus der Nähe wirkte er viel größer als erwartet. Unsere Lehrerin Nora hatte uns erzählt, Imperialisten und Revisionisten stellten Stalin gern als kleinen Mann dar, doch tatsächlich sei er nicht so klein gewesen wie Ludwig XIV., über dessen Körpergröße – seltsamerweise – niemand je redete. Jedenfalls, fügte sie ernst hinzu, sei es ein typisch imperialistischer Fehler, sich auf Äußerlichkeiten zu konzentrieren statt auf das, was wirklich zählt: Stalin war ein Riese und sein Erbe weitaus wichtiger als seine Statur.
Was Stalin so besonders machte, fuhr Nora fort, war seine Fähigkeit, mit den Augen zu lächeln. Ist das zu glauben? Mit den Augen lächeln? Es lag daran, dass sein freundlicher Schnurrbart die Lippen verdeckte, und wer nur auf die Lippen achtete, würde niemals erkennen, ob Stalin gerade lächelte oder etwas anderes tat. Doch es genügte ein Blick in seine Augen – stechend, intelligent und braun – und man wusste Bescheid. Stalin lächelte. Manche Leute schafften es nicht, anderen in die Augen zu sehen. Offensichtlich hatten sie etwas zu verbergen. Stalin hingegen sah einen unverwandt an, und falls ihm danach war und man sich gut benommen hatte, lächelten seine Augen. Meistens trug er einen unscheinbaren Mantel und schlichte braune Schuhe, außerdem schob er sich oft die 12rechte Hand unters linke Revers, wie um sie sich aufs Herz zu legen. Die andere Hand ließ er oft in der Tasche.
»In der Tasche?«, fragten wir. »Ist es denn nicht unhöflich, mit der Hand in der Tasche herumzulaufen? Die Erwachsenen sagen uns immer, wir sollen die Hände aus den Taschen nehmen.«
»Nun ja«, sagte Nora. »In der Sowjetunion ist es sehr kalt. Außerdem«, fügte sie hinzu, »hatte Napoleon auch immer eine Hand in der Tasche, und da hat keiner behauptet, es wäre unhöflich.«
»Nicht in der Tasche«, sagte ich schüchtern. »In seiner Weste. Zu seiner Zeit galt das als Zeichen für eine gute Erziehung.«
Lehrerin Nora ignorierte mich und wartete auf die nächste Frage.
»Und er war klein«, ergänzte ich.
»Woher willst du das wissen?«
»Meine Großmutter hat es mir erzählt.«
»Was genau hat sie gesagt?«
»Sie hat gesagt, Napoleon war klein, aber als Marx' Lehrer Hangel, oder Hegel, ich weiß es nicht mehr, ihn gesehen hat, sagte er, man könnte den Weltgeist auf einem Pferd stehen sehen.«
»Hangel«, korrigierte sie mich. »Und Hangel hatte recht. Napoleon hat Europa verändert. Er war ein Wegbereiter der Aufklärung und ein großer Mann. Aber nicht so groß wie Stalin. Hätte Marx' Lehrer Hangel Stalin dort stehen sehen, natürlich nicht auf einem Pferd, aber vielleicht auf einem Panzer, hätte er ebenfalls vom Weltgeist gesprochen. Stalin war eine wichtige Inspiration für viele Menschen, nicht nur in Europa, sondern auch für Millionen unserer Brüder und Schwestern in Asien und Afrika.«
13»Hat Stalin Kinder geliebt?«, fragten wir.
»Natürlich!«
»Mehr als Lenin?«
»Ungefähr genauso sehr, aber seine Feinde haben immer versucht, das zu verheimlichen. Sie wollten Stalin schlechter als Lenin aussehen lassen, weil er stärker und für sie viel, viel gefährlicher war. Lenin hat Russland verändert, Stalin die ganze Welt. Aus diesem Grund wurde die Tatsache, dass Stalin Kinder ebenso sehr geliebt hat wie Lenin, nie offiziell festgestellt.«
»Hat Stalin Kinder so geliebt wie Onkel Enver?«
Lehrerin Nora zögerte.
»Noch mehr?«
»Ihr wisst die Antwort«, sagte sie mit einem warmen Lächeln.
Vielleicht hat Stalin Kinder geliebt. Wahrscheinlich haben die Kinder Stalin geliebt. Absolut fest steht nur, dass ich ihn nie mehr liebte als an jenem nassen Dezembernachmittag, als ich vom Hafen zu dem kleinen Park am Kulturpalast rannte. Ich schwitzte und zitterte und mein Herz klopfte so wild, dass ich fürchtete, es könnte mir aus dem Mund springen. Zwei Kilometer war ich gerannt, so schnell ich konnte, und dann hatte ich den kleinen Park entdeckt, und als Stalin am Horizont erschien, wusste ich, ich war in Sicherheit. Er stand dort so feierlich wie immer mit seinem unscheinbaren Mantel, den schlichten Bronzeschuhen und der rechten Hand unterm Revers, als hielte er sich das Herz. Ich blieb stehen, vergewisserte mich, dass niemand mir gefolgt war, und trat näher heran. Sobald ich die Wange an Stalins Oberschenkel legte und versuchte, seine Knie vollständig zu umarmen, wurde ich unsichtbar. Ich atmete tief durch, kniff die Augen zu und zählte. Eins. Zwei. 14Drei. Als ich bei siebenunddreißig angekommen war, hörte ich die Hunde nicht mehr bellen. Das donnernde Stampfen von Stiefeln auf Asphalt war ein fernes Echo. Nur die Rufe der Demonstranten hallten noch vereinzelt herüber: »Freiheit, Demokratie, Freiheit, Demokratie.«
Als ich mich ganz sicher fühlte, ließ ich Stalin los. Ich setzte mich auf den Boden und nahm ihn genauer in Augenschein. Auf seinen Schuhen trockneten die letzten Regentropfen, die Farbe des Mantels war verblasst. Stalin war genauso, wie Lehrerin Nora ihn beschrieben hatte: ein Bronzeriese mit unerwartet großen Händen und Füßen. Ich legte den Kopf in den Nacken, um zu sehen, ob sein Schnurrbart tatsächlich die Oberlippe verdeckte und er mit den Augen lächelte. Aber da war kein Lächeln. Keine Augen, keine Lippen, nicht einmal ein Schnurrbart. Die Hooligans hatten Stalins Kopf gestohlen.
Ich schlug mir die Hand vor den Mund und unterdrückte einen Schrei. Stalin, der Bronzeriese mit dem freundlichen Schnurrbart, der schon im Garten des Kulturpalastes gestanden hatte, als ich noch nicht einmal geboren war – geköpft? Stalin, über den Hangel gesagt hätte, er wäre der Weltgeist auf einem Panzer? Warum? Was wollten sie? Warum riefen sie »Freiheit, Demokratie, Freiheit, Demokratie«? Was sollte das bedeuten?
Über Freiheit hatte ich nie viel nachgedacht. Warum auch, wir hatten jede Menge Freiheiten. Ich fühlte mich so frei, dass mir die Freiheit manchmal wie eine Bürde erschien und gelegentlich, an Tagen wie diesem, sogar wie eine Bedrohung.
Ich hatte nicht in die Demonstration geraten wollen. Ich wusste ja kaum, was eine Demonstration war. Nur wenige Stunden zuvor hatte ich vor dem Schultor im Regen gestanden und mich gefragt, auf welchem Weg ich nach Hause gehen sollte: linksherum, rechtsherum oder geradeaus. Es stand mir frei, 15mich zu entscheiden. Jede Route warf andere Fragen auf, es galt, Gründe und Konsequenzen abzuwägen, die möglichen Folgen zu bedenken und eine Entscheidung zu treffen, von der ich wusste, dass ich sie am Ende vielleicht bereuen würde.
So wie an diesem Tag. Ich hatte frei entschieden, auf welchem Weg ich nach Hause gehen würde, und die falsche Wahl getroffen. Nach der letzten Stunde hatten wir Klassendienst. Beim Putzen wechselten wir uns in Vierergruppen ab, aber meistens erfanden die Jungen irgendeine Ausrede und ließen die Mädchen allein zurück. Ich hatte mir die Schicht mit meiner Freundin Elona geteilt. An normalen Tagen verließen Elona und ich nach dem Klassendienst die Schule und gingen bei der alten Frau vorbei, die an der nächsten Straßenecke auf dem Bürgersteig saß und Sonnenblumenkerne verkaufte. »Können wir mal probieren? Sind die mit Salz oder ohne? Geröstet oder nicht?«, fragten wir. Die Frau öffnete einen der drei mitgebrachten Säcke – einer für geröstet und gesalzen, einer für geröstet und ungesalzen, der dritte für ungeröstet und ungesalzen –, und wir durften uns aus jedem ein paar Kerne nehmen. An Tagen mit etwas Kleingeld hatten wir die große Auswahl.
Anschließend bogen wir nach links ab und gingen zu Elona. Unterwegs kauten wir Sonnenblumenkerne, und an der Tür mühten wir uns mit dem rostigen alten Schlüssel ab, den Elona an einer Halskette ihrer Mutter unter der Schuluniform trug. Einmal in der Wohnung, mussten wir uns für ein Spiel entscheiden. Im Dezember war das ganz einfach, denn zu der Zeit begann der nationale Liederwettbewerb. Wir dachten uns eigene Lieder aus und stellten uns vor, wir würden im Fernsehen auftreten. Ich schrieb die Texte, Elona war die Sängerin. Manchmal begleitete ich sie am Schlagzeug, was bedeu16tete, dass ich in der Küche mit einem großen Holzlöffel auf die Töpfe eindrosch. Aber in letzter Zeit hatte Elona das Interesse am Liederwettbewerb verloren. Sie wollte lieber Braut-und-Baby spielen. Statt in der Küche auf Töpfen zu trommeln, wollte sie im Elternschlafzimmer die Haarspangen ihrer Mutter ausprobieren, deren altes Brautkleid anziehen oder ihr Make-up auftragen und so tun, als würde sie die Puppen stillen, bis es Zeit fürs Mittagessen war. An diesem Punkt musste ich entscheiden, ob wir weiterspielen – was Elonas Wunsch war – oder ob ich sie dazu überrede, uns Rührei zu machen, oder ob wir, falls keine Eier im Haus waren, Brot mit Öl essen oder einfach nur Brot. Aber das waren vergleichsweise banale Entscheidungen.
Das wahre Dilemma offenbarte sich nach dem Streit, den Elona und ich an dem Tag gehabt hatten. Es ging um den Klassendienst. Elona wollte das Klassenzimmer fegen und wischen, denn andernfalls würden wir den Wimpel für die besten Putzkräfte des Monats, auf den ihre Mutter immer sehr erpicht gewesen war, nie bekommen. Ich entgegnete, dass wir eigentlich an ungeraden Tagen fegen und nur an den geraden fegen und wischen sollten, und weil heute ein ungerader Tag war, könnten wir früher nach Hause gehen und würden den Wimpel trotzdem bekommen. Elona sagte, dies sei nicht das, was die Lehrerin von uns erwarte, und erinnerte mich daran, dass meine Eltern wegen meiner schlampigen Putzarbeit ja schon einmal in die Schule zitiert worden seien. Ich sagte, da irre sie sich; der wahre Grund sei der Kontrolltrupp vom Montagmorgen gewesen, der meine Fingernägel für zu lang befunden habe. Sie erwiderte, das sei egal; so oder so bestehe die richtige Methode darin, den Klassenraum zu fegen und zu wischen, und wenn wir den Wimpel am Monatsende trotzdem bekämen, würde es sich anfühlen wie Schummeln. Außerdem, sagte sie, 17als sei die Diskussion damit beendet, putze sie zu Hause auf diese Weise, denn so habe ihre Mutter es immer gemacht. Ich erklärte Elona, dass sie nicht einfach jederzeit ihre Mutter ins Spiel bringen könne, nur um ihren Willen durchzusetzen, und stürmte wütend hinaus. Als ich vor dem Schultor im Regen stand, fragte ich mich, ob Elona möglicherweise erwarten durfte, von allen nett und freundlich behandelt zu werden, selbst wenn sie im Unrecht war. Ich überlegte, ob ich nicht besser so getan hätte, als liebte ich es, zu fegen und zu wischen, so wie ich ja auch vorgab, furchtbar gerne Braut-und-Baby zu spielen.
Ich hatte es ihr nie erzählt, aber eigentlich hasste ich das Spiel. Ich hasste es, im Schlafzimmer ihrer Eltern zu stehen und das Brautkleid ihrer Mutter anzuziehen. Das Kleid einer Toten zu tragen und die Schminke zu benutzen, die sie noch vor wenigen Monaten selbst benutzt hatte, machte mich fassungslos. Aber alles war noch ganz frisch, und Elona hatte sich sehr auf ihre kleine Schwester gefreut, die später mit meinem kleinen Bruder spielen sollte. Stattdessen war ihre Mutter gestorben, die Schwester im Waisenhaus und nur das Brautkleid noch da. Ich wollte Elona nicht verletzen, indem ich mich weigerte, es zu tragen, oder indem ich ihr sagte, wie sehr ich mich vor den alten Haarspangen ekelte. Natürlich stand es mir frei, ihr meine ehrliche Meinung zu Braut-und-Baby zu sagen, so wie es mir freigestanden hatte, sie das Klassenzimmer allein wischen zu lassen; niemand hielt mich auf. Ich kam zu dem Schluss, dass es besser wäre, Elona mit der sie möglicherweise verletzenden Wahrheit zu konfrontieren, anstatt sie bis in alle Ewigkeit anzulügen, nur um sie bei Laune zu halten.
Nun, da ich nicht nach links zu Elona ging, hätte ich nach rechts gehen können, das wäre der kürzeste Weg nach Hause 18gewesen. Er führte durch zwei schmale Gassen, die auf der Höhe einer Keksfabrik von der Hauptstraße abzweigten. An dieser Stelle tat sich ein neues Dilemma auf. Weil der Betrieb täglich von einem Lastwagen angesteuert wurde, der die Erzeugnisse auslieferte, versammelte sich dort nach Schulschluss eine beträchtliche Anzahl von Kindern. Wählte ich diesen Weg, würde ich mich der von uns so genannten »Keksaktion« anschließen müssen. Ich würde mit den anderen Kindern eine Schlange bilden, die sich an der Außenmauer des Betriebs entlangzog, mit ihnen aufgeregt die Ankunft des Lasters erwarten, die Ausgänge im Blick behalten und auf potenziell störenden Durchgangsverkehr achten, etwa auf Radfahrer oder auch Pferdefuhrwerke. Irgendwann würde sich die Tür des Betriebs öffnen und zwei Transportarbeiter würden heraustreten, die Kisten voller Kekse schleppten, wie zwei Atlasse, beladen mit dem Gewicht der Welt. In dem Moment würde es zu einem kleinen Aufruhr kommen, alle würden losstürzen und rufen: »Geizig, geizig, Kekse her, du Geizkragen!« Die Warteschlange aus schwarz uniformierten Kindern würde sich dann spontan aufteilen in eine Vorhut, die mit den Armen fuchtelt und versucht, sich an die Beine der Fahrer zu klammern, und in eine Nachhut, die zum Werktor ausschwärmt und die Ausfahrt blockiert. Die Arbeiter würden mit hektischen Bewegungen hüftabwärts versuchen, die Kinder abzuschütteln, während sie ihre obere Körperhälfte anspannen würden, um die Kisten noch fester im Griff zu haben. Eine Schachtel würde herunterrutschen, ein Handgemenge würde entstehen und irgendwann würde jemand von der Betriebsleitung aus dem Inneren des Gebäudes auftauchen, mit so vielen Keksen, wie es brauchte, um alle zufriedenzustellen und die Versammlung aufzulösen.
Es stand mir also frei, nach rechts zu gehen oder geradeaus, 19und wenn ich mich für rechts entschied, konnte ich damit rechnen, dass genau das eben Geschilderte geschieht. Es war alles ganz harmlos, und es wäre widersinnig, wenn nicht gar unfair, von einer Elfjährigen, die nicht auf der Suche nach etwas Süßem, sondern einfach nur auf dem Heimweg war, zu verlangen, den köstlichen Keksduft, der aus den geöffneten Fenstern des Backbetriebs strömte, auszublenden und einfach stur weiterzugehen. Ebenso widersinnig wäre es, von ihr zu verlangen, die schiefen, fragenden Blicke der anderen Kinder zu ignorieren und Desinteresse an der Ankunft des Lasters vorzuschützen. Und doch hatten meine Eltern am Vorabend dieses elenden Tages im Dezember 1990 genau das von mir verlangt, und so hing die Wahl des Nachhausewegs direkt mit der Freiheitsfrage zusammen.
In gewisser Weise war es meine Schuld. Niemals hätte ich so triumphierend mit den Keksen nach Hause kommen dürfen. Dann wiederum war es auch die Schuld der neuen Betriebsleiterin. Sie hatte erst vor Kurzem dort angefangen, war mit den Sitten des neuen Arbeitsumfelds noch nicht vertraut und hatte die Kinderversammlung an diesem Tag für ein einmaliges Ereignis gehalten. Statt wie alle ihre Vorgänger jedem Kind einen Keks zu geben, hatte sie ganze Schachteln ausgeteilt. Aufgeschreckt durch die Veränderung und das, was sie für zukünftige »Keksaktionen« vielleicht bedeutete, hatten wir unsere Beute, statt sie auf der Stelle zu essen, in unsere Schulranzen gesteckt und waren weggelaufen.
Ich gebe zu, ich hatte nicht mit dem Theater gerechnet, das meine Eltern veranstalteten, als ich ihnen die Kekse zeigte und erklärte, wie ich sie bekommen hatte. Ihre erste Frage verblüffte mich besonders: »Hat dich irgendjemand gesehen?« Selbstverständlich hatte mich jemand gesehen, nicht zuletzt die Person, die uns die Kekse gegeben hatte. Nein, ich konnte mich 20nicht genau an ihr Gesicht erinnern. Ja, sie war mittleren Alters. Weder groß noch klein, eher mittel. Dunkles, gewelltes Haar. Breites, herzliches Lächeln. Als ich das sagte, wurde mein Vater blass. Er stand aus seinem Lehnstuhl auf, beide Hände am Kopf. Meine Mutter verließ das Wohnzimmer und bedeutete ihm, ihr in die Küche zu folgen. Meine Großmutter strich mir wortlos übers Haar, und mein kleiner Bruder, dem ich einen Extrakeks geschenkt hatte, hörte auf zu kauen, setzte sich in die Ecke und fing vor lauter Anspannung an zu weinen.
Ich musste versprechen, mich nie wieder vor der Keksbäckerei herumzutreiben oder mich in die Warteschlange an der Hauswand einzureihen, außerdem musste ich versichern, dass ich verstanden hatte, wie wichtig es war, die Arbeiter ihre Arbeit machen zu lassen; denn wenn alle sich so verhielten wie ich, würde es in den Geschäften bald keine Kekse mehr geben. GE-GEN-SEI-TIG-KEIT, schärfte mein Vater mir ein. Der Sozialismus beruhe auf Gegenseitigkeit.
Als ich das Versprechen gab, war mir bereits klar, wie schwer es zu halten sein würde. Oder vielleicht auch nicht – wer weiß das schon? Jedenfalls musste ich mein Bestes geben. Dass ich an dem Tag geradeaus gegangen bin statt nach rechts oder zurück, um Elona nach dem Klassendienst abzuholen und Braut-und-Baby zu spielen, dass ich entschieden habe, die Kekse zu ignorieren, kann ich auf niemanden abwälzen. Das waren alles meine Entscheidungen. Ich hatte mein Bestes gegeben und war trotzdem zur falschen Zeit am falschen Ort gelandet, und nun hatte diese ganze Freiheit mir nichts gebracht als die blanke Angst, die Hunde könnten zurückkehren und mich in Stücke reißen oder ich könnte von einer Menschenmenge zertrampelt werden.
Natürlich hatte ich nicht ahnen können, dass ich in eine De21monstration geraten oder dass Stalin mir Zuflucht bieten würde. Wenn ich nicht kurz zuvor im Fernsehen die Bilder von Unruhen in anderen Städten gesehen hätte, wäre mir nicht einmal klar gewesen, dass das seltsame Spektakel aus Leuten, die Slogans skandieren, und Polizisten, die Hunde mit sich führen, »Demonstration« genannt wird. Wenige Monate zuvor, im Juli 1990, hatten Dutzende Albaner die Mauern einiger ausländischer Botschaften überwunden und sich gewaltsam Zutritt verschafft. Ich begriff nicht, wozu man sich in einer fremden Botschaft verschanzen sollte. In der Schule sprachen wir darüber, und Elona erzählte von einer sechsköpfigen Familie, zwei Brüdern und vier Schwestern, die sich als ausländische Touristen verkleidet in die italienische Botschaft in Tirana eingeschlichen hatten. Fünf Jahre lang lebten sie dort – fünf ganze Jahre – in zwei Zimmern. Dann bereiste ein weiterer Tourist unser Land, dieses Mal ein echter namens Javier Pérez de Cuéllar. Er sprach mit den Botschaftskletterern und übermittelte ihren Wunsch, in Italien zu leben, an die Partei.
Elonas Geschichte faszinierte mich. Ich fragte meinen Vater danach. »Das sind Uligans«, sagte er, »so hieß es zumindest im Fernsehen.« Hooligans, fügte er an, sei ein Fremdwort, für das es keine albanische Übersetzung gebe. Wir brauchten keine. Hooligans waren zumeist wütende junge Männer, die zu Fußballspielen gingen, sich betranken und Ärger machten. Sie prügelten sich mit den Fans der gegnerischen Mannschaft und verbrannten Flaggen ohne jeden Grund. Sie lebten größtenteils im Westen, kamen aber auch vereinzelt im Osten vor; aber weil wir weder zum Westen noch zum Osten gehörten, gab es sie in Albanien nicht. Bis vor Kurzem.
Noch während ich versuchte, meine Eindrücke zu verarbeiten, fielen mir die Hooligans ein. Ganz offensichtlich hätte ein Hooligan kein Problem damit, über Botschaftsmauern zu klet22tern, Polizisten anzubrüllen, die öffentliche Ordnung zu stören oder Statuen zu enthaupten. Im Westen gingen die Hooligans anscheinend ähnlich vor; vielleicht hatten sie sich bei uns eingeschlichen, um einfach Ärger zu machen. Die Leute, die vor ein paar Monaten über die Mauer geklettert waren, waren jedoch eindeutig keine Ausländer. Was also hatten diese verschiedenen Sorten von Hooligans gemeinsam?
Ich erinnerte mich vage an irgendwelche Demonstrationen, die ein Jahr zuvor an der Berliner Mauer stattgefunden hatten. Wir hatten darüber in der Schule gesprochen, und Lehrerin Nora hatte erklärt, sie hingen mit dem Kampf zwischen Imperialismus und Revisionismus zusammen, und wie sie sich gegenseitig einen Spiegel vorhielten, wobei beide Spiegel kaputt waren. Nichts davon gehe uns etwas an. Unsere Feinde versuchten regelmäßig, die Regierung zu stürzen, und ebenso regelmäßig scheiterten sie. Ende der Vierzigerjahre hatten wir uns von Jugoslawien losgesagt, weil es mit Stalin gebrochen hatte. Als Chruschtschow in den Sechzigerjahren Stalins Erbe entehrte und uns »linksnationalistisches Abweichlertum« vorwarf, kappten wir die diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion. In den späten Siebzigern kündigten wir unsere Allianz mit China auf, weil es beschlossen hatte, reich zu werden und die Kulturrevolution zu verraten. Uns kümmerte es nicht. Wir waren von mächtigen Feinden umzingelt, aber wir wussten, wir standen auf der richtigen Seite der Geschichte. Wann immer unsere Feinde uns bedrohten, ging die Partei, vom Volk unterstützt, noch stärker daraus hervor. Im Laufe der Jahrhunderte hatten wir gegen gewaltige Reiche gekämpft und dem Rest der Welt bewiesen, dass selbst eine winzige Nation am Rand des Balkans die Kraft zum Widerstand aufbringen konnte. Und nun führten wir den schwierigsten aller Umbrüche an: von der sozialistischen zur kommunistischen Freiheit, 23vom revolutionären, durch gerechte Gesetze geregelten Staat zur klassenlosen Gesellschaft, in der der Staat allmählich absterben würde.
Natürlich hatte die Freiheit ihren Preis, erklärte Lehrerin Nora. Immerzu hatten wir die Freiheit allein verteidigt, und nun war es an ihnen, den Preis zu zahlen. Sie trudelten ins Chaos, wir hingegen blieben standhaft. Wir würden weiterhin als gutes Beispiel vorangehen. Wir besaßen weder Waffen noch Geld, doch wir trotzten dem Sirenengesang des revisionistischen Ostens genauso wie dem des imperialistischen Westens; unsere Existenz schenkte all jenen kleinen Staaten, auf deren Würde nach wie vor herumgetrampelt wurde, neue Hoffnung. An die Ehre, in einer gerechten Gesellschaft zu leben, reichte höchstens unsere Dankbarkeit heran, vor dem Horror geschützt zu sein, der sich in anderen Teilen der Welt entfaltete, an Orten, wo Kinder verhungerten, in der Kälte erfroren oder zur Arbeit gezwungen wurden.
»Seht ihr diese Hand?«, hatte Nora gefragt und mit strenger Miene ihre Rechte in die Höhe gehoben. »Diese Hand wird immer stark sein. Diese Hand wird immer kämpfen. Und wisst ihr, warum? Weil sie Genosse Envers Hand geschüttelt hat. Nach dem Parteitag habe ich sie tagelang nicht gewaschen! Und selbst danach war seine Kraft noch spürbar. Sie wird mich nie verlassen, niemals, bis ich sterbe.«
Ich dachte an Lehrerin Noras Hand und an das, was sie erst vor ein paar Monaten zu uns gesagt hatte. Ich saß immer noch vor Stalins Bronzestatue auf dem Boden und versuchte, meine Gedanken zu ordnen, meinen Mut zusammenzunehmen, aufzustehen und nach Hause zu gehen. Ich wollte mich an jedes ihrer Worte erinnern und ihren Stolz und ihre Stärke heraufbeschwören, als sie uns gesagt hatte, sie werde die Freiheit immer verteidigen, weil sie Onkel Envers Hand geschüttelt hatte. 24Ich wollte sein wie sie. Auch ich muss meine Freiheit verteidigen, dachte ich. Auch ich muss meine Angst überwinden. Ich hatte nie Onkel Envers Hand geschüttelt. Ich hatte ihn nie getroffen. Aber vielleicht reichten Stalins Beine aus, um mir Kraft zu geben.
Ich stand auf und versuchte, zu denken wie meine Lehrerin. Wir lebten im Sozialismus. Der Sozialismus schenkte uns Freiheit. Die Demonstranten waren auf dem Holzweg. Niemand war auf der Suche nach Freiheit. Alle waren längst schon frei, so wie ich, sie übten diese Freiheit einfach aus oder verteidigten sie oder trafen Entscheidungen, zu denen sie stehen mussten, beispielsweise über den Nachhauseweg und ob man nach rechts, nach links oder geradeaus geht. Vielleicht waren sie, so wie ich, Richtung Hafen geirrt und hatten sich zur falschen Zeit am falschen Ort wiedergefunden. Vielleicht hatten sie beim Anblick der Polizisten und der Hunde einfach nur große Angst bekommen, was vielleicht ebenso für die Polizisten und die Hunde galt; auch sie hatten sich gefürchtet, besonders als sie die Menschen losstürmen sahen. Möglicherweise jagten beide Seiten einander, ohne genau zu wissen, wer hinter wem her war, und nur deshalb hatten die Leute angefangen, »Freiheit, Demokratie« zu rufen, aus Angst und aus Unsicherheit, um auf das hinzuweisen, was sie nicht verlieren wollten, und nicht auf das, was ihnen bislang fehlte.
Und vielleicht hatte Stalins Kopf nichts mit alldem zu tun. Vielleicht war er am Vortag durch den Sturm und den Regen beschädigt worden und jemand hatte ihn bereits abgeholt, um ihn zu reparieren und schon bald runderneuert zurückzubringen, mit den blitzenden, lächelnden Augen und dem dicken, freundlichen Schnurrbart, der die Oberlippe verdeckte, genauso, wie man ihn mir beschrieben hatte und wie er immer gewesen war.
25Ich umarmte Stalin ein letztes Mal, drehte mich um, fixierte den Horizont und versuchte, die Entfernung zu meinem Zuhause einzuschätzen. Dann holte ich tief Luft und rannte los.
2.
26Der andere Ypi
»Mais te voilà enfin! On t'attend depuis deux heures! Nous nous sommes inquiétés! Ta mère est déjà de retour! Papa est allé te chercher à l'école! Ton frère pleure!«,* donnerte eine große, schmale, ganz in Schwarz gekleidete Gestalt. Über eine Stunde lang hatte Nini oben auf dem Hügel gestanden und alle Vorbeikommenden gefragt, ob sie mich gesehen hätten, während sie sich nervös die Hände an der Schürze abwischte und angestrengt blinzelte, um mich und meinen roten Schulranzen in der Ferne zu erkennen.
Ich konnte sehen, wie wütend meine Großmutter war. Sie hatte eine merkwürdige Art zu schimpfen: Sie vermittelte einem das Gefühl von Verantwortung, erinnerte einen daran, dass das eigene Tun Auswirkungen auf das Leben der anderen hat, und dann zählte sie alle möglichen Weisen auf, in denen die Priorisierung der eigenen, selbstsüchtigen Interessen andere Leute daran hindert, ihre Ziele zu verfolgen. Während ihr französischer Monolog in unverminderter Lautstärke auf mich niederging, erschien mein Vater am Fuß des Hügels. Er lief keuchend bergauf, in der Hand sein Asthmaspray wie einen winzigen Molotowcocktail. Immer wieder sah er sich um, als 27fürchte er, verfolgt zu werden. Ich versteckte mich hinter meiner Großmutter.
»Sie hat nach dem Klassendienst die Schule verlassen«, rief mein Vater Nini zu. »Ich habe versucht, ihren Weg nachzugehen, aber ich habe sie nirgendwo gefunden.« Sichtlich aufgewühlt blieb er stehen und inhalierte einen Sprühstoß. »Ich glaube, es gab eine Demonstration«, fügte er im Flüsterton an und bedeutete meiner Großmutter mit einer Geste, dass sie besser drinnen weitersprechen sollten.
»Sie ist da«, sagte meine Großmutter.
Mein Vater atmete erleichtert auf, aber sobald er mich sah, wurde er streng.
»Ab in dein Zimmer«, befahl er.
»Das war keine Demonstration, das waren Uligans«, murmelte ich auf dem Weg durch den Hof. Ich fragte mich, warum er diesmal das andere Wort verwendet hatte: Demonstration.
Meine Mutter war unterdessen mit einem großen Hausputz beschäftigt. Gerade war sie dabei, Sachen vom Dachboden herunterzuschleppen, die wir jahrelang nicht zu Gesicht bekommen hatten: einen Sack Wolle, eine rostige Leiter und die alten Bücher meines Großvaters aus seiner Studienzeit. Ich konnte sehen, wie aufgebracht sie war. Sie neigte dazu, Frustrationen in Hausarbeit umzusetzen, und je schlimmer die Frustration, desto ehrgeiziger und größer das Projekt. Wenn sie auf jemanden wütend war, verlor sie kein Wort, sondern klapperte stattdessen mit Töpfen und Pfannen, verfluchte herunterfallendes Besteck und knallte die Schubladen zu. War sie auf sich selbst wütend, rückte sie die Möbel an die Wand, schob Tische aus dem Zimmer, stapelte die Stühle auf und rollte den schweren Wohnzimmerteppich ein, um den Boden darunter zu schrubben.
28»Ich habe Uligans gesehen«, sagte ich. Ich konnte es gar nicht erwarten, ihr von meinem Abenteuer zu berichten.
»Der Boden ist nass«, antwortete sie in drohendem Tonfall und tippte mir mit dem feuchten Mopp zweimal an den Knöchel, um mir zu signalisieren, dass ich mir die Schuhe hätte ausziehen müssen.
»Oder vielleicht waren es keine Hooligans«, fuhr ich fort und löste meine Schnürsenkel, »vielleicht waren es einfach nur Demonstranten.«
Sie hielt inne und sah mich verständnislos an.
»Der einzige Hooligan hier bist du«, sagte sie, hob den Mopp und schwenkte ihn zweimal in Richtung meines Zimmers. »In unserem Land gibt es keine Demonstranten.«
Für Politik hatte sie sich nie interessiert. In der Vergangenheit hatten nur mein Vater und seine Mutter, meine Großmutter, die Entwicklungen verfolgt. Sie unterhielten sich oft über die Revolution in Nicaragua oder den Falkland-Krieg; die jüngst aufgenommenen Verhandlungen zum Ende der Apartheid in Südafrika erfüllten sie mit Begeisterung. Mein Vater sagte, dass er, wäre er Amerikaner und zum Vietnamkrieg eingezogen worden, den Dienst verweigert hätte. Doch glücklicherweise, und das betonte er oft, unterstütze unser Land den Vietcong. Er neigte dazu, sich über die tragischsten Dinge lustig zu machen, und seine Witze über die antiimperialistische Politik waren bei uns Kindern legendär. Wenn Freundinnen bei mir übernachteten und wir auf dem Boden unser Bettenlager ausbreiteten, steckte er den Kopf zur Tür herein und rief: »Gute Nacht, Palästinensercamp!«
Aber seit den jüngsten Ereignissen im Osten, im »revisionistischen Block«, wie wir ihn nannten, hatte sich etwas verändert. Was, konnte ich nicht sagen. Ich erinnerte mich dunkel, im italienischen Fernsehen etwas von Solidarność gehört zu haben. 29Anscheinend hatte es mit Arbeiterprotesten zu tun, und da wir in einem Arbeiterstaat lebten, dachte ich, es wäre vielleicht ein interessantes Thema, um darüber etwas im »Mitteilungsblatt für politische Informationen« zu schreiben, das wir für die Schule vorbereiten sollten. »Ich finde das überhaupt nicht interessant«, sagte mein Vater, als ich ihn danach fragte. »Ich habe was anderes für dein Mitteilungsblatt. Die Kooperative des Dorfes, in dem ich arbeite, hat das im Fünfjahresplan festgelegte Produktionsziel für Weizen übertroffen. Sie haben zu wenig Mais erzeugt, aber das haben sie mit Weizen wettgemacht. Gestern Abend waren sie sogar in den Nachrichten!«
Wenn es um Demonstrationen ging, beantworteten meine Verwandten alle Fragen nur widerwillig. Plötzlich wirkten sie müde und gereizt, schalteten den Fernseher aus oder stellten den Ton so leise, dass die Nachrichten kaum noch zu verstehen waren. Anscheinend teilte niemand meine Neugier. Ich brauchte Erklärungen, aber auf sie war ganz offensichtlich kein Verlass. Weiser war es, auf den Moralkundeunterricht in der Schule zu warten und meine Lehrerin Nora zu fragen. Sie gab stets klare und unzweideutige Antworten. Alles Politische erläuterte sie mit einem Enthusiasmus, den meine Eltern nur zeigten, wenn im jugoslawischen Fernsehen Werbespots für Seifen oder Cremes liefen. Wenn mein Vater Werbung auf TV Skopje sah, ganz besonders die für Körperpflegeprodukte, rief er sofort: »Reklama! Reklama!« Dann ließen meine Mutter und meine Großmutter in der Küche alles stehen und liegen und eilten ins Wohnzimmer, um einen letzten Blick auf eine schöne Frau zu erhaschen, die uns verzückt lächelnd demonstrierte, wie man sich die Hände wäscht. Wenn sie es nicht rechtzeitig schafften und die Werbung vorüber war, sagte mein Vater zerknirscht: »Nicht meine Schuld, ich habe euch gerufen, ihr kamt zu spät!«, was normalerweise in eine Diskussion 30darüber ausartete, dass sie nur deswegen zu spät waren, weil er nie im Haushalt mithalf. Aus der Diskussion wurde schnell eine Schimpferei und daraus gelegentlich ein handfester Streit, oft während jugoslawische Basketballer im Hintergrund Körbe warfen; doch sobald die nächste Werbepause anbrach, war der häusliche Frieden wiederhergestellt. Meine Familie zankte sich über alles. Über alles außer Politik.
Im Kinderzimmer stieß ich auf meinen schluchzenden Bruder Lani. Als er mich sah, wischte er sich die Tränen aus dem Gesicht und fragte, ob ich Kekse mitgebracht hätte.
»Heute nicht«, sagte ich. »Ich bin einen anderen Weg gegangen.« Er sah aus, als würde er gleich wieder in Tränen ausbrechen.
»Ich muss hierbleiben«, sagte ich, »und nachdenken. Möchtest du eine Geschichte hören? Sie handelt von einem Mann auf einem Pferd, der aussah wie der Weltgeist, aber dann wurde ihm der Kopf abgehackt.«
»Ich will sie nicht hören!«, schrie er, und neue Tränen liefen ihm über die Wangen. »Ich habe Angst. Leute ohne Kopf machen mir Angst. Ich will Kekse!«
»Wollen wir ›Schule‹ spielen?«, fragte ich aus lauter schlechtem Gewissen.
Lani nickte. Wir liebten es beide, »Schule« zu spielen. Er setzte sich an meinen Schreibtisch, war der Lehrer und machte sich Notizen, während ich meine Hausaufgaben erledigte. Am liebsten mochte er Geschichte. Wenn ich mir ein Ereignis eingeprägt hatte, trug ich es ihm laut vor, inklusive dramatisierter Dialoge zwischen den wichtigen historischen Persönlichkeiten, teilweise verkörpert von meinen Puppen.
An dem Tag waren uns die Figuren und Ereignisse recht gut vertraut. Meine Klasse nahm gerade die Besetzung Albaniens durch italienische Faschisten im Zweiten Weltkrieg durch, wo31bei das Hauptaugenmerk auf der Rolle des zehnten Ministerpräsidenten lag. Dieser Mann, ein, wie Lehrerin Nora ihn nannte, albanischer Verräter, arrangierte nach König Zogus Flucht die Machtübergabe an die Italiener. Zogus Herrschaft und ihre Nachwirkungen machten allen albanischen Bestrebungen, eine wahrhaft freie Gesellschaft zu werden, ein Ende. Nach Jahrhunderten der Knechtschaft unter dem Osmanischen Reich und Jahrzehnten des Kampfes gegen Großmächte, die das Land unter sich aufteilen wollten, schlossen sich 1912 Patrioten aus allen Landesteilen zusammen, trotzten ethnischen und religiösen Differenzen und kämpften gemeinsam für die Unabhängigkeit. Dann eliminierte Zogu seine Gegner, erklärte Lehrerin Nora, dehnte seine Macht aus und krönte sich zum König von Albanien, bevor das Land mit der Unterstützung albanischer Kollaborateure von Faschisten besetzt wurde. Am 7. April 1939, dem offiziellen Datum der italienischen Invasion, kämpften viele tapfere Soldaten und Zivilisten gegen die italienischen Kriegsschiffe. Bis zu ihrem letzten Atemzug erwiderten sie den übermächtigen Artilleriebeschuss mit den wenigen Waffen, die ihnen zur Verfügung standen. Andere wiederum – die Beys, die Großgrundbesitzer und die Wirtschaftseliten, jene, die dem ausbeuterischen, blutrünstigen König gedient hatten – hießen die Besatzer willkommen und spekulierten auf einen Posten in der neuen Kolonialverwaltung. Einige von ihnen, darunter auch der ehemalige Ministerpräsident, dankten den Italienern sogar dafür, dass sie das Land von König Zogus schwerem Joch befreit hatten. Wenige Monate später kam besagter Ministerpräsident bei einem Luftangriff um. Sein Leben als Verräter, der mit dem König gemeinsame Sache gemacht hatte, und sein Tod als faschistischer Lump waren an dem Tag das Thema meiner Geschichtshausaufgabe.
Wenn wir in der Schule über Faschismus sprachen, waren 32alle sehr aufgeregt. Es kam zu lebhaften Diskussionen und die Kinder platzten fast vor Stolz. Wir wurden aufgefordert, von Verwandten zu berichten, die im Krieg gekämpft oder den Widerstand unterstützt hatten. Elonas Großvater beispielsweise war im zarten Alter von fünfzehn Jahren in die Berge gegangen, hatte sich den Partisanen angeschlossen und italienische Eindringlinge abgewehrt. Nach der Befreiung Albaniens 1944 war er nach Jugoslawien weitergezogen, um den dortigen Widerstand zu unterstützen. Er kam oft in die Schule, um über seine Zeit als Partisan zu sprechen und darüber, dass Albanien und Jugoslawien die einzigen Länder waren, die den Krieg ohne die Hilfe alliierter Truppen gewonnen hatten. Andere Kinder erzählten von Großeltern, Großonkeln und Großtanten, die den Antifaschisten Nahrung und Unterschlupf gewährt hatten. Andere brachten Kleidung oder persönliche Gegenstände von Vorfahren mit, die ihr junges Leben der Bewegung geopfert hatten: ein Hemd, ein besticktes Taschentuch, einen wenige Stunden vor der Hinrichtung geschriebenen Brief an die Familie.
»Haben wir Verwandte, die im Krieg gegen den Faschismus mitgemacht haben?«, fragte ich zu Hause. Alle dachten angestrengt nach, wühlten in alten Fotos, berieten sich mit Verwandten und kamen schließlich auf Baba Mustafa, den Großonkel des Großcousins der Frau meines Onkels. Baba Mustafa hütete den Schlüssel der örtlichen Moschee, und eines Nachmittags versteckte er dort eine Gruppe von Partisanen, die nach dem Abzug der Italiener und der Ankunft der Deutschen eine Nazigarnison überfallen hatten. Begeistert erzählte ich die Begebenheit im Unterricht nach. »Wie bist du noch mal mit ihm verwandt?«, fragte Elona. »Was hat er in der Moschee gemacht? Warum hatte er den Schlüssel?«, tönte Marsida, eine andere Freundin. »Was ist aus den Partisanen geworden?«, woll33te Besa, eine dritte, wissen. Ich versuchte, die Fragen so gut es ging zu beantworten, aber die Wahrheit war, dass ich nicht genug Informationen erhalten hatte, um die Neugier meiner Freundinnen zu befriedigen. Das Gespräch wurde erst konfus und dann unangenehm. Nach einem kurzen Hin und Her wirkten meine Verwandtschaft mit Baba Mustafa und sein Beitrag zum antifaschistischen Widerstand erst unbedeutend und dann aufgebauscht. Am Ende hatte ich den Eindruck, dass selbst Nora ihn insgeheim für ein Produkt meiner Fantasie hielt.
An jedem 5. Mai, dem Tag, an dem wir der Kriegshelden gedachten, besuchte eine Abordnung der Partei unser Viertel, um den Familien der Märtyrer abermals zu kondolieren und ihnen zu versichern, das Blut ihrer geliebten Angehörigen sei nicht umsonst vergossen worden. Ich saß am Küchenfenster und beobachtete voll bitterem Neid, wie meine Freundinnen in ihren besten Kleidern und mit großen Sträußen frischer roter Rosen auf dem Arm Fähnchen schwenkten, Partisanenlieder sangen und den Weg zu ihrem Haus wiesen. Ihre Eltern stellten sich in einer Reihe auf und schüttelten den Parteifunktionären die Hand, der Fotograf knipste Fotos und ein paar Tage später waren die Abzüge fertig und wurden in der Schule ausgestellt. Ich hatte nichts vorzuweisen.
Nicht genug, dass meine Familie keiner sozialistischen Märtyrer gedenken konnte; der albanische Kollaborateur, zehnter Ministerpräsident des Landes, Vaterlandsverräter, Klassenfeind und in Schuldebatten verdientes Ziel von Hass und Verachtung, trug zufälligerweise denselben Nachnamen wie ich und denselben Vornamen wie mein Vater: Xhafer Ypi. Jedes Jahr lasen wir seinen Namen im Geschichtsbuch, und jedes Jahr erklärte ich den anderen geduldig, dass wir zwar Namensvettern, aber nicht verwandt waren. Ich musste erklären, dass mein 34Vater nach seinem Großvater benannt worden war, der zufälligerweise genauso hieß wie der alte Ministerpräsident. Jedes Jahr aufs Neue grauste mir davor.
Mit angehaltenem Atem las ich die Geschichtshausaufgabe. Ich überlegte einen Moment, griff dann zornig nach dem Buch und stand auf. »Komm mit«, befahl ich Lani. »Es geht schon wieder um den anderen Ypi.« Lani folgte mir gehorsam, im Mund den Stift, mit dem er gemalt hatte. Ich schlug die Tür hinter uns zu und marschierte in Richtung Küche.
»Morgen gehe ich nicht in die Schule!«, verkündete ich.
Zunächst beachtete mich niemand. Meine Mutter, mein Vater und meine Großmutter saßen nebeneinander und mit dem Rücken zur Tür an einem kleinen Eichentisch dicht an dicht auf klapprigen Klappstühlen. Sie hatten die Ellenbogen auf die Tischplatte gestützt und die Hände an die Schläfen gelegt, und ihre Köpfe waren so weit nach vorne gebeugt, dass es aussah, als wollten sie sich jeden Moment vom restlichen Körper ablösen. Anscheinend waren sie in ein mysteriöses Ritual vertieft, doch ihre Rücken verdeckten das rätselhafte Objekt der Anbetung.
Ich wartete auf eine Reaktion, bekam jedoch nichts weiter zu hören als ein »Pssst«. Ich stellte mich auf Zehenspitzen und beugte mich vor. Mitten auf dem Tisch stand unser altes Radio.
»Morgen gehe ich nicht in die Schule!«
Ich hob die Stimme und ging ein paar Schritte in die Küche hinein. Das Geschichtsbuch in meiner Hand war an der Stelle mit dem Foto des Ministerpräsidenten aufgeschlagen. Lani stampfte mit dem Fuß auf und sah mich verschwörerisch an. Mein Vater drehte sich ruckartig und mit schuldbewusster Miene um, meine Mutter schaltete das Radio aus. Bevor der Empfang verhallte, schnappte ich noch zwei Wörter auf: »politischer Pluralismus«.
35»Wer hat euch erlaubt, aus eurem Zimmer zu kommen?« Die Stimme meines Vaters klang bedrohlich.
»Es geht schon wieder um ihn«, sagte ich mit immer noch lauter, nun aber leicht zittriger Stimme. Den Tadel überging ich einfach. »Um Ypi, den Verräter. Ich gehe morgen nicht in die Schule. Ich werde nicht schon wieder meine Zeit mit Erklärungen verplempern, dass wir mit diesem Mann nichts zu tun haben. Ich habe das längst allen erzählt, wieder und wieder. Aber sie werden erneut fragen, das weiß ich genau, so als hätte ich nie was gesagt und als wüssten sie es nicht besser. Sie werden fragen, wie sie es immer tun, und mir sind die Erklärungen ausgegangen.«
Ich hatte den Monolog schon öfter vorgetragen, jedes Mal, wenn in Geschichte, Moralkunde oder Albanisch das Thema Faschismus anstand. Meine Familie war strikt gegen das Schwänzen. Ich wusste, sie würden auch dieses Mal dagegen sein. Ich hatte ihnen nie begreiflich machen können, wie es sich anfühlte, von den eigenen Freundinnen unter Druck gesetzt zu werden. Und meinen Freundinnen hatte ich nie begreiflich machen können, wie es war, in einer Familie zu leben, für die das Vergangene anscheinend bedeutungslos war, die allein über die Gegenwart reden und die Zukunft planen wollte. Damals konnte ich mir ein latentes Gefühl nicht erklären, das ich erst heute in Worte fassen kann: dass es sich bei dem Leben, das ich in meinem Zuhause und draußen in der Welt lebte, tatsächlich nicht um eins handelte, sondern um zwei; zwei Leben, die sich manchmal wechselseitig ergänzten und einander stärkten, meistens aber mit einer Realität kollidierten, die ich nicht ganz verstand.
Meine Eltern starrten einander an. Nini betrachtete sie kurz, dann drehte sie sich zu mir um und sagte in einem ebenso festen wie tröstlichen Ton:
36»Selbstverständlich gehst du hin. Du hast nichts Falsches getan.«
»Wir haben nichts Falsches getan«, korrigierte meine Mutter. Sie streckte die Hand nach dem Radio aus, um mich wissen zu lassen, dass sie weiterhören wollte und meine Anwesenheit in der Küche nicht mehr erwünscht war.
»Es geht hier nicht um mich«, sagte ich. »Oder um uns. Es geht um den Kollaborateur. Wenn wir jemanden hätten, den wir für sein Heldentum feiern, könnte ich in der Schule über ihn reden und die anderen würden nicht mehr ständig nach meiner Verwandtschaft mit diesem anderen Ypi fragen. Aber wir haben niemanden in der Familie, nicht mal einen entfernten Verwandten. Keiner von uns hat je versucht, unsere Freiheit zu verteidigen. Niemand in diesem Haus hat sich jemals um die Freiheit geschert.«
»Das stimmt nicht«, sagte mein Vater. »Es gibt da jemanden. Dich. Du scherst dich um die Freiheit. Du bist eine Freiheitskämpferin.«
Das Gespräch nahm denselben Verlauf wie immer: Meine Großmutter argumentierte, es sei irrational, nur wegen eines Nachnamens Unterricht zu versäumen, mein Vater tat alles mit einem Witz ab und meine Mutter wandte sich wieder der Sache zu, bei der ich sie gestört hatte.
Aber diesmal passierte noch etwas Unerwartetes. Plötzlich ließ meine Mutter vom Radio ab, stand auf und drehte sich zu mir um. »Sag ihnen, dass Ypi nichts Falsches getan hat«, sagte sie.
Nini runzelte die Stirn und sah verwirrt meinen Vater an. Mein Vater griff mit besorgter Miene zum Asthmaspray, wich ihrem Blick aus und wandte sich stattdessen an meine Mutter. Meine Mutter stierte entschlossen zurück, ihre Augen blitzten vor Wut. Sie wirkte wie jemand, der ganz gezielt Unruhe stif37ten will. Sie ignorierte den stummen Vorwurf meines Vaters und sprach einfach weiter.
»Er hat nichts Falsches getan. War er ein Faschist? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Hat er die Freiheit verteidigt? Es kommt darauf an. Um frei zu sein, muss man erst einmal am Leben sein. Vielleicht hat er versucht, Leben zu retten. Welche Chance hatte Albanien denn gegen Italien? Albanien war von Italien abhängig, in jeder erdenklichen Weise. Wozu Blut vergießen? Die Faschisten hatten das Land doch längst übernommen. Die Faschisten kontrollierten alle Märkte. Es war Zogu, der ihnen Anteile an den staatlichen Unternehmen überschrieb. Lange vor den italienischen Waffen kamen italienische Waren ins Land. Selbst unsere Straßen wurden von Faschisten gebaut. Mussolinis Architekten haben unsere Regierungsgebäude entworfen, lange bevor seine Beamten dort eingezogen sind. Sie nennen es eine faschistische Invasion, aber …«
Sie hielt inne, beim Wort Invasion verzog sie den Mund zu einem sarkastischen Lächeln.
»Jetzt ist nicht der richtige Moment«, ging Nini dazwischen. Sie sah mich an. »Nur darauf kommt es an: Du hast nichts Falsches getan. Du hast nichts zu befürchten.«
»Wer sind sie?«, fragte ich ebenso verwirrt wie neugierig. Ich verstand nicht alles, was meine Mutter gesagt hatte, aber allein die Länge ihres Vortrags ließ mich aufhorchen. Große Erklärungen abzugeben, war nicht ihre Art. Zum ersten Mal hatte ich gehört, wie meine Mutter eine Meinung zu Politik und Geschichte äußerte. Mir war völlig unbekannt gewesen, dass sie eine besaß.
»Sie sagen, Zogu war ein Tyrann und ein Faschist«, fuhr meine Mutter fort, von meinen Fragen ebenso unbeeindruckt wie von Ninis Warnung. »Wozu gegen den einen Tyrannen aufbegehren, wenn man sich mit dem anderen arrangiert hat? Wo38zu mit seinem Leben die Unabhängigkeit eines Landes verteidigen, das praktisch längst besetzt ist? Die wahren Feinde des Volkes – Lass mich!«, unterbrach sie sich, fuhr aggressiv herum und sah meinen Vater an, der direkt neben ihr saß und jetzt schwer atmete. »Sie sagen, er war ein Verräter. Nun ja …«
»Wer sind sie?«, fragte ich noch einmal. Inzwischen war ich noch verwirrter.
»Sie, sie, das sind … sie meint die Revisionisten«, beeilte sich mein Vater, es an ihrer Stelle zu erklären. Dann hielt er inne, und weil er nicht weiterwusste, wechselte er das Thema: »Ich hatte dir doch gesagt, du sollst in dein Zimmer gehen und nachdenken. Warum bist du herausgekommen?«
»Ich habe nachgedacht. Ich will morgen nicht in die Schule.«
Meine Mutter schnaubte verächtlich. Sie verließ den Tisch und machte sich daran, mit Töpfen und Pfannen zu klappern und Besteck ins Spülbecken zu werfen.