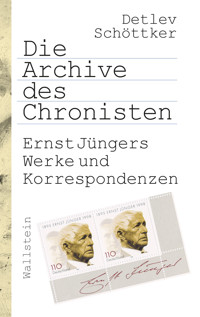
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie Briefe von Büchern erzählen – eine neue Sicht auf das Werk Ernst Jüngers. Viele Werke Ernst Jüngers basieren auf Briefen. In Tagebüchern und Schriften stützte sich Jünger auf Korrespondenzen, die er in einem, bis heute nur unzureichend erschlossenen Archiv im Umfang von etwa 130.000 Schreiben der Nachwelt überliefert hat. Dieses Briefarchiv enthält Informationen aus allen Phasen der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert, in die Jünger wie kaum ein anderer Schriftsteller eingebunden war. Als Sammler und Autor orientierte er sich an einer universalhistorischen Chronistik, die Erkenntnisse der Anthropologie und Naturgeschichte verwendet. In vier biografisch-werkgeschichtlichen Analysen geht Detlev Schöttker dem Zusammenhang zwischen Jüngers Tagebüchern, Schriften und Korrespondenzen nach. Neben den viel gelesenen Tagebuch-Chroniken »In Stahlgewittern« (1920), »Strahlungen« (1942–1958) und »Siebzig verweht« (1980–2003) behandelt das Buch weitere chronistische Werke, darunter die autobiografische Essay-Sammlung »Das Abenteuerliche Herz« (1929 und 1938), die Abhandlung »Der Arbeiter« (1932), die Erzählung »Auf den Marmorklippen« (1939), die naturhistorische Darstellung »An der Zeitmauer« (1959) und der Roman »Eumeswil« (1977) und bietet so neue Erkenntnisse zum Grundverständnis der Werke Jüngers.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Detlev Schöttker
Die Archive des Chronisten
Ernst Jüngers Werke und Korrespondenzen
Gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
Projekt SCHO 406/61
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der
Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2025
Wallstein Verlag GmbH
Geiststraße 11, 37073 Göttingen
www.wallstein-verlag.de
Umschlaggestaltung: Günter Karl Bose, Berlin
unter Verwendung der Briefmarke »Ernst Jünger« (1998);
© Deutsche Bundespost / Grafische Gestaltung: Antonia Graschberger
Lithografie: SchwabScantechnik, Göttingen
ISBN (Print) 978-3-8353-5871-3
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8846-8
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8847-5
Inhalt
Vorwort
Grundlagen: Tagebuch-Chroniken, Briefwechsel und Autorschaft
I. Nation und Welt: Krieg als chronistisches Projekt
1. Fortschreibungen: Von den Stahlgewittern zum Arbeiter
2. Soldaten als Leser: Nachrichten von »Mitkämpfern«
3. Dialogische Hierarchie: Bruderschaft und Autorschaft
II. Distanzierter Beobachter: Chronist im NS-Staat
1. Auf den Marmorklippen: Chronik des politischen Terrors
2. »Gefährlich leben!«: Reaktionen auf eine Erzählung
3. »Neue Literatur«: Die Strahlungen als Tagebuch-Chronik
Bildteil
III. Auf Horchposten: Geheime Mitteilungen
1. Verbindungen zur Résistance: Paul und Sophie Ravoux
2. Bombenkrieg und Ehekrisen: Gretha Jünger
3. Kontakte zu NS-Gegnern: von Niekisch zu Wulf
IV. Reaktionen auf Zeitgenossen: Netzwerke, Gegner, Anhänger
1. Weltgeschichte: Debatten mit Heidegger, Schmitt, Benjamin
2. Siebzig verweht: Briefchronik und Wegweiser ins Briefarchiv
3. Produktive Aneignung: Bernward Vesper und Heiner Müller
Schluss: Die Heiterkeit des Chronisten
Dank
Literaturverzeichnis
Abbildungsnachweise
Personen- und Werkregister
Anmerkungen
Vorwort
Auch weit über zwanzig Jahre nach seinem Tod am 17. Februar 1998 bleibt Ernst Jünger ein umstrittener Autor: von den einen als kalter Zeitdiagnostiker abgelehnt, von den anderen als herausragender Repräsentant der literarischen Moderne gewürdigt. In den Debatten über das Erstarken rechtsnationaler Parteien wird Jünger nicht selten sogar als Vordenker genannt. Die Auffassung geht an seinen Schriften allerdings vorbei, da er seit 1930 – mit Ausnahme des Buchessays Der Waldgang (1951) – keine politischen Beiträge mehr veröffentlicht hat. Er bevorzugte vielmehr autobiographische, essayistische und fiktionale Darstellungsweisen, die in vielen Büchern miteinander verknüpft werden. Zwar gibt es in den Artikeln, die Jünger zwischen 1925 und 1929 in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht hat, Bekenntnisse zum Frontsoldatentum und zur deutschen Nation, doch wurden sie abgelöst von Überlegungen zum Wandel der Arbeits- und Erfahrungsformen in der Moderne.
Jünger hat diese Wende in drei Werken vollzogen: in der ersten, 1929 erschienenen Fassung der autobiographischen Essay-Sammlung Das Abenteuerliche Herz, in der 1930 erschienenen Abhandlung Die Totale Mobilmachung und im Sizilianischen Brief an den Mann im Mond vom selben Jahr. Alle drei Texte scheinen wenig miteinander zu tun zu haben, bilden aber einen engen Zusammenhang. Nicht zufällig hat Jünger die Abhandlung zum industriellen Wandel im frühen 20. Jahrhundert und den Briefessay 1934 in den Band Blätter und Steine aufgenommen, den zweiten Text unter dem leicht veränderten Titel Sizilischer Brief an den Mann im Mond. Jünger bringt hier seine Bewunderung für den fiktiven Beobachter auf dem Erdsatelliten zum Ausdruck, da dieser, wie es heißt, nicht nur allen Menschen zugetan sei, sondern auch die Fähigkeit habe, über die »Verschiedenheit der Zeiten« hinweg Konstanten des menschlichen Verhaltens zu erkennen, die hinter der sichtbaren Oberfläche verborgen liegen. Jünger bezeichnet diese Fähigkeit als »stereoskopischen Blick«, eine Wahrnehmungsform, die er zuvor im Abenteuerlichen Herzen erläutert hat. Der Mann im Mond wird damit zur Personifikation jenes distanzierten und zugleich in die Tiefe schauenden Beobachters, der Jünger als Chronist der Moderne sein wollte.
Chronistik war die Grundidee der Tagebücher Jüngers. Über Acht Jahrzehnte hinweg notierte er hier Erlebnisse, Beobachtungen und Einsichten und ergänzte diese durch zeitübergreifende Erläuterungen. Die gedruckten Fassungen der Tagebuch-Aufzeichnungen gehören zu den bekanntesten Werken Jüngers und spielen auch in diesem Buch eine zentrale Rolle: InStahlgewittern (1920, seit 1922 in Neuausgaben), Strahlungen (1949, erweitert in drei Bänden 1963) und Siebzig verweht (1980 bis 1997 in fünf Bänden). Dass Jünger Aufzeichnungen in diesen Werken mit universalhistorischen Deutungen verknüpft hat, ist allerdings nicht frei von Widersprüchen. Wie der Mann im Mond ein Produkt der Fantasie ist, so gehört auch die Chronistik wegen der fließenden Übergänge zwischen Tatsachen und Fiktionen einer vergangenen Epoche der Geschichtsschreibung zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit an.
Seit Beginn des 19. Jahrhunderts hatten Historiker dagegen den Anspruch, Erklärungen für politische, kulturelle oder gesellschaftliche Entwicklungen auf der Basis schriftlicher Quellen und gesicherter Fakten zu liefern. Faktuale Narration, nicht chronologische Reihung von Vorgängen war das Medium, um historische Zusammenhänge darzustellen und zu erklären. Damit sollte die Geschichtsschreibung als Wissenschaft etabliert werden. Jünger aber orientierte sich in seinen Tagebüchern an der älteren Chronistik, die er aus Lektüren einschlägiger Werke kannte. Dabei ersetzte er die heilsgeschichtlichen Deutungsmuster seiner Vorläufer durch anthropologische und naturhistorische Erklärungen, die ihm seit seinem Studium der Zoologie in Leipzig Mitte der zwanziger Jahre bekannt waren.
Für Einblicke in die Zeitgeschichte und die Biografie Jüngers sind die Tagebücher deshalb nur bedingt geeignet. Abgesehen davon, dass die Aufzeichnungen selektiv und im eigenen Interesse verfasst sind, gibt es auch größere Lücken, da Jünger nach der Machtübernahme Hitlers im Jahr 1933 Papiere aus den vorausgehenden Jahren vernichtet hat und für die Zeit von 1949 bis 1964 keine Tagebuch-Aufzeichnungen überliefert sind. Die Leerstellen lassen sich durch Korrespondenzen füllen, die Jünger ebenfalls über Acht Jahrzehnte hinweg führte, in einem Archiv aufbewahrte und um Materialien zu den Partnern ergänzte. Viele der Briefe liefern Informationen aus allen Phasen der Geschichte im 20. Jahrhundert, in die Jünger wie kaum ein anderer Schriftsteller eingebunden war: Frontsoldat und Offizier im Ersten Weltkrieg, Verfasser von Kriegsbüchern und Mitarbeiter nationalistischer Zeitschriften in den zwanziger Jahren, freier Schriftsteller und Kritiker des NS-Regimes zwischen 1933 und 1939, Offizier der Wehrmacht in Paris während des Zweiten Weltkriegs und Autor zahlreicher Werke vom Beginn der Nachkriegszeit bis Anfang der neunziger Jahre.
Die Tagebücher und Korrespondenzen bilden eigenständige Archive der Zeitgeschichte, sind aber zugleich eng miteinander verbunden, da Jünger in vielen Aufzeichnungen Briefe erwähnt oder zitiert hat: zunächst vereinzelt in den Büchern zum Ersten Weltkrieg, dann vermehrt in den Tagebüchern zum Zweiten Weltkrieg und schließlich systematisch in den fünf Bänden Siebzig verweht seit Mitte der sechziger Jahre. Während die Tagebücher zu beiden Weltkriegen gut ediert und kommentiert sind, ist Jüngers Briefarchiv nur unzureichend erschlossen. Ein Grund ist der große Umfang, der den des gedruckten Werkes und seiner handschriftlichen Vorarbeiten deutlich übertrifft. Es handelt sich um etwa 130.000 Schreiben von mehr als 5.000 Verfassern. Mit vielen von ihnen hat Jünger über Jahre, zum Teil auch über Jahrzehnte hinweg korrespondiert. 1996 übergab er das Briefarchiv zusammen mit dem gesamten schriftlichen Nachlass dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach, wo der Bestand in den folgenden Jahren erfasst wurde und seither für die Benutzung zugänglich ist.
In der vorliegenden Darstellung werden die Tagebücher, Schriften und Korrespondenzen Jüngers als Grundlagen eines dokumentarisch-chronistischen Projekts zu Leben, Werk und Zeit gedeutet. Wegen der Fülle des Materials kann weder das gesamte Werk noch der gesamte Briefbestand berücksichtigt werden. An die Stelle summarischer Beschreibungen treten exemplarische Darstellungen, die einen Schwerpunkt in der Zeit- und Weltgeschichte haben. Jüngers Privatleben, das sich in den Briefen spiegelt, gehört dazu ebenso wie seine diaristischen, autobiographischen und essayistischen Bücher. Die Schriften zitiere ich nach der von Jünger und seiner Frau Liselotte betreuten Ausgabe der Sämtlichen Werke, die von 1978 bis 2003 in 22 Bänden erschienen ist (im Text mit der Sigle SW sowie Band- und Seitenzahl). Im Falle von Textänderungen, die Jünger für Neuausgaben seiner Schriften häufig vorgenommen hat, greife ich auf Erstdrucke oder die historisch-kritischen Ausgaben von Helmuth Kiesel zurück (zitiert mit Siglen und Seitenzahl). Briefe, die nicht veröffentlicht sind, finden sich im Nachlass Jüngers im Deutschen Literaturarchiv in Marbach (mit dem Nachweis DLA).
Einige Teilkapitel basieren auf Beiträgen, die ich während der Arbeit an diesem Buch in Zeitungen, Zeitschriften, Sammelbänden und im Rahmen von Editionen veröffentlicht habe (s. Literaturverzeichnis). Diese Beiträge sind für die vorliegende Publikation verändert und um neue Erkenntnisse erweitert worden. Das Kapitel »Grundlagen« dürfte vor allem für wissenschaftlich orientierte Leser von Interesse sein, die anderen auch für Jünger-Leser. Bei Verweisen auf Ausführungen innerhalb des Buches nenne ich die Ziffer des entsprechenden Kapitels in Klammern (z. B. s. IV.1.).
Grundlagen: Tagebuch-Chroniken, Briefwechsel und Autorschaft
Tagebücher und Briefwechsel haben Jüngers Leben und Schriften nicht nur begleitet, sie bilden die Grundlagen seiner Autorschaft. Schon die gleichnamige Hauptfigur der 1923 veröffentlichten Erzählung Sturm, ein junger Offizier, der als Selbstporträt angelegt ist, führt »in seiner freien Zeit« neben einer »Grabenchronik« einen »umfangreichen Briefwechsel« (SW 15, 20). Im Vorwort der 1949 erschienenen Strahlungen werden beide Darstellungsweisen ebenfalls miteinander in Verbindung gebracht. Jünger schreibt dort, dass sich seine »Autorschaft« im Zweiten Weltkrieg auf »Tagebücher« beschränke, wenn er von einem »ausgedehnten Briefwechsel und kleineren Schriften absehe« (SW 2, 17). Während er die Tagebücher Ende der vierziger Jahre in überarbeiteter Form veröffentlichte, druckte er in Siebzig verweht auch aktuell verfasste Briefe oder wies durch Zitierung älterer Schreiben auf das Briefarchiv hin.
Beim Schreiben von Tagebüchern und Briefen hat Jünger auch an sein Nachleben gedacht, wie aphoristische Texte in Siebzig verweht zeigen, die er in den Band Autor und Autorschaft (1984) übernommen hat. Dort heißt es über die von ihm präferierten Schreibweisen: »Tagebücher, Briefwechsel: das fünfte Rad am Wagen und vielleicht das einzige, das posthum weiterläuft« (SW 19, 199). Private Aufzeichnungen und Mitteilungen, so vermutlich der Gedanke, werden in der Regel erst nach dem Tod des Autors veröffentlicht, sodass er durch Publikationen im Bewusstsein seiner Leser weiterlebt. Diese Hoffnung auf weltliche Unsterblichkeit gehört seit der Antike zu den Grundgedanken der Literatur; sie wurde am Ende des 18. Jahrhunderts von Schriftstellern erneuert, die von Zeitgenossen nicht beachtet wurden, und ist bis in die Gegenwart lebendig geblieben. Für Jünger war die Hoffnung auf Unsterblichkeit ein Lebenselixier.
Aufzeichnungen und Mitteilungen
Prägnante Kurztexte sind die Basis aller Schriften Jüngers. Er war vor allem Diarist und Essayist, aber kein Mann fiktionaler Prosa, obwohl er eine Reihe von Erzählungen und Romanen veröffentlicht hat. Aber auch in diesen Werken wird nicht ausschweifend erzählt, vielmehr sind fiktionale Passagen meist durch Reflexionen unterbrochen, wie Jüngers Darstellungen zur Zukunft der Kommunikationstechnik in mehreren Werken zeigen: das Mobiltelefon in Heliopolis (genannt »Phonophor«), die Überwachungsdrohne in Gläserne Bienen (»Liliputroboter«) und das Internet in Eumeswil (»Luminar«). Es handelt sich nicht um dichterische Utopien, sondern prognostische Darlegungen in medienhistorischer Ausrichtung. In diesem Sinne bezeichnet der fiktive Herausgeber das von ihm aufgefundene Manuskript von Eumeswil am Ende des Buches nicht als Roman, sondern als »Aufzeichnungen« (SW 17, 379).
Den Begriff verwendete Jünger für diaristische und essayistische Schriften gleichermaßen: »Aufzeichnungen bei Tag und Nacht« lautet der Untertitel der 1929 erschienenen Essay-Sammlung Das Abenteuerliche Herz; mit »Kaukasische Aufzeichnungen« ist ein Kapitel in den Strahlungen (1949) überschrieben. Nachträge zu einzelnen Werken nannte Jünger »Adnoten«. Die Bezeichnung verwendete er für Ergänzungen zum Arbeiter (1932), die 1964 unter dem Titel Maxima – Minima erschienen sind, sowie für Erläuterungen zu der Erzählung Auf den Marmorklippen (1939) in einer Taschenbuch-Ausgabe von 1973. Sgraffiti nannte er schließlich eine 1960 erschienene Fortsetzung des Abenteuerlichen Herzen mit kurzen Prosatexten. Das letzte Buch Die Schere (1990) besteht ebenfalls aus aphoristischen Kurztexten, in denen alle Themen des Werkes nochmals vergegenwärtigt sind.
In Tagebüchern hat Jünger die Aufzeichnungen meist datiert, in essayistischen und autobiographischen Büchern dagegen nummeriert oder mit Überschriften versehen. Man kann diese Darstellungsweise auf die chronistische Geschichtsschreibung des späten Mittelalters oder auf das naturkundliche Schrifttum der Frühen Neuzeit zurückführen, die sich zum Teil überlagert haben.[1] Dies ist auch bei Jünger der Fall. In seinen Korrespondenzen mit Entomologen hat er die Tradition weitergeführt.[2]
Allerdings werden Tagebücher und Briefe – anders als Romane, Dramen, Gedichte und Essays – nicht zum Kern literarischer Werke gerechnet; der Literaturwissenschaftler Gérard Genette spricht sogar von »privaten Epitexten«.[3] Jünger war ganz anderer Auffassung: Er bezeichnete Tagebücher als »neue Literatur« und Briefe als »bestes Zeugnis« der Geschichtsschreibung (s. II.2 und III.3.). Darüber hinaus hatte er Vorbehalte gegen das reine Erzählen. So heißt es in einem Brief an seinen Bruder Friedrich Georg vom 18. April 1936, der die Übersendung des Manuskripts der autobiographischen Erzählung Afrikanische Spiele begleitete: »Besonders beschäftigt mich der bei solchen Rückblicken immer heikle Punkt – ob nämlich die Dosierung von Handlung und Reflexion im angemessenen Verhältnis steht« (DLA). In einer Aufzeichnung in den Strahlungen zu Theodor Fontanes Quitt heißt es ebenso: »Bei der Lektüre kam mir wieder der Gedanke, dass eine starke Erzählerkraft den Autor leicht schädigt, da in ihrem schnellen Strome das feine Geistesplankton nicht gedeiht« (15. September 1942; SW 377, 376 f.).
»Feines Geistesplankton«: Das ist eine treffende Metapher für die aphoristische Schreibweise, die auch bei anderen Autoren der Moderne in diaristischen, essayistischen und erzählenden Texten zur Anwendung kommt.[4] Gerhard Nebel, treuer Anhänger und langjähriger Korrespondenzpartner Jüngers, vergegenwärtigt die aphoristische Schreibweise in einem 1949 veröffentlichten Buch über die Entwicklung der Schriften, indem er jeweils an den Anfang der knapp 25 Werkkapitel ein Konvolut von Zitaten stellt. Dies, so Nebel, erinnere nur scheinbar »an einen Sentenzenkommentar«; vielmehr wolle er dem »deutschen Leser, der seine Jünger-Bücher während des Krieges« verloren habe, »eine Art Anthologie« bieten.[5] Auch wenn es Nebel hier wohl in erster Linie darum ging, seine Kenntnis des Werkes zu demonstrieren, hat er damit einen Grundzug von Jüngers Schreibpraxis vergegenwärtigt.
Sammeln und Verwerten
Während Jünger in Tagebüchern als distanzierter Beobachter auftrat, gab er sich in Briefwechseln als aufgeschlossener Dialogpartner, der Kontakte zu Freunden und Lesern in aller Welt unterhielt.[6] Wie die Tagebücher war das Schreiben von Briefen für ihn keine Nebensache, sondern Bestandteil der täglichen Schreibarbeit. Die Korrespondenz hat Jünger mehrere Stunden pro Tag beschäftigt, wie seine Sekretäre Armin Mohler und Heinz Ludwig Arnold, die zeitweise im Haus der Familie in Wilflingen lebten, bestätigt haben.[7] Ein von Jünger überliefertes Kontor-Buch, in dem zwischen 1947 und 1949 unter der Bezeichnung »Brief-Journal« Eingang, Inhalt und Beantwortung von Briefen exakt verzeichnet sind, gibt einen Einblick in Art und Umfang der Korrespondenzen für diese Jahre, wurde aber später nicht weitergeführt (DLA).
Als Jünger Ende der vierziger Jahre zu einer Leitfigur des literarischen Lebens wurde, wuchs seine Korrespondenz stetig an. Gleich in der zweiten Aufzeichnung in Siebzigverweht heißt es am 4. April 1965: »Immer noch Mengen von Post. Man muss den Reaktor klein halten, damit er nicht außer Kontrolle gerät« (SW 4, 9). Doch war dies offenbar nicht möglich. »Meine Post«, so der über Neunzigjährige an den französischen Journalisten Frédéric de Towarnicki, »ist täglich ein Abenteuer für mich. Leider kann ich es nur zum Teil bewältigen« (SW 22, 98). Auch wenn er sich postalisch zurückhielt, sammelte Jünger weiterhin alle Briefe: bis in die sechziger Jahre in Mappen und später in Archivkästen, die in einem Raum seines Hauses in Wilflingen aufgestellt waren, wo sie noch heute in Leerform zu sehen sind (Abb. 1).
Die Briefsammlung ist nicht isoliert, sondern ergänzt andere Sammlungen, die sich bis heute in Jüngers Haus in Wilflingen befinden (Abb. 2): eine umfangreiche Bibliothek, die in mehreren Zimmern untergebracht ist; eine große Käfersammlung, die sich zusammen mit einer Spezialbibliothek im Flur des ersten Stockwerks befindet; Sanduhren in Schränken; außerdem Naturobjekte an den Wänden, Fotos von Freunden und Bekannten auf einer Fensterbank, Spazierstöcke in zwei Bodenvasen, Muscheln in mehreren Körben, Fundstücke von Spaziergängen in einer Schale und vieles mehr.[8] Die wichtigsten Sammlungsteile hat Jünger in eigenen Schriften behandelt: Korrespondenzen und ihre Bedeutung für die Geschichtsschreibung in der essayistischen Erzählung Das Haus der Briefe (1951), die Geschichte von Zeitmessung und Zeiterfahrung in der Abhandlung DasSanduhrbuch (1954) und die Käfersammlung als Abbild der Natur in der autobiographischen Darstellung Subtile Jagden (1967). Hier berichtet Jünger nicht nur über seine entomologischen Aktivitäten, sondern äußert sich auch allgemein zu Fragen des Sammelns. Grundoperationen seien die »Zentrierung« des Objekts und dessen »Einordnung in ein System von Daten, die in Jahrzehnten gehortet« worden sind (SW 10, 91) (Abb. 3).
In einem Nachtrag stellt Jünger die Person des Sammlers in den Mittelpunkt: »Wenn man mich nach der Figur oder nach dem Mittelpunkt des Buches fragen würde, so möchte ich antworten: die anonyme Gestalt des Sammlers, die sich durch einen Zeitgenossen repräsentiert. Das Sammeln ist eines der großen Abenteuer des homo ludens, das weit in die Welt und ihre Mannigfaltigkeit hinausführt, gleichviel an welche Objekte es sich anheftet. Das können Bücher, Bilder, Kupferstiche, griechische Münzen, Schmetterlinge sein, selbst alte Scherben – in jedem Fall ist das Leben zu kurz, um die Fülle auszuschöpfen und ihr Genüge zu tun. Der Sammler ist der ständig nach Neuem begierige, doch auch immer wieder durch Neues beglückte Mensch« (SW 22, 418). Der Autor liefert hier ein Selbstporträt, für das seine Briefsammlung ein beredtes Zeugnis abgibt.
Als Jünger die Unterlagen 1996 zusammen mit dem schriftlichen Nachlass dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach verkaufte, umfasste das Briefarchiv etwa 90.000 Schreiben an ihn und etwa 40.000 von ihm in Abschriften oder Durchschriften.[9] Die Briefe wurden in den folgenden Jahren mit Angaben zu Datum, Absender und Adressaten in einer Datenbank erfasst, doch sind sie bisher nur zu einem geringen Teil einzeln verzeichnet worden. Dazu kommen – und dies ist ein Indikator für Umfang und Breite der Kommunikation – etwa 13.000 Briefe von Jünger in anderen Autoren-Nachlässen des Deutschen Literaturarchivs. Weitere Briefe in privaten und öffentlichen Archiven sind bisher nicht ermittelt worden und vom Umfang her schwer zu berechnen; ihre Zahl dürfte in die Zehntausende gehen.
Jünger bemühte sich seit Ende des Zweiten Weltkriegs darum, seine Briefsammlung zu erschließen. Er tat das in drei Schritten: 1945 nahm er eine alphabetische Ordnung nach Absendern der Schreiben vor, über die er 1958 in Jahre der Okkupation berichtet hat (s. III.3.). Mitte der sechziger Jahre ließ er von seinem Sekretär Heinz Ludwig Arnold ein alphabetisches Verzeichnis der Korrespondenten erstellen, das von seiner Frau Liselotte handschriftlich ergänzt wurde. Es enthält ca. 5.000 Namen, die bei größeren Briefwechseln durch ein »x« markiert sind (DLA). Den Bestand ergänzte das Ehepaar Jünger später fortlaufend um Dokumente zu den Briefpartnern, darunter Zeitungsartikel, Fotos, Rezensionen, Verlagsprospekte, Einladungskarten, Manuskripte und Todesanzeigen. »Wie für die meisten meiner Dossiers«, so Jünger nach dem Tod eines Freundes in Siebzig verweht, »ist die Todesanzeige das letzte Blatt. Meine Rolle als Türschließer« (28. November 1988; SW 21, 333). Zu vielen Korrespondenzpartnern liegen umfangreiche Materialkonvolute vor, die nicht nur Aufschluss über die Briefpartner, sondern auch über die produktive Rezeption von Jüngers Werk geben (s. IV. 3.).
In vielen Schriften Jüngers werden Briefe nicht nur erwähnt, sondern auch zitiert. In den autobiographischen Büchern zum Ersten Weltkrieg finden sich längere Schreiben an seinen Bruder Friedrich Georg (s. I.3.). In den Tagebüchern zum Zweiten Weltkrieg weist Jünger regelmäßig auf erhaltene Briefe hin oder zitiert diese als Dokumente (s. III.2.). Er folgt hier einem Vorbild, dem katholischen Schriftsteller Léon Bloy, der ebenfalls über 50 Jahre Tagebuch führte und Teile daraus veröffentlichte.[10] Wie bei ihm spielte bei Jünger die Selbstdarstellung im Spiegel der Briefe eine zentrale Rolle. So heißt es in einer Aufzeichnung vom 30. März 1940 in Gärten und Straßen, die er später gestrichen hat, um die eigene Eitelkeit nicht so deutlich hervortreten zu lassen: »Es scheint mir überhaupt, dass meine Post gewinnt, und das bestätigt mich in meiner Ansicht, dass die Welt gleich einer Waage auf unser Gewicht und Wachstum reagiert. Der Autor darf übrigens erwarten, dass in dem Briefe, den ein unbekannter Leser an ihn richtet, sich Zeichen äußern, wie sie mit dem Eintritt in ein Wirkungsfeld verbunden sind.«[11]
Solche Hinweise blieben nicht unbemerkt. So bezeichnete Carl Schmitt den Korrespondenzpartner Ende der vierziger Jahre in seinem Glossarium als »Brief- und Traum- und Tagebuchverwerter«.[12] Die Charakterisierung bezieht sich auf die Strahlungen, in denen Jünger auch Briefe von Schmitt erwähnt (23. Dezember 1942, 28. März 1943 und 30. August 1943). In einem späteren Schreiben an Nicolaus Sombart, das Schmitt ebenfalls in sein Glossarium aufnahm, wird aus der Feststellung ein Vorwurf, ohne dass Jüngers Name fällt (während er ihn an anderen Stellen auch persönlich angegriffen hat). Er schreibt: »Die heutige Methode der literarisch-publizistischen Verwertung aller Einfälle, die Fruktifizierung des eigenen Briefwechsels, die Ökonomie der schon bei der Niederschrift zum Druck bestimmten Tagebücher, das zerstört alle guten Möglichkeiten eines Briefwechsels.«[13]
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs – und damit beginnt die zweite Phase der Verwertung – ließ Jünger seine Briefe in zwei Reisetagebüchern drucken. In das Tagebuch einer Brasilien-Reise, die er 1936 unternahm und zehn Jahre später unter dem Titel Atlantische Fahrt veröffentlichte, nahm er elf Briefe an seinen Bruder Friedrich Georg auf. Ein 1949 erschienenes Buch über einen Norwegen-Aufenthalt im Jahr 1935 mit dem Titel Myrdun ist ganz aus Briefen an den Bruder zusammengesetzt (s. I.3.). Während der Druck einzelner Schreiben in Zeitungen, Zeitschriften und Sammlungen von untergeordneter Bedeutung ist,[14] ließ Jünger 1955 Teile seines Briefwechsels mit Hans Speidel, seinem zeitweiligen Vorgesetzten während der Besatzungszeit in Paris, in einer Festschrift zum 60. Geburtstag drucken, um ihre Verbundenheit zu dokumentieren.[15] Ein Jahr später übernahm er einen Brief von Martin Heidegger in sein Buch über Antoine de Rivarol, in dem dieser eine der von Jünger übersetzten Maximen kommentiert (SW 14, 326–328), um die seit Ende der vierziger Jahre bestehende Verbindung bekannt zu machen.[16] Aber dies waren Einzelfälle.
Seit Mitte der sechziger Jahre verwertete Jünger Briefe in größerem Umfang in seinen Schriften, sodass man von einer dritten Phase sprechen kann. In den 1965 begonnenen und 1996 abgeschlossenen Tagebüchern Siebzig verweht (von 1980 bis 1997 in fünf Bänden erschienen) druckte er ältere Briefe und Briefwechsel als Dokumente und setzte aktuelle Briefe an die Stelle von Aufzeichnungen. Siebzig verweht ist damit Briefchronik und Wegweiser ins Briefarchiv zugleich (s. IV.2.). 1975 veröffentlichte Jünger seine Korrespondenz mit dem Maler und Zeichner Alfred Kubin, mit dem er seit Anfang der zwanziger Jahre in Kontakt stand, nachdem ihn die Lektüre des Romans Die andere Seite zur Auseinandersetzung in zwei Beiträgen angeregt hatte.[17] Zur selben Zeit erweiterte er den Abdruck der beiden Buchessays Der Arbeiter und DasSanduhrbuch in den Sämtlichen Werken um Briefe von Lesern, die zur Klärung von Sachverhalten beigetragen haben (SW 8, 388 ff. und SW 12, 234 ff.).[18]
Archiv und Fortleben
Seit den siebziger Jahren finden sich in Jüngers Tagebüchern Aufzeichnungen zum Nachleben von Schriftstellern, die er in die Aphorismen-Sammlung Autor und Autorschaft (1984) übernommen hat (mit Nachträgen in SW 19). Die Überlegungen begleiten die Vorsorge für den eigenen Nachlass. Man kann Jünger deshalb – trotz der zahlreichen Veröffentlichungen zu Lebzeiten – als Archivautor bezeichnen. Herausgebildet hat sich der Typus seit Ende des 18. Jahrhunderts, etabliert erst am Ende des 19. Jahrhunderts mit der Einrichtung von Literaturarchiven. Archivautorschaft zielt auf die Nachwelt, geht also über »Werkpolitik« und »Werkherrschaft« hinaus, die auf die Verwertung von Schriften zu Lebzeiten bedacht sind.[19] Bei Jünger kommt hinzu, dass er in eigenen Werken wie erwähnt immer wieder auf das Material seines Briefarchivs zurückgegriffen hat, die Sammlung also in produktiver Weise verwendete, sodass er sich vom Typus des Nachlass-Autors unterscheidet. »Ein Historiker«, so heißt es 1977 in Jüngers Roman Eumeswil, »ist schwer denkbar ohne archivarische Neigungen« (SW 17, 55).
Die Idee des Literaturarchivs geht auf den Philosophen und Historiker Wilhelm Dilthey zurück. In einem 1889 veröffentlichten Vortrag mit dem Titel Archive für Literatur erhob er die Forderung, Aufzeichnungen, Briefe und unveröffentlichte Texte von Schriftstellern in Institutionen zu sammeln. Für Verordnungen gab es Staatsarchive, für Bücher gab es Bibliotheken, für Manuskripte von Schriftstellern aber keinen Ort der Aufbewahrung und Überlieferung. Dilthey begründete seine Forderung nach Literaturarchiven damit, dass autobiographische Zeugnisse einen höheren Rang hätten als gedruckte Werke. »Bücher«, so schreibt er, seien »Kräfte in einem abgeleiteten Sinn«; der »Atem des Menschen« aber gehe in erster Linie aus »Entwürfen, Briefen, Aufzeichnungen« hervor.[20]
Jünger teilte die Auffassung. In einer Aufzeichnung in Siebzig verweht vom 20. März 1980 berichtet er über die Lektüre der postum erschienenen Tagebücher Friedrich Hebbels, der seine Erlebnisse, Erfahrungen und Ideen zwischen März 1835 und Oktober 1863 so kontinuierlich und umfassend wie kaum ein Schriftsteller zuvor aufgezeichnet hatte. Er tue dies, so Hebbel in der ersten Eintragung, nicht nur für seine »künftigen Biographen«, sondern wolle zugleich »ein Notenbuch« seines »Herzens« vorlegen.[21] Die Lektüre von Tagebüchern, so Jüngers Kommentar zu Hebbel, ermögliche »eine größere Intimität« mit dem Autor. Der Leser trete durch sie »in eine Kammer ein, die sich hinter dem Werk« verberge, sodass er an der »geistigen Entwicklung« des Autors ebenso teilnehmen könne wie an ihren »äußeren Umständen« (SW 5, 588).
Die Hoffnung auf dauerhafte Wirkung hat an Attraktivität nicht verloren, da viele Autorinnen und Autoren ihre Unterlagen sammeln, um sie nach dem Tod, nicht selten auch schon zu Lebzeiten, öffentlichen Literaturarchiven auf Ewigkeit zu überlassen.[22] Auch Jünger hat sich über lange Zeit mit der Sicherung seines schriftlichen Nachlasses einschließlich seines Briefarchivs beschäftigt. Am 21. August 1942 betonte er in einem Schreiben an seinen Bruder Friedrich Georg, dass er die Briefe an ihn durch Publikation sichern möchte, als sein privates Archiv in Kirchhorst durch Bombenangriffe der britischen Luftwaffe auf Hannover und Umgebung gefährdet war (s. III.2.). Anlass war die erwähnte Auswahl von Briefen an den Bruder, die er in Myrdun (1943) drucken lassen wollte. Zugleich erweiterte er die Idee des »konservierenden Akts« durch die folgende Mitteilung: »Gern gäbe ich all meinen Briefen auf diese Weise ein wenig irdenen Stoff zum Überdauern, denn sie schildern Schritt um Schritt meine Erziehung, meine Geschichte, meine Vorlieben und Freundschaften« (DLA).
Die Erklärung blieb nicht isoliert. Am 1. April 1943 notierte Jünger in den Strahlungen unter dem Stichwort »Briefe«, dass er sich immer »Mühe« gebe, wenn er »an Friedrich Georg schreibe, auch an Carl Schmitt und zwei, drei andere« (SW 3, 33). Solche Schreiben sind in einem Konvolut enthalten, das Jünger 1948 unter der Bezeichnung »Brief-Journal« zusammenstellte und publizieren wollte (s. I.3.). Auch hier stand das Fortleben als Person im Vordergrund, wie ein Schreiben an Gerhard Nebel vom August 1948 zeigt. Während dieser die Auffassung vertrat, dass Korrespondenzen »erst erscheinen« dürften, »wenn wenigstens ein Briefpartner gestorben« sei, begründete Jünger sein Vorhaben zum einen mit der Unsicherheit der Nachlassbetreuung, zum anderen mit dem Wunsch nach einem postumen Leben. Er schreibt: »So ist es höchst fragwürdig geworden, ob Freundeshand jemals unseren Nachlass ordnen, ja ob von einem solchen Nachlass überhaupt die Rede sein kann. Insofern befinden sich alle Aufzeichnungen in ständiger Gefahr. Der Druck stellt demgegenüber eine Sicherung dar.« Deshalb plädiere er dafür, dass Autoren »als eigene Erbschaftsverwalter« auftreten sollten, wenn sie eine »posthume Existenz« führen wollten; man habe schließlich »Weltuntergänge« erlebt.[23]
Der Umgang mit unveröffentlichen Schriften veränderte sich nach der Gründung des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, in dem seit Mitte der fünfziger Jahre Nachlässe deutschsprachiger Schriftsteller aufgenommen wurden.[24] Jünger war über das Archiv gut informiert, da seine zweite Frau Liselotte bis zur Heirat im Jahr 1962 hier als Archivarin tätig war. In einem Brief an Carl Schmitt vom 20. Oktober 1972, den er in den zweiten Band von Siebzig verweht aufnahm, wies er auf die Erfahrungen seiner Frau hin: »Tausende von Briefen, zum Teil brisanten Inhalts, liegen in meinem Archiv. Beruhigend ist für mich die Tatsache, dass ich in meiner Frau eine zuverlässige Verwalterin im Haus habe. Sie ist Archivarin und hat lange Jahre hindurch die Cotta’sche Handschriftensammlung betreut.« Zugleich betont er: »Ich lasse diese Bestände schlummern: quieta non movere. Es fehlt nicht an Neugierigen. Die Edition von Briefwechseln bei Lebzeiten ist wenig ratsam; post mortem sollte man zuverlässige Betreuer haben, so weit das möglich ist« (SW 5, 99).
In einem zehn Jahre später verfassten Brief an Schmitts Haushälterin Anni Stand, den er ebenfalls in Siebzig verweht aufnahm, gibt Jünger Auskunft über den gemeinsamen Briefwechsel: »Wie ich von Carl Schmitt hörte, hat sich unsere Korrespondenz vollständig in seinem Besitz erhalten, obwohl sein Berliner Haus zerstört wurde und seine Bibliothek zeitweilig beschlagnahmt gewesen ist. Da die meisten Briefe an mich in seiner schönen Handschrift vorliegen, muss er entweder das Konzept oder eine Kopie verwahrt haben. Ich erhielt seine erste Nachricht am 14. Juli 1930 und die letzte am 6. Mai 1982, immer noch in prägnanter Schrift. Längere Pausen deuten an, dass unsere Harmonie entweder gestört (oder gestört worden) war.« Ergänzend heißt es: »Dazu der Briefwechsel zwischen Duschka Schmitt und meiner Frau Gretha, ferner Nachrichten aus dem Umkreise. Ich sollte wenigstens die Namen zusammenstellen – es wäre gut, wenn ich einmal dazu käme« (28. Dezember 1985; SW 20, 588 f.).
Viele Jahre später berichtet Jünger in einem Brief an Carl Schmitt vom 3. Januar 1992, den er ebenfalls in Siebzig verweht aufgenommen hat: »Professor Kaiser regt bei Liselotte wieder die Publikation unseres Briefwechsels an.« Doch wolle er, wie es weiter heißt, mit einer Veröffentlichung noch warten, da man der Korrespondenz »wie einem Wein in der Flasche noch Zeit gönnen« solle (3. Januar 1992; SW 22, 61). Schmitt erhob keinen Einspruch. Wie Jünger dürfte auch ihm die Bedeutung des Briefwechsels als zeitgeschichtliches Zeugnis bewusst gewesen sein.[25] Für eine Publikation waren wohl auch weitere Briefwechsel vorbereitet, die bald nach Jüngers Tod erschienen sind, darunter die mit Rudolf Schlichter, Martin Heidegger, Margret Boveri und Gerhard Nebel.[26] Doch handelt es auch hier um ein begrenztes Segment des Briefarchivs. Viele gehaltvolle und zum Teil über Jahrzehnte hinweg geführte Briefwechsel mit Freunden, Verwandten, Redakteuren und Wissenschaftlern sind nicht veröffentlicht worden. Der überwiegende Teil der Schreiben stammt von weitgehend unbekannten Personen, hat aber nicht selten großen Quellenwert, da viele Schreiben, wie zu zeigen ist, neue Sichtweisen auf Autor und Werk eröffnen.
Briefarchive von Schriftstellern
Zur Vorbereitung des Nachlebens gehörte in Wilflingen nicht nur die Archivierung von Korrespondenzen. Parallel dazu arbeitete das Ehepaar Jünger seit dem 80. Geburtstag des Autors an der Publikation einer zweiten Gesamtausgabe, die unter dem Titel Sämtliche Werke zunächst auf 18 Bände geplant war und nach Jüngers Tod mit aktuellen Schriften und Ergänzungen auf 22 Bände anwuchs (erschienen bis 2003). Aus dem Verkaufserlös des Archivs gründete das Ehepaar Jünger außerdem eine Stiftung zum Erhalt des Wohnhauses als Museum, das bereits wenige Jahre nach dem Tod von Ernst Jünger für Besucher geöffnet wurde. Hier finden sich auch Porträts bekannter Künstler (Zeichnungen, Gemälde und Büsten), die durch Reproduktionen zur visuellen Präsenz Jüngers in der Nachwelt beigetragen haben.[27]
Jüngers Nachwelt-Aktivitäten waren also ungewöhnlich groß. Doch hatte er Vorläufer, die in der Forschungsliteratur zum Teil behandelt wurden. Auf die Bedeutung von Briefen für die Rekonstruktion der intellektuellen Entwicklung von Autorinnen und Autoren hat Sigrid Weigel in der Einleitung zu ihrer 2002 erschienenen Monographie über Ingeborg Bachmann hingewiesen und dafür den Begriff der Konstellation verwendet.[28] Dieter Henrich machte den Begriff zwei Jahre später zur Grundlage eines Buches über die Entstehung des deutschen Idealismus, in dem er zeigen konnte, dass die vieldiskutierten Leitgedanken der Protagonisten in Briefen ihrer kaum bekannten philosophischen Lehrer vorbereitet waren.[29]
Dass diese Korrespondenzen nur lückenhaft oder zufällig überliefert worden sind, hängt mit dem fehlenden Nachlass-Bewusstsein bis Ende des 18. Jahrhunderts zusammen.[30] Doch ist über die Geschichte des Archivierens von Korrespondenzen bis heute wenig bekannt, da Briefe überwiegend als Kommunikationsmedium oder literarische Kunstform behandelt wurden.[31] In Publikationen zur Theorie des Archivs werden autobiographische Zeugnisse in der Regel nicht behandelt.[32] Ein Grund dafür ist, dass hier Ideen von Michel Foucault im Vordergrund stehen, der in seinem Buch Archäologie des Wissens einen für literarische Hinterlassenschaften wenig erkenntnisfördernden Archivbegriff verwendet hat. Als »Archiv« bezeichnet er eine Summe von »Aussagesystemen«, abstrahiert also im Sinne des strukturalistischen Paradigmas von Subjekten.[33] Schriftstellerinnen und Schriftsteller aber sind ihrem Selbstverständnis nach nicht Vertreter von »Aussagesystemen«, sondern wollen über den Tod hinaus als Individuen mit eigenen Ausdrucksweisen wahrgenommen werden.
Den Beginn dieses modernen Nachlass-Bewusstseins repräsentiert Goethe. Er war nicht der erste Autor, der unveröffentlichte Tagebücher und Briefe überliefert hat, vermutlich aber der erste, der diese zu seinen Lebzeiten zum Zwecke der Überlieferung von einem Fachmann archivieren ließ. In einem Beitrag mit dem Titel DasArchiv des Dichters und Schriftstellers, den er 1823, knapp zehn Jahre vor seinem Tod, in der Zeitschrift Über Kunst und Alterthum veröffentlichte, liefert er Erläuterungen zur Verzeichnung seines schriftlichen Nachlasses, in deren Mittelpunkt die Nachwelt steht.[34] Der Entschluss war folgenreich. Auf der Basis des Nachlasses entstand 1885 das Weimarer Goethe-Archiv, das vier Jahre danach als Goethe- und Schiller-Archiv weitergeführt wurde und später auch Nachlässe von anderen Weimarer Autoren aufnahm.
Auch Dilthey berief sich im anfangs erwähnten Vortrag auf Goethe. Sein Aufruf zur Gründung von Literaturarchiven nahm zwar die Entwicklung im 20. Jahrhundert vorweg, hat aber eine lange Vorgeschichte. Denn das Nachlass-Bewusstsein, das Ende des 18. Jahrhunderts entstand und nach Goethes Tod institutionalisiert wurde, basiert auf einem Nachwelt-Bewusstsein, das die Literatur seit der Antike prägte. Dauerhafter Ruhm, also das Weiterleben des Individuums im Gedächtnis der Nachgeborenen, ist nicht nur eine der wichtigsten Antriebsfedern des literarischen Schreibens, sondern auch Grundlage archivarischer Aktivitäten.[35] Hermann Lübbe verwendete für solche, in die Zukunft weisenden Aktivitäten den Begriff »Präzeption«. Gemeint ist damit eine kalkulierte Strategie der »Überlieferungsbildung«, die »ein künftiges historiographisches Rezeptionsinteresse quellenmäßig bedienbar« macht.[36]
Dennoch ist die Bewahrung literarischer Hinterlassenschaften keine hinreichende Grundlage dauerhafter Ruhmbildung. Sie muss durch Editionen und Interpretationen ergänzt werden, deren Protagonisten wiederum am Nachruhm von Autoren teilhaben.[37] Während Tagebücher mit überschaubarem Aufwand aus dem Nachlass ediert werden können, ist die Situation bei großen Briefarchiven komplizierter, da für deren Erschließung bis heute keine hinreichende Lösung gefunden wurde.[38] In der essayistischen Erzählung Das Haus der Briefe hat Jünger eine solche Erschließung in fiktionaler Form skizziert, die mit der zunehmenden Digitalisierung von Archivbeständen Realität werden könnte. Jünger verfasste die Erzählung in den späten vierziger Jahren nach der alphabetischen Sortierung seines Briefarchivs, veröffentlichte sie 1951 als Buch und übernahm sie 1980 in den 16. Band der Sämtlichen Werke. Der Text ist nicht nur irgendeine Erzählung, sondern bildet die gedankliche Grundlage der archivarischen Aktivitäten Jüngers. Ein Ich-Erzähler berichtet hier über den Besuch eines elektronisch perfekt ausgestatteten Archivs, das auf Briefe spezialisiert ist, aber auch Tagebücher berücksichtigt. Beide gelten als herausragende Quellen für die Geschichtsschreibung (s. III.3). »Briefsammlungen«, so heißt es hier, »sind wichtiger als Bibliotheken« (SW 16, 350).
Tagebücher und Chroniken
Die gedruckten Tagebücher Jüngers bilden die intellektuelle Essenz seiner handschriftlichen Aufzeichnungen. Sie unterscheiden sich durch Außensicht von literarischen Tagebüchern, in denen seit Mitte des 18. Jahrhunderts die Selbstbeobachtung im Vordergrund stand.[39] Durch Datierung unterscheiden sich Jüngers Tagebuch-Aufzeichnungen zugleich von Notizbüchern, die in Literatur und Philosophie der Moderne eine wichtige Rolle spielen.[40] Ähnlichkeiten weisen sie dagegen mit Chroniken auf, die über Jahrhunderte hinweg Grundlage der Geschichtsschreibung waren. Die Nähe mag bei einem Autor des 20. Jahrhunderts irritieren, da die Chronistik in der Geschichts- und Literaturwissenschaft dem Schrifttum des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit zugeordnet wird, in der Moderne aber keine Rolle zu spielen scheint.[41] Selbst in einem mehrbändigen Standardwerk wie den Geschichtlichen Grundbegriffen wird die Chronistik nicht behandelt, da Historiker seit dem späten 18. Jahrhundert das Erzählen zur Grundlage der Geschichtsschreibung gemacht haben.[42]
In der Literatur des 20. Jahrhunderts gibt es allerdings herausragende Werke, in denen Schriftsteller auf chronistische Verfahren zurückgegriffen haben, um die Vergangenheit nicht als abgeschlossenen Kosmos zu behandeln, sondern mit der Gegenwart in Verbindung zu bringen.[43] Dazu gehören Karl Kraus’ Weltkriegsdrama Die letzten Tage der Menschheit (1919/1922), Bertolt Brechts Stücke zum Nationalsozialismus wie Furcht und Elend des Dritten Reiches (1938) und Alfred Döblins vierbändiges Romanwerk November 1918 (1939–1950). Von Ideen der Chronistik sind darüber hinaus drei dokumentarische Werke beeinflusst, die die Literatur der Bundesrepublik seit den siebziger Jahren geprägt haben: Uwe Johnsons Jahrestage, Alexander Kluges Chronik der Gefühle und Walter Kempowskis Echolot, in denen Jüngers Tagebücher einen zentralen Stellenwert einnehmen (s. IV.2.).
Einer der wenigen Autoren, die darauf hingewiesen haben, dass die mittelalterlichen Chronisten Nachfolger hatten, war Walter Benjamin. Mit dem Thema war er vertraut, weil er auf die Verwendung von Chroniken in Dramen der Barockzeit aufmerksam geworden war, als er an seinem Buch Ursprung des deutschen Trauerspiels (1928) arbeitete.[44] Der mittelalterliche Chronist, so schreibt Benjamin später in seinem Aufsatz Der Erzähler (1936), deute Ereignisse der Geschichte »als Musterstücke des Weltlaufs«. Damit unterscheide er sich vom Historiker, der sich in erster Linie mit dem konkreten Verlauf von Ereignissen beschäftige. Dennoch sei der Chronist in der Neuzeit nicht untergegangen, sondern trete in der »säkularisierten Gestalt« eines »Geschichts-Erzählers« auf, wie Benjamin am Beispiel der Erzählungen von Johann Peter Hebel und Nikolai Lesskow erläutert.[45]
Chronistische Tagebücher hat Benjamin nicht berücksichtigt. Doch haben auch diese eine lange, auf die Renaissance zurückgehende Tradition, worauf Gustav René Hocke in seinem Buch Europäische Tagebücher aus vier Jahrhunderten hinweist.[46] Zwar verfolgt er die Entwicklung nicht bis ins 20. Jahrhundert, betont aber, dass sich das »politische Tagebuch« während der NS-Zeit von einem »chronistischen« hin zu einem »protestierenden Zeugenbericht« entwickelt habe.[47] Dabei bezog er sich auch auf Jüngers Strahlungen. Ob dieser darüber informiert war, ist unbekannt, traf Hocke aber 1968, fünf Jahre nach Erscheinen des Buches in Rom, nachdem beide bereits 1940 brieflichen Kontakt hatten (vgl. HB 66 f.). Anders als die bekannten Tagebücher Victor Klemperers zur NS-Zeit, die 1995 veröffentlicht wurden,[48] sind die Strahlungen aber kein »protestierender Zeugenbericht«. Vielmehr nimmt Jünger hier die Haltung des distanzierten Weltdeuters ein, die er 1930 im Sizilischen Brief vergegenwärtigt hat (s. II.3).
Jünger ließ diesen Text wie erwähnt zweimal nachdrucken, sodass er programmatische Bedeutung bekam: 1934 übernahm er ihn in den Essay-Band Blätter und Steine; 1979 stellte er ihn an den Beginn des neunten Bandes der Sämtlichen Werke. Die allegorische Deutung des fiktiven Mannes im Mond als distanzierter Weltdeuter hat eine visuelle Entsprechung auf den Schutzumschlägen dieser Gesamtausgabe. Es handelt sich um ein 1976 entstandenes Porträt des englischen Künstlers Michael Leonhard in Medaillon-Form, das Jünger im Kosmonauten-Outfit mit Cäsaren-Schnitt auf einem thronähnlichen Sessel zeigt, den Blick ins Weite gerichtet (Abb. 4). Die Bildverwendung dürfte also kein Zufall sein.
I. Nation und Welt: Krieg als chronistisches Projekt
Als Jünger nach Ende des Ersten Weltkrieges auf der Grundlage seiner Tagebücher mit der Arbeit an seinem Buch InStahlgewittern begann, gab es keine Vorbilder für die Darstellung von Kriegen über weite Räume hinweg mit unterirdischen Stellungen in Festungsgröße und industriell produzierten Waffen wie Panzern, Flugzeugen und Giftgas. Dieser historische Einschnitt hat Jünger nicht nur in den Stahlgewittern, sondern auch in vielen Schriften über zehn Jahre hinweg beschäftigt. Dazu gehören weitere Kriegsbücher bis zu Feuer und Blut (1925), die Abhandlung Die Totale Mobilmachung (1930) sowie mehrere, von ihm herausgegebene Dokumentationen und Sammelbände um 1930. Sieht man von der ersten Fassung des Abenteuerlichen Herzen (1929) ab, dann gipfeln die Darstellungen zum Krieg in dem umfangreichen Buchessay Der Arbeiter (1932), in dem Jünger die Überlegungen zu einer anthropologischen Theorie der Moderne erweitert hat. Die Schriften sind also nicht isoliert voneinander zu betrachten, sondern bilden einen Zusammenhang aus Zeitdiagnose und Zeitdokumentation.
Geht man über die Chronologie der Werke hinaus, dann lassen sich drei Ebenen unterscheiden, auf denen Jüngers Auseinandersetzung mit dem Ersten Weltkrieg und seinen Folgen stattfand: erstens die autobiographischen Bücher der frühen zwanziger Jahre, die in der Totalen Mobilmachung und im Buchessay Der Arbeiter historiographisch weitergeführt werden; zweitens die systematische Sammlung der Briefe von Frontsoldaten aus deutschsprachigen und angelsächsischen Ländern, die Jünger für spätere Bearbeitungen der Stahlgewitter verwendete und damit zum Ursprung seines Archivs geworden sind; drittens mehrere Dokumentationsbände zum Krieg, die Jünger zum Teil in Zusammenarbeit mit seinem Bruder Friedrich Georg veröffentlichte und die Basis einer lebenslangen, aber auch konfliktreichen Zusammenarbeit zwischen beiden geworden sind.
1. Fortschreibungen: Von den Stahlgewittern zum Arbeiter
Im Vorwort zur ersten, 1920 im Selbstverlag erschienenen Ausgabe der Stahlgewitter schreibt Jünger, das Buch sei der »in Form gebrachte Inhalt« seiner »Kriegstagebücher« (STG I, 20).[1] Von 1914 bis 1918 hielt er in Tagebuch-Aufzeichnungen, die er in seinem Archiv überliefert hat, Erlebnisse als Soldat und Offizier an der Westfront fest.[2] Gleichzeitig berichtete er darüber in Briefen an die Eltern und an den Bruder Friedrich Georg.[3] Die diaristische und die briefliche Form der Berichterstattung werden im Vorwort der Stahlgewitter zusammengeführt. Der erste Satz lautet in diesem Sinne: »Noch wuchtet der Schatten des Ungeheuren über uns. Der gewaltigste der Kriege ist uns noch zu nahe, als dass wir ihn ganz überblicken, geschweige denn seinen Geist sichtbar auskristallisieren« (ebd., 18). Gleich im zweiten Satz geht Jünger von der persönlichen Erfahrung zur historischen Deutung des Krieges über: »Eins hebt sich indeß immer klarer aus der Flut der Erscheinungen: Die überragende Bedeutung der Materie. Der Krieg gipfelte in der Materialschlacht; Maschinen, Eisen und Sprengstoff waren seine Faktoren. Selbst der Mensch wurde als Material verwertet« (ebd.). Aus dieser dualen Form der Kriegsdarstellung, der persönlichen und der historischen, entwickelte sich nach und nach ein chronistisches Projekt zur Deutung des Krieges und seiner Folgen.
Kriegserfahrung und Geschichtsschreibung
Jünger schildert in den Stahlgewittern eine vier Jahre währende Soldatenzeit an der Westfront in zwanzig zeitlich aufeinanderfolgenden Episoden. Die Erfahrungen werden hier nicht nur festgehalten, sondern zugleich historisch eingeordnet. Die Darstellungsweise weist Überschneidungen zu Chroniken auf, auch wenn Jünger im Untertitel der ersten Ausgabe an der Bezeichnung Tagebuch festhielt: Aus dem Tagebuche eines Stoßtruppführers. In der Bearbeitung von 1934 wird daraus Ein Kriegstagebuch. Seit der Bearbeitung von 1961 ließ Jünger den Untertitel weg, sodass nur noch das Kapitel »Vom täglichen Stellungskampf« an den diaristischen Ursprung erinnert (SW 1, 56–73). Im Vorwort der Bearbeitung von 1924 beruft sich Jünger zwar ebenfalls auf sein Tagebuch, betont nun aber den reflektierenden Zugriff. Er wolle die Darstellung des Krieges, so heißt es, durch den »stilisierten Bericht« noch »umfangreicher und tiefer« gestalten, denn der »Geist« stehe »über Ort und Zeit« (STG I, 24). Hier spricht kein Tagebuch-Autor, der persönliche Erfahrungen aufzeichnet, sondern ein Chronist, der Erinnerungs- und Deutungsarbeit für eine Gemeinschaft leisten will.
Durch die historiographischen Erläuterungen unterscheiden sich die Stahlgewitter von anderen Tagebüchern des Ersten Weltkriegs, selbst wenn diese dokumentarische Einfügungen wie Zeitungsmeldungen oder offizielle Verlautbarungen enthalten.[4] Zugleich unterscheidet sich Jüngers Buch durch die Erlebnisebene von philosophischen Deutungen des Krieges, die bald nach Ausbruch publiziert worden sind.[5] Zu ihnen gehören neben Beiträgen von Georg Simmel, Werner Sombart und Thomas Mann ein 1916 veröffentlichter Essay von Max Scheler mit dem Titel Der Genius des Krieges und der Deutsche Krieg. »Das Gesamterlebnis des Krieges«, so heißt es hier, bestehe »gerade in dieser Aufhebung des Individualismus zugunsten einer Einbindung des Einzelnen als Glied eines übergeordneten Volkskörpers.«[6] Jünger war derselben Auffassung, formulierte diese aber erlebnisbezogen. »Wir hatten«, so heißt es in den Stahlgewittern, »Hörsäle, Schulbänke und Werktische verlassen und waren in den kurzen Ausbildungswochen zusammengeschmolzen zu einem großen, begeisterten Körper« (STG I, 26).
In der Bearbeitung von 1924 erweiterte Jünger die historiographische Deutung der Ereignisse, wie ein Vergleich mit vorausgehenden Fassungen zeigt. 1920 und 1922 heißt es über einen Einsatz zu Beginn der Somme-Schlacht im August 1916, bei dem Jüngers Kompanie schwere Verluste erlitten hatte: »Die Tage von Guillemont machten mich zum ersten Male mit den verheerenden Wirkungen der Materialschlacht bekannt. Wir mussten uns ganz neuen Formen des Krieges anpassen« (STG I, 240). In der Fassung von 1924 wird die historische Erläuterung zur Weltdeutung: »Geist und Tempo des Kampfes veränderten sich, und erst von der Sommeschlacht an trug dieser Krieg sein besonderes Gepräge, das ihn von allen anderen Kriegen schied. Von dieser Schlacht an trug der deutsche Soldat den Stahlhelm und in seine Züge meißelte sich jener starre Ausdruck einer aufs allerletzte überspannten Energie, der spätere Geschlechter vielleicht ebenso rätselhaft und großartig anmuten wird, wie uns der Ausdruck mancher Köpfe der Antike oder der Renaissance« (STG I, 242).
In der Schrift Der Kampf als inneres Erlebnis, die 1922 zeitgleich mit der ersten Verlagsausgabe der Stahlgewitter erschienen ist, erläutert Jünger soldatische Denk- und Empfindungsweisen, geht also von der Ereignisebene zu ihrer kollektivpsychologischen Deutung über. Darüber hinaus ist die Darstellung von einem expressionistischen Pathos geprägt, das zur Weltdeutung tendiert, wie der Anfang deutlich werden lässt: »Zuweilen erstrahlt an den Horizonten des Geistes ein neues Gestirn, das die Augen aller Rastlosen trifft, Verkündung und Sturmsignal einer Weltwende wie einst den Königen aus dem Morgenlande. Dann ertrinken die Sterne ringsum in feuriger Glut, Götzenbilder splittern zu irdenen Scherben, und wieder einmal schmilzt alle geprägte Form in tausend Hochöfen, um zu neuen Werten gegossen zu werden« (KIE 35).
Jüngers Überlegungen zur soldatischen Haltung sind in spätere Bearbeitungen der Stahlgewitter eingegangen. In der Fassung von 1924 schreibt Jünger über den Krieger: »Und es schien, als ob in dieser von ihm selbst geschaffenen Landschaft auch der Mensch ein anderer geworden wäre, geheimnisvoller, härter und rücksichtsloser als sonst in einer Schlacht« (STG I, 242). Auch hier gibt es Weltdeutung, wie das Kapitel »Die große Schlacht« zeigt, in dem Jünger die sogenannte Michaelis-Offensive dargestellt hat, bei der über 60 Soldaten seiner Kompanie durch den Einschlag einer Granate getötet worden sind, während er selbst schwer verwundet wurde. Er schreibt: »Hier wurde das Schicksal von Völkern zum Austrag gebracht, es ging um die Zukunft der Welt. Ich empfand die Bedeutung der Stunde, und ich glaube, dass jeder damals das Persönliche sich auflösen fühlte und dass die Furcht ihn verließ« (ebd., 517).
Literarische Anknüpfungen
Seit 1923 hat Jünger seine Kriegserfahrungen in literarischer Form verarbeitet. Als er 1922 in Hannover seine spätere Frau Gretha von Jeinsen kennenlernte, waren die Stahlgewitter gerade in einer Verlagsausgabe erschienen. Häufiger als dieses und die nachfolgenden Kriegsbücher erwähnt er in den Briefen an seine Freundin die Arbeit an literarischen Werken.[7] Schon im Februar 1923 ist von einem »Roman« die Rede (GJ/EJ 19), vermutlich die seit April des Jahres erschienene Fortsetzungsgeschichte Sturm. Auch 1925 spricht Jünger von der Arbeit an einem »Roman«, der ihm »seit langem« vorschwebe (GJ/EJ 46). Vermutlich handelt es sich um ein Buch mit dem Titel »Ferdinand Dark, der Landsknecht und Träumer«, das 1926 vom Aufmarsch-Verlag angekündigt wurde, aber nicht erschienen ist.[8]
Seither plante Jünger eine Laufbahn als Schriftsteller. Im August 1923 war er mit 28 Jahren auf eigenen Wunsch aus der Reichswehr ausgeschieden und hatte im Oktober ein Studium der Zoologie in Leipzig begonnen. Doch rückte das Schreiben schon seit Beginn des Studiums in den Mittelpunkt, wie weitere Briefe an Gretha von Jeinsen zeigen. Jünger setzte damit in die Praxis um, was er bereits im Februar 1923 in einem dieser Briefe wie folgt formulierte: »Ich habe mich nach dem Kriege so entwickelt, dass ich mich nur noch für eine wirklich große Idee ins Feuer stellen darf« (GJ/EJ 28). Als das Paar am 3. August 1925 in Leipzig heiratete, ließ Jünger im Kirchenbuch unter der Rubrik »Beruf« die Bezeichnung »Schriftsteller« eintragen (vgl. ebd., Abbildungsteil). Im Mai 1926 verließ er die Universität, um als Autor zu arbeiten.
Den literarischen Anspruch setzte Jünger erstmals in der erwähnten Erzählung Sturm um, die im April 1923 in sechzehn Folgen im Hannoverschen Kurier erschienen ist. In einem redaktionellen Vorspann zur ersten Folge wird der Text als »Roman« und als »Kriegsdichtung von Ernst Jünger« bezeichnet (Abb. 5). Es folgen Hinweise zur Biografie des Verfassers und zu seinen Büchern In Stahlgewittern und Der Kampf als inneres Erlebnis. Es ist zu vermuten, dass Jünger die beiden Feuilleton-Redakteure Eberhard Sarter und Kurt Voss kannte. Zumindest dürfte er mit dem angebotenen Text auf deren Interesse gestoßen sein. Voss z. B. hatte sich wie Jünger 1914 mit 18 Jahren freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet, war ebenfalls Kompanie-Führer und studierte nach Kriegsende Germanistik, war also mit Ereignissen und Figuren gut vertraut.
Ob Voss und sein Kollege die kriegskritische Auffassung der Erzählung geteilt haben, ist unbekannt. Als Fortsetzungsgeschichte einer Tageszeitung war der Text aber literarisch und politisch ungewöhnlich. Doch blieb er unbekannt, bis er im Jahr 1963 in Buchform veröffentlicht wurde. Wie der mutmaßliche Entdecker, Jüngers Bibliograph Hans Peter Des Coudres, in einem Nachwort schreibt, sei dem Autor die Publikation im Hannoverschen Kurier »aus der Erinnerung entschwunden«.[9] Dies aber ist eher unwahrscheinlich, da die Erzählung literarisch anspruchsvoll ist und sich deutlich von den anderen Kriegsbüchern Jüngers unterscheidet. Denn sowohl die Titelfigur, der Zoologe Sturm, als auch die anderen beteiligten Personen, der Verwaltungsjurist Döhring und der Maler Hugershoff, vertreten nicht nationalistische oder soldatische Auffassungen, sondern haben intellektuelle und künstlerische Interessen, über die sie in den Gefechtspausen sprechen.
Helmuth Kiesel hat die Erzählung nicht in die kritische Edition der autobiographischen Kriegsdarstellungen aufgenommen (KIE). Doch gibt es Überschneidungen mit Jüngers Biografie sowie einer 1934 erschienenen Bearbeitung der Stahlgewitter, in der er auf entsprechende Gespräche in den Gefechtspausen anspielt. »Ich glaube«, so heißt es hier, »dass die unterirdischen Sitzungen unserer kleinen Runde, dreihundert Meter vorm Feinde, seltsam genug waren« (STG I, 281). Wie Jünger führt auch der Protagonist der Sturm-Erzählung ein Tagebuch, das er als »Grabenchronik« bezeichnet (SW 15, 15). Und wie dieser hatte auch Jünger neben literarischen Ambitionen zoologische Interessen (im Jahr der Veröffentlichung begann er ein Studium der Zoologie).
Biographische Entsprechungen gibt es auch mit Texten, die Sturm den beiden Gesinnungsgenossen in den Gefechtspausen vorliest. Es handelt sich um eine »Reihe von Novellen«, in denen das Leben von drei Bohemiens geschildert wird. Es sind der Dandy Tronck, der Nachtschwärmer Kiel und der Leser Falk. Alle drei sind Spiegel- oder Wunschbilder Jüngers, sodass man von einem komplexen autofiktionalen Selbstporträt sprechen kann. Ob Jünger wie der Protagonist zeitweise eine staatskritische Auffassung vertreten hat, lässt sich nicht belegen, doch ist Sturms Kommentar zum Selbstmord eines Kameraden am Beginn der Erzählung eindeutig: »Hier hatte wieder ein Einzelner gegen die Sklavenhalterei des modernen Staates nachdrücklich protestiert« (SW 15, 16).
Sechs Jahre vor Erich Maria Remarques Antikriegsroman Im Westen nichts Neues (1929) schildert Jünger also in seiner Erzählung drei Soldaten, die den Sinn des Krieges infrage stellen und sich ein anderes Leben wünschen. Es ist nicht auszuschließen, dass Remarque die Erzählung kannte, da er wie Jünger in Hannover lebte und seit 1922 ebenfalls literarische Beiträge im Hannoverschen Kurier veröffentlichte.[10] 1928 lobte er in der Zeitschrift Sport im Bild, die er redigierte, Jüngers Stahlgewitter in einer Sammelbesprechung mit der Überschrift Fünf Kriegsbücher. »Den Ablauf der Geschehnisse«, heißt es hier, »zeichnen die ›Stahlgewitter‹ mit der ganzen Macht der Frontjahre am stärksten, ohne jedes Pathos geben sie das verbissene Heldentum des Soldaten wieder, aufgezeichnet von einem Menschen, der wie ein Seismograph alle Schwingungen der Schlacht auffängt« (STG II, 470 f.).
Zugleich weist Remarque auf Jüngers Kriegsbuch Das Wäldchen 125 hin. Es ist 1925 erschienen und vertieft in literarischer und essayistischer Form Erlebnisse, die Jünger im Kapitel »Englische Vorstöße« der Stahlgewitter geschildert hatte. Er behandelt hier die Kämpfe zwischen dem 29. Juni und dem 30. Juli 1918, die zu einer schweren Niederlage seiner Kompanie geführt haben.[11] Es sei sein »Wunsch«, so Jünger im Vorwort, an einem »ganz kleinen Abschnitt« des Geschehens »die Fülle der Kräfte und Beziehungen auszuführen, in denen sich Menschen unserer Zeit im Kampf gegenüberstehen«. Das Wäldchen sei als Ort dafür geeignet, weil es »für einige Wochen zum Mittelpunkt des Lebens und Sterbens von tausend Menschen« geworden sei (KIE 136 f.).
Auch in diesem Fall beruft sich Jünger auf die »Tagebuchform«, verwendet aber im Untertitel den Begriff »Chronik«, mit deren Darstellungsweisen er vertraut war. In der Tat weist das Buch zwei ihrer Kennzeichen auf: zum einen das episodische Prinzip, zum anderen die zeitübergreifende Deutung der Ereignisse (s. II.3.). Über den Ort schreibt Jünger: »Er besaß nicht einmal strategischen Wert, und doch war es damals ein Ort von europäischer Bedeutung, ein örtliches Symbol der Macht, in dem sich viele Linien des Schicksals schnitten, und gegen die Kräfte von Menschen und Maschinen in Bewegung gesetzt wurden.« Daher »lohne es sich wohl«, ihn »zum Angelpunkt einer Betrachtung zu machen, die über den Einzelfall ins Allgemeine greifen« wolle (KIE 137).
Allerdings liefert Jünger in vielen Passagen des Buches eine nationalistische Deutung des Krieges, die den historischen Anspruch der Stahlgewitter unterläuft. Er schreibt: »Nur aus dem Blute empfangen die großen Begriffe: Geschichte, Ehre, Treue, Männlichkeit, Vaterland, die in der wechselnden Beleuchtung des Verstandes kalt und seelenlos erscheinen, ihre lebendige Kraft« (KIE 344). Jünger hat die Formulierung in der 1935 erschienenen Bearbeitung des Buches zwar wieder gestrichen, vergleichbare Passagen aber beibehalten, darunter die folgende Rede an die Gegner, die zum hohlen Pathos wird: »Du Stück des sonnigen Frankreich, in das uns Kräfte verschlugen, die stärker sind als wir! Glaube nicht, dass wir mit kaltem Herzen in dieser Verwüstung stehen. Und ganz unerträglich wäre es, wenn wir nicht ahnten, dass sich hinter der Vernichtung neues Leben drängt. Du musst dein Schicksal, das du nicht verdientest, tragen wie wir« (ebd., 161).
Nationalistisches Pathos durchzieht auch die 1925 veröffentlichte Erzählung Feuer und Blut. Jünger orientiert sich hier an dem Kapitel »Die Große Schlacht« der Stahlgewitter, beschränkt die Darstellung aber auf wenige Tage zu Beginn des Kriegsgeschehens, wie im Untertitel angedeutet wird: Ein kleiner Ausschnitt aus einer großen Schlacht. So begrenzt der Ausschnitt in zeitlicher Hinsicht war, so bedeutend waren die Ereignisse. Helmuth Kiesel hat diese in der kritischen Edition wie folgt erläutert: »Dies sind die drei ersten Tage der sogenannten ›Michaelsoffensive‹, mit der die Oberste Heeresleitung im Frühjahr 1918 den Sieg erzwingen wollte, bevor die Amerikaner in den Krieg eingreifen konnten. Diese ›Große Schlacht‹, wie sie offiziell hieß, begann am 21. März 1918 mit einem apokalyptisch wirkenden Artillerieangriff der Deutschen und endete am 6. April. Während dieser Zeit verloren die Deutschen 239.000 Soldaten, die Briten 178.000 und die Franzosen 34.000, zusammen fast eine halbe Million. Den erstrebten Durchbruch erreichten die Deutschen nicht« (KIE 22 f.).
In der vorausgehenden Nacht vom 19. auf den 20. März 1918 wurde Jüngers Kompanie durch eine Granate stark dezimiert. Es gab unter den 150 Männern 20 Tote und etwa 60 Verwundete. Dies ist der Ausgangspunkt von Feuer und Blut. Gleich zu Beginn des Buches tritt Jünger als Chronist im Sinne eines Geschichts-Erzählers auf: »Es gibt im Strome der Zeit, in diesem unaufhörlichen Werden, das uns umgibt, Augenblicke, in denen wir rasten und plötzlich erkennen, dass etwas geworden ist. In solchen Augenblicken wird uns klar, wie wenig Einfluss wir im Grunde auf die Dinge besitzen, wie alles aus der Tiefe hervorwächst und ins Dasein tritt, um kurze Zeit zu verweilen und wieder abzutreten und so eine geheimnisvolle Aufgabe zu erfüllen im Wechsel von Werden, Sein und Vergehen« (KIE 367).
Publizistik und Chronistik
Zwischen 1925 und 1930 hat Jünger etwa 90 Beiträge in soldatischen und nationalistischen Zeitschriften und Sammelbänden veröffentlicht, die meisten in zwei Organen, die er mit gleichgesinnten Publizisten herausgegeben hat: zum einen Die Standarte, die seit September 1925 den Untertitel Beiträge zur geistigen Vertiefung des Frontgedankens trug (seit April 1926 Wochenschrift des neuen Nationalismus); zum anderen die Wochenschrift Arminius, die zwischen November 1926 bis Mai 1927 erschienen ist und den Untertitel Kampfschrift für deutsche Nationalisten bekam. Die Titeländerungen spiegeln die veränderten Auffassungen Jüngers wider: vom Bekenntnis zum Frontsoldatentum zum Plädoyer für die Nation.
Die Beiträge waren lange Zeit nicht bekannt, da Jünger sie nicht aufgehoben oder in spätere Ausgaben seiner Schriften übernommen hat. Dennoch erlangten sie später einen gewissen Bekanntheitsgrad, da sie mit dem 1950 erschienenen Buch Die Konservative Revolution in Deutschland 1918 von Armin Mohler in Verbindung gebracht wurden. Das Buch ist aus einer philosophischen Dissertation hervorgegangen, die 1949 an der Universität Basel angenommen worden war. Zwischen 1949 und 1953 war Mohler Sekretär Jüngers. Der Datierung im Vorwort nach hat er die Vorbereitung der Drucklegung am 1. Januar 1950 in Ravensburg, dem damaligen Wohnort Jüngers, abgeschlossen.[12] Mohler kannte die publizistischen Beiträge der späten zwanziger Jahre zu dieser Zeit vermutlich nicht, ordnete aber andere Schriften von ihm den konservativen Strömungen in der Weimarer Republik zu, die er vom Nihilismus geprägt sah: die erste, 1929 erschienene Fassung der Essay-Sammlung Das Abenteuerliche Herz und der ein Jahr später erschienene Sizilische Brief an den Mann im Mond. Die publizistischen Beiträge Jüngers wurden dagegen erst seit den neunziger Jahren in Publikationen zur Konservativen Revolution berücksichtigt, darunter in einem viel beachteten Buch von Stefan Breuer.[13]
Die erste bibliographische Übersicht der publizistischen Beiträge findet sich bereits in der 1957 erschienenen Gesamtdarstellung von Gerhard Loose, der mit Jünger korrespondiert hat (DLA).[14] Es dauerte allerdings lange, bis die Texte tatsächlich zugänglich waren. Eine erste, nahezu vollständige Edition veröffentlichte Sven Olaf Berggötz 2001 auf der Basis von Horst Mühleisens Bibliographie der Werke Jüngers (1996) unter dem Titel Politische Publizistik.[15] So verdienstvoll die Zusammenstellung und Kommentierung der Beiträge für die Kenntnis von Jüngers Werk ist, so unzureichend ist ihre Bezeichnung als »politisch«. Denn Jünger hat den Krieg und seine Folgen in vielen Artikeln historisch kommentiert und zugleich Rezensionen über literarische Werke zum Krieg verfasst, knüpfte also an die Stahlgewitter und seine nachfolgenden Kriegsbücher an.[16]
Insgesamt sind Jüngers publizistische Beiträge, die Berggötz im Nachwort als Einheit auffasst, sehr heterogen. Die Artikel des Jahres 1925 sollten Grundlage eines Buches mit dem Titel Der Frontsoldat und seine Aufgabe werden (vgl. PP 679). Das »Wesen des Frontsoldatentums«, so Jünger, sei das »einer Kampfgemeinschaft, die durch die Gemeinsamkeit einer großen geschichtlichen Leistung innerlich verbunden« sei (ebd. 69). »Geschichtliche Leistung«: die Charakterisierung bezieht sich nicht nur auf die Soldaten der deutschen Armee, sondern auf die aller Länder, die am Krieg beteiligt waren, wie Äußerungen in den Stahlgewittern und späteren Dokumentationen zeigen (s. I.2.). In einem anderen Beitrag mit dem Titel Der Frontsoldat und die Wilhelminische Zeit hat Jünger die Idee geschichtsphilosophisch vertieft. Er setzt sich dort mit den Geschichtsauffassungen von Wilhelm Marx, Oswald Spengler und Friedrich Nietzsche auseinander, die ihn weiterhin beschäftigt haben.
Dazu gehört der Beitrag Der Krieg als inneres Erlebnis (nicht zu verwechseln mit dem Buchessay von 1922 Der Kampf als inneres Erlebnis). Jünger wird hier wie Nietzsche und Spengler zum Weltdeuter. Er nimmt dabei Einsichten der 1930 erschienenen Abhandlung Die Totale Mobilmachung vorweg und schreibt im Sinne der mittelalterlichen Chronistik: »So hat wirklich das Zeitalter der Industrie eine Landschaft hervorzuzaubern gewusst, die den mächtigen Visionen eines Dante sehr nahe kommt, eines weißglühenden Fegefeuers des Materials. Ein Fegefeuer? Man hat uns in unseren Kindertagen über diesen Aberglauben zu lachen gelehrt, aber hier beginnen wir zu begreifen, welche mittelalterliche Größe in diesem Symbol der Reinigung durch Glut, der feurigen Ausbrennung des sündigen Menschen liegt« (PP 103 f.).
Im Unterschied zu den Beiträgen des Jahres 1925 sind die des folgenden nationalistisch ausgerichtet. Jünger geht hier von der historischen Argumentation zur politischen Agitation über. Im Vorwort zu einer 1926 erschienenen Schrift seines Bruders Friedrich Georg mit dem Titel Aufmarsch des Nationalismus schreibt er: »Der Vater dieses Nationalismus ist der Krieg. Was unsere Literaten und Intellektuellen darüber zu sagen haben, ist für uns ohne Belang« (PP 183 f.). In einem Beitrag mit dem Titel Der Charakter heißt es in diesem Sinne: »Geschichte wird nicht konstruiert, sondern gelebt« (ebd., 211). In den Jahren 1927 und 1928 wechseln politisch und historisch orientierte Beiträge. Auch in dem aufwändig gestalteten Sammelband Die Unvergessenen, den Jünger im Jahr 1928 mit zahlreichen Beiträgen zu den im Krieg gefallenen deutschen Schriftstellern herausgegeben hat (viele stammen von seinem Bruder), dominieren Biografien und Werkdarstellungen.
In einem Beitrag mit dem Titel »Nationalismus« und Nationalismus, der 1929 in der Zeitschrift Das Tagebuch erschienen ist, wendet sich Jünger gegen eine politische Deutung des Begriffs, da diese von den »abgestandenen Formulierungen einer patriotischen Phraseologie« geprägt sei (PP 502). Stattdessen bekennt er sich zu den elementaren Kräften des Frontsoldatentums ohne nationale Beschränkung, wenn er mit typographischer Hervorhebung schreibt: »Wir überlassen die Ansicht, dass es eine Art der Revolution gibt, die zugleich die Ordnung unterstützt, allen Biedermännern. Was hat denn das Elementare mit dem Moralischen zu tun? […] Wir sind keine Bürger, wir sind Söhne von Kriegen und Bürgerkriegen, und erst wenn dies alles, dieses Schauspiel der im Leeren kreisenden Kreise, hinweggefegt ist, wird sich das entfalten können, was noch an Natur, an Elementarem, an echter Wildheit, an Ursprache, an Fähigkeit zu wirklicher Zeugung mit Blut und Samen in uns steckt« (ebd. 507).
In anderen Artikeln des Jahres 1929 treten politische Aussagen hinter phänomenologische Reflexionen zurück. Jünger beschäftigt sich in diesen Artikeln in erster Linie mit zeitgenössischen Romanen, in vielen Fällen mit solchen, die den Krieg behandeln. So heißt es in einem Beitrag zu Alfred Kubins Roman Die andere Seite, der 1929 in der Zeitschrift Widerstand erschienen ist: »Das Reich der Träume, des Aufwachens von Gestalten aus dem Grunde des Unbewussten, die rätselhaften Zeichen, die in die Dinge geritzt sind und zu tieferer Erforschung locken, – dies alles ist dem echten Künstler nicht fremd« (PP 459 f.).
Erfahrung und Erkenntnis: Das Abenteuerliche Herz
Die autobiographischen Essays, die Jünger 1929 unter dem Titel DasAbenteuerliche Herz veröffentlicht hat, bestätigten seine Abkehr von der Politik. Vom Krieg ist hier nur noch beiläufig die Rede. Im Mittelpunkt steht ein Subjekt, das über Wahrnehmungen, Träume und Lektüren berichtet und die aktuellen Erfahrungen mit Erinnerungen an Kindheit und Jugendzeit verbindet. Subjektivismus ist Jünger allerdings fremd. Vielmehr orientiert er sich an der zeitgenössischen Physiognomik, Morphologie und Gestaltlehre, die er während seines Studiums der Zoologie in Leipzig zwischen 1923 und 1925 kennenlernte. Was in den Texten – nicht selten rudimentär und kryptisch – nur angedeutet wird, lässt sich auf die zeitgenössischen Diskurse der Anthropologie und Phänomenologie zurückführen.[17]





























