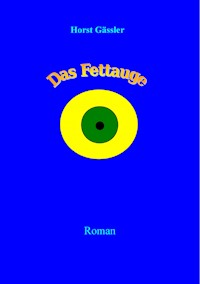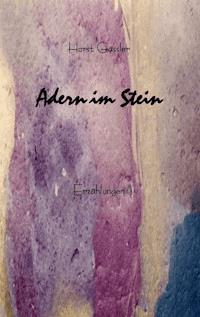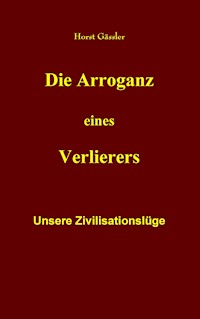
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch entlarvt schonungslos die Lebenslüge von unserer sogenannten Zivilisation. Denn sind wir wirklich die Zivilisation, die wir vorgeben zu sein? Sind wir das Tier, das sich zu einem wahren Homo Sapiens, also zu einem weisen und vernunftbegabten Wesen entwickelt hat? Oder sind wir immer noch der alte Affe, der als homunculus mit seinem wachsenden Gehirn alles weiter entwickelt hat nur nicht sich selbst? Ist die Kunde vom Homo Sapiens also Fake News? In einer kritisch vergleichenden und selten so kompromitierenden Synopsis geht der Autor dieser brisanten Frage nach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Horst Gässler, Gymnasiallehrer für Latein und Englisch a. D., beschäftigt sich seit vielen Jahren kritisch mit pädagogischen und gesellschaftlichen Themen.
Folgende weitere Bücher sind bisher erschienen:
Mit dem System zum Terror der Macht
–
Die phantastischen Abenteuer eines Ritters von der traurigen Gestalt, der auszog um Bildung zu lehren
– Tatsachenroman
(Darin werden exemplarisch die internen Paradoxien von Macht und Ohnmacht, von Anspruch und Wirklichkeit in unseren Schulsystemen, denen Lehrer oft ausgesetzt sind, von einem Insider aufgedeckt)
Adern im Stein
- Erzählungen
(Unerwartete Erfahrungen, die Spuren in unserem Leben hinterlassen)
Das Fettauge
– Roman
(Unsere Gesellschaft in der Sackgasse einer zerstörten Welt und manipulierten Zukunft, aus der nur ein radikaler Neuanfang führen kann)
Nicht an Wissen mangelt es uns. Was uns fehlt, ist der Mut, begreifen zu wollen, was wir wissen, und daraus die Konsequenzen zu ziehen.
(Sven Lindqvist, in "Durch das Herz der Finsternis")
INHALT
Vorwort
Vom Reich der Affen zum Reich der Könige
(Mit einem kritischen Blick auf die Geschichte der Menschheit vom Affen bis in die Antike im anthropologisch-gesellschaftlichen Zeitraffer wird mit gezielten Bezügen zur Gegenwart der Frage nachgegangen, ob wir von einer human-geistigen Entwicklung des Menschen sprechen können.)
Die Rolle der Religionen von Judentum, Christentum, Islam u. a. als Richtschnur für die Menschheit
(Grundzüge und Widersprüche der Religionen und ihr Versagen, eine humanere Welt zu gestalten)
IDie Kultur Indiens - Buddhismus und Hinduismus als Wegbereiter für eine humane Gesellschaft?
Der sanfte Weg der Vernunft und der Weg der Spaltung – Kastenwesen und Kolonialismus)
Konfuzius und das Reich der Mitte – Fernöstliche Weisheit als gesellschaftlicher Rettungsanker?
(Der Weg von der Weisheit zum zentralistischen Gemeinschaftsdenken
)
Japans Neuordnung und der Angriff kolonialer Mächte
(Neue Anfänge werden von fremden Mächten überrollt)
Die Indianerkulturen in Amerika und ihre Zerstörung
Die Azteken, Maya und Inka
(Der Bericht von Bartolomé de las Casas als Zeugnis einer grausamen Eroberungskultur gegen jede Vernunft und Menschlichkeit – und die Parallelen in unserer Zeit)
Die Indianer Nordamerikas und das europäische “Missverständnis”
(Schert euch zum Teufel! Wir brauchen euer Land. Vernunft und Widerstand zwecklos.)
Die Aborigines in Australien und ihre (Alb)-Traumzeit
(Die Zertrümmerung einer magischen Kultur und eine späte Reue)
Der Beutekontinent Afrika
(Wir bauen uns unsere eigene Welt aus den Rohstoffen und Menschenressourcen anderer.)
Die kontinental-europäische Scheinwende
Nicoló Machiavelli – auf der Suche nach einem guten Fürsten
Martin Luther und die Bedeutung der Freiheit eines Christenmenschen
Immanuel Kant – Von der Unfreiheit des Geistes zur Freiheit der Vernunft
Karl Marx – Ein Weg zur humanen Egalität
Vom Tier zum Mensch? - Die Frage nach einer globalen humanen Gesellschaft
(Wie viele andere versuchte auch der arabische Historiker Ibn Khaldun, der Menschheit einen Weg zu einer Gesellschaft der Vernunft aufzuzeigen. Wie haben wir bis heute solche Visionen umgesetzt? Oder sind wir dazu gar nicht mehr in der Lage?)
Das Jahrhundert der Kriege
Die Weltkriege
(Ein „Idealismus“ wider alle Vernunft und der verzweifelte Widerstand einer Minderheit)
Die Zeit danach - Korea und Vietnam
(Die Alten haben wieder nichts gelernt, doch eine junge Generation möchte die Welt verändern)
Die Golfkriege - Der Kampf ums Öl
(Culture Clash und politische Lüge – Vernichtungswahn auf allen Seiten)
Der “Arabische Frühling”
(Das Aufbegehren gegen eine suppressive Staats- und Religionsführung)
Der “Prager Frühling”
(Panzer gegen gesellschaftliche Freiheitsbewegung)
Die Entwicklung von Technik und Mensch seit dem Zweiten Weltkrieg
Die ersten Umbrüche - Musik, Fernsehen, neues Denken
(Westliche Wohlfühlkultur und alternativer Lebensentwurf)
Die Wucht des technologischen Zeitalters und der unkontrollierten Wirtschaft
(Die Macht der Technologie über die Vernunft des Menschen)
Die Entscheidung – Was nun?
Anmerkungen und Quellenangaben
I. Vorwort
So wie wir jeden Morgen einen Blick in den Spiegel werfen, so müssen wir es auch wagen, in den Spiegel unserer Menschheitsgeschichte zu blicken. Erst durch diese bewusste Herausforderung, sich Rechenschaft abzulegen über unseren bisherigen Werdegang und unseren gegenwärtigen gesellschaftlichen Zustand, werden wir unser Spiegelbild als das erkennen, was es wirklich ist: ein Abbild unserer momentanen Existenz. Können wir unseren jetzigen Zustand als die Zivilisation beschreiben, die wir nach außen immer vorgeben zu sein?
Vor dem Hintergrund eines nicht zu übersehenden Klima- und Bevölkerungswandels sowie von erbitterten Verfeindungen und grausamen Kriegen, deren Ursachen auch “zivilisationsbedingt” sind, muss irgend wann einmal in logischer Konsequenz die Frage gestellt werden, ob der Mensch im Laufe seiner Geschichte ebenfalls einen Wandel, eine Entwicklung durchgemacht hat. Eine Entwicklung, die den Namen Menschsein, eben Humanität, verdient, da sie sich ja angeblich von der Entwicklung anderer Lebewesen wie Tieren und Pflanzen abheben soll. Es hat im Laufe unserer Geschichte zahlreiche Stimmen der Vernunft, eines “common sense” gegeben, die uns Menschen in immer neuen Versuchen dazu aufriefen, auf eine gemeinsame, friedliche und gerechte Gesellschaft hinzuwirken. Wie sagte schon Ibn Khaldun: “Der Wissenschaften gibt es viele, und die Weisen unter den Völkern der menschlichen Gattung sind zahlreich.“1 Und auch Goethe bekräftigte circa 500 Jahre später: „Wer kann was Dummes, wer was Kluges denken, Das nicht die Vorwelt schon gedacht?“2 Doch welchen Stellenwert haben wir in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit den klugen Gedanken dieser Persönlichkeiten beigemessen? In wieweit ist im Laufe unserer Geschichte bis heute das uns verliehene Potential von Intellekt und Vernunft von uns selbst in Anspruch genommen und weiterentwickelt worden, um diesem Unterschied zwischen Mensch und Tier gerecht zu werden? Welchen verpassten Chancen begegneten wir im Laufe unseres Daseins und unserer Geistesgeschichte, um uns mit Recht eine “Zivilisation” nennen zu können?
Gewiss haben wir unseren Verstand für viele Produktentwicklungen eingesetzt. Aber für uns selbst? Hierbei möchte ich zwischen Intellekt, Verstand und Vernunft unterscheiden. Intellekt ist das, was uns die Natur an Substanz in unseren Schädel mitgegeben hat. Als Verstand würde ich die Fähigkeit zum Denken und Kombinieren bezeichnen. Aber erst die Vernunft bringt dieses Denken und Kombinieren in einen sinnvollen Zusammenhang.
Die folgenden Gedanken, Ereignisse und geschilderten Zusammenhänge, die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder unumstößliche Objektivität erheben, da die Darlegung des Problems nur anhand ausgewählter Beispiele erfolgt, möchten Sie, den Leser, dazu ermuntern, in eine selbstkritische Welt ohne wenn und aber einzutauchen und sich Ihrer Verantwortung als Mensch zu stellen. Dabei folgt der Gedankengang keinem starren System einer geschichtlichen Zeitlinie, sondern er orientiert sich eher an dem assoziativen Sprung von einem jeweils auftauchenden Ausgangspunkt aus. Denn es steht nicht im Vordergrund, wann ein Ereignis stattgefunden hat oder wann ein Gedanke geäußert wurde, sondern, dass es überhaupt stattgefunden hat oder dass der Gedanke geäußert wurde. Diese assoziativen Sprünge spiegeln nur unser inhomogenes und oft widersprüchliches Leben wider. Doch am Ende der Lektüre sollte ein eigenes klares Fazit von Ihnen, dem Leser, stehen.
II. Vom Reich der Affen zum Reich der Könige
(Mit einem kritischen Blick auf die Geschichte der Menschheit vom Affen bis in die Antike im anthropologisch-gesellschaftlichen Zeitraffer wird mit gezielten Bezügen zur Gegenwart der Frage nachgegangen, ob wir von einer human-geistigen Entwicklung des Menschen sprechen können.)
“Während die Zivilisation unsere Häuser verbessert hat, hat sie nicht in gleichem Maße die Menschen verbessert, die darin wohnen sollen. Sie hat Paläste geschaffen, aber es war nicht so leicht, [wahre] Edelmänner und Könige hervorzubringen.”
(Henry David Thoreau) 3
Als er zum ersten Mal den Sprung von seinem sicheren Baum auf das unter ihm liegende Terrain wagte mit der Ungewissheit, aber auch mit der Entdeckerfreude eines herausfordernden Kerls, da erlebte er ein Desaster, das ihn für den Rest seines Lebens traumatisieren sollte. Er war zwar der erste Affe auf festem Boden. Aber um welchen Preis! Kaum hatte er die Erde mit seinen Füßen berührt, da sah er nur eine schlabberige Zunge in einem weit aufgerissenen Maul, aus dem ihn der faulige Geruch eines leeren Magens anwehte. Der Löwe hatte ihn schon längere Zeit aus seinem Versteck beobachtet und auf diesen Augenblick gewartet. Doch die Muskeln des möchtegern Erdbewohners nutzten reaktionsschnell die Kraft des Abschwungs notwendigerweise gleichzeitig zu einer blitzartigen Aufwärtsbewegung zurück auf seinen rettenden Ast. Das zahnbewehrte Maul seines Feindes huschte unter ihm hinweg ins Leere. Da saß er nun, unser Freund, leicht keuchend und mit pochendem Herzen und blickte auf den Rücken des mächtigen Tieres, das - mit einem letzten verärgerten Blick nach oben - langsam im Unterholz verschwand. Diese Sekunde des Schreckens ließ in unserem Vorfahren einen Minderwertigkeitskomplex wachsen, der ihn von nun an mit all seinen Ersatzhandlungen prägen sollte.
Es dauerte eine geraume Zeit, bis unser Artgenosse einen vorsichtigen erneuten Versuch startete, und diesmal erfolgreich. Seine wachsende Entdeckerfreude wurde mit den unterschiedlichsten Erkenntnissen belohnt, denn er wagte es immer wieder, sich über seine vier Arme und Beine zu erheben. Und sein Clan folgte ihm. Anfangs zögerlich, stets bereit zum Sprung zurück auf den rettenden Ast. Denn dieser wird ihm später zum Stöckchen, zum Knüppel, zur Keule, zum Szepter, zur Nuklearbombe werden. Dann zeigte er sich immer couragierter. Trotz der unvergesslichen beispiellosen Niederlage spürte er ein zunehmendes Verlangen, sich ein neues Territorium zu erschaffen. Er begann, seine ersten Spuren im weichen Untergrund zu hinterlassen, Spuren, die noch Millionen von Jahren später seine Nachfahren in Erstaunen versetzen und auf einen anthropologisch triumphalen Weg zu ihm zurückführen sollten. Das Gehirn war noch klein, entwickelte sich jedoch in Folge der Methode von Versuch und Irrtum immer weiter. Es wurden einfachste Werkzeuge gefertigt, die zunächst dazu dienten, das alltägliche Leben vor allem in Bezug auf Nahrungssuche und Nahrungsverwertung des vorhandenen Angebots zu erleichtern. Der wachsende Erfolg weckte Begehrlichkeiten auf Objekte in den Territorien anderer Lebewesen. Dieser Umstand zwang ihn dazu, neue Instrumentarien zu erfinden, um sein angestrebtes Ziel zu erreichen. Noch war er Affe, aber er registrierte in einem kleinen Bereich seines Gehirns, dass er eine leichte Überlegenheit den anderen Wesen gegenüber zu erringen begann. Diese Erkenntnis machte ihn mutiger, und es reifte in ihm die Entscheidung, an allem, was ihn umgab, Rache zu nehmen für die einst erlittene schmachvolle Niederlage, die ihn beinahe das Leben gekostet hatte. Mit dem vorhandenen Früchteangebot war er bald nicht mehr zufrieden. Der Standort ernährte die wachsende Familie nicht mehr. Also gelüstete es ihn nach etwas Neuem, Handfestem - Fleisch! Doch die Beute, die ihm täglich vor der Nase herumlief, musste erlegt werden. Dazu brauchte es neues Gerät. Sein Hirn war mit den erworbenen Fertigkeiten ebenfalls gewachsen. So wusste er, was zu tun war. Er griff zu den Waffen. Damit begann ein Siegeszug ohnegleichen. Denn dies war auch gleichzeitig die Stunde, in der sein Umfeld zum Selbstbedienungsladen wurde. Bisher noch in bescheidenem Umfang. Aber das sollte sich im Laufe seiner Entwicklung gewaltig ändern.
Die sichtbaren Erfolge ließen in unserem angehenden Hominiden einen gewissen Stolz aufkeimen und verschafften ihm eine erfreuliche Genugtuung, auch wenn das Leben noch hart und gefährlich war. Und trotzdem schien er sich auch Zeit zur Muße zu nehmen, in der ihn sein aufkommendes Selbstbewusstsein dazu drängte, seine Taten in irgend einer Weise zur Schau zu stellen. Er kratzte und pinselte sie in Stein und auf Fels und konnte nun jeden Tag sein Leben im Spiegel seiner Kreativität bewundern. Dies nährte die Hoffnung in einer übergeordneten Macht, die später als Großer Geist, Jahwe, Gott, Allah verehrt werden würde, dass sich hier ein Kulturwesen erschaffe, das die Komplexität seines Daseins im Laufe der Zeit begreifen würde.
Dann jedoch kam das Feuer und mit ihm ein entscheidender Wendepunkt im Leben der gesamten Sippe. Wer das Feuer besaß, besaß die Macht. Nicht umsonst führte diese Tatsache später zu dem dramatischen Mythos, in dem Prometheus zur Strafe an einen Felsen des Kaukasusgebirges geschmiedet wurde, weil er gegen das Verbot der Götter gehandelt und dem Menschen das Feuer gebracht und damit gleichzeitig der gesamten Götterwelt ein Faustpfand der Macht aus den Händen geschlagen hatte. Die Götter, die fest entschlossen waren, ihren Einfluss weiterhin hartnäckig zu verteidigen, waren entsetzt, so wie es seine Rivalen waren. Denn das Feuer eröffnete neue Möglichkeiten. Es erhellte das Dunkel, es diente zur Abschreckung, mit ihm konnten fremde Behausungen niedergebrannt werden und es machte das Fleisch, das man bisher roh verzehren musste, mürbe und leichter verdaulich. Ein erbitterter Kampf um das Feuer entbrannte. Es war zwar schon vorher in der Natur vorhanden, aber jetzt lernte man dieses einstige Schreckgespenst zu kontrollieren, ja im Laufe der Zeit selbst zu entfachen. Schon damals entbrannte ein brutaler Kampf um das Know-how der Zeit. Durch dieses Verlangen nach einem wichtigen Element war der Krieg endgültig in die Welt gekommen und brachte Tod und Verderben über eine Spezies, die im Begriff war, ihre Instinkte immer mehr abzulegen. - Dies war vielleicht die Zeit, in der der Wilde begann, seine Alltagsgeräte wie Knochen, Steinschneide und Jagdspieße zu ersten Kriegswaffen umzuformen. Aus einem Ast wurden stärkere Bögen und schnellere Pfeile, aus einem jungen Baum eine schlagkräftige Keule. Als dann die Metalle entdeckt wurden, schmiedete man Schwerter und Dolche, dazu kamen Helebarden, Morgensterne und andere Totschlaginstrumente, schließlich das Schießpulver. Und nun begann das Morden auf breiter Basis. Der Tod konnte auf Distanz gehalten werden. Eine Entwicklung, die bis in unsere Zeit hinein bis zu Urangeschossen und Nuklearbomben verfeinert wurde. Denn der gleiche Kampf um eine Vorherrschaft mit noch grausameren Mitteln wird noch heute weitergeführt, ohne dass der Verlust des Instinkts durch den Gewinn an Vernunft ausgeglichen wurde. Der verheerende Einsatz der Atombombe im Zweiten Weltkrieg und das Bestreben weiterer Staaten in unserer heutigen Zeit, vernichtende Nuklearsprengköpfe zu entwickeln, muss an der gängigen These einer Humanentwicklung Zweifel aufkommen lassen. Doch davon später. - Was die Natur dieser Spezies an Regeln, Gefühl, Angst, Respekt mitgegeben hatte, wurde zusehends dem Willen eines Individuums, das sich sein eigenes System schaffen wollte, unterworfen. Das führte dazu, dass zunächst einmal der Kopf in zunehmendem Maße die Aufgaben der Instinkte übernahm und dem Menschen - nennen wir ihn ab jetzt so - klarmachte, dass er mit dem aufreibenden Sammeln und Jagen keine Perspektive mehr hatte. Also entschied er sich dazu, an einem geeigneten Platz sesshaft zu werden und sich der Reproduktionsfähigkeit der Natur zu bedienen. Neben Samen holte er sich auch lebende Tiere, die er vorher in wilden Verfolgungsjagden noch erlegt hatte, in sein Haus - es sollten den Tieren später auch Menschen in dieser dienenden Funktion folgen. Durch Aussaat und Vermehrung sicherte er sich ein genügsames Auskommen, das ihm eine gewisse Unabhängigkeit gewährte. Schon früh erkannte er die Vorteile einer Kooperation mit Gleichgesinnten und er fing an, mit seinen überschüssigen Produkten zu handeln. Sein Sphärenbereich weitete sich aus. Handel und Migration führten zu neuen Bereichen, neuen Kulturen, neuen Ansiedlungen. Die Neugierde trieb ihn zu wissenschaftlichen Studien über die Welt und den Himmel allgemein. Doch er wäre nicht der alte Affe, wenn er nicht auch als Mensch nach Fremdem begehrte. Krieg war damit vorprogrammiert und sollte uns Menschen bis in die heutige Zeit begleiten.
Mag auch die Entdeckung von Metallen einen großen Segen über ihn gebracht haben, Frieden bescherten sie ihm nicht. Neben sinnvolle Haushaltsgeräte traten grausamere Waffen, um die Rivalen möglichst schnell zu liquidieren und auf diese Weise sein eigenes Territorium und seine Macht zu erweitern. Kleine Ansiedlungen wuchsen zu Dörfern, Dörfer formten sich zu Städten, die nicht mehr locker organisiert, sondern straff kontrolliert werden mussten. Dies erforderte verwaltungsmäßige Strukturen, die von einem Zentrum aus angelegt und gesteuert werden mussten. Dieses Zentrum manifestierte sich in einem Herrscher, der mit weitreichenden Machtbefugnissen ausgestattet wurde. Diese Macht stützte sich vor allem auf ein gut ausgerüstetes Heer, das Potentaten aller zukünftigen Generationen die Herrschaft nach innen wie nach außen sicherte. Auch ein öffentlich zugänglicher Rechtskodex stärkte den König und die Gesellschaft. Eine wichtige Grundlage für ein friedliches Zusammenleben war die Landwirtschaft, die die Bevölkerung mit ausreichender Nahrung versorgen sollte. Um dies zu gewährleisten, wurde ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem aufgebaut, bei dem streng auf gerechte Verteilung des kostbaren Nass geachtet wurde. Handel und Wissenschaften wurden vertieft, und langsam gewann der Mensch ein Bild von seiner näheren und weiteren Umgebung und vom Aussehen seiner Welt. Ein Wissenseifer griff um sich und drängte die einen oder anderen dazu, die Vielfalt von Flora und Fauna zu studieren und mit rudimentären Begriffen zu benennen. Bereiche wie Geographie, Astronomie, Mathematik, Verwaltung, Architektur, bildende Kunst, Malerei und Musik, die ersten Ansätze einer Schrift und Literatur wurden weiter entwickelt. Sogar erste Anzeichen eines Geschichtsbewusstseins zeigten sich in Form von einfachen Annalen oder Chroniken, die Kriegszüge und Verwaltungserrungenschaften der Vergangenheit aufzeichneten. Diese historischen Berichte dienten eher einer Glorifizierung der eigenen Taten, die an der Größe der Beute und des neu errungenen Terrains gemessen wurden. Eine tiefgreifendere Reflexion, die eine weiterführende Erkenntnis über das Geschehene und Getane hätte bringen können, fand nicht statt. Doch auch der Mensch selbst wurde Opfer seiner Differenzierung. In zunehmendem Maße teilte sich die Bevölkerung in wenige Gewinner und immer mehr Verlierer. Wer zum Beispiel wie ein Pharao gottgleiche Macht besaß, stand über allem. Sein Ziel, ja seine Aufgabe war es, eine übergeordnete Weltordnung zu schaffen, der sich der Mensch unterwirft. Zwar wurde dem einzelnen Menschen zugestanden, sein eigenes Handeln zu bestimmen, aber er musste dann auch bereit sein, alle Konsequenzen seines Handelns zu tragen. Unter dieser Voraussetzung ordnete man sich doch lieber unter. So konnte der Herrscher allein verteilen und verurteilen. Die einen, die in dessen Gunst standen, hatten ein gutes Auskommen, die anderen sorgten als mittellose Sklaven oder Gefangene für deren Wohlergehen. Oftmals waren Handwerker in verpflichtende Aufgaben des Königs beziehungsweise des Pharao eingebunden, wobei sie während dieser Zeit zwar versorgt wurden, aber auch ein hohes Maß an Freiheit verloren. Sie waren quasi Arbeitssklaven für den Staat. Aus dieser unendlichen Macht eines Einzelnen erwuchs die Sehnsucht, sich in irgend einer Form ein Denkmal für die Ewigkeit zu errichten, erbaut auf den Tränen und dem Leid mehr oder weniger rechtloser Menschen. Das bittere Schicksal dieser Menschen wurde übertüncht von den malerischen Selbstbespiegelungen der Herrschergrößen, die das Leben oberflächlich bunt erscheinen ließen. Die ärmlichen Untertanen waren, auch weil sie es sich gar nicht leisten konnten, von jeglicher Erkenntniserweiterung und Schulbildung ausgeschlossen. Diese aber wurde zum tragenden Pfeiler eines menschenwürdigen Lebens.
Im vorherrschenden Patriarchat schickte der Vater als Familienoberhaupt nur den Sohn zur Ausbildung. Für wie wichtig er dessen Ausbildung erachtete, lässt sich aus erhaltenen Schriften ersehen, die bezeugen, dass schon damals manche Väter mit Sorge den Fortschritt ihrer Sprösslinge beobachteten und beim strengen Lehrer mit einer Fürbitte vorsprachen, die oft auch mit einer Zuwendung untermauert wurde. Eine erfolgreiche Bildung sorgte für ein Auskommen des Einzelnen und stellte gleichzeitig auch den gesamten Staatsapparat auf eine breitere Basis. Das angeeignete Wissen nutzte man zur Bewältigung des alltäglichen Lebens. Schrift, Zahlen, Gestirne waren hauptsächlich Hilfsmittel für Berichte, Mengen-, Kurs- und Zeitberechnungen. Noch fehlte ihnen die magische Aura, die später den Weg in eine transzendentale Welt und zu neuen Existenzfragen bereitete. Denn die Konzentration der Herrscherclans auf die eigene absolutistische Macht führte lange Zeit dazu, dass man ihren Verlust und damit einen Identitätsverlust fürchtete, wenn man den Einfluss fremder Kulturen in all ihren Verschiedenartigkeiten zuließ. Sie sahen sich als die Vertreter einer vorgegebenen Weltordnung, die es um jeden Preis im Inneren und gegen Anfechtungen von außen zu bewahren galt. In logischer Konsequenz schotteten sie sich gegen alles Fremde ab. Eine neue belebende Dynamik wurde so unterbunden und ließ die eigene Kultur zunächst verkrusten, dann erstarren und schließlich ganz verblassen. Gefördert wurde diese Entwicklung auch durch die Tatsache, dass der Gott bzw. die Götter größeres Ansehen als der König erlangten, wodurch die Verpflichtung, dem König zu dienen, von einer Art Befreiungsdrang unter der Bevölkerung abgelöst wurde.
Andere Völker dagegen, die einen offeneren Kulturaustausch praktizierten, entwickelten sich durch dieses wechselseitige Geben und Nehmen zu zwar veränderten, aber dynamischeren Kulturkreisen.
Einen ersten gravierenden Einschnitt erlebte die Welt im vorderen Orient unter dem Perserkönig Cyrus II (6. Jht. v. Chr.), der systematisch damit begann, durch die Unterwerfung benachbarter Völker ein Großreich zu errichten, in dem er in prächtigen Palästen residierte. Auch Dareius der Große erweiterte sein Reich und konsolidierte seine Herrschaft durch systematische Strukturierung der Verwaltung, die nur ein Zentrum kannte, den König. Und doch manifestierte sich in ihm eine neue Denkweise, wie eine Selbstdefinition zeigt:
“Nach dem Willen des Allweisen Herrn bin ich so geartet, dass ich das Recht liebe, das Unrecht hasse. Ich mag nicht, dass der Schwache um des Starken willen Unrecht erleide, aber ich mag auch nicht, dass dem Starken um des Schwachen willen Unrecht widerfahre.”4
Bald aber zeigte sich, welche Anforderungen an seinen Sohn Xerxes mit diesem gewaltigen Erbe verbunden waren. Dieser hatte wohl auch den Machthunger seiner Vorfahren geerbt, doch seine verfehlte kriegerische Expansionspolitik und der innere Zerfall des Reiches leiteten Jahrhunderte von Zwistigkeiten und Eroberungskriegen ein, die immer weiter in die westliche Welt ausstrahlten.
Da half selbst die Weisheit eines Zarathustra (ca. 600 v. Chr.) nicht, nach dessen Lehre der Mensch im Kampf zwischen Gut und Böse die Wahl hätte, sich kraft seiner Vernunft für den “richtigen” Weg zu entscheiden. So lesen wir in den Gathas des Zarathustra: “O Mazda, als Du am Anfang mit Deinen Gedanken uns Leib, Weisheit und Gewissen erschafftest und [...] uns Rede- und Tatkraft verliehen hattest, wolltest Du, daß wir unseren Glauben nach unserem Willen wählen.”5 Der gute Wille zum Umdenken, zu einer Neuorientierung und neuen Positionsbestimmung des Menschen ist überhaupt die Voraussetzung für eine positive Veränderung von uns selbst und der Welt.
Diesem Prinzip von Gut und Böse, von richtig und falsch werden wir später wieder in der christlichen Bibel und dem islamischen Koran begegnen, wo diese widerstreitenden Elemente ebenfalls eine herausragende Rolle spielen. Denn mit dieser seiner “richtigen” Entscheidung für das Gute kann der Mensch mitwirken an einem Heilsplan eines imaginären Gottes, eines “Allweisen Herrn” (Ahura Mazda), dessen Prinzipien „Gut Denken”, “Gut Reden” und “Gut Handeln“ in der Symbolfigur Faravahar ausgedrückt werden. Doch diese Grundsätze für eine positive Entwicklung, für einen Fortschritt in der Menschheitsgeschichte, werden in ihrer Zeit und darüber hinaus mit wiederkehrender Un-Vernunft missachtet. Folglich waren auch ein scheinbar unbesiegbarer Alexander der Große wie auch der Koloss des römischen Reiches den Wechselfällen des Schicksals - oder muss man vielleicht von selbstinszenierten Gesetzen der Geschichte sprechen? - unterworfen. Alexander der Große allerdings folgte nicht dem Rat seines Lehrers und berühmten Philosophen Aristoteles, bei seinen Eroberungen den Griechen gegenüber als Führer, den "Barbaren" gegenüber als Herrscher aufzutreten. Auch als Gebildeter und Weiser konnte sich Aristoteles nicht von der Sklavengesellschaft befreien. Nach ihm muss zwar der Mensch in seiner Form als zoon logikon, d. h. als Lebewesen, das Teil hat an der Vernunft, in seiner Form als zoon politikon, d. h. als Lebewesen, das zu einem Gemeinschaftwesen gehört, auf eine harmonische Gemeinschaft - allerdings unter Gleichgestellten - hinstreben. Aber „von Natur aus ist der ein Sklave, der einem anderen gehören kann und auch gehört und der nur insofern an der Vernunft teilhat, als er sie von anderen annimmt, sie aber nicht von sich aus besitzt.“6 Bereits hier muss auf Immanuel Kant und die Aufklärung verwiesen werden, die den Menschen aus eben dieser „Unmündigkeit“ befreien wollten.
Alexander der Große versuchte einerseits eine Weltherrschaft zu errichten, aber andererseits beabsichtigte er ein Reich zu schaffen, in dem sich Menschen und Kulturen gegenseitig durchdringen und befruchten. Mit ihm wurde zum ersten Mal in großem Stil in optimistischer Weise eine Völkergemeinschaft angestrebt, in der er nicht mehr zwischen guten Griechen und minderwertigen Barbaren unterschied. Er achtete die andersartigen Menschen und Kulturen, obwohl er - im Widerspruch zu sich selbst - "Strafaktionen" wie die Zerstörung der Königsmetropole Persepolis als Racheakt durchführen ließ. Doch auch seine Vision scheiterte an seinen Nachfolgern. Die Phasen politischer, wirtschaftlicher und kultureller Blüte mündeten in nahezu regelmäßigem Rhythmus in ein geschichtliches Dunkel, in dem eine ohne Zweifel vorhandene Vernunft sich nicht genügend Gehör verschaffen konnte, um für die Menschheit ein nachhaltiges Licht zu entzünden. Ein aufgeklärter Geist, der der Menschheit eine entscheidende positive Wendung auf Dauer geben konnte, war nicht in Sicht.
Im alten Griechenland erreichten allerdings die Stadtstaaten durch den regen Austausch von Handelswaren und Wissenschaften und auch durch eine gewisse Migration verschiedenartiger Menschen vorübergehend eine neue Blütezeit ihrer Kulturen. Eine ausgeprägtere Reflexion über das Leben und den gesamten Kosmos ließ neue Aspekte im menschlichen Zusammenleben sichtbar werden. Die nach wie vor in Sklaven und Freie zweigeteilte Gesellschaft, die Macht und Aufgabe des Staates und das eigene Kulturverständnis wurden einer kritischeren Betrachtung unterzogen. Das gesellschaftliche Zusammenleben, allgemeines Recht, Macht und die Rolle des Individuums wurden als Erscheinungsformen des täglichen Lebens in einen geistigen Bereich von Reflexion und Moral hinübergeführt, so dass eine bewusste Auseinandersetzung mit dem status quo ausgelöst wurde. Leider wurden - und werden - nur all zu häufig solche im wahrsten Sinne des Wortes “Lichtgestalten” als Phantasten oder gar Spinner desavouiert.
Als Diogenes von Sinope (der Mann in der Tonne - 4. Jht. v. Chr.) - so kolportiert eine Anekdote - am helllichten Tag demonstrativ mit einer Laterne auf dem dichtbevölkerten Marktplatz von Athen umher ging, hielten ihn die Bürger für einen Narren und verspotteten ihn gar als “Hund”. Gefragt, warum er denn bei Tage mit einer Laterne herum lief, soll er geantwortet haben: “Ich suche einen ‘Menschen’”. Für ihn war also ein “Mensch” nicht eine Person, die sich anhand ihrer Kleidung, ihres Amtes oder ihres Reichtums als Bürger definierte, sondern für ihn war ein “Mensch” jemand, der den anderen trotz seiner Andersartigkeit achtete, der nach nicht mehr verlangte als das für ihn Notwendige und der die guten Eigenschaften eines Mit-Menschen besaß. Kann man eine trotz vieler anerkennenswerter Errungenschaften inhumane Gesellschaft deutlicher bloßstellen?
In der Theorie setzte man sich mit vielen begrüßenswerten Gedanken um die Existenz des Menschen und die ihm verliehene Vernunft auseinander, doch sie fanden wenig Eingang in die Praxis des täglichen Lebens. Die Philosophie der Stoa mit ihrem göttlichen Logos definiert alle Menschen als Teil dieses göttlichen Wirkens. In logischer Konsequenz sind alle Menschen Mitglieder dieser Gemeinschaft, ganz gleich, wo sie auf dieser Erde wohnen, zu welchem Volksstamm sie gehören oder ob sie Sklaven oder freie Bürger sind. Grausamkeiten gegenüber dem Mitmenschen und brutale Rache am besiegten Feind war unvereinbar mit dieser Auffassung von humaner Gemeinschaft, die als Teil einer göttlichen Weltordnung verstanden wurde. Diese "Popularphilosophie" konnte sich weit ausbreiten und hatte lange Zeit Bestand, aber als substanziell humanistische Vorstellung konnte sie nicht auf Dauer Fuß fassen. Das “secundum naturam vivere” (gemäß der Natur leben) der Stoiker blieb für die Mehrheit, besonders für die Herrschenden, die eigentlichen Gestalter, ein rein theoretischer Gedanke. Machtund Lebenskämpfe und das Streben nach Luxus ließen ihrer Philosophie immer weniger Spielraum. Um diese Vorstellung eines menschlichen Miteinander wurde lange von einzelnen unerschütterlichen Gruppen gerungen, aber sie fand ihre Auflösung spätestens in der Vorstellung von dem Kampf jeder gegen jeden (Hobbes' “homo homini lupus” [Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf] - 17. Jht.). Gegen diesen “Zerfall” setzten Hobbes und ebenso die nachfolgenden Philosophen John Locke und Jean-Jacques Rousseau ihre unterschiedlichen Staatstheorien, um der Gesellschaft einen mehr oder weniger vernünftigen Rahmen zu geben. Doch auch sie hatten nicht den erhofften dauerhaften Erfolg.
Auch Platon (ca. 4. Jht. v. Chr.), einer der wohl größten Philosophen, scheiterte mit seinen hohen Gedankengängen, die sich auf das zweifelnde, aber aktive Denken eines Sokrates (“Ich weiß, dass ich nichts weiß”) stützten, an der Realität seiner Zeit. Seine Vorstellung von dem Streben nach der Idee des Guten, wie es ähnlich auch schon bei Zarathustra anklang, war selbst für die gebildeten Zeitgenossen eine Herausforderung, weil das letztendliche Ziel kaum erreichbar schien. Aber Platon würdigte schon den Versuch auf dem Weg dorthin positiv. Er wollte den Menschen, der sich selbst in den beschränkten Horizont seiner geistigen Höhle eingesperrt hatte und das eigentlich Wahre und Gute nicht sehen konnte oder wollte, befreien. Diesen Zustand schildert Platon in seinem berühmten Höhlengleichnis7: In einer Höhle saßen Menschen, die so angekettet waren, dass sie nur geradeaus nach vorne auf eine Höhlenwand schauen und sich nicht bewegen konnten. Hinter ihnen, Richtung Eingang, war eine Mauer, über der die verschiedensten Gegenstände entlang getragen wurden. Das Licht eines Feuers nahe am Eingang warf die Schatten der Gegenstände an die Wand, und die angeketteten Menschen hielten diese Schatten fälschlicherweise für die realen Gegenstände, weil sie nichts anderes kannten. Diese Menschen würden sich nun sträuben, wenn man sie aus der Höhle herausführen und ihnen das wahre Licht und die wahren Gegenstände zeigen wollte, weil sie glaubten, aus ihrer wahren Welt gerissen zu werden. Erst wenn man sie mit sanfter Gewalt aus ihrer Lage befreien und sie zwingen würde, das wahre Licht und die wahre Welt außerhalb der Höhle zu sehen, würden sie nach einem kurzen Gewöhnungsprozess die Wahrheit erkennen.
Genau so verhält es sich mit den Menschen, die nicht nach der wahren Erkenntnis streben wollen. Ihnen bleibt die Wahrheit versperrt, es sei denn, jemand führt sie aus dieser Dunkelheit heraus zum wahren Licht. (vgl. ebenso das Zeitalter der Aufklärung, S.110ff) Deshalb finden wir auch Platons optimistische Vorstellung in seiner Schrift “Der Staat”, dass weise, d. h. erkenntnis- und erfahrungsreiche Menschen an der Spitze eines Staates stehen sollten. Sie wären eine Option für ein fortschrittliches und harmonisches Gemeinwesen.
Erst Jahrtausende später sollte die Forderung der Selbstbefreiung an den Menschen in Kant wieder einen Fürsprecher, wenn auch nur auf Zeit, finden. Denn selbst die Schriften der legendären Bibliothek von Alexandria, in der im Laufe der Jahrhunderte das gesammelte Wissen der damaligen Welt zusammengetragen worden sein soll, sollten nicht ausreichen, um den “Machern” der Geschichte das weite Spektrum des menschlichen Geistes nahezubringen, geschweige denn sie zu einem menschheitsorientierten Handeln zu veranlassen.
So erlebte auch diese Geistesbewegung einiger Griechen zum guten Denken und Handeln - in “alter Tradition” - keine Fortführung in der Kultur der Römer, die einerseits eine enge geistige Bindung mit dem Nachbarn pflegten, aber andererseits nicht die Kraft besaßen, als Katalysator die alt-überlieferten Grundsätze vom guten Denken, guten Reden und guten Handeln auf einer neuen Ebene weiterzuführen. Das Prinzip der Eroberung und Unterwerfung wurde von dem pragmatischen Streben nach Macht, Gewinn und Luxus bestimmt und prägte den Alltag der herrschenden Schicht. Immer noch war Sklaverei ein Stützpfeiler dieses Lebens. Selbst wenn es hier und dort eine menschenwürdige Behandlung der Sklaven gegeben hat, ja sie sogar gelegentlich freigelassen wurden, waren sie dennoch Lebewesen niedrigster Klasse. Immer noch beherrschte eine gewollte Spaltung die Gesellschaft. Kräftige Sklaven - und Kriegsgefangene - wurden im römischen Reich oft zu Gladiatoren ausgebildet, nicht, um im Heer für das Reich zu kämpfen, sondern um in Volksbelustigungen die Masse zu unterhalten. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wurden Menschen in blutrünstigen “Spielen” zur Unterhaltung der Bevölkerung eingesetzt, wobei sie sich gegenseitig abschlachten oder mit unzureichender Ausrüstung gegen wilde Tiere zum Überlebenskampf antreten mussten. Der ordinären Masse der Zuschauer wurde dabei eine Scheinmacht übertragen. Sie durfte mit gesenktem oder gehobenem Daumen oder durch Beifall entscheiden, ob der besiegte Gegner überleben durfte oder den Tod erleiden musste. Römische Herrscher traten hier nicht als Verfechter einer humanen Philosophie auf. Kaiser Augustus selbst schreibt in seinem Tatenbericht: “Dreimal habe ich ein Gladiatorenspiel in meinem Namen und fünfmal im Namen meiner Söhne und Enkel veranstaltet. In diesen Spielen haben etwa zehntausend Menschen bis zum Tod gegeneinander gekämpft. ... Hetzjagden mit afrikanischen Tieren [wie Löwen, Leoparden, Elefanten u.ä.] habe ich im Circus oder auf dem Forum oder im Amphitheater für das Volk in meinem Namen oder im Namen meiner Söhne und Enkel veranstaltet, wobei etwa 3500 Tiere “verbraucht” wurden.”8
Die selbstsüchtige Verteidigung der Anhänger dieses Genres, dass es sich in den Filmen ja nicht um wirkliche Tote handelt, läuft ins Leere. Denn es geht hier um eine Grundsatzhaltung dem Leben gegenüber. Brauchen wir wirklich den Tod der anderen, um unsere Vergnügungssucht zu befriedigen, weil uns alles darunter keinen Kick mehr vermittelt? Haben wir jegliche Empathie für das Leiden anderer Menschen verloren, so wie es der amerikanische Philosoph und Mathematiker Charles Eisenstein sieht? “Doch wir ... wurden ausgebildet, Dinge außerhalb ihres Kontextes zu verstehen, das Probeexemplar aus der Natur zu entnehmen und ins Labor zu schaffen. Egal, was die Quelle ist, ob nun ein Gefängnis in Bagdad oder ein Videospiel aus dem Silicon Valley. Der Zuschauer sieht die selben Pixel auf dem Bildschirm. Wir lassen Kinder keine Gewaltfilme schauen, weil das für sie traumatisch wäre - sie würden denken, die Gewalt sei real. Doch die allgegenwärtige Darstellung von Gewalt in unserer Kultur wird sie noch früh genug desensibilisieren. Das Leiden anderer nimmt eine Unwirklichkeit an, ohne die wir niemals fortfahren könnten, es zu verursachen. ... Unglücklicherweise halten die Zahlen, die man verwendet, um Gewalt zu messen - Mordraten, abgeholzte Flächen Regenwald, Konzentrationen toxischer Chemikalien, Sachschäden bei Katastrophen usw. -, das tatsächliche Leid auf sichere Distanz: Es ist entfernt und damit unwirklich. Wann wird es für uns wirklich? Wenn es den Bereich des objektiven verlässt und zu Geschichten und Bildern wird, die mit echten Menschen verbunden sind.”12 Aus diesem Grund scheint uns das Leid unberührt zu lassen, weil es nicht direkt in unser eigenes Leben schneidet, wir also keine eigene Schmerzerfahrung “erleiden”. Nehmen wir fremde Gefühle nur als leblose Bildsequenzen oder reine Information wahr ohne jegliche innere Beteiligung? Wären wir vernunftbegabte Wesen, würde uns allein schon der Verstand mahnen: “Diese anderen sind Lebewesen wie du, die die gleiche Freude, den gleichen Schmerz, die gleiche Sorge, die gleiche Angst, die gleiche Hoffnung empfinden, mögen sie geographisch oder ethnisch auch noch so weit entfernt sein!” Und trotzdem: Werden nicht auch viele unserer Sportveranstaltungen wie Boxen, Catchen, Autorennen, Fußball, Handball und andere unter einem ähnlich aufregend unterhaltsamen Aspekt gesehen? Wie weit haben wir uns von der Fairness entfernt, wenn wir beim Boxen bewusst Tiefschläge einsetzen, um den Gegner K.O. zu schlagen, wenn bei Autorennen sich die Konkurrenten gegenseitig “abschießen”, um einen positiveren Punktestand zu erzielen, wenn Fußballer oder Handballer den Kontrahenten “umarmen” und ihn so paralysieren oder sie ihn so am Trikot festhalten, dass an ein Weiterlaufen nicht zu denken ist, oder sie ihm gar einen brutalen Ellenbogencheck verpassen, damit der Kontrahent schon gleich in die Knie geht? Vom flächendeckenden illegalen Doping möchte man gar nicht sprechen. Schon George Orwell hatte dieses Phänomen erkannt, als er Sport definierte: “Sport is war minus the shooting” (Sport ist Krieg ohne Schusswaffen).
Und wie betreiben wir “spannende” Geschichtsbewältigung? Inszenieren wir nicht in regelmäßigem Rhythmus Historienspektakel wie Gladiatorenspiele, Ritterkämpfe und Kriegsschlachten in einer Weise nach, dass sie möglichst authentisch bei den Zuschauern herüberkommen. Und um einen großen Unterhaltungswert zu bieten und ein reges Interesse zu erwecken, werden die pseudogeschichtlichen Events möglichst gewalttätig, grausam und mit ohrenbetäubendem Getöse nachgestellt. Menschen werden mit Messern, Schwertern, Lanzen und Bayonetten so realitätsgetreu wie möglich “niedergemetzelt”, im Pulverdampf von Gewehr- und Kanonenkugeln “niedergestreckt”. Und das alles dient keineswegs einem aufklärenden Geschichtsverständnis (Wer kann schon den grausamen Tod durch einen Schwerthieb und die qualvollen Verwundungen und Verstümmelungen wirklich nachempfinden?!). Nein! All diese Veranstaltungen dienen zur Belustigung, Unterhaltung und Abwechslung der Schaulustigen und nicht zuletzt dem Ruf als Touristenmagnet, dem Umsatz von Verkaufsbuden und damit dem Gemeindebudget. Am Ende gehen alle zufrieden