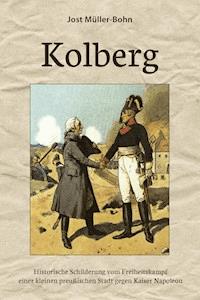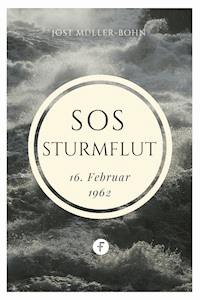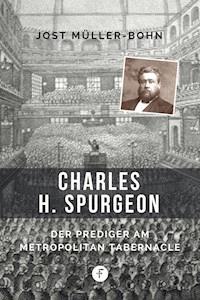Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: 2. Weltkrieg
- Sprache: Deutsch
Zwei Schicksale von Millionen – inmitten von Not, Angst und Zerstörung. 1945: Der Osten steht in Flammen. Ein junges Mädchen, ein Kind und ein Mann kämpfen ums Überleben, während der Sturm der Vernichtung über Europa hinwegfegt. Im Chaos des Krieges – zwischen Bombenhagel, Flucht und Verzweiflung – suchen sie Halt und finden Gottes bewahrende Hand. Einer von ihnen ist ein „verlorener Sohn“, der durch die Hölle von Polen, der Tschechoslowakei und den Endkampf um Berlin geht – und auf wundersame Weise überlebt. Doch warum er? Warum nicht die unzähligen anderen Kinder, Mütter, Greise, die unschuldig dem Krieg zum Opfer fallen? Warum trifft unvorstellbares Leid auch aufrichtige Christen? Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Fragen, die auch die ersten Christen nicht stellten, als sie verfolgt, getötet und zerrissen wurden, während andere überlebten. Diese authentischen Berichte – basierend auf Tagebüchern und Erinnerungen – nehmen den Leser mit in eine Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung, aber auch des Glaubens und der Hoffnung. Sie laden ein, trotz aller Unsicherheiten mit Vertrauen in die Zukunft zu blicken. Unheimlicher Ostwind, was bringst du? – Gott ist da, der uns hilft!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die aus dem Osten kamen
Millionen auf der Flucht vor dem Tod
Jost Müller-Bohn
Impressum
© 2015 Folgen Verlag, Bruchsal
Autor: Jost Müller-Bohn
Cover: Sergej Pauli, Villingen-Schwenningen
Lektorat: Mark Rehfuss, Schwäbisch Gmünd
ISBN: 978-3-944187-86-0
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Inhalt
Vorwort
Requiem der Millionen
Fluch und Segen im Feuerregen
Fern- oder Heimweh
Nach Ostland geht unser Ritt
Ein harter Aprilscherz
Die Lieblingsfarbe des Königs
Dem Tod ins Angesicht geschaut
Meuterei im Kessel
Flucht aus St. Nazaire
Verirrt in Feindesland
An der Oderfront
Der Tod flog vorbei
Ein Wort kenne ich nicht – Kapitulation
O Gott, dass wir so gesündigt haben
Frauen, Schnaps und Uhren
Der Tote und das Brot
Unbequeme Einquartierung
Gefahrvolle Hamsterfahrten
Vom Feind gespeist
Schweinefutter und Maschinenpistolenfeuer
So wie der Baum fällt, so bleibt er liegen
Endstation Frieden
Raumschiff in Not
Nachwort
Vorwort
DIE AUS DEM OSTEN KAMEN
Zwei Menschenschicksale von Millionen – in gleicher Bedrängnis, Not und Gefahr.
Zwei Menschen im Sturmwind der Vernichtung – ein Kind, ein junges Mädchen, und ein Mann erleben den katastrophalen Oststurm im Jahre 1945.
Zwei Menschen aus dem Millionenheer, vom Ostwind verweht, suchen und finden Gott und seine Hilfe.
Einem Mann aus Königsberg wird die Weisung gegeben:
»… der fliehe auf das Gebirge, und wer in der Stadt ist, der gehe hinaus, und wer auf dem Lande ist, der komme nicht herein« (Lukas 21, 21).
Ein »verlorener Sohn« wird im Feuerregen der Vernichtung in Polen, der Tschechoslowakei und beim Endkampf um Berlin in unbegreiflichem Maße bewahrt und geführt.
Zu gleicher Zeit gehen Zehntausende, am Krieg unschuldige Kinder, Greise, Mütter und Männer zugrunde. Warum gerade sie? Waren andere weniger schuld? Weshalb machte das Leid, die unvorstellbare Not nicht vor aufrichtigen Christen halt?
Das sind Fragen, die durch dokumentarische Tatsachenberichte nicht beantwortet werden können.
Diese Fragen wurden von den ersten Christen nicht gestellt. Während viele als Märtyrer wegen ihres Glaubens zerhackt, zerfleischt und von wilden Tieren zerrissen wurden, blieben andere zur gleichen Zeit verschont.
Diese authentischen Berichte – aus Tagebüchern und Erinnerungen zusammengestellt – sollen die Leser ermuntern, glaubensvoll und im Vertrauen auf Gott in die düstere und drohende Zukunft zu blicken. Unheimlicher Ostwind, was bringst du? – Gott ist da, der uns hilft!
Jost Müller-Bohn
Requiem der Millionen
Königsberg - Pillau - Danzig - Kiel
Von Ostpreußen nach Friesland – von Schlesien zum Schwarzwald.
Blickt man vom Ufer ans andere Land, beschleicht ein Sehnen unerkannt, Heim- oder Fernweh mag es sein; doch deutlich ruft es: Komm heim! Du irrender Mensch, komm heim!
Das neue Jahr hatte in Deutschland begonnen, es war das Jahr 1945 nach Christi Geburt, wie es hieß. Ein unheimliches Ahnen von umwälzenden Geschichtsereignissen beherrschte das Denken von Millionen aus deutschen Grenzgebieten zwischen Memel, Tilsit, Stettin und Breslau.
Eine unruhige, wild gezackte Trennlinie durchschneidet zweimal die weißgraue Schilflandschaft des Odergebietes – der alte und der neue Strom. Über die breiten, nicht zugefrorenen Flussläufe ragen in kühnen Bogen zwei lebenswichtige Brücken. Auf den schneeverwehten Landstraßen wälzen sich schwerfällig unübersehbare Züge von Flüchtlingswagen. Endlos scheinen die Kolonnen zu sein, endlos die Angst, endlos die Qual, endlos der Hunger, endlos die Kälte, endlos der Weg – alles scheint endlos, hoffnungslos zu sein. Wie Rinnsale vom Norden, Osten und Südosten kommen sie träge heran. Millionen Menschen auf der Flucht vor dem Grauen. Für viele ist es schon gleichgültig, wo sie in dieser Zeit ankommen, niederfallen oder sterben. Von überall her strömen sie zusammen. Über die leicht gewölbten Hügel bis an den Horizont kann man die Elendszüge erkennen. Da gibt es Kinder, die kaum zehn Jahre alt sind. Sie stapfen gedankenlos mit letzter Kraft neben dem Wagen her. Die Wagen sind überfüllt. Von schon zerbrochenen Fahrzeugen mussten Frauen und Kleinstkinder mit übernommen werden. Das lauffähige Volk trabt bereits unzählige Kilometer nebenher.
Grau und düster breitet sich der Himmel über die Weite der Neumark. Das Stampfen der Pferde, das Ächzen und Knarren der Holzräder, hin und wieder ein Aufschrei, ein Fluch, ein Weinen – sonst löst sich kein kriegerischer Laut aus dem erstarrten Winterpanorama. Einige hundert Meter von der Rückzugsstraße entfernt ist alles noch so still. Dieser Elendszug gleicht einer stummen, dämonischen Pantomime. Schemenhaft erscheinen und verschwinden sie wieder in der nebelhaften Wüste aus Schnee und Eis. Bedrückendes Schweigen – die bekannte Ruhe vor dem Sturm.
An den Brücken aber ist es anders. Wie bei einem Flussdelta fließen hier die Wege zusammen. Aus den Rinnsalen werden Bäche, aus den Bächen wilde, reißende Ströme flüchtender Menschen. Eine Sintflut erschöpfter Menschenleiber. Lebensgefährliches Gedränge herrscht. Feldgendarmerie und Hilfstruppen sind nicht mehr Herr der Lage. Ratlos schreien sie in das Durcheinander.
Für die, die über die Brücken wollen, gilt nur eine Parole: »Rette sich, wer kann!«
Aber wie sollen sie hinüberkommen? An den Seiten liegen umgekippte, zerbrochene Treckwagen. Was sollen sie tun? Einfach durchbrechen? Das Schwache muss dem Stärkeren weichen. Anstand, Bescheidenheit, Rücksicht und Nächstenliebe gelten nicht mehr – nur Ellenbogenbewegung, Gewalt, Rücksichtslosigkeit kann noch zum Ziel, zum anderen Ufer führen. Zwei Brücken sind zu überwinden – so nah und doch so fern!
In dieser Stunde gibt es nur einen Gedanken: »Eile, rette dein Leben, und wenn möglich, noch das der Deinen!«
Viel zu spät ließ man sie ziehen. Durchhalteparolen über geheimnisvolle Wunderwaffen hatten ihre unheimlich mystische Wirkung nicht verfehlt.
Wie der Frühlingswind die Erde vom Schnee, so sollen jetzt diese angeblich noch vorhandenen Wunderwaffen das Land vom Feind befreien.
»Wir werden siegen, weil wir siegen müssen«, ist in den Gehirnen zur manischen Idee geworden. »Die Front wird standhalten«, hatten die Ortsgruppenführer versichert. Am nächsten Morgen aber erfuhr man, dass die gesamten Partei-, Kreis- und Ortsgruppenleitungen wie Schlossgespenster mit Sack und Pack, Koffer und Kisten, Frauen und Kindern im Winternebel verschwunden waren. Wer nur zwölf Stunden vorher die geringste Äußerung einer Evakuierungsmaßnahme gemacht hätte, wäre schnell als Defätist, als feiger Volksverräter und Gerüchtemacher gebrandmarkt worden. Nun waren sie fort, die gestrengen Richter der Nation.
Die Betrogenen traten ein unheilvolles Erbe an.
Plötzlich ist der Feind da. Keine drei Kilometer entfernt steht die russische Panzerspitze. Alles stürmt wie auf Befehl auf die Straße. Jählings ist alles verstopft, jeder wünscht den anderen hinter sich. »Gebt uns den Weg frei!« – »Die Russen kommen!« – »Ihre Rache mit ihnen!« – »Sie werden kein Pardon geben!« – Ein kaltes Entsetzen erfasst alle. Der Tag des Gerichtes, der Abrechnung, ist da. »Sie werden uns alle niedermetzeln!« Gräuelgeschichten kursieren schon seit Wochen in den Wohnungen und Gasthäusern. Von abgeschnittenen Zungen und ausgestochenen Augen, von Verschleppungen nach Sibirien und bestialischen Vergewaltigungen flüstert man. Die nazistische Propaganda schürt das Feuer der Angst. Man will dadurch allerletzte Abwehrkräfte mobilisieren.
Jetzt explodieren rechts und links neben dem Dorf Panzergranaten. Stalinorgeln brüllen ihr grausames Requiem. Schlachtflieger feuern in auseinanderstiebende Menschenmassen. Schreiende Kinder versuchen, den nächsten Wald, das kleine Haus, die kurze Hecke zu erreichen. Wie Holzpuppen, die Arme zum Himmel erhoben, fallen viele tot zur Seite. Rotgefärbter Schnee, schreiende Mütter vor kleinen Kinderleichen. Wahnsinnsrufe in eiskalter Luft – ohne Widerhall. Bald wird der weiche, barmherzige Schnee eine hüllende Decke über das unaussprechliche Leid werfen.
Ganz Ostdeutschland besteht jetzt nur noch aus blutenden Wunden, über die der strenge Winter herzlos seinen eisigen Sargdeckel legen will. Am schlimmsten hat es die Flüchtlinge, die Wehrlosen, die Unerfahrenen, die Alten, die Kinder und Mütter betroffen. Oft sind sie von beiden Seiten bedrängt. Hinter ihnen drücken in zügigem Vorangehen die feindlichen Armeen, vom Westen versuchen zusammengewürfelte Ersatzreservetruppen mit Lastwagen (Marke Holzgasdauerbrenner) oder zusammengeflickten Restpanzern durch die vollgestopften Straßen in Richtung Front zu kommen. Rücksichtslos fahren sie in Wagen-, Pferde- und Menschenknäuel hinein, vorbei oder hindurch, um die Flut der Roten Armee noch aufzuhalten. Wagen zerbrechen, kippen um, versinken in aufgehäuften Schneebergen am Straßenrand. Pferde scheuen, bäumen sich auf und reißen die fahrenden Elendshütten in eiskalte Wasserbäche.
»Wir werden weitermarschieren, wenn alles in Scherben fällt …« Nach diesem Motto werden Kinder, Greise und Frauen mit in das Grauen gerissen. Die satanische Tyrannei bleibt konsequent bis zum völligen Ende. Für viele ein Grauen ohne Ende.
Mit dumpfer Gleichgültigkeit ziehen Überlebende weiter. Eine alte Geschichte steigt aus uralter Vergangenheit auf – die Völkerwanderung! Von Ost nach West, von Nord nach Süd befinden sich Millionen Beraubter, Betrogener, Vergewaltigter und Geschlagener auf der Flucht vor dem tödlichen Verderben. Sie sehen nicht mehr die verstummten Toten am Straßenrand, sie schauen nicht auf die um Hilfe flehenden, unbekannten Alten, sie blicken nicht mehr auf die ausgebluteten Lippen der Verwundeten. Sie sind hart geworden, sehr hart und abgestumpft. Frauen werfen aus »Barmherzigkeit« ihre Neugeborenen vom Wagen. In eiskalter Winternacht, bei -25 °C haben sie entbunden. Sie können das qualvolle Zeitlupensterben ihrer Säuglinge nicht mit ansehen. Blutrot droht hinter ihnen der Osthimmel, brennende Dörfer, brennende Heimat! Das Grollen der Front treibt die Heimatlosen bis zur Erschöpfung weiter. Der schrille Ruf: »Die Russen sind da!« peitscht die überanstrengten Körper erneut voran. Entkräftete Mütter schützen mit letzter Körperwärme ihre fiebernden Kinder. Still drücken ihre Hände zum letzten Mal die Lider über die geliebten Kinderaugen. Kein Wiegenlied, kein Abendgebet, kein warmes Nest. Unter den dunklen Wagenplanen hat der unheimliche Würger sein Werk. Blühendes Leben erlischt im Schatten des Todes.
»Die Krähen schreienUnd ziehen schrillen Flug’s zur Stadt,Bald wird es schneien –Weh dem, der keine Heimat hat!«
Sie hatten eine Heimat, aber die wird ihnen gewaltsam entrissen. Wer jetzt keine zweite Heimat kennt, ist elend dran. Ein Gericht Gottes hat begonnen. Natürlich, von dem Gott, dem Millionen vertraut, dem heißgeliebten Führer, können sie keine Hilfe mehr erwarten. Sie können ihn nicht anrufen oder zur Rechenschaft ziehen.
Im bombensicheren Bunker zu Berlin tobt der wahnsinnige Sohn der Hölle gegen jedermann. Er bemitleidet sich selbst, beschimpft Soldaten, Volksgenossen und Generäle. Er jammert über sein tragisches Schicksal. Vom Schicksal aber der eben Geschilderten spricht er nicht. Im Meer der feindlichen Armeen ist nur noch ein Wrack des stolzen Schiffes geblieben, auf dem todeswund die Führer des Dritten Reiches um ihr Leben kämpfen. Sie wünschen noch nicht zu sterben und erkaufen sich durch das Sterben anderer einige Stunden. Wer das sinnlose Spiel nicht mitmachen will, wird zum Volksverräter erklärt und ohne richterlichen Spruch am nächsten Baum oder Telegraphenmast aufgehängt. »Ihr seid geboren, für Deutschland zu sterben – denn die Fahne ist mehr als der Tod«, war seine Botschaft. Immun gegen alle Vernunft haben Betörte ihm noch bis zum letzten Atemzug geglaubt.
»Es lebe unser heißgeliebter Führer«, röchelten Männer und Frauen und gingen mit diesem heidnischen Gebet in den Tod. In dieser Zeit stehe ich auf der Brücke von Schwedt, einer idyllischen Kleinstadt an der Oder. Fassungslos erblicken Kinderaugen das Grauen. Bis heute, 25 Jahre danach, haben mich diese Erinnerungen nicht verlassen. Die Stadt ist noch unzerstört. Für Feindbomber war sie bisher kein geeignetes Ziel. Die Schlossfreiheit, das kleine verträumte Schlösschen, wo einst Königin Luise von Preußen auf der Flucht vor den Franzosen Unterkunft und Wiedersehen mit ihren Kindern fand, liegt unberührt und in Schnee eingehüllt da.
Damals, im Jahre 1806, befand sich die Königin auf der Flucht nach Memel. Jetzt treibt der Flüchtlingsstrom von Memel dem Westen zu. Wie damals wurden auch jetzt aus den Siegern die Besiegten, aus den Verfolgern die Verfolgten. Im Jahre 1812 sang man ein Lied, das 1945 wieder hochaktuell wird, nur dass die Geschlagenen nicht Franzosen, sondern Deutsche – Ost- oder Westpreußen sind:
»Es irrt durch Schnee und Wald umherDas große, mächt’ge Franzenheer.Speicher ohne Brot,Aller Orten Not,Wagen ohne Rad,Alles mild’ und matt,Kranke ohne Wagen,So hat sie Gott geschlagen!«
Ausgemergelte Ackergäule ziehen rastlos die schmutzigen Bauernwagen. Durch den matschigen Schneebrei malen sich mühsam die klobigen Holzräder. An den Wagen hängen Namens- und Ortsschilder: »Paul Schulz, Gumbinnen«. »Hans Gärtner, Ortelsburg«. »Fritz Masur, Memel«.
Aus Tilsit und Insterburg, aus Kleinkuhren, Nidden, Warnicken, Georgswalde, Neukuhnen, Schwarzrodt, aus der Rominter Heide – aus Deutsch-Eylau, Marienburg, Bromberg und Posen kommen sie heran. Immer geringer werden die Entfernungen – Schneidemühl, Arenswalde, Stargard – mein Gott, sind die Russen schon bis dorthin gekommen oder vollzieht sich hier ein geplanter Evakuierungsrückzug? Durch den Wehrmachtsbericht werden wir eines Besseren belehrt: »Starken sowjetischen Kräftegruppen ist es gelungen, geringfügigen Geländegewinn im nördlichen Ostpreußen zu verzeichnen. Waffen-SS-Verbände, Wehrmachtskampfgruppen mit Einheiten des Deutschen Volkssturms stehen in einer siegreichen Abwehrschlacht den verblutenden Feinden gegenüber. Im unerbittlichen Kampf ist die russische Großoffensive vor den deutschen Abwehrlinien zusammengebrochen!«
»Geringfügiger Geländegewinn« in Ostpreußen? Ob wohl die Ostpreußen auf ihren vereisten Flüchtlingswagen beim Überqueren der Oder es noch glauben können? Ihre Heimat war schon immer vom Kampf ums Dasein gezeichnet. Gegen Frost und Hitze, gegen Naturgewalten und harte Witterung hatten sie stets zu kämpfen in der Einsamkeit der melancholischen, schönen Landschaft, der Weite, der stürmischen Ostseeküste mit den Nehrungen, der flachen Wiesen und Heidesträucher, die bis an den Schnittpunkt des Himmels, den Horizont, reichen; das steinbesäte südliche Ödland, die waldumsäumten lieblichen Seen der Masuren haben den Menschen eine besondere Prägung verliehen. Schon im Ersten Weltkrieg mussten sie fliehen. Die ältere Generation kann es der Jugend noch gut erzählen. Nur 30 Jahre lagen zwischen den Kriegskatastrophen.
Jetzt aber durchzieht sie ein unheilvolles Ahnen – es ist eine Flucht ohne Umkehr. »Wir werden unsere Heimat wohl nie wiedersehen.« Heimwehkrank werden sie in der Fremde den Kindern von den strohgedeckten Holzhütten an den Masurischen Seen erzählen, von dem Fischreichtum der Gewässer, von der göttlichen Schönheit der fast undurchdringlichen Wälder, den kleinen Inseln auf den Seen, den blinkenden Wassern im hügeligen Lande, von der unberührten Schönheit jener Landschaft, die durch den masurischen Schifffahrtskanal vom Mauersee bis Altenburg und weiter bis nach Königsberg verbunden ist. Andere werden gerührt vom Samland, vom Ermland, vom Frischen Haff, vom Gebiet südlich des Pregel, von der Bernsteinküste und dem Strand von Warnicken, vom Blinkfeuer und dem Leuchtturm von Pillau berichten. Auch von der Kurischen Nehrung, von der gesagt wurde: »Die Kurische Nehrung ist so merkwürdig schön, dass man sie eigentlich gesehen haben muss, wenn nicht ein wunderbares Bild der Seele fehlen soll« (Wilhelm von Humboldt), werden sie ausführlich erzählen.
Sie, die jetzt auf der Flucht ins Ungewisse sind, ahnen: »Wir werden sie nicht wiedersehen, unsere Heimat.« Nur in Träumen von der Vergangenheit werden die Hochdünen, die aufgestauten Sandgebirge zwischen Haff und Meer und alle bezaubernden Naturerscheinungen in Erinnerung kommen. Die schreienden Möwen der Nordsee können das Heimweh der Zugvögel, die einst über die Vogelwarte von Rossitten zogen, nicht ersetzen, denn es ist die Einmaligkeit der geprägten Jugenderinnerung an die Heimat. Als die Störche und Kraniche noch einmal über die Dörfer und einsamen Gehöfte ihre Kreise zogen, beneidete sie mancher. Gern wären sie auf deren Flügeln vor der Zukunft geflohen. Auch die alte historische und ehrwürdige Stadt Königsberg mit dem gartenumsäumten Schlossteich, das markante Schloss, den Fischmarkt und den Hafen mitten in der Stadt überflogen zu Hunderten die Zugvögel, dem Süden entgegen.
Und hier gerade beginnt die Geschichte von Menschen, die wie von unsichtbarer Hand aus dem Brand herausgeführt wurden.
Eines Tages bin ich bei einem Prediger aus Königsberg zu Besuch. Wie so oft in deutschen Familien kommt das Gespräch auf die unglückseligen Ereignisse des letzten Krieges. Mit zitternder, bebender Stimme berichtet er von seinem Schicksal.
Als der Herbst ins Land zog und die Novemberstürme die Weiten kahlfegten, waren nur geringe Vorboten einer grauenhaften Entwicklung zu bemerken. In den Nächten erglühte hin und wieder der Osthimmel von Nord nach Süd an den verschiedensten Punkten. Memel, Tilsit und andere Grenzstädte waren bereits Frontgebiet. Die Feuerlinie der Kampfhandlungen wurde schon teilweise 30 Kilometer hinter die Reichsgrenze verlegt. Aus Orten, die vom Feind schon besetzt gewesen, dann aber vereinzelt noch einmal in den Besitz von deutschen Truppen gekommen waren, hörte man schreckliche Dinge. Der Rachedurst des russischen Großvolkes schien bis zum Höchstmaß geschürt. Wehe dem, der den willkürlich handelnden Soldaten in die Hände fiel. Wir waren gewarnt, und doch wollten viele der Warnung keinen Glauben schenken. Gar mancher wiegte sich in selbst bereiteter Gedankensicherheit, dass es doch nicht wahr sein könne, zumal die russische Armee schon drei Monate scheinbar unschlüssig, tatenlos in den erreichten Stellungen verharrte. Das Dröhnen der Front war für Wochen gänzlich verstummt, die nächtlichen Feuer erloschen und ein Hauch des Friedens überwehte noch einmal die großen Räume der Landschaft Ostpreußens. Die ersten Flüchtlingskolonnen waren in Richtung Westen verschwunden, und das Leben schien wieder seinen geregelten Gang zu gehen. Man ging ins Kino, die Straßenbahnen fuhren so, als wäre nichts zu befürchten.
Als der erste Schnee fiel und die Bevölkerung noch einmal in ihren Häusern nach den Bräuchen der Heimat Weihnachten feierte, war zwar der so ersehnte Weihnachtsfrieden noch nicht gekommen, aber das Volk wurde kriegsmüde. Vielleicht waren es die anderen auch? In phantastischen Hoffnungen scheint der Mensch unermesslich und unbegrenzt zu sein.
Silvester und Neujahr waren die Christen in gewohnter Weise betend beieinander. Immer noch lag eine fast unerträglich-verführerische Stille über dem Lande. Wer den Lärm der Stadt hinter sich ließ, glaubte nicht, am Rande des Unterganges oder unmittelbar vor einer Sintflut wilder Zerstörung zu leben, sondern hatte den Eindruck, in einem verzauberten Märchenland zu sein. Lautlos wie der Schnee war die Zeit. Eine Insel des Friedens, ein Niemandsland inmitten schrecklicher Kriegsjahre.
Doch dann schlug es ein! Wie ein Donnerschlag zum Weltuntergang, wie der grässliche Ton der Gerichtsposaunen zur Apokalypse. Am 12. Januar 1945 traten Millionen sowjetischer Soldaten aus den Bereitschaftsstellungen zum Sturm an, Welle auf Welle, als würden aus dem Schneemeer unzählige Kämpfer emporwachsen. Seit dem Morgengrauen hörten wir das drohende Grollen der Front. Alles war in Bewegung geraten. Stalinorgeln und Artillerie eröffneten den Reigen. Dann stießen Panzer vom Typ T 34 wie grässliche Tiger nach vorn, und ihnen folgten Tod, Verderben, Hunger und Gewalt. Die Offenbarung Christi zog gegenwartsnah über unser schönes Land. Der Scheinfriede war gebrochen. Unwillkürlich wurde man an die Worte der Bibel erinnert: »Und es ging hervor ein anderes Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde, und dass sie sich untereinander erwürgten, und ihm ward ein großes Schwert gegeben … und ich sah, und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme unter den vier Gestalten sagen: Ein Pfund Weizen um ein Silberstück und drei Pfund Gerste um ein Silberstück; aber Öl und Wein taste nicht an. … Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, des Name hieß Tod, und die Hölle folgte ihm nach.« Dass sich die Einzelheiten buchstäblich erfüllen würden, ahnte keiner. Erst später sollten wir erfahren, wie Menschen in bestialischer Weise verhungert, erwürgt und auf andere Art umgekommen sind.
Die dünne Verteidigungsfront, aufgefüllt mit Volkssturmkämpfern, Kindern und Greisen mit italienischen Gewehren aus dem abessinischen Krieg und Schrotflinten, wurde an vielen Stellen aufgerissen. Der Deich war durchbrochen. Wie Blitze durchfuhren Tausende von Stahlkolossen bereits das Hinterland Ostpreußens. Tag und Nacht war der Lärm der Flüchtlinge, das Wiehern der Pferde, die Flüche der Kutscher zu hören. Geschäfte wurden geplündert, Feldgendarmerie mit dem gefürchteten »Brustschild« versuchte, sich gegen den Strom der Hemmungslosen zu werfen. In der Ferne hörten wir das ununterbrochene Brummen und Rumoren der Kriegsmaschinerie. Schon in den Morgenstunden kamen Flugzeuge. Plötzlich schossen sie wie Habichte aus der Höhe hinunter. Erschreckende Gedanken durchfuhren uns: Es sind keine Deutschen! Das ist der Feind! Es entwickelten sich einzelne Luftkämpfe. Dann war der Spuk, so schnell wie er gekommen, wieder vorbei. Nachts hingen Leuchtschirme von Aufklärungsflugzeugen am Himmel.
Gumbinnen brannte. Nun begannen Tausende die Stadt zu verlassen. Sie flohen nach Pommern. Wieder und wieder kamen die Tiefflieger. Sie nahmen die Gleisanlagen, den Bahnhof und den Hafen unter Feuer. Ohrenzerreißender Lärm der Motoren und Bordwaffen hallte über die Dächer. Angeschossene Pferde blieben dampfend auf der Straße liegen. Da, in der Ferne kamen sie schon wieder. Zunächst sahen sie wie ein Schwarm von Krähen aus, kleine Punkte dicht an dicht. Dann aber stürzten sie wie Aasgeier vom Himmel. In der Nacht fahren Züge um Züge aus dem Bahnhof. Verwundete, Kinder und Frauen bringen sich in Sicherheit.
Das Wetterleuchten eines unheimlichen Gewitters stieg bedrohlich empor. Im Wehrmachtsbericht wurde bekanntgegeben, dass die Feinde die Ost- und Westgrenzen des deutschen Vaterlandes überschritten hätten. Unter dem Lärm gewaltiger Materialschlachten drängten sie ins Hinterland vor. Jetzt halfen keine nationalistischen Lieder: »Lieb’ Vaterland, magst ruhig sein – fest steht und treu die Wacht am Rhein!«
Der Rhein war bereits überschritten. Die Überlegenheit der feindlichen Armeen zeigte sich auch darin, dass Schlachtflieger Jagd auf einzelne Soldaten machten. Ihre Luftüberlegenheit war so gewaltig, dass sie mit den deutschen Truppen Katz und Maus spielten.
Mächtig wälzte sich die russische »Dampfwalze« heran, ein Heer von Millionen rachedürstender Feinde. Ein unheimliches Ahnen von nie erlebtem Schrecken und Grauen erwachte in beängstigender Weise bei vielen Zivilisten und Soldaten. Der strenge Winter hielt sein Regiment über unserer schönen Landschaft. Der schneidende Ostwind fegte unbarmherzig über die Felder, die zugefrorenen Flüsse und die Masurischen Seen. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahrhunderts mussten wir vor den russischen Heeren fliehen.
Königsberg, die Hauptstadt des Landes, wurde zur Festung erklärt. In hektischer Eile errichteten Soldaten, Zivilisten und Kriegsgefangene Befehlsbunker, Gefechtsstände, Panzersperren und Gräben. Die Stadt glich einem modernen Heerlager – durcheinandergewürfelte Restbestände einer einst stolzen Armee.
Am 23. Januar 1945 war der Platz vor dem Königsberger Hauptbahnhof mit Flüchtlingen übersät. Es kamen hochbepackte Bauernwagen aus allen Straßen hinzu. Wie ein Lavastrom eines aktiven Vulkans breiteten sich die Menschenmengen aus. Die am Abend nach Pommern abgefahrenen Eisenbahnzüge mit Verwundeten und Flüchtlingen kamen schon zurück. Die Rückzugswege waren vom Feind versperrt. Königsberg war nun eingeschlossen, aber das scheint die Menschen zunächst noch gar nicht zu interessieren. Hier in der Hauptstadt, unter ihrer Bevölkerung, erscheint es sicherer, nicht so unheimlich wie auf den einsamen Landstraßen. Unentwegt rollte ein Wagen nach dem anderen heran, meistens kutschierten Frauen. Dazwischen fuhren auch noch Straßenbahnen. Dann brausten wieder Tiefflieger über die Dächer der alten Königsstadt. Hart klangen die Abschüsse der Bordkanonen – tok – tok – tok – tok – schi – schwumm – klik – klik – klik – tackerte es vom Himmel und an den Hauswänden. Wie gejagte Hühner huschten die Leute auseinander und suchten Schutz in den Kellern. Alarm und Entwarnung wurde nicht mehr gegeben. War der Schlachtenlärm vorüber, kamen die Menschen wieder aus ihren Löchern hervor. Die Stadt glich einem überladenen Rettungsboot, das manövrierunfähig festgefahren war.
Die alte Pillauer Landstraße wurde von endlosen Kettenfahrzeugen aller Art verstopft. Unter den Zehntausenden von Zivilisten, die förmlich bis fünf Minuten nach 12 Uhr im Unklaren gelassen worden waren, befanden sich auch etwa 500 Mitglieder unserer Kirchengemeinde.
An diesem Dienstag versammelten wir uns im Gotteshaus, um über die entstandene Sachlage zu beraten. Ältesten, Frauen, Müttern und Kindern war es jetzt, da bereits die Zangenarme der russischen Panzerarmeen die Stadt umfasst hatten, gestattet worden, zu fliehen. Jünglinge von 16 Jahren an und ältere Männer bis zum Alter von 65 Jahren mussten zurückbleiben, um die Stadt zu verteidigen. Wer ohne Befehl und in fluchtverdächtiger Weise angetroffen wurde, konnte mit einem Schild auf der Brust befestigt: »Ich bin ein feiger Vaterlandsverräter!« ohne richterlichen Spruch am nächsten Baum öffentlich aufgehängt werden.
Die einberufene Gebetsversammlung der Gemeinde hätte nicht spannungsgeladener sein können. Unsere größte Not, das Problem der Stunde, war die Trennung, nicht nur von Hab und Gut, sondern vielmehr von noch blutjungen Söhnen und liebvertrauten Vätern oder Großvätern. In vielen und verschiedenen Lebenslagen hatte man Gott vertraut und Hilfe von Ihm erhalten. Sollte Er nicht gerade in der allergrößten Not eine Antwort und einen Weg bereit haben?
»Deshalb wollen wir um eine klare Antwort von Gott bitten«, sagte ich der Gemeinde. Die Lage war so bedrohlich, da bereits die russische Artillerie Königsberg mit Granatfeuer belegte. Die Scheiben flogen aus den Fensterrahmen, die Erde und Häuserwände erbebten und das Geschirr flog aus den Schränken. Es musste etwas geschehen – Gott sollte die Antwort geben. Einige aber wollten gern ihre eigenen Meinungen über Gottes Willen stellen und beteten deshalb nach ihren Wünschen: »Herr, Du wirst eine feurige Mauer um Königsberg legen, und kein Russe wird je diese Stadt betreten.« Manche von ihnen hatten mehrere Häuser. Auch hatte die Parole von den ungeahnten »Wunderwaffen« der deutschen Armeen auf viele eine solche Wirkung, sich betören zu lassen und nicht aus der Stadt fliehen zu wollen. Unter der Leitung des Geistes Gottes aber bekam ein Mann die Weisung, zu erklären, dass diese erbetene Mauer eine Strohmauer eigener Fantasie sei, und dass das Feuer der russischen Artillerie diese Strohmauer zum Scheiterhaufen machen würde. Es war mir gut bekannt, dass die, die da bleiben wollten und von der feurigen Mauer sprachen, große Besitzungen hatten. Von Gott kam mir aber eine Botschaft ins Herz: »Es ist keine Zeit mehr zu verlieren! Fliehe und rette sich, wer kann!« Das teilte ich der Gemeinde mit: »Mein Entschluss ist klar und fest: Ich werde gehen!« Viele begannen zu weinen und zu schreien. Es schieden sich die Geister, einige trieben zur Eile an, um das rettende Vaterland noch zu erreichen, andere waren zögernd und widerstanden mir. Insbesondere ein verantwortliches Mitglied des Vorstandes beschimpfte mich mit den Worten: »Du bist ein Mietling, der sich davonschleichen will. Der Hirte verlässt seine Herde nicht. Wer da glaubt, der bleibt.« Eine schwere Anschuldigung! Ich aber wollte nur nach den klaren Anweisungen Gottes handeln. Es galt zu erforschen, ob die Frontlage wirklich so ernst sei, um die Stadt verlassen zu müssen. Deshalb sagte ich: »Wir wollen uns von Gott eine Antwort in der Weise erbitten, dass Er uns durch einen verantwortlichen Mann der Stadt oder Armee eine klare Weisung gibt, ob Königsberg verlassen werden muss.«
Die versammelte Gemeinde begann zu beten. Noch während sie betete, trat ein hoher Parteifunktionär in den Raum und sagte: »Was tut denn ihr noch hier? Königsberg muss sofort geräumt werden! Die sowjetischen Panzerspitzen haben bereits das Stadtgebiet erreicht. Bald werden alle Zufahrtswege gesperrt sein. Jeder sollte versuchen, ins Samland zu fliehen!«
»Wir haben jetzt eine eindeutige, klare Antwort auf unser Gebet«, sagte ich zu der Gemeinde, »nun wollen wir gehorsam sein und gehen!«
»Nein!«, schrien einige, »wir wollen nicht fliehen, wir wollen hierbleiben und auf Gottes Hilfe warten!« Panikstimmung verschloss die Ohren für die Anweisung von Gott. Hab und Gut, Haus und Besitz hatten die Herzen mancher so gefangen, dass sie die deutlichen Mahnungen Gottes nicht ernst nahmen. So kam ich in eine bedrohliche Lage, in der entstandenen Auseinandersetzung auch das Rechte sagen zu können.
»Wir wollen Gott noch einmal bitten, uns in dieser Weise eine Antwort zu geben. Er wird es uns nicht verübeln, wenn wir so beten«, sagte ich. Nach kurzer Zeit kam zum zweiten Mal ein Verantwortlicher der Behörde und mahnte noch eindringlicher zur Eile, nach der Parole: »Rette sich, wer kann!« Spontan stand ich auf und teilte der erregten Menge meinen Entschluss mit: »Ihr Lieben, jetzt haben wir dreimal eine klare Antwort von Gott erhalten. Deutlicher kann Er kaum noch reden. Mein Entschluss steht fest: Ich gehe!« Wieder entstand ein großes Stimmengewirr, hin und her gingen die Meinungen. Verzagte standen bewegungsunfähig da und schauten dem Treiben ohnmächtig zu. Einige übertönten alle und schrien: »Nein, wir gehen nicht!«
Erwartungsvoll blickten sie nun wieder alle auf mich. Die Last der ganzen Verantwortung lag auf meinen Schultern. Nach kurzem, innerlichem Gebet sagte ich dann: »Gut, dann wollen wir noch einmal nach dem Willen Gottes forschen! Er möge uns diesmal aus Seinem Wort eine Weisung geben.« Ich nahm meine Bibel zur Hand und schlug in einem Griff das Lukasevangelium auf. Mein Blick fiel sogleich auf die Worte Jesu: »Wenn ihr aber sehen werdet Jerusalem belagert von einem Heer, so merket, dass herbeigekommen ist eine Verwüstung. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe auf das Gebirge und wer in der Stadt ist, der gehe hinaus und wer auf dem Lande ist, der komme nicht herein. Denn das sind die Tage der Vergeltung, damit erfüllet werde alles, was geschrieben ist.« Obwohl hier ein anderer Zeitabschnitt der Geschichte von Jesus gemeint ist, war es für mich und einige andere eine unmissverständliche Anweisung, die Stadt zu verlassen.
»Viermal haben wir jetzt Signale Gottes gehört, einmal durch Seine Botschaft, zweimal durch die Befehle der Stadtbehörden und jetzt eben durch Sein Wort. Wer hören will, der folge mir jetzt.« Vier junge Mädchen und Frauen standen auf. Sie schlossen sich uns an. So gingen wir unter manchen Drohungen hinaus. Einen Handschlitten hatte ich schon bereitgestellt. Mehrere Decken und nötige Lebensmittel waren darauf gepackt. So zogen wir durch die verlassenen Straßen der Stadt. Am Stadtrand waren aber bereits die meisten Wege versperrt. Verängstigt kamen Frauen und Kinder zurück, die nicht mehr fliehen konnten. Inmitten dieses haltlosen Wirrwarrs schritten wir in stillem Gebet voran. Immer näher kam das Dröhnen der Artilleriegranaten, des Maschinengewehrfeuers und der Bomben. Plötzlich hielt ein Militärbus neben uns. Er hatte den dringenden Befehl, aus der Stadt hinaus nach Fischhausen zu fahren. Hierfür gab es aber nur eine einzige Straße, die noch freigehalten wurde, und zwar nur für Militärfahrzeuge mit besonderer Genehmigung. Alle anderen Straßen waren bereits durch Panzertruppen des Feindes besetzt.
Ein Mann sprang aus der geöffneten Tür des Militärfahrzeuges: »Bitte einsteigen! Wir nehmen euch sechs da mit!«
Überrascht schauten wir auf den Offizier.
»Wir haben doch den Handschlitten und einige Sachen!«, sagte ich. »Alles mit hinein, alles hinein!«, schrie er förmlich. Die Sachen wurden in hektischer Eile eingeladen, und auch wir mussten uns in die äußerste, hintere Ecke des Militärbusses drücken. Wir wurden dann mit Uniformen zugedeckt, und los ging die 36 Kilometer lange Fahrt nach Fischhausen. Unter Beschuss von Artillerie und Panzergranaten fuhren wir durch den einzigen dünnen Schlauch, der auf dem Landweg noch nach dem Westen offen war. Alle Kontrollen der Feldgendarmerie und der Waffen-SS passierten wir unentdeckt. Ein dringender Armeebefehl verschaffte uns freie Bahn.
Endlich war unser erstes Ziel erreicht: Fischhausen. Dort wurden wir unter den Uniformen hervorgeholt und ausgeladen. Wir konnten Gott nur danken für diese sichere Führung aus dem Gefahrenbereich der Festung Königsberg. Es galt nun aber, keine Zeit zu verlieren, denn Panzertruppen durchquerten bereits den größten Teil Ostpreußens. Mit unserem Handschlitten und dem kärglichen Gepäck machten wir uns auf den Weg. Der Wintersturm tobte zeitweise so heftig, dass wir wiederholt stehen bleiben mussten, um Atem zu schöpfen. Viele erlahmten auf halbem Wege. Manche der Flüchtlinge kehrten um, selbst auf die Gefahr hin, der Roten Armee in die Hände zu fallen. Nur mit großer Mühe konnten sich die Flüchtlinge, getrieben von panischer Angst, auf den vereisten Straßen gegen den Wind und andere Hindernisse behaupten. Wir selber stapften unentwegt voran in der großen Masse durch das endlos erscheinende Eismeer. Es kam des Öfteren vor, dass sich Soldaten von aufgelösten Einheiten des Heeres, der Luftwaffe und der Organisation Todt in die Flüchtlingszüge einreihten.
Die Menschen auf den Bauernwagen waren ärger dran als wir. Ihre Fahrzeuge blieben oft stundenlang am Wegesrand stehen. Dagegen kamen Mütter mit Kinderwagen, alte Leute, die auf Handschlitten gezogen wurden und Jugendliche mit ihren Habseligkeiten auf Fahrrädern besser voran. Die Kräfte wollten uns manchmal verlassen, doch wir ermunterten uns dann gegenseitig mit Gottes köstlichem Wort und halblaut gesprochenen Stoßgebeten. In die Flüchtlingskolonnen hinein brausten mitunter von beiden Richtungen militärische Fahrzeuge und drängten die Menschen in die Gräben. Deshalb kamen vereinzelt durch deutsches Militär eigene Leute zu Tode: Greise, Schwache und Verwundete. Andere wiederum hatten das außergewöhnliche Vorrecht, von Militärfahrzeugen mitgenommen zu werden. Der eiskalte Ostwind trieb einen unsagbar großen Elendshaufen vor sich her. Nach stundenlangem Fußmarsch erreichten wir endlich Pillau.
Von hier, so hofften wir, könnten wir auf dem Seeweg den Westen erreichen. Doch schrecklich aussichtslos erschien uns die Lage hier. Zu Zehntausenden waren die Menschen von überall her in die Stadt geströmt, sie hatten die gleiche Hoffnung wie wir und wollten durch den Transport mit Schiffen gerettet werden. Im Hafen lagen einige große Schiffe, darunter das Schwesternschiff der »Wilhelm Gustloff«. Über Kilometerlängen standen die Flüchtlinge Kopf an Kopf. Das Beschämende in dieser katastrophalen Situation war, dass es gewissenlose Schiffskapitäne gab, die aus dieser himmelschreienden Not Erpressergeschäfte machten. Riesige Summen Geldes wurden für die Schiffsplätze verlangt und – gezahlt!
Wer dazu nicht in der Lage war, konnte den kleinsten Hoffnungsschimmer auf Rettung begraben und musste an Land zurückbleiben. Für jede Person wurden 400 bis 500 Reichsmark verlangt; wir hatten für uns sechs Personen nicht die ganze Summe, doch wir erhielten sechs Schiffskarten, und zwar für das größte Passagierschiff, das im Hafen lag. Unterdessen hatte der Menschenstrom ständig zugenommen. Die Straßenränder glichen einem Schuttabladeplatz. Dort häufte sich das zurückgelassene Hab und Gut, der Ballast von angeblichen Wertsachen, von dem man sich bis hierher nicht hatte trennen können. Zur Rechten wie zur Linken sah man Koffer, Kisten, Säcke, Kinderwagen, Vorratsfässer, Nähmaschinen, Betten, Bilder und Spielzeug, ja, sogar frisch geschlachtete Schweine liegen. Die Angst vor den Russen, die am nächsten Tag schon in Pillau einmarschieren könnten, jagte die Menschen in immer größer werdender Anzahl zum Hafen. Für mich war es ein Wunder, dass ich überhaupt die Schiffskarten bekommen hatte, denn es war eigentlich strengste Anweisung gegeben, sie nur an Mütter mit Kindern, an Väter mit Kindern oder Großeltern mit Kindern zu vergeben. Um nicht zurückbleiben zu müssen, kamen die Menschen auf die ausgefallensten Ideen.
Sie reichten ihre Kinder weiter »zur freundlichen Benutzung«, sozusagen als »Ausweis«, indem sie sie von den Schiffen wieder herunterhievten in die Hände von Verwandten, wie Vätern, Schwestern und anderen teuren Menschen, die sie unbedingt auf diese Weise aus Ostpreußen heraushaben wollten. Die Kinder waren für die Kontrolleure die sogenannte »Legitimation«, mit deren Hilfe man berechtigt war, ein Schiff zu besteigen.
Leider kam es dabei vor, dass Kleinkinder zwischen Bord- und Hafenwand ins eiskalte Wasser stürzten. Schreien, Kreischen, Fluchen und Brüllen erfüllte die Luft, doch keiner konnte sich darum kümmern, was mit den Kindern geschah. Manche Kinder wurden dabei von Fremden aufgegriffen und skrupellos als »Schiffskarte« benutzt. Auch wurden hin und wieder unachtsamen Müttern schlafende Kinder geraubt. Selbst Soldaten in notdürftigen Zivilkleidern bemächtigten sich kleinster Kinder oder hielten einfach ein geschickt gewickeltes Bündel in ihren Armen, um damit die Kontrolleure zu täuschen und auf ein Schiff zu kommen. Die Hafen- und Fallreepposten waren nicht mehr Herr der Lage. In einigen Fällen wurde sogar später bekannt, dass sich Soldaten in Frauenkleidern auf die Schiffe geschmuggelt und dadurch die scharfen Kontrollen überlistet hatten. Wurde aber jemand in solch einer Verkleidung von SS-Streifen oder Feldgendarmerie erwischt, so hatte er sein Leben verwirkt, er baumelte dann in den kommenden Tagen an einem Lichtmast oder Gerüst in der Hafengegend.
Für uns war es umso erstaunlicher, dass wir sechs Personen ohne ein Kind oder irgendeine Raffinesse auf das Schiff gelangten. Wir dankten Gott unaufhörlich in unseren Herzen für die erstaunliche Hilfe. Sie war zu groß, als dass wir sie nur mit »Zufall« hätten bezeichnen können.
Plötzlich wird Fliegeralarm gegeben. Durch Ruftüten und Lautsprecher scholl es: »Fliiieeegeralllarm! Fliiieeegeralllarm!« Von allen Decks eilen die Menschen zu den Treppen, drücken und wälzen sich vorwärts, denn die Alarmglocken läuten unentwegt: »Ding – ding – ding – ding!« Rücksichtslos wird nach rechts und links getreten, denn es spricht sich schnell herum, dass die Engländer den Hafen von Pillau bombardieren wollen. Somit wäre das Schiff, auf dem wir uns befinden, das lohnendste Ziel, denn es war das größte im Hafen. Die Angst erfüllte alle Menschen und wuchs. Mit wildem Geschrei verließen die Massen das Schiff. Die Panik griff so um sich, dass die Besatzung mit entsicherten Schusswaffen dazwischen sprang, um einigermaßen Ruhe zu schaffen. Viele stürzten von der Brücke in die eiskalten Fluten des Hafenbeckens, aber wir kamen wohlbehalten vom Schiff herunter. Durch das kaum beschreibliche Chaos waren die Frauen, die mit mir flohen, besonders gewaltig erschreckt. Als der Luftangriff vorüber war, hatten sie kein Verlangen mehr, auf das Schiff zurückzukehren. Sie wollten gar kein Schiff mehr betreten, sondern hatten den Wunsch, zurück nach Königsberg zu gehen. Aber ich sagte ihnen: »Nein, Gott hat uns so wunderbar aus dem nahenden Verderben geführt, wir gehen nicht mehr zurück! Lasst uns dort an den Strand gehen und niederknien und Gott bitten, uns einen weiteren Weg zu zeigen, um aus dieser Lage herauszukommen.« Während die Wellen ununterbrochen an das vereiste Ufer schlugen und die schwimmenden Eisschollen krachend aufeinanderstießen, knieten wir im weißen Schnee nieder und beteten zu Gott, dem mächtigen Retter aus aller Not. Unser Gebet war noch nicht zu Ende, als plötzlich durch Lautsprecher Stimmen erschollen: »Alles fertig machen, wir legen hier an und nehmen Flüchtlinge mit!«
Erschrocken fuhren wir auf, schauten uns um und sahen drei Boote in militärischer Tarnfarbe dem Hafen näherkommen. Es waren Minensuchboote, die nach Kurland hätten fahren sollen, um dort verwundete Soldaten abzuholen. Der Seegang war jedoch so schwer und der Frost so stark, dass sie nicht weiterfahren konnten. Darum hatten sie Befehl bekommen, Flüchtlinge an Bord zu nehmen und sie zu den noch offenen Häfen zu fahren. Da wir zum Gebet am Kai geblieben waren, standen wir gleich dicht an der Bordkante, wo diese kleinen, schnittigen Schiffe anlegten. In Pillau warteten an die 60.000 Flüchtlinge in sehnsüchtiger Hoffnung, ein rettendes Schiff zu erreichen. Sie hatten schon tagelang vergeblich gehofft – nun standen wir, die wir gerade erst angekommen waren, in den ersten Reihen. Die Landungsbrücken wurden niedergelassen. In rücksichtsloser Drängelei stürmte die angstgepeinigte Flüchtlingsmenge auf das Schiff. Dabei wurde unsere Gruppe auseinandergerissen. Marinesoldaten sperrten den Zugang ab und kontrollierten scharf, denn nur Frauen und kleine Kinder durften das Schiff betreten. Ich selber wurde zurückgewiesen. Jugendliche im Alter von 16 Jahren an und ältere Männer bis zu 65 Jahren mussten an Land bleiben. Sie sollten zur Verteidigung Königsbergs zurückgebracht werden.
Meine Frau gelangte unversehrt im großen Gedränge auf das Schiff. Vergeblich sah sie sich nach mir um und suchte mich. In großer Erregung wandte sie sich an einen Schiffsoffizier: »Wo ist mein Mann?«
Jener antwortete: »Ihr Mann darf nicht mit rauf, er muss zurück nach Königsberg. Hier dürfen keine Männer auf das Boot!« Darauf entgegnete meine Frau: »Wenn mein Mann nicht auf das Schiff darf, so will ich auch sofort herunter! Ich will da sein, wo mein Mann ist. Wir gehen dann zurück nach Königsberg.«
»Seien Sie vernünftig und froh«, sagte der Offizier, »dass Sie auf dem Schiff sind! Tausende Frauen würden glücklich sein, wenn sie auf dem Schiff sein könnten und Sie wollen wieder herunter? Lassen Sie Ihren Mann hier!«
»Nein, ich will da sein, wo mein Mann ist!«, erwiderte meine Frau. Mürrisch fragte daraufhin der Seeoffizier: »Wie heißt Ihr Mann?« Sie nannte meinen Namen. Der Offizier drängte sich durch die große Menschenansammlung; denn Tausende standen da und wollten mit. Plötzlich rief er in der großen Volksmenge meinen Namen. Wie ein elektrischer Schlag durchfuhr es mich, als ich in militärisch-barschem Ton meinen Namen hörte. Ich dachte schon, dass mich irgendjemand in Königsberg verraten habe, und jetzt sei die Gestapo oder Feldgendarmerie hinter mir her, um mich zu verhaften, weil ich Königsberg heimlich verlassen hatte.
Ich machte mich auf alles gefasst. Es war für mich als Mann ja verboten gewesen, Königsberg zu verlassen. Alle Männer sollten helfen, die Stadt zu verteidigen. Durch Gottes Geheiß und Führung war ich aber doch in wunderbarer Weise hinausgeleitet worden.
Wieder hörte ich meinen Namen noch einmal laut und vernehmlich. Ich blieb stehen und meldete mich. Ein Offizier mit einem Matrosen kam auf mich zu, um mich zu verhaften. Der Offizier griff mich am Arm und sagte: »So, folgen Sie mir! Machen Sie keine Dummheiten und kommen Sie mit!«
Man brachte mich auf das Schiff, auf das meine Frau im Gedränge mit hinaufgestiegen war. Ich wurde durch die gaffende Menge geschoben. Sie gingen mit mir hinunter ins Schiff, öffneten eine Stahltür und schoben mich in einen dunklen Raum. Barsch befahl er mir: »Legen Sie sich dort hin, verhalten Sie sich ganz ruhig! Sie dürfen sich nicht melden!«
Ich dachte bei mir: »So, nun haben sie dich ganz sicher. Sie werden dich gewiss abtransportieren und irgendwo zum Tode verurteilen.« Ich legte mich nieder und schlief fest ein. Gut eine Stunde hatte ich wohl in der eisernen Behausung geschlafen, als der Offizier wiederkam und mir eine Schüssel mit Gulasch und Reis brachte.
»Sie haben gewiss Hunger. Essen Sie das. Dann legen Sie sich wieder hin und verhalten sich ganz ruhig. Sie dürfen sich nicht melden!« Sein Ton war immer noch ungehalten, aber nicht so streng wie vorher. Die Speise kam mir wie eine Henkersmahlzeit vor. Dennoch dankte ich Gott und aß mit gutem Appetit, denn ich wusste, mir kann nicht mehr oder weniger passieren als Gott zulässt. Als das Geschirr abgeholt wurde und die schwere Eisentür sich schloss, hüllte ich mich wieder in die Pelzdecken, die ich in diesem dunklen Raum gefunden hatte und schlief erneut ein. Ich war fest davon überzeugt, dass ich irgendwo vor ein Standgericht kommen und erschossen würde.
Abbildung 1: »Er verschwand wie er gekommen war: würdelos und unbedeutend. Das Erbe aber, das er hinterlassen hat, war wie sein Leben: grausam und wüst …«
Abbildung 2: Alle Häfen, die noch in deutscher Hand sind, erleben den Massenandrang flüchtender Menschen. Frauen und Kinder werden zuerst evakuiert. Im Hintergrund sind Schlauchrettungsboote zu erkennen.
Nach einer Stunde erschien derselbe Offizier wieder, um mich aus meiner eisernen Gefangenschaft zu holen. So kam ich an Deck, wo ich meine Frau inmitten der vielen Mütter und Kinder fand. Die Frauen schauten mich an, als sähen sie ein Wesen aus einer anderen Welt. Als sie diesen männlichen Zivilisten an Bord erblickten, begannen sie hysterisch zu schimpfen: »Oh, dieser Feigling hat sich heraufgeschlichen! Unsere Väter, unsere Jungen von 16 Jahren mussten da bleiben, und dieser vollgefressene Mann ist mitgekommen! Schmeißt ihn über Bord!« So schrien sie alle durcheinander.
Schiller hat recht, wenn er schreibt, dass der Mensch in der allergrößten Not schlimmer als ein Tier wird:
»Gefährlich ist’s, den Leu zu wecken, Verderblich ist des Tigers Zahn, Jedoch das Schrecklichste der Schrecken, Das ist der Mensch in seinem Wahn. Da werden Weiber zu Hyänen …«
Meine Frau griff voller Angst nach mir, als wollte sie mich vor der aufgebrachten Menge schützen, schwieg aber und sagte kein Wort von der Unterredung mit dem Offizier. Es war gut so. Nachdem sich der erste Sturm der Entrüstung gelegt hatte, sagte ich zu ihnen, noch immer in der festen Annahme und dem Glauben, dass ich zur Aburteilung geführt würde: »Warum schreit ihr so? Ich weiß nicht, was mir passieren wird. Man hat mich gefangen genommen und auf dieses Schiff gebracht. Ich glaube, ich werde zum Tode verurteilt und standrechtlich erschossen, weil ich Königsberg verlassen habe.« Sie wurden alle ganz still und sahen mich mitleidig und teilweise beschämt an. »Gehen Sie zum Offizier und fragen Sie ihn selbst«, sagte ich noch.
Im selben Augenblick schlug die Volksmeinung um. Wie ein Föhnwind war jetzt Mitleid in die Herzen der vorher hasserfüllten Frauen gefahren.
»Das ist doch heller Wahnsinn, jetzt vor Toresschluss noch einen Menschen sinnlos zu erschießen!«, meinten einige. »Vielleicht können wir Sie verstecken und Ihnen helfen!«
Sie waren nun recht freundlich zu mir. Das Schiff stampfte mit aller Kraft durch die aufgewühlte, eisige See. Bald erreichten wir Gotenhafen. Dort legte das Minenräumboot an. »Alles aussteigen!«, wurde befohlen. »Umsteigen auf größere Schiffe!« Wir entdeckten drei größere Schiffe; ein Marinelehrschiff, ein Lazarettschiff und auch die große »Gustloff«. Wir konnten wählen. Die Frauen wollten jedoch nicht auf das größte Schiff. Sie hatten noch genug von der ersten Panik. »Das Schiff ist zu groß«, meinten sie, »und wird vom Feind bestimmt als erstes unter Feuer genommen. Wir gehen lieber auf das Marinelehrschiff.«
Abbildung 3: Die zerstörte Reichskanzlei in Berlin.
Abbildung 4: Jeder kennt nur noch einen Gedanken: Wie komme ich zu etwas Essbarem? Alles, was nicht niet- und nagelfest ist, wird mitgenommen. Selbst Kartoffelschalen stehen keine zehn Minuten unbeachtet umher.
Im Schneckentempo schob sich die graue Menschenkette Schritt für Schritt über das Fallreep bis zur Wache ins Innere des Schiffes. Mühsam kletterten wir die Stufen des Holzgerüstes empor. Man stellte uns eine Bescheinigung mit folgendem Inhalt aus:
Ein wachhabender Offizier prüfte die Papiere und Ausweise. Alles war gut durchorganisiert. Immer neue Transporte kamen an aus Pillau und Danzig.
Es dauerte eine gehörige Zeit, bis alle an Bord des Schiffes waren. Die Schiffe legten allerdings nicht gleich ab. Es sprach sich herum, dass russische U-Boote vor dem Hafen seien, und dass außerdem die Ausfahrt zum Teil durch Minen, die von englischen Flugzeugen abgeworfen worden wären, versperrt sei. Man hatte uns nach ganz unten gebracht. Wir befanden uns dicht an dicht auf dem letzten Deck des Schiffes. Siebentausend Flüchtlinge waren an Bord. Das Schiff war mehrfach überladen. Endlich aber dröhnten die Maschinen, und das Schiff legte ab. Die Fallreeps wurden an Land gezogen. Aufheulende Sirenen kündigten die bevorstehende Fahrt an. Dumpf blökten die Nebelhörner, die Alarmglocken schrillten und das ganze Schiff erzitterte. Unbändiger Freudentaumel erfasste alle. Die »Hansa« fuhr als erstes Schiff. Die Flüchtlinge weinten vor Freude, und wildfremde Menschen fielen sich in die Arme und küssten sich.
Die Schlepper zogen an, die Seile spannten sich. Wild schäumte das Wasser durch die Schiffsschrauben. Langsam glitt der Koloss vom Pier in die Fahrrinne des Hafenbeckens. Stumm winkten die Menschen, die im Hafen zurückblieben. Der Schneesturm wurde so heftig, dass alle Mann unter Deck gingen. Doch in Kürze sollte uns eine Hiobsbotschaft ereilen. Das Schiff hatte einen Maschinenschaden und musste bei Hela liegen bleiben.
Gegen 14.00 Uhr holte uns die »Gustloff« ein, stoppte und ankerte neben uns. Durch das plötzliche Versagen unserer Maschinen hätten wir beinahe einen Zusammenstoß mit dem Linienschiff »Schleswig-Holstein« verursacht. Die »Gustloff« fuhr allein weiter. Wir mussten zurückbleiben und haderten mit unserem Schicksal. Keiner ahnte, dass das unsere große Rettung werden sollte. Am Maschinenschaden wurde indessen fieberhaft gearbeitet.
Nach einiger Zeit gab es plötzlich eine entsetzliche Detonation. Menschen flogen durch den Raum, Kinder und Mütter schrien laut auf und wollten zu den Türen hinausflüchten. Marinesoldaten sprangen jedoch mit entsicherten Pistolen, Gewehren und Maschinenpistolen auf die Menge zu und riefen: »Ruhe! – Sofort Ruhe! – Alles stehen bleiben oder wir schießen! Es ist nichts passiert. Eben sind nur Minen unschädlich gemacht worden.«
Nach einer halben Stunde war alles vorbei. Wir durften uns wieder frei bewegen. Als wir auf das Oberdeck kamen, war von der »Gustloff« nichts mehr zu sehen. Nach der Behebung des Maschinenschadens wurde uns sogar Geleitschutz gegen russische U-Boote gegeben, den die »Gustloff« auch so bitter nötig gehabt hätte. Bei ihr aber fehlte er. Später haben wir dann erfahren, dass der große »Kraft durch Freude«-Dampfer mit etwa 4500 Flüchtlingen aus Ostpreußen und 1700 Mann militärischen Personals in der schneereichen, kalten Januarnacht in die Tiefe des Meeres gesunken war.
Das große Schiff war mit einem Torpedoboot als Geleitschutz in Richtung Kiel ausgelaufen. Um 21.06 Uhr erschütterte ein harter, dumpfer Schlag den Luxusdampfer. Alles erstarrte! Dann folgte ein zweiter Schlag. Die »Gustloff« erzitterte und schwankte. Sekunden später bohrte sich ein dritter Torpedo in den schon wunden Meeresriesen. Das vierfach überladene Schiff neigte sich. Auf dem 200 Meter langen Fahrgastschiff mit 25.448 BRT (Bruttoregistertonnen) breitete sich am Abend des 30. Januar 1945 hinter der Halbinsel Hela eine Panik unbeschreiblichen Ausmaßes aus. Rettungsmaßnahmen wurden schnellstens eingeleitet, die allerdings wenig Erfolg hatten, wie sich später herausstellte. Der letzte Funkspruch lautete: »Laufe mit halber Kraft allein weiter!« Als die herangeeilten Rettungsschiffe an die Unglücksstelle kamen, stand das Deck fast senkrecht zur Wasseroberfläche. Langsam verschwand die Breitseite im Wasser. Die letzten Menschen sprangen kopfüber in die eiskalten Fluten. Um 22.25 Uhr verschwand die »Gustloff« in der Tiefe.
Dieser stählerne Eisensarg riss 5.300 Menschen mit sich in den Tod: Mütter, Kinder, Greise, Verwundete und Matrosen. Nur etwa 900 Menschen sollen gerettet worden sein. Wir, die wir an viel Entsetzliches und Grauenhaftes gewöhnt, horchten auf und bekamen eine Ahnung von dem Drama, das sich unter der Zivilbevölkerung abspielte, die nach Beginn der russischen Großoffensive zu Hunderttausenden auf Land- und Seewegen in Richtung Westen fliehen mussten.
Ängstlich und verschüchtert drängten sich die Menschen zusammen. Frauen und Kinder weinten aus Furcht, ein gleiches Schicksal erleiden zu müssen. Ratlosigkeit hatte fast alle ergriffen. Voller Bangen und Ungewissheit sah man dem Kommenden entgegen. Warum hatte es nicht uns getroffen? Wann würde uns der Tod ereilen? Menschen ohne Gott sind wie losgelöste Flöße im Strom der Zeit. Wir sechs beugten inmitten der großen Verzagtheit unsere Knie und beteten zu Jesus Christus, dem Heiland der Welt, dem Wind und Wellen gehorsam sein müssen und der Seine Engel ausgesandt hat, um die zu bewahren, die die Seligkeit ererben sollen. Wir lasen aus der Bibel ein Wort Gottes und bekamen Trost in dieser hoffnungslosen Lage. Der Friede Gottes nahm wieder Besitz von unseren Herzen.
In den folgenden zwölf Tagen und Nächten durchkreuzten wir die Ostsee. Durch alle Fliegerangriffe mit den vielen Bombenabwürfen kamen wir sicher hindurch und erreichten endlich Kiel, wo wir vor Anker gehen konnten.
Gott hatte uns durch viele Sperren und größte Gefahren sicher ins Hinterland gebracht. Ich ahnte nicht, was für eine neue Gefahr auf mich zukam. In Gottes Führung war beschlossen, dass wir eine Frau mit neun Kindern entdecken sollten, die ohne Hilfe war und wegen der Seekrankheit kaum auf ihren eigenen Beinen stehen konnte. Die meisten Flüchtlinge waren auf der Reise seekrank geworden. So sagte ich zu meiner Frau: »Sieh doch die Frau dort mit den vielen Kindern! Lass uns helfen und lieber unsere alten Klamotten stehen lassen!«
Wir boten unsere Hilfe an. Ich selber nahm das kleinste Kind von etwa einem halben Jahr auf meinen Arm und ein größeres Kind an die Hand. Meine Frau nahm ebenfalls zwei Kinder. Die anderen vier Frauen nahmen sich der Mutter und der restlichen Kinder an. So waren wir bereit, an Land zu gehen. Durch die lange Fahrt mit den vielen Gefahren waren alle mehr oder weniger erregt. Die Menschen drängten rücksichtslos über die Landungsbrücke. Es ging ihnen zu langsam, so stießen sie von hinten ungeduldig nach vorn. Plötzlich befanden wir uns vor einer Sperre. Feldgendarmerie und Waffen-SS-Soldaten griffen alle Männer auf, die von Danzig mitgekommen waren, um sie wieder nach Ostpreußen zurückzuschaffen, wo sie bei der Verteidigung eingesetzt werden sollten. So wurde auch ich bis vor einen Sicherungsposten gedrängt. Er fragte mit barscher Stimme: »Haben Sie Kinder?«
In meiner Aufregung sagte ich: »Na, das müssten Sie doch sehen, dass ich Kinder habe, eins auf dem Arm und eins an der Hand!«
»Ja, ja«, sagte er, mich weiterschiebend, »ich wollte es nur bestätigt haben.« So kam ich durch diese Sperre hindurch. Alle anderen Männer, die man für wehrtüchtig befunden hatte, mussten nach all den überstandenen Strapazen wieder auf das Schiff und wurden zurück nach Ostpreußen gebracht.
Später, nach einer langen Zeit, erfuhr ich von all dem Elend, den Qualen und Nöten, die jene hatten durchmachen müssen, die Gottes Weisung nicht gefolgt waren und sich nicht hatten warnen und aus Königsberg herausführen lassen. Ich habe Gott nur immer und immer wieder danken müssen, dass Er uns auf Seine wunderbare Art gerettet und an einen sicheren Ort gebracht hat.
Vor innerer Erregung hat der Prediger die letzten Sätze nur unter Schluchzen und mit fast erstickter Stimme hervorbringen können. Zwischen einzelnen Worten entstanden sekundenlange Pausen, weil die Erinnerung an das Vergangene ihn überwältigte. Wir weinten beide über die Gnade und das Erbarmen unseres Gottes einerseits, wie auch über das Leid und die Qualen, die andere über sich ergehen lassen mussten, weil sie sich in falscher Sicherheit gewiegt hatten. Ein minutenlanger Weinkrampf hatte den Prediger erfasst. Als er wieder sprechen konnte, erzählte er mir auch von dem Schicksal der Frau, die ihm so hart in Königsberg in der Gemeinde widerstanden hatte. Monatelang hatte sie die Belagerung von Königsberg mitgemacht. Für sie schien es sich zunächst zu bewahrheiten, dass die Festung wirklich uneinnehmbar sei. Königsberg kapitulierte erst am 8. April 1945. Danach ergoss sich eine Flut wilder Grausamkeiten und Bestialitäten.
Jahre danach begegnete unser Prediger dieser Frau in einer Gemeinde. Sie sah alt und völlig verändert aus. Sie erschien ihm gänzlich unbekannt.
Er berichtet: »Mein Erstaunen wächst, als sie mich fragt: ›Kennst du mich nicht mehr, Bruder?‹ Tonlos schüttelte ich den Kopf. Dann stellt es sich heraus, dass es die schon erwähnte Frau war, die um ihrer Güter willen Königsberg nicht verlassen hatte. Sie wirkte fast wie ein Mensch ohne Seele, als sie monoton ihre Erlebnisse aus jenen schrecklichen Tagen schilderte. Gleich nach dem Einmarsch der russischen Truppen war ihr Mann verhaftet und in ein Arbeitslager gesteckt worden. Sie selbst wurde Regimentsdirne bei der Besatzungsmacht. Unzählige Vergewaltigungen hat sie über sich ergehen lassen müssen. Als es ihr eines Tages gelang, sich für Stunden von der Truppe zu entfernen, fand sie vor der Tür ihres Hauses einen verwahrlosten, zerlumpten Mann. Der verwilderte Bart machte ihn schwer erkenntlich. Es war ihr eigener, elend umgekommener Mann. Unter Aufbietung aller Kräfte verscharrte sie ihn vor dem Hause und eilte wieder zur Truppe zurück. Als sie am nächsten Tag nochmals Gelegenheit hatte, zu ihrem Haus zu eilen, fand sie den bereits von ihr Begrabenen völlig unbekleidet wieder vor dem Hause liegen. Man hatte ihn hervorgeholt, seine Kleider entfernt, und seine Frau musste zum zweiten Mal das trostlose Amt des Leichenbestattens vollziehen. Nicht nur wir sechs waren aus der Stadt Königsberg herausgekommen, auch andere hatten auf den verschiedensten Wegen vor dem Hereinbrechen der Katastrophe die rettende Seite erlangt. Unzählig sind die Wunder und Gebetserhörungen, die Gott schenkte. Nicht nur in Kriegs- und Verfolgungszeiten, sondern auch in Friedenszeiten habe ich Gottes Eingreifen erlebt.«
Fluch und Segen im Feuerregen
Zum Leben zu wenig - Zum Sterben zu viel
Mein Leben begann »im wunderschönen Monat Mai, als alle Vöglein sangen«.
Berlin, die leidgeprüfte und von Gott gezeichnete Stadt, war mein Geburtsort und meine Heimat. Mit viereinhalb Pfund Körpergewicht war ich zum Sterben noch nicht gerufen, zum Leben aber fast zu schwach. Ein zappelndes Häufchen Elend in einem viel zu großen Babykorb. Trotzig geballte Fäustchen mit zehn, etwa streichholzdicken Fingerchen, strampelnde, elend dünne Beinchen, ein frisch verbundener und fest gewickelter Bauchnabel, eine krause, schwarzbehaarte, faltige Stirn, darunter eine kleine Mundöffnung, aus der zehnmal so viele Schreisalven herausgestoßen wurden, als man hätte annehmen können, unterstrichen mein Daseinsrecht auf dieser Erde. Die Chance meines Überlebens war in den damaligen Jahren wesentlich geringer als in unseren Tagen, wo moderne Brutkästen den allerkleinsten Neugeborenen Körperwärme geben und eine schützende Hülle zu der gefährlichen Außenwelt darstellen.
Meine Mutter weinte viel in jenen Tagen, wenn sie die rundlichen und wohlgenährten Kinder meines Jahrgangs erblickte und sie mit dem sehr hässlichen »Entlein« und seiner geringen Lebenserwartung verglich.
Doch mitunter wachsen solche kleinen Kreaturen »wider Erwarten« doch heran. Als meine Mutter mich bei einer Untersuchung durch den Fürsorgearzt nur für wenige Augenblicke aus den Augen ließ, um sich besorgt über meinen kläglichen Zustand zu äußern, wäre fast ein Unglück passiert. Wer da meint, dass viereinhalb Pfund Lebensenergien nicht ausreichten, um von einem zwei Meter breiten Tisch herunterzuhopsen, der irrt. Er wage nicht den Versuch, ein schreiendes Kind unbeobachtet auf einer glatten Tischplatte liegen zu lassen. Wäre nicht der Arzt hinzugesprungen, um mich festzuhalten, hätte es die Stunde meines Todes werden können. So wurde ich im letzten Moment aufgefangen.
»Haben Sie gesehen, was für eine Energie in dem kleinen Zappel steckt?«, fragte der Arzt. »Warum weinen Sie? Er wird am Leben bleiben!«
Das Geburtsgewicht hatte sich bald verdoppelt, ich nahm ständig an Gewicht zu. Die Tal- und Höhenwege des Lebens lagen damals für mich noch verborgen im Nebel der Zukunft. Freud’ und Leid, Lebenslust und Krankheitslast, Lieben und Hassen gehören zu dem Wechselgesang unseres Lebens. Zwei Gefühle haben mich bis zum heutigen Tage nicht verlassen: Heim- und Fernweh. Ein Weh löst im Wechsel das andere ab. War ich in der Ferne, trieb es mich mit Macht zur Heimat. Hatte ich über eine längere Zeit die elterliche Häuslichkeit erlebt, so zog es mich wieder hinaus in die Ferne. Es mag darin begründet liegen, dass unsere endgültige Heimat bei Gott ist, denn wir lesen in der Bibel: »Wir sind nur Gäste und Fremdlinge auf dieser Erde, die zukünftige Heimat suchen wir in der ewigen und himmlischen Welt.«
Bald sehnte ich mich nach Gemeinschaft mit gleichaltrigen Stammesgenossen. Da ich zunächst ohne ein Geschwisterchen aufwuchs, suchte ich einen Ausweg aus dem Alleinsein. Die Mutter war fort. Nachdem sie mich eindringlich ermahnt hatte, keine Dummheiten zu machen, ging sie einkaufen. Ich hatte keine bösen Absichten, dennoch verriegelte ich die Tür, um ein wagehalsiges Abenteuer zu unternehmen. Ich wollte nämlich gern die Kinder sehen, die im finsteren Berliner Hinterhof spielten, und nach ihnen rufen. Aus diesem Grund schob ich einen Hocker an das Fenster und kletterte unter großer Anstrengung auf das schmale Fensterbrett. Es war ein einfaches Fenster im 5. Stockwerk. Der schmale Hof lag tief unter mir im spitzen Winkel. Deshalb drückte ich mein Näschen mit aller Kraft an die Scheibe, um die Kinder sehen zu können und im Geiste meiner Fantasie mit ihnen zu sprechen. Meine Mutter ahnte nicht, in welch tödlicher Gefahr sich ihr einziges Kind befand. Ihr wäre vor Schreck sicher das Herz stehen geblieben. Doch »Kinder haben ihren Schutzengel bei sich«, so sagt man im Volksmund, und das stimmt sicher, denn es erscheint ziemlich unwahrscheinlich, dass ein etwa nur zwei Millimeter dickes Glas dem Druck eines kleinen Knaben standgehalten hätte.
Glücklicherweise hatte die von mir verriegelte Wohnzimmertür einen Glaseinsatz. Als meine Mutter die verschlossene Tür vorfand und mich rief, konnte ich wohl antworten und ihr sagen, wo ich mich befand, aber ich wäre nicht fähig gewesen, den kurzen Weg vom Fensterbrett auf den Hocker zurückzugehen. Mit sanfter Stimme sprach meine Mutter beruhigend auf mich ein: »Bleib bitte ganz ruhig stehen und beweg dich nicht! Ich komme gleich wieder.«
Sie holte schnell den Hausmeister. Dieser schlug die Scheibe der Wohnzimmertür ein und drückte mit einem langen Stock den Riegel der Tür herunter. Ich war gerettet!
Fern- oder Heimweh
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Nach Ostland geht unser Ritt
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Ein harter Aprilscherz
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Die Lieblingsfarbe des Königs
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Dem Tod ins Angesicht geschaut
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Meuterei im Kessel
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Flucht aus St. Nazaire
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Verirrt in Feindesland
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
An der Oderfront
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Der Tod flog vorbei
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Ein Wort kenne ich nicht – Kapitulation
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
O Gott, dass wir so gesündigt haben
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Frauen, Schnaps und Uhren
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Der Tote und das Brot
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Unbequeme Einquartierung
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Gefahrvolle Hamsterfahrten
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Vom Feind gespeist
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Schweinefutter und Maschinenpistolenfeuer
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
So wie der Baum fällt, so bleibt er liegen
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Endstation Frieden
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Raumschiff in Not
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe.
Nachwort
Diese Ereignisse, die heute von der heranwachsenden Jugend, die andere Probleme kennt, kaum verstanden werden, sollen uns aufrufen, mehr denn je unsere Kräfte dem Frieden zu widmen. Nur der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann uns bewahren und erhalten.
Die geschilderten Erinnerungen sollen in keiner Weise alte Wunden aufbrechen, irgendeinen Rassenhass oder gar Vergeltungstriebe in uns wecken.
Nach bereits 25 Jahren ist versucht worden, alle Begebenheiten wahrheitsgemäß und in objektiver Weise wiederzugeben. Der Leser wird bemerkt haben, dass große Teile der Lebenszeugnisse in persönliche Rede und in die Gegenwartsform gesetzt worden sind. Natürlich ist es ausgeschlossen, nach den vielen Jahren, die inzwischen vergangen sind, alle geführten Reden wortwörtlich und genau niederzuschreiben. Hierbei erweist es sich, dass unser Gedächtnis unvollkommen ist. Dass diese Gespräche sinngemäß stattgefunden haben, sei hier nur kurz unterstrichen und erwähnt. Die beiden Berichterstatter sind von der Tatsache überzeugt, dass ihre Bewahrung unverdiente Gnade ist und sie denen in keiner Weise etwas voraushaben, die Leid, Not oder gar den Tod erleiden mussten. Man könnte dem ebenso Beispiele entgegensetzen, in denen überzeugte Atheisten gleichfalls »mit heiler Haut« davongekommen sind, während bekennende Christen ihr Leben lassen mussten.
Die Antwort auf die Frage nach dem »Warum« werden wir in diesem Leben nicht ergründen können. Dieses Buch sollte aber gerade zweifelnde Menschen anregen, sich dem allmächtigen Gott zu stellen und vor seiner uneingeschränkten Macht zu kapitulieren.