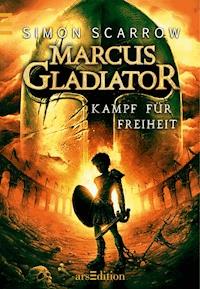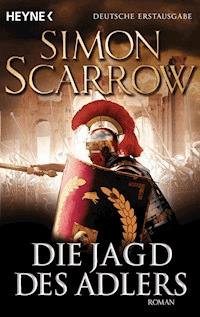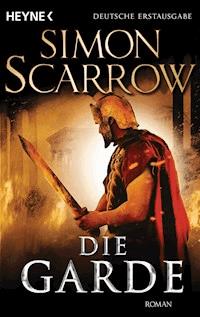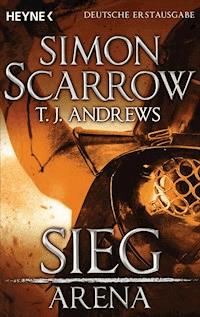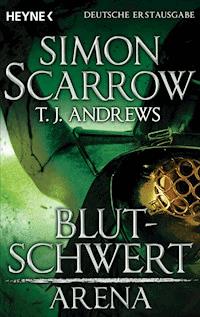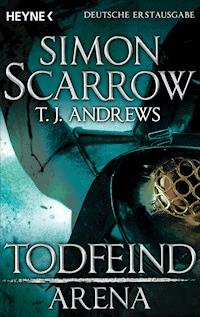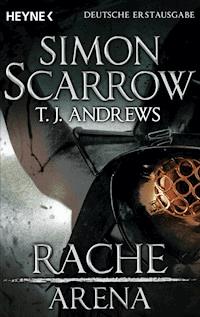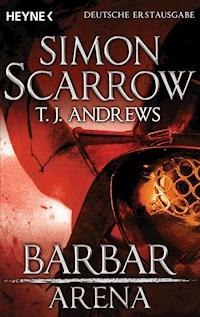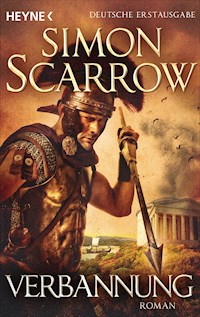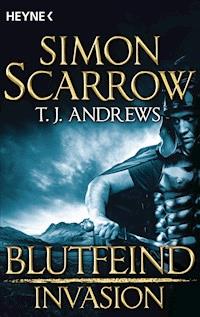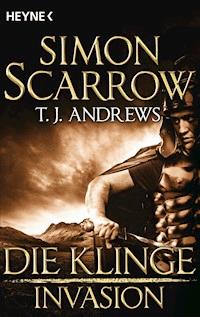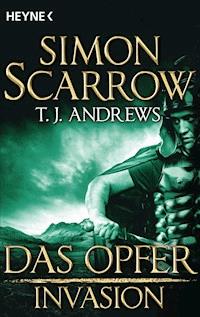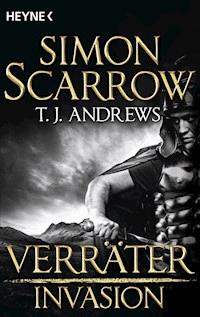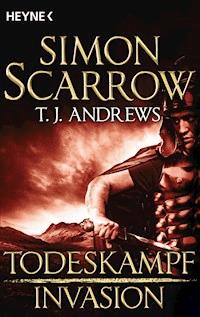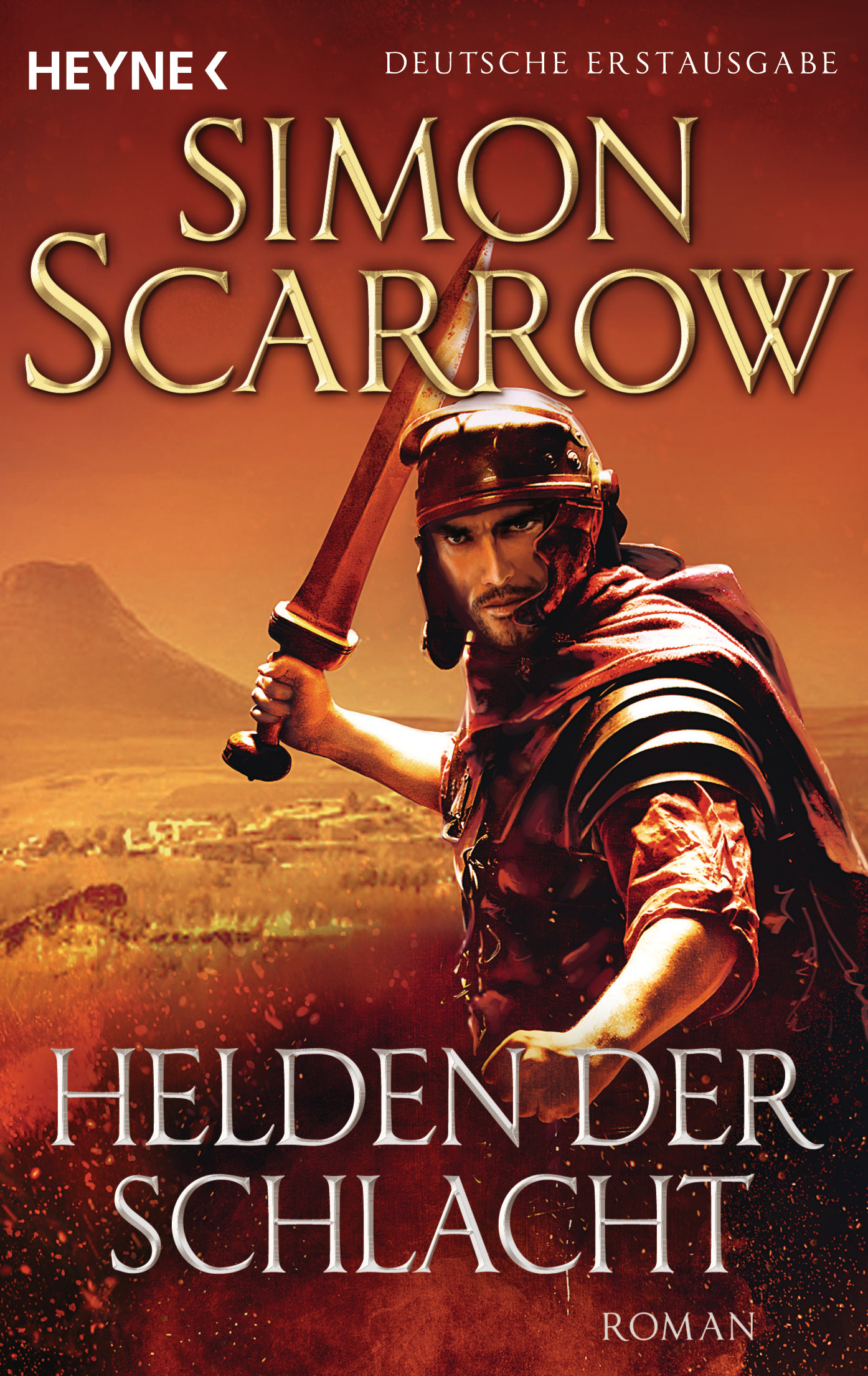9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rom-Serie
- Sprache: Deutsch
Sie kämpfen bis aufs Blut
Britannien 44 n. Chr.: Die römischen Eroberer kämpfen im zweiten Jahr gegen die Stämme Britanniens. Die meisten Soldaten sind kriegsmüde. Bei der entscheidenden Schlacht gerät die Legion, in der die Centurionen Macro und Cato dienen, in eine Falle. Der Kampf ist verloren, die Soldaten werden vom jähzornigen General Plautius verbannt. Wie Tiere gehetzt, müssen Macro und Cato jetzt um ihr Leben kämpfen – und um ihre Ehre.
- »Simon Scarrow stellt eine größere Konkurrenz für mich dar, als mir lieb ist.« (Bernard Cornwell)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 632
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Simon Scarrow
DIE BEUTE
DES ADLERS
Roman
Aus dem Englischen
von Kristof Kurz
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe THEEAGLE’S PROPHECY erschien 2004 bei Headline Publishing Group, London
Vollständige deutsche Erstausgabe 01/2013
Copyright © 2004 by Simon Scarrow
Copyright © 2013 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Werner Bauer
Umschlagillustration: Nele Schütz Design, München,
unter Verwendung eines Motivs von
© Shutterstock/Nejron Photo
Datenkonvertierung E-Book: Greiner & Reichel, Köln
ISBN: 978-3-641-09721-9V002
www.heyne.de
Für meine Brüder Scott und Alex, in Liebe.
Danke für die schöne Zeit.
ORDNUNGDERRÖMISCHEN ARMEEINBRITANNIEN, A. D. 44
DIE ORGANISATION DER RÖMISCHEN LEGION
Die Centurionen Macro und Cato sind die Hauptfiguren in Die Beute des Adlers. Damit sich auch Leser, die mit den römischen Legionen nicht vertraut sind, zurechtfinden, habe ich die verschiedenen Dienstgrade, die im Roman vorkommen, hier kurz zusammengefasst. Der Zweiten Legion, Macros und Catos »Heimat«, gehörten rund fünfeinhalbtausend Mann an. Die Basiseinheit war die achtzig Mann starke Centurie, die von einem Centurio befehligt wurde, als dessen Stellvertreter der Optio fungierte. Die Centurie war in acht Mann starke Unterabteilungen gegliedert, die sich im Lager einen Raum und im Feld ein Zelt teilten. Sechs Centurien bildeten eine Kohorte, und zehn Kohorten bildeten eine Legion; die Erste Kohorte hatte jeweils doppelte Stärke. Jede Legion wurde von einer hundertzwanzig Mann starken Kavallerieeinheit begleitet, unterteilt in vier Schwadronen, die als Kundschafter und Boten Verwendung fanden. Die Ränge in absteigender Folge lauteten folgendermaßen:
Der Legat war ein Mann aristokratischer Herkunft und üblicherweise über dreißig Jahre alt. Der Legat befehligte die Legion mehrere Jahre lang und hoffte darauf, sich einen Namen zu machen, um so seine anschließende Karriere als Politiker zu fördern.
Beim Lagerpräfekten handelte es sich um einen erfahrenen Veteranen, der zuvor oberster Centurio der Legion gewesen war und die Spitze der einem Berufssoldaten offen stehenden Karriereleiter erklommen hatte. Er war üblicherweise ein vertrauenswürdiger Mann von großer Erfahrung, der in Abwesenheit des Legaten das Kommando über die Legion übernahm.
Sechs Tribune taten als Stabsoffiziere Dienst. Dies waren Männer Anfang zwanzig, die zum ersten Mal in der Armee dienten, um administrative Erfahrung zu sammeln, bevor sie untergeordnete Posten in der Verwaltung übernahmen. Anders verhielt es sich mit dem Obertribun. Er war für ein hohes politisches Amt bestimmt und sollte irgendwann eine Legion befehligen.
Die sechzig Centurionen sorgten in der Legion für Disziplin und kümmerten sich um die Ausbildung der Soldaten. Diese handverlesenen Männer benötigten Führungsqualitäten und die Bereitschaft, bis zum Tode zu kämpfen, weshalb auch die Verluste unter ihnen höher waren als bei jedem anderen Dienstrang. Die Rangfolge der Centurionen ergab sich aus dem Zeitpunkt ihrer Beförderung. Der dienstälteste und damit ranghöchste Centurio – ein hochdekorierter, weithin angesehener Soldat – befehligte die Erste Centurie der Ersten Kohorte.
Die vier Decurionen der Legion kommandierten die Kavallerie-Schwadronen und hofften darauf, zum Befehlshaber der Kavallerie-Hilfseinheiten befördert zu werden.
Jedem Centurio stand ein Optio zur Seite, der die Aufgabe eines Ordonnanzoffiziers wahrnahm und geringere Kompetenzen hatte. Ein Optio wartete gewöhnlich auf einen freien Platz im Centurionat.
Unter den Optios standen die Legionäre, Männer, die sich für fünfundzwanzig Jahre verpflichtet hatten. Theoretisch durften nur römische Bürger in der Armee dienen, doch wurden zunehmend auch Männer der einheimischen Bevölkerung angeworben, denen beim Eintritt in die Legion die römische Staatsbürgerschaft verliehen wurde.
Nach den Legionären kamen die Männer der Hilfskohorten. Diese wurden in den Provinzen rekrutiert und stellten die Reiterei sowie die leichte Infanterie des Römischen Reiches und nahmen andere Spezialaufgaben wahr. Nach fünfundzwanzigjährigem Armeedienst wurde ihnen die römische Staatsbürgerschaft verliehen.
KAPITEL 1
Wie weit ist es noch bis zum Lager?«, fragte der Grie- che und warf erneut einen Blick über die Schulter. »Werden wir es vor Anbruch der Dunkelheit erreichen?«
Der Decurio, der die kleine berittene Eskorte anführte, spuckte einen Apfelkern aus und schluckte das saure Fruchtfleisch hinunter, bevor er antwortete.
»Das schaffen wir schon. Keine Sorge, Herr. Noch etwa fünf oder sechs Meilen, mehr nicht.«
»Geht das nicht schneller?«
Der Mann spähte schon wieder über die Schulter. Jetzt konnte auch der Decurio nicht länger der Versuchung widerstehen und sah sich ebenfalls um. Nichts. Der Weg war bis zu der Stelle, wo er zwischen dicht bewaldeten, in der Hitze flirrenden Hügeln verschwand, völlig verlassen. Seit sie gegen Mittag von dem befestigten Vorposten aufgebrochen waren, war ihnen keine Menschenseele begegnet. Der Decurio, die Eskorte aus zehn Reitern unter seinem Kommando sowie der Grieche mit seinen beiden Leibwächtern folgten der Straße, die zum gewaltigen Feldlager des Generals Plautius führte. Dort hatte man drei Legionen und zwei Dutzend Hilfstruppeneinheiten zusammengezogen – sie sollten zum vernichtenden Schlag gegen Caratacus und seine Armee aus der Handvoll britischer Stämme, die noch offen gegen Rom Widerstand leisteten, ausholen.
Der Decurio interessierte sich brennend dafür, was genau der Grieche mit dem General zu schaffen hatte. Im Morgengrauen hatte ihm der Präfekt der tungerischen Reiterkohorte befohlen, zusammen mit den besten Männern aus seiner Schwadron den Griechen zum General zu eskortieren. Er hatte gehorcht, ohne Fragen zu stellen. Doch jetzt regte sich seine Neugierde, und er warf dem Griechen verstohlen einen Blick zu.
Trotz des gewöhnlichen leichten Umhangs und der einfachen roten Tunika roch der Kerl förmlich nach Reichtum und Kultiviertheit. Seine Fingernägel waren sorgfältig manikürt, wie der Decurio mit Abscheu feststellte, und aus dem schütteren dunklen Haar und dem Bart wehte ihm der Hauch einer teuren Zitronenpomade entgegen. Obwohl der Grieche keine Ringe trug, verrieten doch weiße Stellen auf der Haut seiner Finger, dass er an prunkvollen Handschmuck gewöhnt war. Mit einem verächtlichen Gesichtsausdruck kam der Decurio zu dem Schluss, dass es sich bei ihm wohl um einen jener ehemaligen griechischen Sklaven handelte, die sich ins Herz der imperialen Bürokratie geschlichen hatten. Die Tatsache, dass sich dieser Mann gerade in Britannien befand und es noch dazu sehr offensichtlich darauf anlegte, möglichst nicht aufzufallen, ließ darauf schließen, dass die Botschaft, die er dem General überbringen sollte, so delikat war, um sie nicht den offiziellen Kurieren anvertrauen zu können.
Dann wanderte der Blick des Decurio langsam zu den beiden Leibwächtern, die direkt hinter ihrem Herrn ritten. Sie waren ebenfalls einfach gekleidet. Unter ihren Umhängen trugen sie Kurzschwerter in militärischen Trageriemen. Das waren keine ehemaligen Gladiatoren, wie sie die reichsten Männer Roms gerne als Leibwächter in den Dienst nahmen. Für den Decurio waren sowohl die Schwerter als auch ihre disziplinierte Haltung ein unverkennbares Zeichen, dass es sich bei ihnen um Prätorianer handelte, die vergeblich versuchten, unerkannt zu bleiben. Ein weiterer schlagender Beweis dafür, dass der Grieche in höchstem Auftrag hier war.
Der kaiserliche Beamte sah sich noch einmal um.
»Wartest du auf jemanden?«, fragte der Decurio.
Der Grieche versuchte, seine ängstliche Miene zu verbergen, und zwang sich zu einem kleinen Lächeln. »Und ich hoffe, dass dieser jemand nicht auftaucht.«
»Jemand, der uns Ärger machen könnte?«
Der Grieche starrte ihn einen Augenblick lang an und lächelte abermals. »Nein.«
Der Decurio wartete auf eine Erklärung, doch der Grieche wandte sich wortlos von ihm ab. Schulterzuckend biss der Decurio in seinen Apfel und ließ den Blick über die Umgebung schweifen. Im Süden schlängelte sich der Oberlauf der Tamesis durch die sanft gewellte Landschaft. Die Hügel waren von uralten Wäldern gekrönt, und in den Tälern lagen die verstreuten Siedlungen und Bauernhöfe der Dobunni, eines Stammes, der sich bereits kurz nach der Landung der römischen Truppen vor einem Jahr unterworfen hatte.
Ein schönes Fleckchen, um sich niederzulassen, dachte der Decurio. Sobald er seine fünfundzwanzigjährige Dienstzeit abgeleistet und die Bürgerrechte sowie eine kleine Abfindung erhalten hatte, würde er sich am Rande einer Veteranenkolonie ein kleines Gehöft kaufen, um dort friedlich seinen Lebensabend zu verbringen. Er könnte sogar die Einheimische heiraten, die er in Camulodunum kennengelernt hatte, ein paar Kinder zeugen und sich dem Suff ergeben.
Der schöne Tagtraum wurde jäh unterbrochen, als der Grieche sein Pferd plötzlich zügelte und den Weg hinabstarrte. Die braunen Augen unter den gezupften Brauen verengten sich. Mit einem Fluch hob der Decurio den Arm, um seine Männer anzuhalten, bevor er sich seinem besorgten Schützling zuwandte.
»Was ist jetzt?«
»Dort!« Der Grieche deutete mit dem Finger. »Sieh nur!«
Der Decurio drehte sich müde im Sattel um. Das Leder knarrte unter seiner Reithose. Einen Moment lang konnte er nichts erkennen. Doch als er den Blick zu der Stelle hob, wo der Weg zwischen den Hügeln verschwand, sah er die dunklen Silhouetten von Reitern, die aus den Schatten der Bäume ins Sonnenlicht stürmten. Sie galoppierten direkt auf den Griechen und seine Eskorte zu.
»Wer zum Hades sind die denn?«, murmelte der Decurio.
»Keine Ahnung«, antwortete der Grieche. »Aber ich kann mir schon denken, wer sie geschickt hat.«
Der Decurio warf ihm einen nervösen Blick zu. »Sind sie uns feindlich gesinnt?«
»Ohne Zweifel.«
Der Decurio maß die Verfolger, die jetzt kaum mehr als eine Meile entfernt waren, mit erfahrenem Blick: acht in flatternde dunkelbraune und schwarze Umhänge gehüllte Reiter, die gebückt auf ihren Pferden hockten und diese zur Eile antrieben. Acht gegen dreizehn – den Griechen nicht mitgezählt. Günstige Voraussetzungen, dachte der Centurio.
»Wir haben genug gesehen.« Der Grieche wandte sich von den Reitern in der Entfernung ab und gab dem Pferd die Fersen. »Los!«
»Vorwärts!«, befahl der Decurio, und die Eskorte galoppierte dem Griechen und seinen Leibwächtern hinterher.
Der Decurio war wütend. Es gab keinen Grund zu einer derartigen Eile. Sie waren im Vorteil und konnten ihre Pferde so lange ausruhen, bis sie die Verfolger auf ihren erschöpften Tieren erreicht hätten, um dann kurzen Prozess mit ihnen zu machen. Doch andererseits war nicht auszuschließen, dass ein Angreifer den Griechen mit einem Glückstreffer erledigte. Da war der Befehl des Präfekten eindeutig: dem Griechen durfte unter keinen Umständen etwas zustoßen. Sein Leben musste um jeden Preis geschützt werden. Angesichts dessen war es wohl vernünftiger, der Konfrontation aus dem Weg zu gehen, so unehrenhaft der Decurio dies auch finden mochte. Sie hatten eine Meile Vorsprung und würden mit Leichtigkeit das Lager des Generals erreichen, bevor der Gegner in Schlagdistanz war.
Als er sich erneut umsah, stellte der Decurio mit Schrecken fest, dass die Verfolger ordentlich aufgeholt hatten. Sie verfügten über exzellente Pferde. Sein eigenes Ross und die seiner Männer waren nicht schlechter als alle anderen der Kohorte, konnten damit aber beileibe nicht mithalten. Zudem musste es sich bei den Gegnern um erstklassige Reiter handeln, wenn sie ihre Pferde zu einer derartigen Eile antreiben konnten.
Zum ersten Mal beschlichen den Decurio Zweifel. Das waren keine einfachen Wegelagerer. Und ihrem schwarzen Haar, der dunklen Haut und den wallenden Umhängen und Tuniken nach zu urteilen wohl auch keine Einheimischen. Die keltischen Stämme, die auf dieser Insel lebten, griffen die Römer nur an, wenn sie klar in der Überzahl waren. Außerdem schien der Grieche seine Verfolger zu kennen. Sein Entsetzen war deutlich spürbar; andererseits gehörte er einem bekanntermaßen furchtsamen Volk an. Er konnte sich nur mit Mühe auf seinem Pferd halten, während seine Leibwächter zu beiden Seiten mit deutlich größerer Eleganz und höherem Selbstvertrauen ritten. Das angespannte Gesicht des Decurio verzog sich zu einem Lächeln um die zusammengebissenen Zähne. Vielleicht machte der Grieche ja bei Hof eine gute Figur. Als Reiter taugte er jedenfalls nicht viel.
Und so geschah wenig später das Unvermeidliche. Mit einem lauten Kreischen geriet der Grieche zu weit auf eine Seite, und obwohl er verzweifelt an den Zügeln zerrte, konnte er nicht verhindern, dass ihn der Schwung aus dem Sattel riss. Fluchend gelang es dem Decurio, sein eigenes Pferd im letzten Moment herumzureißen, um den Mann nicht niederzutrampeln.
»Halt!«
Ein Chor aus Flüchen und alarmiertem Wiehern ertönte, als die Eskorte einen Ring um den auf dem Rücken liegenden Griechen bildete.
»Hoffentlich lebt dieser Bastard noch«, murmelte der Decurio, als er sich aus dem Sattel schwang. Sofort waren die Leibwachen zur Stelle und beugten sich über den Mann, für dessen Wohlergehen sie verantwortlich waren.
»Ist er tot?«, fragte der eine.
»Nein. Er atmet.«
Der Grieche öffnete die Augen und schloss sie sofort wieder, da ihn die Sonne blendete. »Was … was ist geschehen?« Sein Kopf fiel wieder zurück, und er wurde erneut ohnmächtig.
»Hoch mit ihm!«, bellte der Decurio. »Setzt ihn auf sein Pferd.«
Die Prätorianer zerrten den Griechen auf die Beine und wuchteten ihn in den Sattel. Dann stiegen sie selbst auf. Einer nahm die Zügel des Pferdes, während der andere den Mann mit festem Griff um die Schulter stützte.
Der Decurio deutete auf die Straße vor sich. »Bringen wir ihn von hier weg!« Während sich die drei Männer in Bewegung setzten, wandte er sich zu den Verfolgern um.
Sie waren viel näher gekommen und nur noch etwa dreihundert Schritt entfernt. Die Reiter fächerten sich zu einer keilförmigen Formation auf und stürmten direkt auf die wartende Eskorte zu, wobei sie leichte Wurfspeere aus den Halftern zogen und sie über den Kopf hoben, um sie auf Kommando losschleudern zu können.
»Schlachtreihe bilden!«, bellte der Decurio.
Seine Männer trieben die schnaubenden Pferde auseinander und nahmen über die Breite der Straße hinweg Gefechtsordnung ein. Sie hoben die Schilde, um ihre Körper zu schützen, und richteten die Lanzen auf die schnell näherkommenden Reiter. Jetzt wünschte der Decurio, er hätte seinen Männern befohlen, sich mit Wurfspeeren auszurüsten. Doch er hatte mit einem ereignislosen Ritt gerechnet. Nun würden sie erst der feindlichen Speersalve standhalten müssen, bevor sie dem Gegner im Nahkampf entgegentreten konnten.
»Bereit machen!«, befahl der Decurio und gab so das Signal zum Gegenangriff. »Auf mein Zeichen … Attacke!«
Unter wildem Schlachtgebrüll trieben die Hilfstruppen ihre Pferde an. Immer schneller preschten die beiden Angriffslinien aufeinander zu.
Die gegnerischen Reiter machten keine Anstalten, ihre Geschwindigkeit zu verringern. Einen Augenblick lang war der Decurio überzeugt, dass sie mit voller Wucht in seine Männer krachen würden, und bereitete sich auf den Aufprall vor. Er spürte, wie sich in seinen Reihen der Wunsch nach Rückzug bemerkbar machte und die Gefechtslinie langsamer wurde.
Schnell gewann der Decurio die Fassung zurück. »Weiter! Nicht langsamer werden!«, brüllte er zu beiden Seiten.
Schon konnte man die Gesichter der Heranstürmenden erkennen: Sie waren hoch konzentriert, ruhig und unerbittlich. Die wallenden Umhänge und Tuniken verdeckten jeden Hinweis auf ihre Rüstung. Beim Gedanken an den einseitigen Verlauf des bevorstehenden Kampfes empfand der Decurio fast Mitleid mit ihnen. Auch wenn sie die besseren Pferde hatten – im Kampf Mann gegen Mann würden sie gegen die gut gepanzerten Hilfstruppen den Kürzeren ziehen.
Im letzten Moment – und ohne, dass ein Befehl gegeben wurde – rissen die Feinde ihre Pferde herum, ritten die römische Gefechtslinie entlang und holten mit den Wurfspeeren aus.
»Vorsicht!«, rief einer der Männer des Decurio, als mehrere Speere in einer niedrigen Flugbahn auf die Eskorte zugeschossen kamen. Das war keine panisch abgefeuerte Salve. Jeder Mann hatte sein Ziel sorgfältig anvisiert. Die eisernen Speerspitzen bohrten sich präzise in die Kehlen und Flanken der römischen Pferde. Nur ein Speer traf einen Reiter knapp über dem Sattelhorn in den Bauch. Sie hatten ihre Ziele mit Bedacht gewählt, begriff der Decurio. Die verletzten Tiere stiegen entweder auf und versuchten, mit den Hufen an die Speere zu gelangen, die aus ihren Leibern ragten, andere wichen unter schrillem Wiehern zur Seite aus. Ihre Reiter mussten die Gefechtsformation aufgeben und konnten nur mit Mühe die Gewalt über ihre Rösser wiedererlangen. Zwei Männer wurden abgeworfen und fielen kopfüber auf den harten Erdboden.
Weitere Wurfspeere schossen durch die Luft. Das Pferd des Decurio erbebte, als sich ein dunkler Schaft in seine rechte Schulter bohrte. Instinktiv presste der Decurio die Schenkel gegen den Ledersattel und fluchte, als das Pferd stehen blieb und so heftig den Kopf schüttelte, dass der Schaum aus seinem Maul flog und im Sonnenlicht glitzerte. Um ihn herum löste sich seine Eskorte in einem Durcheinander aus verwundeten Pferden und ihren Reitern auf, die Mühe hatten, sich von den in Panik geratenen Tieren zu entfernen.
Der Feind hatte seine Wurfspeere verbraucht. Jetzt zog jeder Mann sein Schwert – das lange Spatha, das zur Grundausrüstung der römischen Reiterei gehörte. Nun hatte sich das Blatt gewendet, und die Eskorte stand vor ihrer völligen Vernichtung.
»Sie greifen an!«, rief eine panische Stimme direkt neben dem Decurio. »Lauft!«
»Nein! Zusammenbleiben!«, brüllte der Decurio und glitt von seinem verletzten Pferd. »Wenn ihr flieht, seid ihr verloren! Zusammenbleiben! Alle zu mir!«
Der Befehl kam zu spät. Die Hälfte der Männer befand sich schon nicht mehr im Sattel. Manche waren noch benommen vom Sturz, die anderen versuchten immer noch, ihre Pferde unter Kontrolle zu bekommen. Eine koordinierte Verteidigung war unmöglich. Jetzt war jeder Mann auf sich allein gestellt. Der Decurio trat zur Seite, damit er genügend Platz hatte, um mit der Lanze manövrieren zu können. Er starrte auf die gesenkten Schwerter der unaufhaltsam herantrabenden Gegner.
Ein Befehl ertönte auf Latein. »Lasst sie!«
Die acht Reiter steckten ihre Schwerter in die Scheide und rissen fest an den Zügeln, um den verängstigten Römerhaufen zu umrunden. Dann gaben sie ihren Pferden die Fersen und galoppierten in Richtung des Legionslagers.
»Scheiße«, murmelte jemand in plötzlicher Erleichterung. »Das war knapp. Ich dachte schon, dass sie uns gleich den Garaus machen.«
Instinktiv schloss sich der Decurio dieser spontanen Gefühlsregung an. Doch dann gefror ihm das Blut in den Adern.
»Der Grieche … sie sind hinter dem Griechen her.«
Und sie würden ihn erreichen. Trotz ihres Vorsprungs würde der benommene Mann die Prätorianer erheblich verlangsamen. Man würde sie einholen und abschlachten, lange bevor sie sich in General Plautius’ Lager in Sicherheit bringen konnten.
Der Decurio verwünschte den Griechen und sein eigenes Pech, weil ausgerechnet er mit dieser Aufgabe betraut worden war. Er packte die Zügel des Pferdes, auf dem der verwundete Soldat ritt, der sich immer noch damit abmühte, den Wurfspeer aus seinem Bauch zu ziehen.
»Runter da!«
Der Mann biss vor Schmerzen die Zähne zusammen. Offenbar hatte er den Befehl gar nicht gehört. Der Decurio warf ihn aus dem Sattel und schwang sich aufs Pferd. Mit einem entsetzlichen Schrei fiel der Mann so heftig auf den Boden, dass der Speer dabei zerbrach.
»Alle, die noch im Sattel sitzen – mir nach!«, rief der Decurio, wendete das Pferd und galoppierte den Angreifern hinterher. »Mir nach!«
Er beugte sich so weit vor, dass die Mähne des Tieres gegen seine Wange strich. Das Pferd schnaubte und strengte jeden Muskel an, um den erbarmungslosen Befehlen seines Herren zu gehorchen. Der Decurio sah sich um. Vier Männer hatten sich aus dem Haufen gelöst und folgten ihm. Fünf gegen acht. Es sah schlecht aus, doch zumindest hatte der Feind keine Wurfspeere mehr. Gegen ein einfaches Schwert hatte der mit Lanze und Schild bewaffnete Decurio einen deutlichen Vorteil. Sein Herz war mit dem Verlangen erfüllt, blutige Rache an den unbekannten Gegnern zu üben, und so trieb er sein Pferd unbarmherzig an. Gleichzeitig sagte ihm sein Verstand, dass er in erster Linie den Griechen retten musste, der an diesem Desaster überhaupt erst schuld war.
Die Straße führte eine sanfte Anhöhe hinab. Der Feind donnerte in dreihundert Schritten Entfernung dahin. Eine Drittelmeile davor ritten die Prätorianer, die immer noch Mühe hatten, den Griechen im Sattel zu halten.
»Los doch!«, rief der Decurio über die Schulter. »Nicht zurückfallen!«
Die drei Reitergruppen durchquerten das Tal und ritten zu der Anhöhe dahinter hinauf. Nun wurde deutlich, dass die Angreifer ihre Tiere bei der ersten Attacke über Gebühr ermüdet hatten. Die Lücke zwischen ihnen und dem heranstürmenden Decurio schloss sich zusehends. Mit einem Triumphschrei rammte er die Fersen in die Flanken des Pferdes. »Los doch! Los doch, meine Schöne! Mit letzter Kraft!«, brüllte er in die Ohren seiner Stute.
Als der Feind die Spitze des Hügels erreicht hatte, war sein Vorsprung bereits um die Hälfte zusammengeschmolzen. Die Reiter waren mittlerweile hinter der Hügelkuppe verschwunden, doch der Decurio war sich sicher, dass sie sie einholen würden, bevor sie über den Griechen und die Prätorianer herfallen konnten. Er drehte sich um und bemerkte erfreut, dass ihn seine Männer fast erreicht hatten. Also würde er nicht allein gegen den Feind anreiten.
Auf der Spitze des Hügels angekommen, erkannte er in etwa drei Meilen Entfernung das gewaltige, lang gestreckte Lager des Generals. Ein verworrenes Muster aus winzigen Zelten überzog ein riesiges Areal, das von einem mit einer Palisade gekrönten Erdwall begrenzt wurde. Hier hatten sich drei Legionen und zahlreiche Hilfskohorten versammelt, um in einem unaufhaltsamen Vorstoß Caratacus und seine britische Armee aufzuspüren und zu vernichten. Der Decurio hatte nur wenige Augenblicke, um diesen Anblick zu genießen – dann wurde die Aussicht durch mehrere feindliche Reiter blockiert, die gewendet hatten und nun auf ihn zugestürmt kamen. Er hatte keine Zeit mehr, anzuhalten und seine Männer um sich zu scharen, daher hob er schnell seinen Schild und richtete die Lanzenspitze auf die Brust des nächsten Angreifers.
Und plötzlich war er mitten im Getümmel. Der wuchtige Aufprall schleuderte seinen Arm zurück und verdrehte ihm schmerzhaft die Schulter. Die Lanze wurde ihm aus der Hand gerissen. Als der Gegner mit wehenden Umhängen, Mähnen und Pferdeschwänzen an ihm vorbeipreschte, hörte er das dumpfe Grunzen des Mannes, den er durchbohrt hatte. Eine Schwertklinge schlug gegen seinen Schild, glitt am Messingbuckel ab und schlitzte seine Wade auf. Dann waren sie an ihm vorbei. Der Decurio riss die Zügel herum und zog das Schwert. Waffenklirren und Schreie kündigten die Ankunft seiner Männer an.
Mit hocherhobenem Schwert stürzte sich der Decurio in den Kampf. Seine Männer waren in der Unterzahl und kämpften mit dem Mut der Verzweiflung. Wer eine Attacke abwehrte, fiel ungedeckt der nächsten zum Opfer, und als der Decurio seine Männer erreicht hatte, lagen bereits zwei von ihnen blutend neben dem stöhnenden Mann, den der Decurio mit seiner Lanze durchbohrt hatte, auf dem Boden.
Er bemerkte eine Bewegung zu seiner Rechten und zog den Kopf ein, als sich eine Schwertspitze in den Metallrand seines Schildes grub. Der Decurio riss den Schild zur Seite, um so seinen Gegner zu entwaffnen, wirbelte herum und holte gleichzeitig mit dem Schwert aus. Die Klinge blitzte, und der Mann riss angesichts der drohenden Gefahr weit die Augen auf und ließ sich nach hinten fallen. Die Schwertspitze des Decurio drang durch seine Tunika, zerkratzte jedoch lediglich seine Brust.
»Scheiße!«, zischte der Decurio und gab seinem Pferd die Fersen, um näher an seinen Gegner heranzukommen. Das wilde Verlangen, den Feind zur Strecke zu bringen, machte den Decurio blind für Angriffe von anderen Seiten, und so sah er die Gestalt, die auf ihn zurannte und ihr Schwert in seine Hüfte bohrte, viel zu spät. Er bemerkte den Hieb erst, als der Mann mit bluttriefendem Schwert zurücksprang. Sofort begriff der Decurio, dass es sein Blut war, das an der Klinge klebte, doch er hatte keine Zeit, um die Wunde in Augenschein zu nehmen. Ein kurzer Blick verriet ihm, dass er der letzte Überlebende war. Seine Männer waren entweder tot oder lagen im Sterben. Ihre merkwürdigen, schweigenden Gegner, die kämpften, als wären sie für die Schlacht geboren, hatten erst zwei Verluste hinnehmen müssen.
Hände griffen nach seinem Schildarm, und der Decurio wurde erbarmungslos aus dem Sattel gerissen und fiel so hart auf den Erdboden, dass ihm die Luft aus der Lunge gedrückt wurde. Er lag auf dem Rücken, als sich eine dunkle Silhouette vor den blauen Himmel schob. Der Decurio sah sein Ende nahen, verzichtete jedoch tapfer darauf, die Augen zu schließen.
Seine Lippen verzogen sich zu einem verächtlichen Grinsen. »Nun mach schon, du Bastard!«
Doch der Schwerthieb blieb aus. Der Mann wirbelte herum und war verschwunden. Dann ein Scharren, Schnauben und sich schnell entfernendes Hufgeklapper, bis nur noch die eigentümlich friedliche Stille eines Sommernachmittags zu hören war. Das Summen der Insekten wurde nur vom Stöhnen eines Mannes unterbrochen, der verletzt im Gras neben dem Decurio lag. Der konnte kaum fassen, dass er noch am Leben war, dass der Feind ihn verschont hatte, obwohl er hilflos zu Boden gegangen war. Er schnappte nach Luft und setzte sich auf.
Die sechs überlebenden Reiter hatten die Verfolgung des Griechen wieder aufgenommen. Bitterer Groll stieg im Decurio auf. Er hatte versagt. Obwohl er seine Männer geopfert hatte, würde es den Unbekannten gelingen, den Griechen einzuholen. Schon konnte er sich die harsche Strafpredigt ausmalen, die ihm bevorstand, wenn er und die kümmerlichen Überbleibsel der Eskorte zum Lager der Kohorte zurückkehrten.
Plötzlich überkamen den Decurio Schwindel und Übelkeit, und er musste sich mit der Hand auf dem Boden abstützen, um nicht umzufallen. Die Erde unter seinen Fingern fühlte sich warm, klebrig und feucht an. Er sah an sich herab und bemerkte, dass er in einer Blutlache saß. Sein Blut, wie ihm benommen klar wurde. Dann erinnerte er sich an die Wunde in seiner Hüfte. Eine Hauptschlagader war durchtrennt worden. Dunkles Blut spritzte stoßweise zwischen seinen ausgestreckten Beinen hervor. Sofort presste er eine Hand auf die Wunde, doch er konnte den warmen Strom, der durch seine Finger floss, nicht aufhalten. Es wurde kälter, und mit einem traurigen Lächeln wurde ihm bewusst, dass er die Abreibung durch den Präfekten der Kohorte nicht länger fürchten musste. Nicht in diesem Leben zumindest. Der Decurio hob den Kopf und sah zu dem Griechen und seinen Leibwächtern hinüber, die nur noch winzige Punkte in der Entfernung bildeten.
Sie flohen um ihr Leben, doch der Ernst ihrer Lage war nicht länger seine Sorge. Sie waren nur noch Schatten, die am Rande seiner schwindenden Sinne tanzten. Er ließ sich ins Gras zurückfallen und starrte in den klaren blauen Himmel. Der Waffenlärm war längst verhallt. Nur das einlullende Summen der Insekten war geblieben. Der Decurio schloss die Augen und nahm die wohltuende Wärme des Sommernachmittags in sich auf, bis sein Bewusstsein allmählich schwand.
KAPITEL 2
Aufwachen!« Der Prätorianer schüttelte die Schulter des Griechen. »Narcissus! Wach auf!«
»Du verschwendest deine Zeit«, sagte sein Kamerad auf der anderen Seite. »Der ist außer Gefecht.«
Beide sahen sich zu dem Scharmützel auf der Hügelkuppe um.
»Dieser verdammte Hurensohn muss endlich aufwachen. Sonst sind wir geliefert. Ich bezweifle, dass unsere Freunde da oben noch viel länger durchhalten.«
»Tun sie auch nicht.« Sein Begleiter kniff die Augen zusammen. »Es ist vorbei. Vorwärts.«
Der Grieche stöhnte und hob mit schmerzverzerrter Miene den Kopf. »Was … ist passiert?«
»Wir sind in Gefahr, Herr. Wir müssen schnell weiter.«
Narcissus schüttelte den Kopf, um den dumpfen Nebel zu verscheuchen, der sich über seinen Verstand gelegt hatte. »Wo sind die anderen?«
»Tot, Herr. Wir müssen weiter.«
Narcissus nickte, ergriff die Zügel und trieb sein Pferd an. Plötzlich schoss es vorwärts, als ihm der Prätorianer mit dem Schwert sanft in die Seite stach.
»Langsam!«, blaffte Narcissus.
»Tut mir leid, Herr. Aber wir haben keine Zeit zu verlieren.«
»Jetzt hör mal zu!« Narcissus wandte sich ärgerlich um, um den Prätorianer daran zu erinnern, mit wem er es hier zu tun hatte. Dabei huschte sein Blick über die Straße hinter ihnen. Ihre Verfolger hatten soeben den letzten Mann der Eskorte niedergemacht und nahmen die Verfolgung wieder auf.
»Also gut«, murmelte er. »Verschwinden wir.«
Während die drei Reiter ihre Pferde antrieben, sah Narcissus zum entfernten Lager hinüber. Er hoffte, dass die Wachen aufmerksam genug waren, um die beiden Gruppen rechtzeitig zu entdecken und Alarm zu schlagen. Wenn aus dem Lager nicht umgehend Hilfe kam, war es durchaus möglich, dass sie dort nicht lebend ankommen würden. Die unzähligen Reflektionen des Sonnenlichts auf den polierten Waffen und Rüstungen im Lager hätten genauso gut Sterne sein können, so unerreichbar schienen sie ihm.
Der Feind, der sich mit donnernden Hufen näherte, war kaum mehr als eine Viertelmeile entfernt. Von diesen Männern konnte sich Narcissus keine Gnade erhoffen. Sie machten keine Gefangenen. Es waren Attentäter, und ihr Befehl lautete, den Privatsekretär des Kaisers zu töten, bevor er mit General Aulus Plautius zusammentreffen konnte. Narcissus fragte sich, wer sie wohl angeheuert hatte. Sollte sich das Blatt wenden und einer der Attentäter in seine Hände fallen, so verfügte der General über Folterknechte, die bekannt dafür waren, selbst den Willen des stärksten Mannes zu brechen. Doch die gewonnenen Erkenntnisse würden von geringem Nutzen sein. Narcissus’ Feinde – und die seines Herrn, Kaiser Claudius – waren verschlagen genug, um ihre Mörder durch anonyme und entbehrliche Hintermänner anzuwerben.
Der Geheimauftrag, mit dem Narcissus betraut worden war, sollte eigentlich nur dem Kaiser selbst und seinen engsten Beratern bekannt sein. Nur sie wussten, dass die rechte Hand des Kaisers nach Britannien reiste, um sich dort mit General Plautius zu treffen. Zum letzten Mal hatte er den General vor einem Jahr gesehen. Damals war Narcissus Teil des kaiserlichen Gefolges gewesen. Claudius hatte sich gerade lange genug bei seiner Armee aufgehalten, um Zeuge der Niederlage der Eingeborenenarmee zu werden und die Lorbeeren für den Sieg einzustreichen. Zum kaiserlichen Hofstaat hatten Tausende Menschen gehört, und weder Claudius noch Narcissus hatte es an Luxus oder Sicherheit gemangelt. Doch dieses Mal war Geheimhaltung das oberste Gebot. Narcissus, der inkognito und ohne seinen geliebten Schmuck reisen musste, hatte den Prätorianerpräfekten gebeten, ihm zwei der besten Männer seiner Eliteeinheit zum Schutz zu überlassen. Mit Marcellus und Rufus im Gefolge war er aus einem kleinen Hintereingang des Kaiserpalastes geschlichen.
Doch die Kunde von seinem Auftrag hatte sich nichtsdestoweniger verbreitet. Sobald sie Rom verlassen hatten, war Narcissus das Gefühl nicht losgeworden, beobachtet und verfolgt zu werden. Die Straßen, auf denen sie ritten, waren nie verlassen – immer war weit hinter ihnen die ein oder andere kaum erkennbare Gestalt auszumachen gewesen. Natürlich hätte es auch ein unbescholtener Reisender sein können, doch Narcissus lebte in in einer so großen Furcht vor seinen Feinden, dass er dergleichen nicht als Zufall abtun konnte. Tatsächlich war seine Angst so groß, dass es ihm zur Gewohnheit geworden war, jede erdenkliche Vorsichtsmaßname zu treffen. Nur dadurch hatte er sich länger als viele andere in der gefährlichen Welt des kaiserlichen Hofstaats behaupten können. Ein Mann wie Narcissus, der um hohe Einsätze spielte, brauchte Augen im Hinterkopf, um alles um sich herum wahrzunehmen: jede Handlung, jede Gefälligkeit, jedes stumme Kopfnicken und jedes Flüstern, das bei den kaiserlichen Festmahlen zwischen den Aristokraten ausgetauscht wurde.
Das alles erinnerte ihn nur allzu oft an den doppelgesichtigen Gott Janus, den Wächter Roms, der zu beiden Seiten nach Gefahr Ausschau halten konnte. Als Teil des kaiserlichen Hofstaats war es unabdingbar, zwei Gesichter zur Schau zu stellen: einmal das des eifrigen Dieners, der stets bemüht ist, seinen politischen Herrn und alle im Rang über ihm Stehenden zufriedenzustellen; und dann das des ruchlosen, zu allem entschlossenen Intriganten. Seine wahren Gefühle konnte er nur in Gegenwart derjenigen Männer zum Ausdruck bringen, die er selbst zum Tode verurteilt hatte. Es bereitete ihm äußerste Genugtuung, sie seine Verachtung und seinen Zorn spüren zu lassen.
Nun schien es, als sei sein eigenes Ende gekommen. So viel Angst er auch vor seinem Tod hatte, so groß war auch seine Neugier herauszufinden, wer aus der zahlreichen Schar seiner Erzfeinde diesen Hinterhalt geplant hatte. Auf seiner Reise hatte es bereits zwei Anschläge auf sein Leben gegeben: einmal in einem Gasthof in Noricum, wo ein Streit über ein paar verschüttete Weinkrüge ausgebrochen war, der sich schnell in eine handfeste Schlägerei verwandelt hatte. Narcissus und seine Leibwächter hatten das Treiben aus einer Nische heraus beobachtet, als plötzlich ein Messer durch den Raum direkt auf ihn zugeschossen kam. Marcellus bemerkte es rechtzeitig und drückte den Kopf des kaiserlichen Sekretärs in letzter Sekunde in die Schüssel mit Eintopf, sodass sich die Klinge in den Holzbalken hinter ihm gebohrt hatte.
Und einmal war plötzlich eine Gruppe von Reitern auf der Straße hinter ihnen aufgetaucht, als sie gerade auf dem Weg zur Hafenstadt Gesoriacum gewesen waren. Sie waren kein Risiko eingegangen und hatten sofort die Flucht ergriffen. Die völlig verausgabten Tiere hatten gerade so den Hafen erreicht. Die Kais waren mit Gütern vollgestellt gewesen – Vorräte für Plautius’ Legionen, die nach Britannien verschifft werden sollten. Gleichzeitig wurden Gefangene von den von dort zurückgekehrten Schiffen entladen, die dann auf den Sklavenmärkten im ganzen Imperium verkauft wurden. Narcissus quartierte sich auf dem ersten Schiff in Richtung Britannien ein. Als der Frachter auslief und den chaotischen, geschäftigen Kai hinter sich ließ, hatte Marcellus leicht seinen Arm berührt und auf eine Gruppe von acht Männern gedeutet, die stumm ihre Abreise beobachtet hatten – ohne Zweifel dieselben Männer, die ihn auch jetzt verfolgten.
Narcissus sah sich erneut um und war entsetzt, wie schnell der Vorsprung zusammengeschmolzen war. Das Lager dagegen schien so weit entfernt wie zuvor.
»Sie holen auf!«, rief er seinen Leibwächtern zu. »Tut doch was!«
Marcellus warf seinem Prätorianerkameraden einen Blick zu, woraufhin beide Männer die Augen verdrehten.
»Was meinst du?«, rief Rufus. »Sollen wir lieber die eigene Haut retten?«
»Warum nicht? Ich will jedenfalls nicht für einen Griechen draufgehen.«
Sie beugten sich im Sattel vor und gaben ihren Pferden mit wilden Rufen die Fersen.
»Verlasst mich nicht!«, rief Narcissus panisch, als sie davonritten. »Lasst mich nicht zurück!«
Der kaiserliche Sekretär spornte ebenfalls sein Pferd an, sodass es langsam zu den anderen aufschloss. Der saure Gestank von Tierschweiß stach ihm in die Nase. Bei jeder Bewegung des Pferdes drohte er, auf den schnell unter ihm vorbeiziehenden Erdboden zu fallen. Narcissus knirschte vor Furcht mit den Zähnen; noch nie in seinem Leben hatte er so viel Angst gehabt. Er schwor sich, nie wieder ein Pferd zu besteigen. Von heute an würde er ausschließlich in der Sicherheit und Bequemlichkeit einer Sänfte reisen. Als er mit seinen Leibwächtern gleichzog, zwinkerte Marcellus ihm zu.
»So ist es schon besser, Herr … jetzt ist es nicht mehr weit!«
Die drei Männer ritten so schnell, dass ihnen der Wind um die Ohren pfiff, doch jedes Mal, wenn sie sich umwandten, schienen die Reiter näher gekommen zu sein. Kurz vor dem Lager ermatteten Verfolgte wie Verfolger gleichermaßen. Sie spürten, wie sich die Brustkörbe ihrer Pferde hoben und senkten wie gewaltige Blasebälge. Die Tiere schnappten nach Luft, und der halsbrecherische Galopp wurde zu einem müden Kanter, obwohl sich die Männer nach Kräften mühten, auch noch das Letzte aus ihren Pferden herauszuholen.
Als sie den nächsten Hügel erreicht hatten, sah Narcissus, dass sie nicht mehr als zwei Meilen vom rettenden Lager entfernt waren. Größere Soldatengruppen waren damit beschäftigt, auf dem offenen Feld vor dem Schutzwall zu arbeiten oder zu exerzieren. Man musste die anstürmenden Reiter doch inzwischen bemerkt, Alarm gegeben und einen Erkundungstrupp ausgesendet haben. Doch die drei Männer starrten auf eine ungestörte, schläfrige Szenerie hinab. Wieder trieben sie ihre erschöpften Pferde zur Eile an, währenddessen sich die Lücke zwischen ihnen und ihren Verfolgern immer weiter schloss.
»Ja, sind die denn blind?«, rief Rufus bitter aus und winkte wild mit dem Arm. »Hier drüben, ihr verschlafenen Ärsche! Hier sind wir!«
Die Straße führte eine sanfte Böschung zu einem Bach hinunter, der sich an einem uralten Eichenwäldchen entlangschlängelte. Die ruhige Wasseroberfläche wurde aufgewirbelt, als Narcissus und seine Leibwächter durch die Furt stürmten und tropfnass auf der anderen Seite herauskamen. Jetzt waren die feindlichen Reiter nur noch zweihundert Schritt entfernt. Ihre Beute galoppierte auf einem ausgetretenen Pfad an den Eichen vorbei. Tiefe Wagenspuren, in denen sich die Pferde leicht die Beine brechen konnten, zwangen sie an den Straßenrand. Narcissus spürte, wie das Ginstergestrüpp an seiner Reithose zerrte, und senkte den Kopf, um nicht gegen einen Ast zu stoßen. Sie hörten ein Platschen hinter sich – nun hatten auch ihre Verfolger den Bach erreicht.
»Wir sind fast da!«, rief Marcellus. »Nicht aufgeben!«
Dort, wo die Sonne durch das Laubdach drang, war der Pfad mit hellen Flecken gesprenkelt. Endlich hatten sie das Wäldchen hinter sich gelassen, und vor ihnen tauchte das schwere Lagertor auf, bei dessen Anblick Narcissus’ Herz höher schlug. Langsam glaubte er tatsächlich, dass sie mit heiler Haut davonkommen würden.
Die von Wasser und Schweiß tropfenden Pferde galoppierten ins Sonnenlicht.
»Ihr da!«, ertönte eine Stimme. »Stehen bleiben! Halt!«
Narcissus sah eine Gruppe von Männern, die sich im Schatten des Waldrandes ausruhten. Neben ihnen war frisch geschlagenes Holz gestapelt, und ein paar Maultiere grasten zufrieden. Die Männer hatten ihre Wurfspeere in Griffweite in den Boden gerammt, ihre Schilde hatten sie auf den gekrümmten Rand gestellt, um sie jederzeit aufnehmen zu können.
Marcellus riss heftig an den Zügeln. Sein Pferd wich den Brennholzsammlern nur knapp aus. Er holte tief Luft. »Zu den Waffen! Zu den Waffen!«, rief er.
Die Männer sprangen im Nu auf und ergriffen ihre Waffen, während die Reiter auf sie zugaloppierten. Der kommandierende Optio schritt ihnen entgegen, das Schwert wachsam erhoben.
»Für wen haltet ihr euch eigentlich, ihr Spinner?«
Die drei Reiter hielten erst an, als sie sich inmitten der Legionäre befanden. Marcellus stieg ab und deutete auf die Straße hinter sich.
»Sie sind hinter uns her! Ihr müsst sie aufhalten!«
»Wer ist hinter euch her?«, brummte der Optio verärgert. »Wovon redet ihr?«
»Wir werden verfolgt. Sie wollen uns umbringen.«
»Das ist doch Schwachsinn. Beruhige dich, Mann. Und dann raus mit der Sprache. Wer seid ihr?«
Marcellus zeigte mit dem Daumen auf Narcissus, der über den Sattel gebeugt nach Luft schnappte. »Ein Sonderbeauftragter des Kaisers. Wir wurden angegriffen. Unsere Eskorte wurde aufgerieben. Sie sind knapp hinter uns.«
»Wer denn?«, fragte der Optio erneut.
»Keine Ahnung«, erwiderte Marcellus. »Aber sie werden jeden Augenblick hier sein. Nehmt Gefechtsformation ein!«
Der Optio sah ihn zweifelnd an, dann befahl er seinen Männern, sich zu sammeln. Die meisten hatten sich bereits bewaffnet und formten schnell eine Gefechtslinie, Wurfspeer in der einen, Schild in der anderen Hand. Alle Augen waren auf den Waldrand gerichtet, wo die Straße aus dem Schatten über die Wiese zum Lager führte. Schweigend warteten sie auf das Auftauchen der Reiter, doch nichts geschah. Keine Hufschläge, keine Schlachtrufe – die Eichen standen still und stumm da, und auf der Straße, die in den Wald führte, regte sich nichts. Während die Legionäre und die drei Männer angespannt warteten, ertönte aus einem Baumwipfel das heisere Trillern einer Taube.
Der Optio wartete noch einen Augenblick ab, dann richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf die Fremden, die seine wohlverdiente Pause nach dem anstrengenden Holzschlagen unterbrochen hatten.
»Und?«
Narcissus wandte den Blick von der Straße ab und zuckte mit den Schultern. »Sie müssen sich zurückgezogen haben, sobald wir in Sicherheit waren.«
»Sofern sie überhaupt da waren.« Der Optio hob eine Augenbraue. »Also, hättet ihr jetzt die Güte, mir zu erzählen, was hier eigentlich los ist?«
KAPITEL 3
Der Bart steht dir nicht.«
Narcissus zuckte mit den Schultern. »Erfüllt aber seinen Zweck.«
»Wie war die Reise?«, erkundigte sich General Plautius höflich.
»Was? Abgesehen davon, dass ich einen Monat lang jede Nacht in einer flohverseuchten Herberge verbringen musste, abgesehen davon, dass ich diese unbeschreiblich grässliche Pampe zu mir nehmen musste, die hier bei den unteren Schichten als Essen durchgeht, und abgesehen davon, dass ich von einem Haufen gedungener Mörder bis zur Schwelle deines Lagers verfolgt wurde …«
»Ja. Abgesehen davon.« Der General grinste. »Wie war die Reise?«
»Eilig.« Narcissus nahm einen weiteren Schluck Zitronenwasser. Der Privatsekretär des Kaisers und der General saßen unter einem Sonnensegel, das auf einem kleinen Hügel neben den Zelten, die das Hauptquartier des Lagers bildeten, errichtet worden war. Auf dem kleinen Marmortisch zwischen ihren Stühlen standen einreichverzierter Wasserkrug und zwei Karaffen, die von einem Sklaven als Erfrischung gereicht worden waren. Narcissus hatte seine schweißgetränkte Reitkleidung gegen eine leichte Leinentunika getauscht. Trotzdem trieben die drückende Luft und die tief am nachmittäglichen Himmel stehende Sonne den Männern den Schweiß aus den Poren.
Das Lager breitete sich zu allen Seiten aus. Narcissus, der nur die wesentlich kleineren Lager der Prätorianer aus Rom kannte, war von dem Spektakel beeindruckt. Natürlich beobachtete er nicht zum ersten Mal, wie sich die in Britannien stationierten Truppen auf einen Feldzug vorbereiteten. Er war dabei gewesen, als die vier Legionen samt Hilfstruppen vor einem Jahr Caratacus’ Armee zerschmettert hatten.
Der Anblick der wohlgeordneten Zeltreihen stimmte ihn zuversichtlich. Jedes Zelt wies auf die Anwesenheit von acht Männern hin. Manche exerzierten im Lager, andere schärften ihre Schwerter oder kehrten gerade von Expeditionen ins Umland zurück, auf denen sie Getreidekörbe und Nutztiere beschlagnahmt hatten. Diese disziplinierte Ordnung ließ die unbezwingbare Macht Roms erahnen. Mit einer so gewaltigen, gut ausgebildeten Truppe war es nur schwer vorstellbar, dass der Plan des Kaisers, diese Insel und seine Stämme dem Imperium einzuverleiben, scheitern könnte.
Doch genau diese Vorstellung beschäftigte Narcissus und war auch der Grund, warum er in geheimer Mission die weite Reise von Rom zu diesem entlegenen Tamesisufer zurückgelegt hatte.
»Wie lange gedenkst du zu bleiben?«, fragte der General.
»Wie lange?« Narcissus wirkte belustigt. »Du hast noch nicht mal gefragt, warum ich überhaupt hier bin.«
»Nun, ich könnte mir vorstellen, dass du dich nach dem Fortschritt des Feldzugs erkundigen willst.«
»Das auch«, gab Narcissus zu. »Und, wie stehen die Dinge?«
»Das solltest du doch wissen. Oder hast du die Berichte nicht gelesen, die ich nach Rom geschickt habe?«
»Ach, die. Ja, sehr aufschlussreich und äußerst detailliert. Ein schöner Stil, wenn mir die Bemerkung gestattet ist. Erinnert mich irgendwie an Cäsars Commentarii. Es bedarf sicher eines scharfen Verstandes, um eine so große Streitmacht zu befehligen …«
Plautius kannte Narcissus lange genug, um immun gegen die einnehmenden Schmeicheleien zu sein, die dessen größtes Kapital darstellten. Außerdem war er ausreichend mit den feinen Nuancen in der Rede des kaiserlichen Hofstaats vertraut, um die unterschwellige Drohung in der letzten Bemerkung des kaiserlichen Sekretärs zu erkennen.
»Der Vergleich mit dem göttlichen Julius schmeichelt mir selbstverständlich zutiefst. Doch im Vergleich zu ihm hält sich mein Streben nach Macht in Grenzen.«
Narcissus lächelte. »Aber, aber, General. Ein Mann in deiner Stellung, mit einer so gewaltigen Streitmacht unter seinem Befehl hat doch sicher inzwischen einen gewissen Ehrgeiz entwickelt. Daran wäre nichts Ungewöhnliches oder gar Unwillkommenes. Rom schätzt den Ehrgeiz seiner Generäle.«
»Rom vielleicht. Aber der Kaiser? Das bezweifle ich.«
»Rom und der Kaiser sind eins«, sagte Narcissus sanft. »Eine gegenteilige Behauptung könnte in gewissen Kreisen … umstürzlerisch wirken.«
»Umstürzlerisch?« Plautius hob eine Augenbraue. »Das ist doch nicht dein Ernst! Stehen die Dinge in Rom so schlecht?«
Narcissus nahm einen weiteren tiefen Schluck und beobachtete den General eingehend über den Rand seines Wasserglases hinweg, bevor er es abstellte. »Plautius, die Lage ist ernster, als du es dir vorstellen kannst. Wie lange ist es her, seit du zum letzten Mal in Rom warst?«
»Vier Jahre. Ich vermisse die Stadt nicht. Damals hatte noch Gaius Caligula das Sagen. Wie man hört, hat sich unter Claudius doch einiges verbessert.«
Narcissus nickte. »Für die meisten jedenfalls, das stimmt. Das Problem ist, dass der Kaiser den falschen Leuten zu viel Vertrauen schenkt.«
»Anwesende ausgenommen, nehme ich an?«
»Natürlich.« Narcissus runzelte die Stirn. »Übrigens eine Bemerkung, die ich nicht besonders komisch finde. Ich habe dem Kaiser so treu gedient, wie es mir möglich ist. Zu behaupten, dass ich mein Leben seinem Erfolg gewidmet habe, wäre nicht übertrieben.«
»Nun, wie ich von meinen Freunden in Rom erfahren habe, hast du deinen Reichtum in den letzten Jahren beträchtlich vermehren können.«
»Und wenn schon? Was ist denn falsch daran, für seine treuen Dienste belohnt zu werden? Aber ich bin nicht gekommen, um über meine finanzielle Situation zu plaudern.«
»Ganz offensichtlich nicht.«
»Und ich möchte deine Freunde bitten, es sich zweimal zu überlegen, bevor sie erneut solche Bemerkungen in die Welt setzen. Gerüchte dieser Art werden von losen Zungen nur allzu gerne weitergetragen, wenn du verstehst. Betrachte das als eine … Warnung.«
»Ich werde sie es wissen lassen.«
»Sehr gut. Nun, wie gesagt, die Urteilskraft des Kaisers scheint in den letzten Monaten nachgelassen zu haben. Besonders, seit er ein Auge – und andere Körperteile – auf dieses kleine Flittchen Messalina geworfen hat.«
»Ich habe von ihr gehört.«
»Du solltest sie erst sehen.« Narcissus lächelte. »Wirklich. Es ist unbeschreiblich. Sobald sie den Raum betritt und ihre verruchten Augen auf die Männer wirft, schwänzeln sie wie die Welpen um sie herum. Das macht mich krank. Noch dazu ist Claudius noch nicht so alt, als dass ihm Jugend und Schönheit nicht mehr den Kopf verdrehen könnten. Oh, und schlau ist sie auch noch. Jupiter allein weiß, wie viele Liebhaber sie sich hält – und das direkt im Kaiserpalast. Claudius jedoch ist völlig besessen von ihr und kann sich nicht vorstellen, dass sie ihn hintergehen könnte.«
»Und, tut sie das?«
»Das weiß ich nicht. Nicht absichtlich, möchte ich meinen. Doch ihr ungebührliches Auftreten beschädigt den Ruf des Kaisers und lässt ihn wie einen Narren dastehen. Ob sie noch finsterere Pläne ausheckt … nun, dafür fehltmir bisher jeder Beweis. Ich habe nur Vermutungen. Und da wären auch noch die Liberatoren, diese Bastarde.«
»Ich dachte, mit denen hättest du letztes Jahr abgerechnet?«
»Nach der Meuterei in Gesoriacum konnten wir die meisten erledigen. Aber sie sind immer so noch zahlreich, dass sie letzten Sommer den Briten mehrere Waffenlieferungen zukommen lassen konnten. Meine Agenten haben Wind davon bekommen, dass sie etwas Großes planen. Doch die Liberatoren sind machtlos, solange sich die Prätorianer und die Legionen neutral verhalten.«
»Du willst dich also meiner Loyalität versichern?« Plautius sah Narcissus durchdringend an.
»Was dachtest du denn, warum ich gekommen bin? Noch dazu bei Nacht und Nebel?«
»Wird deine Abwesenheit nicht auffallen?«
»Offensichtlich hat jemand Wind von meinem Auftrag bekommen. Ich hoffe nur, dass sich diese Kunde nicht weiter herumspricht. Im Palast heißt es, dass ich mich auf Capri von einer Krankheit erhole. Ich hoffe sehr, wieder in Rom zu sein, bevor die Spione hier im Lager meine Anwesenheit bemerken.«
»Spione des Feindes in meinem Lager?« Plautius täuschte tiefe Betroffenheit vor. »Was denn noch? Spione des Kaisers?«
»Deine Ironie wird gebührend zur Kenntnis genommen, Plautius. Doch nimm es meinen Männern nicht übel. Sie sind hier, um dich zu beschützen und diejenigen auszukundschaften, die eine Bedrohung für den Kaiser darstellen.«
»Und wovor müsste ich wohl beschützt werden?«
Narcissus lächelte. »Vor dir selbst, mein lieber Plautius. Ihre Anwesenheit soll dich daran erinnern, dass die Augen und Ohren des kaiserlichen Palastes überall sind. Und dass unsere politisch bisher unauffälligen Befehlshaber ihre Zungen hüten und ihren Ehrgeiz im Zaum halten sollten.«
»Hältst du mich etwa für so ehrgeizig?«
»Ich weiß nicht.« Narcissus strich sich über den Bart. »Sollte ich das?«
Die beiden Männer starrten sich einen Augenblick lang stumm an. Dann sah General Plautius auf das Glas hinab, das er in den Fingern drehte. Narcissus lachte leise.
»Das dachte ich mir. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt. Wenn du dem Kaiser die Treue hältst – wieso bemühst du dich dann, ihm nach Kräften zu schaden?«
Mit einem lauten Knall stellte der General das leere Glas auf dem Tisch ab und verschränkte die Arme. »Ich weiß nicht, wovon du sprichst.«
»Lass es mich anders sagen – in möglicherweise weniger verfänglichen Worten: Warum setzt du dich nicht stärker für die Belange des Kaisers ein? Soweit ich sehen kann, hat deine Armee bisher kaum mehr fertiggebracht, als die Eroberungen des letzten Jahres zu halten. Der einzige nennenswerte Vorstoß geht auf das Konto von Legat Vespasian und seiner Zweiten Legion im Südwesten. Noch hast du Caratacus nicht gestellt und besiegt, obwohl deine Armee ihm weit überlegen ist und sich die Hälfte der Stämme dieser götterverlassenen Insel auf unsere Seite geschlagen hat. Ich kann mir wahrlich keine günstigeren Umstände vorstellen, um einen Vorstoß zu wagen, den Feind zu vernichten und diesem kostspieligen Feldzug ein Ende zu setzen.«
»Ah, um die Kosten geht es also.« General Plautius schnaubte verächtlich. »Nicht alles auf dieser Welt kann man in Geld bemessen.«
»Falsch!«, blaffte Narcissus, bevor der Patrizier ansetzen konnte, eine hochtrabende Rede über Roms Bestimmung und die Pflicht einer jeden Generation, die Grenzen des glorreichen Imperiums zu erweitern, zu schwingen. »Alles auf dieser Welt hat seinen Preis. Alles! Manchmal wird dieser Preis in Gold ausbezahlt. Manchmal in Blut, doch bezahlt wird er immer. Der Kaiser braucht einen Sieg in Britannien, um seine Position zu festigen. Und wenn es Rom das Leben vieler Tausende seiner besten Soldaten kostet. Das ist kein großer Verlust und leicht wieder auszugleichen. Neue Männer wird es immer geben – doch einen weiteren Kaiser zu verlieren, das können wir uns nicht leisten. Die Ermordung Caligulas hat das Imperium beinahe in die Knie gezwungen. Hätten die Prätorianer Claudius’ Anspruch auf den Titel nicht unterstützt, wäre ein neuer Bürgerkrieg ausgebrochen, und machtlüsterne Generäle hätten in ihrem Streben nach Ruhm die Legionen aufeinandergehetzt. Dann wäre Rom schon bald nur ein weiteres Kapitel in der Geschichte gefallener Mächte geworden. Welcher vernünftige Mann könnte der Welt ein solches Schicksal wünschen?«
»Sehr schön. Sehr treffend gesagt«, erwiderte Plautius. »Aber was hat das mit mir zu tun?«
Narcissus seufzte geduldig. »Dein langsamer Fortschritt kommt uns teuer zu stehen. Der Ruf des Kaisers leidet. Seit der letzten Feier anlässlich eines Sieges in Britannien ist über ein Jahr vergangen. Und doch erhalte ich ständig neue Forderungen nach weiteren Truppen, Waffen und Vorräten.«
»Wir müssen das Gebiet befrieden.«
»Nein. Man kann ein Gebiet erst befrieden, nachdem man den Feind besiegt hat. Du verbrauchst nur wertvolle Ressourcen. Diese Insel ist wie ein Schwamm. Andauernd saugt sie Männer, Geld und politische Macht in sich auf. Wie lange soll das noch so weitergehen, mein lieber General?«
»Wir machen Fortschritte. Das ist auch in meinen Berichten zu lesen. Langsam, aber sicher. Wir drängen Caratacus Meile um Meile zurück. Schon bald wird ihm nichts anderes mehr übrig bleiben, als sich uns zu stellen und zu kämpfen.«
»Und wann, General? In einem Monat? Einem Jahr? Oder noch später?«
»Es ist wohl eher eine Frage von Tagen.«
»Tage?« Narcissus sah ihn zweifelnd an. »Bitte erklär mir das.«
»Gerne. Caratacus und seine Armee haben nicht einmal zehn Meilen von hier ihr Lager aufgeschlagen.« Plautius deutete nach Westen. »Er weiß, dass wir hier sind und dass wir davon ausgehen, dass er sich zurückfallen lässt, sobald wir vorrücken. Nun, bei unserem nächsten Vorstoß wird er an mehreren Furten die Tamesis überqueren, uns umrunden und über diejenigen Stämme herfallen, die sich uns angeschlossen haben. Möglicherweise wird er sogar versuchen, einen so großen Vorsprung herauszuarbeiten, um die Vorratsspeicher von Londinium angreifen zu können. Ein guter Plan, wie ich finde.«
»In der Tat. Doch weshalb weißt du davon?«
»Einer von Caratacus’ Häuptlingen steht als Spion in meinen Diensten.«
»Wirklich? Das ist mir neu.«
»Manche Informationen sind zu heikel, um sie schriftlich festzuhalten«, sagte Plautus selbstgefällig. »Man weiß ja nie, in wessen Hände diese Berichte fallen. Darf ich fortfahren?«
»Bitte.«
»Caratacus weiß nicht, dass die Zweite Legion aus Calleva abgezogen wurde und nun die Furt bewacht. Er wird zwischen meinen Truppen und dem Fluss eingekeilt werden. Und diesmal gibt es keinen Ausweg für ihn. Er wird sich zum Kampf stellen müssen, und wir werden ihn vernichten. Erst dann, Narcissus, habt du und der Kaiser endlich euren Sieg in Britannien. Es werden nur ein paar Aufrührer im Gebirge im Westen und diese Wilden oben in Kaledonien übrig bleiben. Aber sie unter unsere Herrschaft zu zwingen, ist der Mühe nicht wert. Am besten wäre es, eine Verteidigungslinie zu errichten, um sie von der Provinz fernzuhalten.«
»Eine Verteidigungslinie? Was für eine Verteidigungslinie?«
»Ein Graben, eine Mauer, vielleicht ein Kanal.«
»Das klingt sehr kostspielig.«
»Ein Aufstand ist noch kostspieliger. Aber das können wir uns später in Ruhe überlegen. Zunächst müssen wir unsere ganze Aufmerksamkeit darauf richten, Caratacus zu besiegen und den Widerstand der Stämme zu brechen. Ich nehme an, dass du dir die Schlacht nicht entgehen lassen willst?«
»Ganz recht. Ich freue mich schon darauf. Fast so sehr, wie ich mich darauf freue, das Ganze dann dem Kaiser zu berichten. Diese Angelegenheit wird dir zu großem Ruhm verhelfen, Plautius. Uns allen.«
»Darf ich darauf einen Trinkspruch ausbringen?« Plautius füllte beide Gläser und hob sein eigenes. »Auf die Niederlage der Feinde des Kaisers und auf … auf einen glorreichen Sieg über die Barbaren!«
»Auf den Sieg!« Lächelnd leerte Narcissus sein Glas.
KAPITEL 4
Die Centurionen der Zweiten Legion saßen auf mehreren Stuhlreihen im Feldherrenzelt und warteten auf die Ansprache des Legaten. Sie hatten einen ganzen langen Tag damit verbracht, die Legion auf den Gewaltmarsch vorzubereiten, mit dem der Vorstoß früh am nächsten Morgen beginnen sollte. Wohin genau die Armee vorrücken würde, wusste allein Legat Vespasian, der sich jedoch selbst vor seinen engsten Beratern bedeckt hielt. Die Sonne war gerade untergegangen, die Luft erfüllt von Mückenschwärmen. Sie sammelten sich um den flackernden gelben Schein der Öllampen, und ab und an knisterte es, wenn ein Insekt törichterweise den Flammen zu nahe kam. Am Kopfende des Zelts hing in einem Holzrahmen eine große Lederkarte, die einen Ausschnitt der Tamesis zeigte.
In der vierten Reihe saßen die Centurionen der Dritten Kohorte. Ganz außen hatte sich ein großer junger Mann dazugequetscht, der inmitten der faltigen, wettergegerbten Veteranengesichter äußerst fehl am Platze wirkte. Tatsächlich wirkte er fast zu jung, um überhaupt Militärdienst verrichten zu dürfen. Unter dem dunklen, lockigen Haar blitzten dunkle Augen aus einem schmalen Gesicht. Seine schmächtige Gestalt zeichnete sich selbst unter der Tunika, dem Kettenhemd und dem Harnisch deutlich ab. Seine nackten Arme waren dünn und sehnig, jedoch kaum muskulös zu nennen. Trotz der Uniform und den blitzblank polierten Orden an seinem Brustpanzer sah er wie ein Junge aus, und die nervösen Blicke, die er durch den Raum warf, offenbarten seinen Mangel an Selbstsicherheit.
»Cato! Verflucht noch eins, hör auf zu zappeln!«, knurrte der Centurio neben ihm. »Du führst dich ja auf wie von der Tarantel gestochen.«
»Tut mir leid, liegt wohl an der Hitze. Die bekommt mir nicht.«
»Tja, da bist du nicht der Einzige. Ich weiß nicht, was mit dieser verdammten Insel los ist. Entweder es regnet in Strömen oder es ist unerträglich heiß. Ich wünschte, das Wetter würde sich mal entscheiden. Wenn du mich fragst, hätten wir diesen trostlosen Steinhaufen gar nicht erst betreten sollen. Bei den Göttern, warum sind wir überhaupt hier?«
»Macro, wir sind hier, weil wir nun mal hier sind.« Sein Kamerad grinste ihn an. »Hast du mir nicht gesagt, dass das immer die Antwort auf solche Fragen ist?«
Macro spuckte auf den Boden zwischen seinen Stiefeln. »Da will man einmal mit Rat und Tat zur Seite stehen, und schon wird man schwach angeredet. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe?«
Cato musste ein weiteres Mal lächeln. Vor wenigen Monaten war er noch Optio gewesen, der zweite Kommandierende in Macros Centurie. So gut wie alles, was er in den letzten zwei Jahren über die römische Armee gelernt hatte, war ihm von Macro beigebracht worden. Und vor zehn Tagen hatte er schließlich selbst den Befehl über eine Centurie übernommen. Seitdem litt er schwer unter der drückenden Last der Verantwortung, die dieser neue Posten mit sich brachte, und bemühte sich, vor den achtzig Männern seiner Centurie so hart und humorlos wie möglich zu erscheinen. Wobei er im Stillen betete, dass seine Aufregung und Ängstlichkeit unter dieser Maske nicht sichtbar waren. Andernfalls würde er alle Autorität verlieren, und diesen Augenblick fürchtete Cato mehr als alles andere. Und dabei hatte er nur wenig Zeit, die Loyalität seiner Männer zu gewinnen – keine leichte Aufgabe, da er kaum die Namen und noch weniger den Charakter der Männer unter seinem Kommando kannte. Er hatte sie härter exerzieren lassen als die meisten anderen Centurionen, obgleich ihm bewusst war, dass sie ihn erst dann als ihren Befehlshaber anerkennen würden, wenn er sich in der Schlacht bewährte.
ENDE DER LESEPROBE