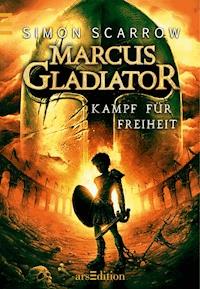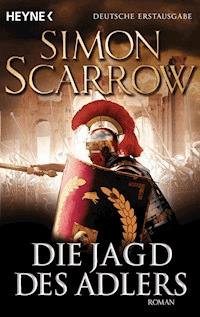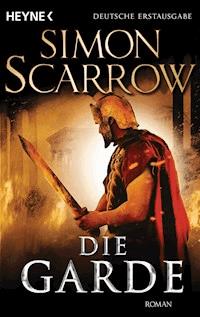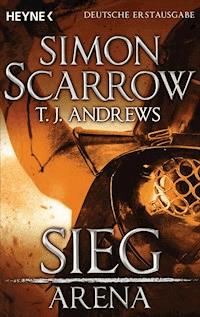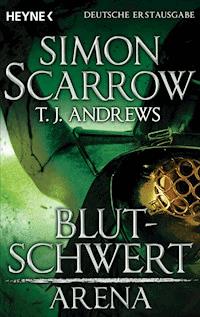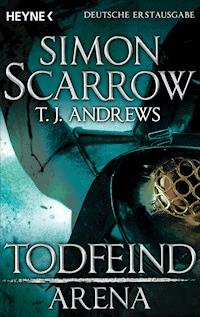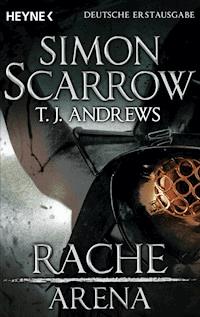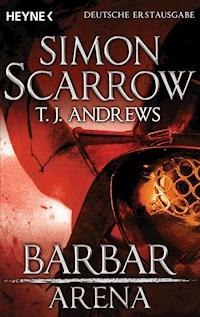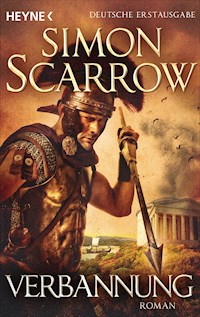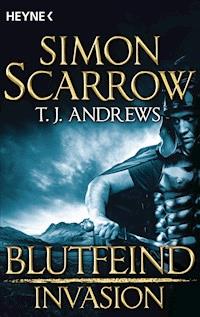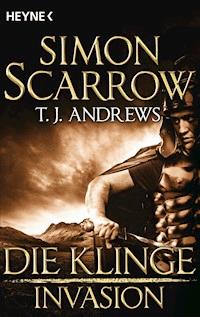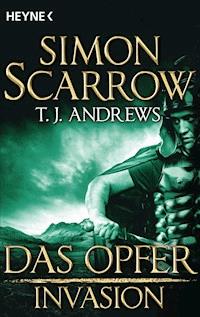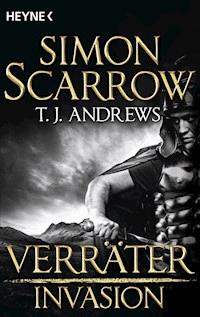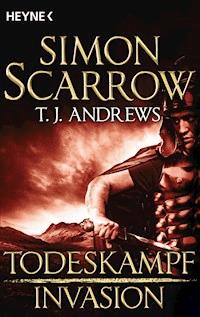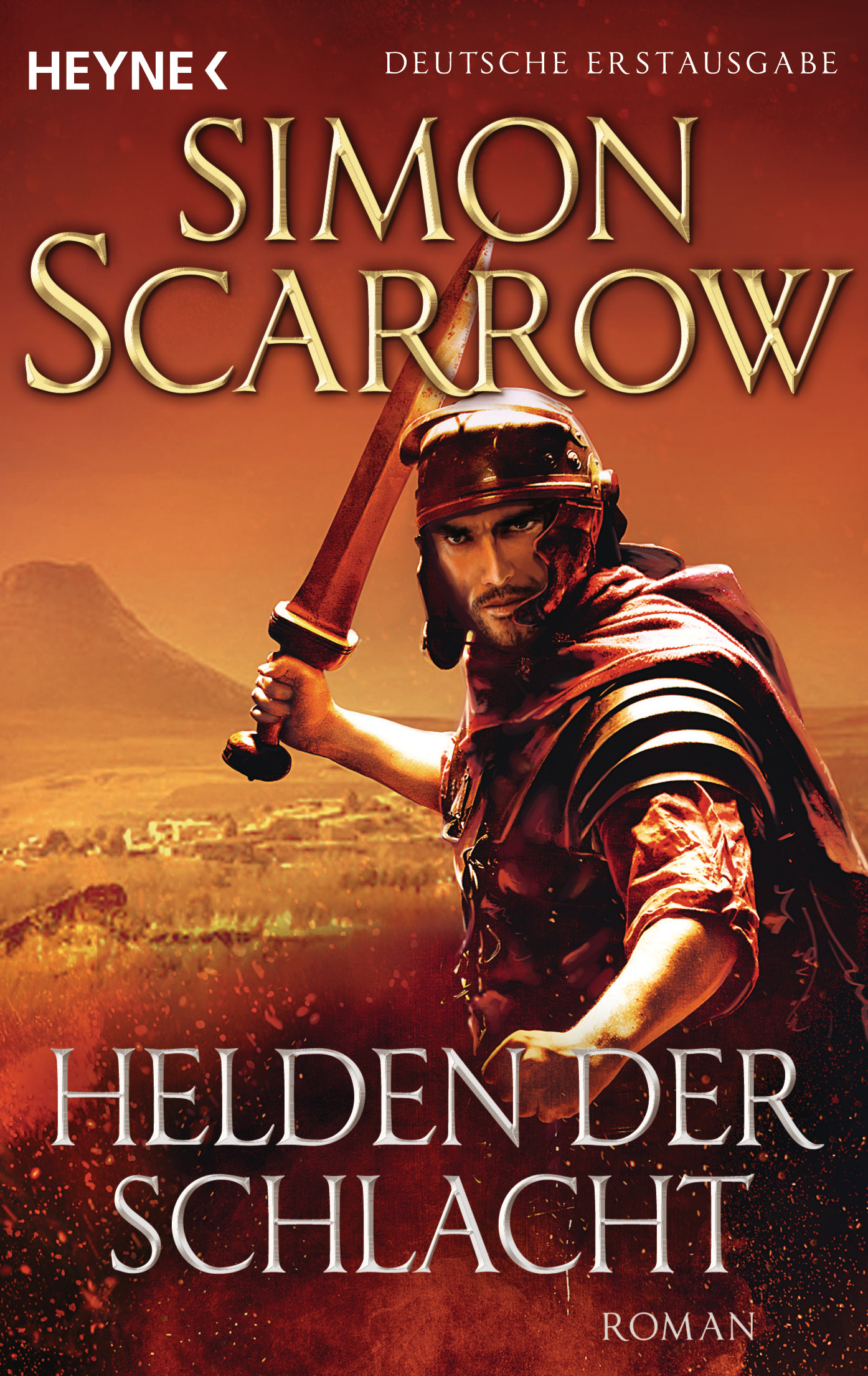9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rom-Serie
- Sprache: Deutsch
Sie werden kämpfen – und sie werden siegen!
Rom, A. D. 45: Die Centurionen Macro und Cato erhalten einen gefährlichen Auftrag. Geheime Schriftrollen, die über die Zukunft Roms entscheiden, sind in die Hände von Piraten geraten. Mit der römischen Flotte begeben sie sich auf die Jagd. Die erste Begegnung mit den Piraten jedoch gerät zum Desaster. Macro und Cato werden für die Niederlage verantwortlich gemacht. Um ihre Ehre zu retten, gibt es nur einen Weg: Sie müssen das Hauptquartier der Piraten ausfindig machen und sich in die Höhle des Löwen begeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 706
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Simon Scarrow
DIEPROPHEZEIUNG DESADLERS
Roman
Aus dem Englischen
von Barbara Ostrop
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe THEEAGLE’S PROPHECY erschien 2005 bei Headline Publishing Group, London
Vollständige deutsche Erstausgabe 10/2013
Copyright © 2005 by Simon Scarrow
Copyright © 2013 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Werner Bauer
Umschlagillustration: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Motivs von © thinkstock
Datenkonvertierung E-Book: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-10295-1
www.heyne.de
Dieses Buch ist meinem Freund und Nachbarn Lawrence Coulton gewidmet, der als Pilot der Royal Air Force bei einem Flugunfall ums Leben kam, als ich gerade in der Endphase des Schreibens war.
Lawrence war einer dieser seltenen Menschen, deren Lebensfreude einfach ansteckend ist.
Seine Gesellschaft war ein großes Vergnügen für jeden, der das Privileg hatte, ihn zu kennen.
EINE KURZE EINFÜHRUNG ZUR RÖMISCHEN MARINE
Die Römer befassten sich relativ spät mit der Seekriegsführung, und erst in der Regierungszeit von Kaiser Augustus (27 v.Chr. – 14 n.Chr.) wurde eine stehende Flotte aufgestellt. Die Marine war in zwei Hauptflotten mit Stützpunkten in Misenum und Ravenna unterteilt (wo ein großer Teil dieses Romans spielt).
Jede Flotte wurde von einem Präfekten befehligt. Vorherige Erfahrung in den Seestreitkräften war nicht erforderlich, denn die Tätigkeit umfasste vor allem administrative Funktionen.
Unterhalb des Rangs des Präfekten ist der große Einfluss der griechischen Marine auf die Flotte des Imperiums unübersehbar. Die Flottillenkommandanten hießen Navarchen und befehligten zehn Schiffe. Die Navarchen bekleideten zur See einen dem Centurionat entsprechenden Rang. Auf Wunsch konnten sie sich als Centurio in die Legion versetzen lassen. Der ranghöchste Navarch der Flotte trug den Namen Navarchus Princeps und entsprach dem Obercenturio einer Legion. Auf Nachfrage stand er dem Präfekten mit seinem fachmännischen Rat zur Seite.
Die Schiffe wurden von Trierarchen befehligt. Wie die Navarchen stiegen auch sie aus den Mannschaftsdienstgraden auf und hatten das Kommando über das jeweilige Schiff. Ihre Rolle entsprach jedoch nicht der eines modernen Kapitäns zur See. Der Trierarch hatte zwar im seemännischen Sinne die Befehlsgewalt über das Schiff, doch in der Schlacht lag die Entscheidungsgewalt bei dem Offizier, dem die Marineinfanteristen des Schiffs unterstanden. Daher habe ich im Roman die griechischen Rangbezeichnungen verwendet, statt auf ein in die Irre führendes englisches Äquivalent auszuweichen.
Unter den Kampfschifftypen stellte die Trireme das »Arbeitspferd« der Flotten dar. Triremen maßen etwa fünfunddreißig Meter in der Länge und sechs Meter an der breitesten Stelle. Jede hatte eine Besatzung von hundertfünfzig Ruderern und Matrosen sowie einer Centurie Marineinfanteristen. Es gab noch andere Fahrzeugklassen, die entsprechend größer (Quinquiremen) oder kleiner (Biremen und Liburnen) waren, doch alle hatten ähnliche Eigenschaften und waren vor allem für schnelle Manöver in der Schlacht geeignet. Daher lagen sie leicht im Wasser, waren nicht sonderlich seetüchtig und geradezu grauenhaft unbequem, wenn die Reise länger als ein paar Tage dauerte.
KAPITEL 1
Die drei Schiffe hoben sich, als die sanfte Woge unter ihrem Kiel hindurchging. Vom hohen Steuerdeck des Handelsschiffs war der Hafen von Ravenna für einen Augenblick zu sehen, bevor das Fahrzeug ins Wellental sank. Das Handelsschiff wurde mit Enterhaken, die am anderen Ende an stabilen Pfosten festgemacht waren, zwischen zwei schlanken Liburnen festgehalten. Die Piraten an Bord der Liburnen hatten die Riemen eingezogen und hastig die Großsegel eingeholt, bevor sie das Handelsschiff geentert hatten. Der Überfall war in einen harten, blutigen Kampf ausgeartet.
Der Beweis für die Wut der Angreifer war an Deck zu sehen: Auf den glatten, abgenutzten Planken lagen die niedergehauenen Matrosen in dunklen Blutlachen. Zwischen ihnen fanden sich die Leichen von mehr als zwanzig Piraten, und der Kapitän der größeren Liburne blickte mit finsterer Miene vom Steuerdeck auf die Szene hinunter. Sie hatten beim Kampf um das Schiff zu viele Leute verloren. Normalerweise verängstigte die brüllende Horde bewaffneter Männer, die von den Seiten her das Schiff enterten, die Opfer so sehr, dass sie ihre Waffen fallen ließen und sich sofort ergaben. Doch nicht dieses Mal.
Die Besatzung des Handelsschiffs war den Piraten unmittelbar an der Reling entgegengetreten und hatte sie mit einer grimmigen Entschlossenheit abgewehrt, die der Piratenkapitän bisher noch nie erlebt hatte – jedenfalls nicht in dem steten Strom von Kauffahrern, auf die er und seine Männer in den letzten Monaten Jagd gemacht hatten. Mit spitzen Gegenständen, Bootshaken, Belegnägeln und einigen wenigen Schwertern bewaffnet, hatten die Verteidiger so lange wie möglich die Stellung gehalten, bis sie von der überlegenen Zahl besser gerüsteter Männer zurückgedrängt worden waren.
Insbesondere vier von ihnen waren dem Piratenkapitän ins Auge gefallen: große, kräftige, mit Kurzschwertern bewaffnete Männer in braunen Tuniken. Sie hatten am Fuß des Masts Rücken an Rücken bis zum Ende gekämpft und ein Dutzend Piraten getötet, bevor sie überwältigt und niedergehauen worden waren. Der Kapitän selbst hatte den letzten von ihnen erschlagen, aber zuvor hatte der Mann ihm noch einen Hieb in den Oberschenkel versetzt – eine Fleischwunde, die inzwischen gut verbunden war, aber immer noch schmerzhaft pochte.
Der Piratenkapitän stieg aufs Hauptdeck hinunter. Er blieb beim Mast stehen, stieß einen der vier Männer mit dem Fuß an und wälzte die Leiche auf den Rücken. Der Mann hatte den Körperbau eines Soldaten und war von mehreren Narben gezeichnet. Genau wie die anderen drei. Vielleicht erklärte das ihr Geschick im Schwertkampf. Er stand auf, blickte aber immer noch auf den toten Römer hinunter. Dann war der also ein Legionär, genau wie seine Gefährten.
Der Kapitän runzelte die Stirn. Was taten Legionäre auf einem Handelsschiff? Und nicht einfach nur irgendwelche Legionäre: Das hier waren handverlesene Männer – die besten. Wohl kaum zufällige Passagiere, die auf Urlaub aus dem Osten zurückgekehrt waren. Zweifellos hatten sie die Verteidigung des Handelsschiffs organisiert und geleitet. Und sie hatten bis zum letzten Blutstropfen gekämpft, ohne auch nur daran zu denken, sich zu ergeben. Es war wirklich eine Schande, überlegte der Kapitän. Er hätte ihnen gern die Chance geboten, sich seiner Besatzung anzuschließen. Manche Männer taten das. Die übrigen wurden an Sklavenhändler verkauft, die nicht fragten, wo die Ware herkam, und die klug genug waren, dafür zu sorgen, dass sie am anderen Ende des Imperiums auf den Markt gebracht wurden. Nicht nur als Verstärkung seiner Mannschaft wären die Männer wertvoll gewesen, sondern auch als Sklaven – wenn man ihnen erst einmal die Zunge herausgeschnitten hätte. Ein Mann würde sich wohl kaum über die Ungerechtigkeit seiner Versklavung beschweren können, wenn er nicht mehr sprechen konnte … Aber die Soldaten waren nun einmal tot. Sie waren mit Absicht gestorben, entschied der Kapitän. Es sei denn, sie hätten geschworen, etwas zu beschützen, oder jemanden …
Was also hatten sie auf dem Schiff getan?
Der Piratenkapitän rieb über den Verband seiner Wunde und blickte sich an Deck um. Seine Männer hatten die Luken des Frachtraums aufgeworfen und trugen die kostbarer wirkenden Teile der Fracht an Deck, wo ihre Kameraden die Kisten und Kästen aufrissen und den Inhalt nach Wertvollem durchwühlten. Weitere Männer befanden sich unter Deck und durchforsteten das Gepäck der Passagiere, und von unten drangen dumpfe Schläge und splitterndes Krachen herauf.
Der Kapitän trat über die Leichen am Fuß des Masts hinweg und suchte sich einen Weg nach vorn. Am Bug drängten sich die Überlebenden des Überfalls: eine Handvoll Matrosen, überwiegend verwundet, und mehrere Passagiere. Sie beobachteten ihn beim Näherkommen misstrauisch. Er hätte beinahe gelächelt, als er sah, wie einer der Matrosen versuchte, sich zitternd zu verkriechen. Der Kapitän zwang sich, weiter ausdruckslos zu schauen. Unter dunklem, verfilztem Haar und einer kräftigen Stirn blickten stechende schwarze Augen hervor. Seine gebrochene Nase war schief zusammengewachsen, und unregelmäßiges, weißes Narbengewebe bedeckte sein Kinn, seine Lippen und seine Wange. Dieses Äußere hatte eine wundervolle Wirkung auf alle, die ihn erblickten, aber die Verletzungen erzählten gar nicht von seiner lebenslangen Erfahrung als Pirat. Er trug die Narben vielmehr schon seit seiner frühen Kindheit, als seine Eltern ihn in den Elendsvierteln von Piräus ausgesetzt hatten, und er hatte längst vergessen, was damals zu diesen schrecklichen Wunden geführt hatte. Die Passagiere und die Besatzung des Handelsschiffs wichen vor dem Piraten zurück, als er eine Schwertlänge vor ihnen stehen blieb und die dunklen Augen über sie wandern ließ.
»Ich bin Telemachos, der Anführer dieser Piraten«, sagte er auf Griechisch zu den verängstigten Matrosen. »Wo ist euer Kapitän?«
Es kam keine Antwort, er hörte nur das nervöse Atmen von Männern, denen ein grausames Schicksal unmittelbar bevorstand. Ohne sie auch nur einen Moment aus den Augen zu lassen, fuhr die Hand des Piratenkapitäns nach unten, und er zog langsam sein Falcataschwert.
»Ich hatte nach dem Kapitän gefragt …«
»Bitte, Herr!«, unterbrach ihn eine Stimme. Der Blick des Piraten glitt zu dem Mann, der es so eilig gehabt hatte, sich vor ihm zu verkriechen. Jetzt hob der Matrose den Arm und zeigte mit bebendem Finger über das Deck. »Der Kapitän liegt dort drüben … Er ist tot … Ich habe gesehen, wie du ihn getötet hast, Herr.«
»Wirklich?« Die dicken Lippen des Piraten verzogen sich zu einem Lächeln. »Welcher ist es?«
»Dort, Herr. Bei der Achterluke. Der Dicke dort.«
Der Piratenkapitän blickte sich um, und seine Augen fanden den rundlichen Körper eines kleinen Mannes, der lang ausgestreckt auf dem Deck lag. Jetzt war er noch einen Kopf kleiner. Letzterer war nirgends zu sehen, und Telemachos runzelte kurz die Stirn, bis ihm wieder einfiel, was vorhin direkt nach dem Entern geschehen war. Vor ihm hatte ein Mann, der Kapitän des Handelsschiffs, schreiend kehrtgemacht, um davonzurennen. Die schimmernde Klinge des Falcata war im Bogen durch die Luft gepfiffen, hatte den fleischigen Hals in einer nahezu gleitenden Bewegung durchschnitten, und der Kopf des Kapitäns war hochgesprungen und über Bord gegangen.
»Ja … ich erinnere mich.« Das Lächeln des Piraten verbreiterte sich zu einem zufriedenen Grinsen. »Wer ist dann also der Erste Offizier?«
Der Matrose, der bisher gesprochen hatte, wandte sich halb zur Seite und nickte schwach zu einem großen Nubier hinüber, der neben ihm stand.
»Du?« Der Pirat zeigte mit der Schwertspitze auf ihn.
Der Nubier warf seinem Schiffskameraden einen vernichtenden Blick der Verachtung zu und nickte dann.
»Tritt vor.«
Der Erste Offizier kam widerstrebend nach vorn und blickte den Piraten argwöhnisch an. Telemachos stellte erfreut fest, dass der Nubier den Mut hatte, seinem Blick zu begegnen. Dann gab es unter den Überlebenden also wenigstens einen Mann. Der Pirat zeigte nach hinten auf die Leichen am Fuß des Masts.
»Diese Männer – die kampfstarken Drecksäcke, die so viele von meinen Leuten umgebracht haben – wer waren sie?
»Leibwächter, Herr.«
»Leibwächter?«
Der Nubier nickte. »Sie sind in Rhodos an Bord gegangen.«
»Aha. Und wen haben sie bewacht?«
»Einen Römer, Herr.«
Telemachos blickte über die Schulter des Nubiers auf die anderen Gefangenen. »Wo ist er?«
Der Nubier zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung, Herr. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit Ihr das Schiff geentert habt. Vielleicht ist er über Bord gegangen, Herr.«
»Nubier …« Der Kapitän beugte sich vor und sprach in einem eiskalten, drohenden Tonfall. »Ich bin doch nicht von gestern. Zeig mir jetzt sofort diesen Römer, oder ich zeige dir, wie dein Herz aussieht … Wo ist er?«
»Hier«, rief eine Stimme aus dem Hintergrund des Haufens von Gefangenen. Jemand schob sich vor, ein hochgewachsener, schlanker Mann mit den unverkennbaren Gesichtszügen seines Volks: dunkles Haar, olivbraune Haut und der herablassende Blick, mit dem die Römer typischerweise dem Rest der Welt begegneten. Er trug eine schlichte Tunika und versuchte zweifellos, sich damit als einer der billig reisenden Passagiere auszugeben, die die gesamte Fahrt an Deck verbrachten. Aber der Mann konnte seine Eitelkeit nicht verbergen, und noch immer schmückte ein teurer Ring den kleinen Finger seiner rechten Hand. Der in ein Goldband eingelassene, große Rubin fiel dem Kapitän sofort ins Auge.
»Du solltest beten, dass der leicht abgeht …«
Der Römer blickte nach unten. »Der hier? Der ist schon seit Generationen in meiner Familie. Mein Vater hat ihn vor mir getragen, und mein Sohn wird ihn nach mir tragen.«
»Sei dir da nicht so sicher.« Belustigung zuckte über die zernarbten Züge des Kapitäns. »Und nun, wer bist du? Jeder, der in Begleitung von vier solchen Schränken von Männern reist, muss Einfluss besitzen … und Reichtum.«
Jetzt war der Römer mit Lächeln an der Reihe. »Mehr, als du dir vorstellen kannst.«
»Das bezweifle ich. Ich habe eine ziemlich gute Vorstellungskraft, wenn es um Reichtum geht. Jetzt aber, sosehr ich auch die seltene Gelegenheit genieße, mich mit einem kultivierten Mann zu unterhalten, haben wir dazu leider keine Zeit. Es könnte sein, dass einer der Beobachtungsposten in Ravenna unsere kleine seemännische Aktion bemerkt und den Kommandanten der dortigen Marine benachrichtigt hat. So gut meine Schiffe auch sind, bezweifle ich doch, dass sie gegen ein kaiserliches Geschwader ankämen. Also, wer bist du, Römer? Ich frage zum letzten Mal.«
»Wohlan. Caius Caelius Secundus, zu deinen Diensten.« Er neigte den Kopf.
»Nun, das ist ein schöner, vornehm klingender Name. Da wird deine Familie wohl auch ein anständiges Lösegeld blechen können?«
»Natürlich. Nenne einen Preis – einen vernünftigen Preis. Man wird ihn bezahlen, und dann kannst du mich und mein Gepäck an Land absetzen.«
»So ohne Weiteres?« Der Kapitän lächelte. »Darüber muss ich nachdenken …«
»Kapitän! Kapitän!«
Achtern entstand Unruhe, als ein Pirat aus einer Luke gestürmt kam, die vom Passagierbereich heraufführte. Er trug etwas, das in ein schlichtes Baumwolltuch eingeschlagen war. Er hob es hoch.
»Kapitän, schau nur! Schau dir das an!«
AllewandtensichdemzumBugrennendenMannzu,dernunaufdieKniefiel,dasBündelvorsichtigniederlegteunddieStofffaltenzurSeiteschlug.DarunterkameinekleineTruhezumVorschein,dieauseinemglattendunklen,fastschwarzenHolzgefertigtwar.AnihremSchimmererkannteman,dasssieschonaltwarundvieleHändesieliebkosthatten.DasHolzwardurchGoldbänderverstärkt.WodieBändersichkreuzten,warenkleineKameenausOnyxindasGoldeingelassen,AbbilderdermächtigstengriechischenGottheiten.EinkleinesSilberschildaufdem Deckel trug die Aufschrift: »M. Antonius hic fecit.«
»Marcus Antonius?« Einen Augenblick lang verlor sich der Piratenkapitän in Bewunderung für den schönen Gegenstand, dann aber meldete sich sein Geschäftsgeist, er schätzte den Wert und blickte den Römer an.
»Deines?«
Das Gesicht von Caius Caelius Secundus war ausdruckslos.
»Nun gut, also nicht deines … aber in deinem Besitz. Ein kleines Meisterwerk. Es muss ein Vermögen wert sein.«
»Das ist es«, räumte der Römer ein. »Und du kannst es haben.«
»Oh … kann ich das?«, gab Telemachos mit feiner Ironie zurück. »Das ist aber sehr freundlich von dir. Ich werde die Gabe wohl annehmen.«
Der Römer neigte huldvoll den Kopf. »Gestatte mir nur, den Inhalt zu behalten.«
Der Kapitän sah ihn scharf an. »Den Inhalt?«
»Ein paar Bücher. Etwas, das ich lesen kann, während für das Lösegeld gesorgt wird.«
»Bücher? Was für Bücher würde man wohl in einem solchen Behältnis aufbewahren?«
»Einfach nur Chroniken«, erklärte der Römer rasch. »Nichts, was dich interessieren könnte.«
»Das lass mich mal selbst beurteilen«, gab der Kapitän zurück und beugte sich vor, um die Truhe genauer in Augenschein zu nehmen.
Vorne befand sich ein kleines Schlüsselloch, und die Truhe war so raffiniert gearbeitet, dass nur eine ganz feine Linie erkennen ließ, wo der Deckel auf dem unteren Teil des Kastens auflag. Der Kapitän blickte auf.
»Gib mir den Schlüssel.«
»D-den habe ich nicht.«
»Keine Spielchen, Römer. Ich will den Schlüssel, und zwar sofort. Oder wir verfüttern dich gleich scheibchenweise an die Fische.«
EinenAugenblicklangerwidertederRömernichtsundregtesichnicht.Dannblitzteetwasglitzerndauf,undderArmdesKapitänsschwanghoch.DieSpitzeseinesSchwertsverharrteeinenFingerbreitvorderKehledesRömers,soruhigundfest,alshättesiesichniebewegt.DerRömerzucktezurück,undjetztließerendlichseineAngsterkennen.
»Den Schlüssel …«, sagte Telemachos leise.
Secundus ergriff den Ring mit den Fingern seiner anderen Hand und mühte sich, ihn abzuziehen. Er saß fest, und seine manikürten Fingernägel rissen die Haut auf, als er versuchte, ihn zu lösen. Schließlich riss er den Ring, den das Blut inzwischen gleitfähiger machte, mit einem angestrengten, schmerzerfüllten Stöhnen ab. Er zögerte einen Augenblick und hielt ihn dann dem Piratenkapitän hin. Seine geballte Faust öffnete sich langsam und gab das auf seiner Handfläche liegende Goldband frei. Nur, dass es sich nicht um einen einfachen Ring handelte. Auf der Unterseite ragte parallel zum Finger ein schmaler, fein gearbeiteter Schaft hervor. Dessen Spitze wies eine verzierte Vorrichtung auf.
»Da.« Die Schultern des Römers sackten besiegt nach unten. Der Piratenkapitän ergriff den Ring und führte den Schaft zum Schloss. Der Schlüssel ließ sich nur auf eine einzige Art einführen, und er mühte sich eine Weile, bevor es ihm gelang, den richtigen Winkel zu finden. Unterdessen drängte sich der Rest der Besatzung um ihn, um zu sehen, was vor sich ging. Der Schlüssel fand ins Schloss, und der Kapitän drehte ihn herum. Es klickte leise, und der Deckel ging ein winziges Stück auf. Mit gierigen Fingern klappte Telemachos den Deckel ganz auf, sodass man den Inhalt sah.
Er runzelte die Stirn. »Schriftrollen?«
In der kleinen Truhe lagen drei große Schriftrollen mit Griffstäben aus Elfenbein, die in weichen Lederhüllen steckten. Die Schutzmäntel waren so verblasst und fleckig, dass der Kapitän die Bücher für antiquiert hielt. Er sah sie enttäuscht an. Eine Truhe wie diese hätte einen Schatz an Edelsteinen oder Goldmünzen bergen sollen. Nicht Bücher. Warum nur, bei allen Göttern, reiste jemand mit einer derart wundervollen Truhe, beförderte darin aber nur ein paar vergilbte Schriftrollen?
»Wie schon gesagt«, der Römer zwang sich zu einem Lächeln. »Einfach nur Schriftrollen.«
Der Piratenkapitän warf ihm einen schlauen Blick zu. »Einfach nur Schriftrollen? Das glaube ich nicht.«
Er stand auf und wandte sich zu seiner Besatzung um. »Schafft diese Truhe und den Rest der Beute auf unsere Schiffe! Los!«
Die Piraten machten sich sofort an die Arbeit und verluden hastig die wertvollsten Teile der Fracht auf die Decks der beiden längsseits festgemachten Liburnen. Der größte Teil der Waren bestand aus Marmor; wertvoll, aber zu schwer, um ihn auf die Piratenschiffe zu verladen. Er hatte allerdings auch einen unmittelbaren Nutzen, dachte der Piratenkapitän lächelnd. Wenn die Zeit gekommen war, würde dieser Ballast das Schiff sofort zum Meeresgrund hinunterziehen.
»Was hast du mit uns vor?«, fragte Secundus.
Der Piratenkapitän wandte den Blick von seinen Männern, die er beaufsichtigt hatte, und sah, dass die gefangenen Matrosen ihn genau beobachteten und sich kaum bemühten, ihre Angst zu verbergen.
Telemachos kratzte sich die Bartstoppeln. »Ich habe heute einige gute Männer verloren. Zu viele gute Männer. Ich werde mich mit einigen von euch behelfen.«
Der Römer grinste höhnisch. »Was, wenn wir uns euch nicht anschließen?«
»Wir?« Der Kapitän lächelte ihn langsam an. »Ich brauche keinen verwöhnten römischen Aristokraten. Du wirst zum Rest gehören, zu denen, die nicht mitkommen.«
»Verstehe.« Der Römer spähte zum Horizont mit dem fernen Leuchtturm von Ravenna und schätzte die Entfernung ein.
Der Kapitän lachte plötzlich auf und schüttelte den Kopf. »Nein, du verstehst gar nichts. Von eurer Marine wird keine Hilfe kommen. Du und die anderen, ihr werdet längst tot sein, bevor ein Schiff hier draußen sein könnte. Außerdem wird nichts mehr hier sein, was sie finden könnten. Ihr und dieses Schiff hier, ihr werdet gemeinsam untergehen.«
Telemachos wartete nicht auf eine Antwort, sondern wandte sich rasch ab, entfernte sich quer übers Deck und schwang sich geübt und gewandt zum Deck seines eigenen Fahrzeugs hinunter. Die Truhe erwartete ihn bereits am Fuß des Masts, aber er schenkte ihr nur einen kurzen, begehrlichen Blick, blieb dann stehen und erteilte seine Befehle.
»Hector!«
Der ergraute Kopf eines stämmigen Riesen ragte über der Reling des Handelsschiffs auf. »Ja, Herr?«
»Bereitet das Abbrennen des Schiffs vor. Aber erst sucht ihr die fähigsten Gefangenen aus. Bringt sie an Bord eures Schiffs. Den Rest könnt ihr töten. Hebt euch dieses arrogante Schwein von einem Römer für den Schluss auf. Der soll noch ein bisschen schwitzen, bevor ihr euch seiner annehmt.«
Hector grinste und verschwand außer Sicht. Kurz darauf hörte man es splitternd krachen; die Piraten hieben Holz für den Bau eines Scheiterhaufens im Frachtraum des Handelsschiffs. Der Kapitän wandte seine Aufmerksamkeit wieder der Truhe zu und ging erneut vor ihr in die Hocke. Als er sie genauer begutachtete, stellte er fest, was für ein handwerkliches Kleinod sie war. Seine Finger liebkosten das warm glänzende Holz und strichen über das Gold und die Onyx-Kameen. Telemachos schüttelte erneut den Kopf. »Schriftrollen …«
Mit beiden Händen entriegelte der Kapitän den Deckel und klappte ihn behutsam auf. Er hielt einen Augenblick inne, griff dann hinein und zog eine der Schriftrollen heraus. Sie war viel schwerer, als er erwartet hatte, und einen Moment lang fragte er sich, ob vielleicht Gold darin versteckt war. Mit den Fingern nestelte er am Lederriemen herum und hob die Schriftrolle hoch, um den Knoten besser zu sehen. Er bemerkte einen schwachen Zitronenduft, der von der Rolle ausging. Mit ein wenig Mühe löste sich der Knoten, und er schüttelte den Riemen herunter, hielt das eine Ende des Pergaments mit der Hand fest und rollte den Beginn der Schrift mit der anderen Hand aus.
Die Schriftrolle war auf Griechisch verfasst. Die Schrift war altmodisch, aber leicht zu entziffern, und Telemachos begann zu lesen. Zunächst trat ein Ausdruck der Verwirrung und Enttäuschung in seine Züge, während sein Blick über eine Zeile nach der anderen wanderte.
Auf dem Deck des Handelsschiffs erklang plötzlich ein Schrei des Entsetzens, der gleich darauf verstummte. Eine kurze Pause, und dann ein weiterer Schrei, gefolgt von einer schrillen Stimme, die um Gnade flehte, bevor auch sie zum Schweigen gebracht wurde. Der Kapitän lächelte. Es würde keine Gnade geben. Er kannte seinen Gefolgsmann Hector gut genug, um sich darüber klar zu sein, dass dieser das Töten anderer Menschen zutiefst genoss. Schmerz zuzufügen war eine Kunst, die er ausgezeichnet beherrschte, sogar noch besser als das Führen seines schlanken Piratenschiffs, das mit einigen der blutrünstigsten Leute bemannt war, die der Piratenkapitän je kennengelernt hatte. Der Kapitän wandte sich wieder der Schriftrolle zu und las weiter, während erneut Schreie durch die Luft hallten.
Gleich darauf stieß er auf einen Satz, der plötzlich alles erklärte. Ein eiskalter Schauer überlief ihn, als ihm klar wurde, was er da in Händen hielt. Er wusste, wo der Text verfasst worden war, wer ihn geschrieben hatte und, wichtiger noch, er wusste, was diese Schriftrollen wert sein mochten. Dann begriff er: Wenn er sich an die richtigen Kunden wandte, konnte er jeden Preis für die Rollen verlangen. Unvermittelt warf er die Schriftrolle in die Truhe zurück und sprang auf.
»Hector! Hector!«
Wieder tauchte der Kopf des Mannes über dem Rand des gekaperten Schiffs auf. Er legte die Hände auf die Reling; in der einen hielt er noch immer einen langen, krummen Dolch, von dem das Blut zwischen den beiden Schiffen ins Meer tropfte.
»Dieser Römer …«, begann Telemachos, »… habt ihr ihn schon getötet?«
»Noch nicht. Er ist als Nächster dran.« Hector grinste. »Möchtest du zuschauen?«
»Nein, ich möchte ihn lebend haben.«
»Lebend?« Hector runzelte die Stirn. »Der ist zu weich für uns. Mit dem kann man verdammt gar nichts anfangen.«
»Oh, der wird sich noch als sehr nützlich erweisen! Er wird uns helfen, reicher als Krösus zu werden. Bring ihn sofort zu mir!«
Gleich darauf kniete der Römer neben dem Mast auf dem Deck. Mit bebender Brust blickte er zum Piratenkapitän und seinem mörderischen Gefolgsmann auf. In seinem Verhalten lag noch immer Trotz, wie der Kapitän bemerkte. Der Mann war Römer durch und durch, und hinter seiner ausdruckslosen Miene überwog die Verachtung für seine Peiniger mit Sicherheit sogar noch das Entsetzen, das er beim Warten auf den Tod empfunden haben musste. Der Kapitän stieß mit der Stiefelspitze gegen die Truhe.
»Ich weiß über die Schriftrollen Bescheid. Ich weiß, worum es sich dabei handelt, und ich kann mir denken, wohin du sie bringst.«
»Denk, was du willst!« Der Römer spie auf das Deck. »Von mir erfährst du nichts.«
Hector hob den Dolch und stürzte sich mit einem Knurren vorwärts. »Hör mal, du …«
»Lass ihn in Ruhe!«, blaffte der Kapitän ihn an und streckte die Hand aus. »Ich habe gesagt, ich will ihn lebend.«
HectorhieltinneundschautemitmörderischemBlickvonseinemKapitänzumRömerundwiederzurück.»Lebend?«
»Ja … Er wird uns ein paar Fragen beantworten. Ich muss wissen, für wen er arbeitet.«
Der Römer lachte höhnisch. »Ich sage nichts.«
»O doch, das wirst du.« Der Kapitän beugte sich über ihn. »Du hältst dich für einen tapferen Mann, das sehe ich. Aber ich habe in meiner Zeit viele tapfere Männer gesehen, und keiner von ihnen hat lange gegen Hector hier durchgehalten. Er versteht sich besser darauf, Schmerz zuzufügen, der lange anhält, als jeder andere Mann, den ich kenne. Er hat da eine besondere Begabung. Es ist eine Kunst, wenn du so willst. Er geht seiner Kunst mit großer Leidenschaft nach …«
Der Kapitän starrte kurz in das Gesicht seines Gefangenen, und schließlich zuckte der Mann zusammen. Telemachos lächelte, richtete sich auf und wandte sich an seinen Untergebenen.
»Bringt die anderen so schnell wie möglich um. Dann setzt das Schiff in Brand. Sobald ihr damit fertig seid, will ich dich hier an Bord haben. Wir werden die Zeit, die wir für die Rückreise brauchen, mit unserem Freund hier verbringen …«
Unter dem schräg einfallenden Nachmittagslicht umfing eine dicke, wirbelnde Rauchwolke das verwüstete Handelsschiff. Flammen leckten durch den Qualm, als das Feuer sich unter Deck festfraß und im ganzen Schiff ausbreitete. Bald loderte das Feuer hoch auf, und die Takelage geriet in Brand, ein feuriges Maßwerk von Flammen wie eine schauerliche Dekoration. Das Krachen und Prasseln des brennenden Holzes und das Brüllen der Flammen war für die Männer an Deck der beiden Piratenschiffe deutlich zu hören, als sie von der italienischen Küste wegsegelten. Weit am östlichen Horizont lag die Küste Illyricums mit ihrem Labyrinth abgelegener Meeresarme und einsamer Inseln. Langsam verklang das Prasseln des Feuers hinter ihnen in der Ferne.
Bald war das einzige Geräusch, das die heitere Stille der durchs Meer schneidenden Schiffe durchbrach, das wahnsinnige Gebrüll eines Mannes, der einer Folter unterworfen wurde, wie er sie sich in seinen schrecklichsten Albträumen nie ausgemalt hatte.
KAPITEL 2
Rom … Scheiße …« Centurio Macro stöhnte, während er sich auf seinem Strohsack aufrichtete. Der schreckliche Schmerz in seinem Schädel ließ ihn zusammenzucken. »Ich bin immer noch in Rom.«
Durch den zerbrochenen Fensterladen fiel ein matter Lichtstrahl in das schmuddelige Zimmer und legte sich auf sein Gesicht. Er schloss die Augen, presste die Lider zusammen und holte langsam tief Luft. Am Vorabend hatte er bis zur Bewusstlosigkeit gesoffen, und wie üblich schwor er sich nun im Stillen, nie wieder billigen Wein anzurühren. Die vergangenen drei Monate waren voll von solchen Schwüren gewesen. Tatsächlich hatten sie sich in den letzten Tagen beunruhigend gehäuft, da Macro zu zweifeln begonnen hatte, ob er und sein Freund Cato jemals wieder irgendwohin abkommandiert werden würden. Es schien eine Ewigkeit her zu sein, seit sie gezwungen gewesen waren, die Zweite Legion in Britannien zu verlassen und nach Rom zurückzukehren. Macro sehnte sich inbrünstig nach einem militärischen Leben zurück. In einer der Legionen, die entlang der langen Grenzen des Reichs aufgestellt waren, musste es doch gewiss eine freie Stelle geben? Aber anscheinend erfreuten sich alle Centurionen im aktiven Dienst einer abscheulich guten Gesundheit. Entweder das, überlegte Macro mit finsterer Miene, oder es gab irgendeine Verschwörung, um ihn und Centurio Cato aus der Liste der aktiv Diensttuenden zu streichen und ihnen ihren ausstehenden Sold weiter vorzuenthalten. Das war eine absolute Verschwendung seiner langjährigen Erfahrung, dachte er wütend. Und ein schlechter Start für Cato, der vor nicht einmal einem Jahr zum Centurio befördert worden war.
Macro öffnete das eine Auge einen Spalt und blickte über die nackten Bodendielen zur anderen Seite des kleinen Zimmers. Catos dunkle, zerzauste Locken lugten unter mehreren Lagen von Umhängen und Decken hervor, die sich auf den billigen Strohsäcken türmten. Die zerschlissenen Lagerstätten stanken nach Schimmel und waren fast die einzige Möblierung gewesen, die sie in dem gemieteten Zimmer vorgefunden hatten.
»Cato …«, rief Macro leise, erhielt aber keine Antwort. Der Bursche regte sich nicht. Er musste wohl noch schlafen. Nun schön, sollte er ruhig schlafen. Es war Januar, die Morgenstunden waren kalt, und es machte keinen Sinn aufzustehen, bevor die Sonne hoch genug gestiegen war, um etwas Wärme in die dicht bevölkerte Stadt zu bringen. Wenigstens war es nicht so schlimm wie die betäubende Kälte, die sie letzten Winter in Britannien erdulden mussten. Das endlose Elend des feuchten, kalten Klimas hatte sich ins Herz der Legionäre gefressen und ihnen melancholische Gedanken an Zuhause eingegeben. Jetzt war Macro zu Hause, und die schreckliche Enttäuschung, sein Leben mit dahinschwindenden Ersparnissen fristen zu müssen, machte ihn ganz verrückt.
Macro hob die Hand und kratzte sich am Kopf, die Läuse verfluchend, die in jeder Ecke des baufälligen Mietshauses zu nisten schienen.
»Die verdammten Läuse mischen auch noch mit«, brummte er. »Hat es dieser Tage wirklich jeder auf mich abgesehen?«
Seine Beschwerde war nicht ganz unberechtigt. Fast zwei Jahre lang hatten Cato und er gegen die wilden Stämme Britanniens gekämpft und ihren Teil zum Sieg über Caratacus und die keltischen Horden beigetragen. Was aber war der Lohn für all die Gefahren, denen sie ins Auge gesehen hatten? Ein feuchtes Zimmer in einem baufälligen Mietshaus im Elendsviertel der Subura, während sie darauf warteten, wieder zum Dienst beordert zu werden. Schlimmer noch, aufgrund irgendeiner bürokratischen Spitzfindigkeit hatten sie seit ihrer Ankunft in Rom keinen Sold erhalten, und nun hatten Macro und Cato das Geld fast aufgebraucht, das sie aus Britannien mitgebracht hatten.
Aus der Ferne drangen vom Forum Stimmengewirr und Rufe herüber, während die Stadt im matten Licht des Wintermorgens allmählich zum Leben erwachte. Macro zitterte und zog sich den dicken Armeeumhang um die breiten Schultern. Mit schiefer Miene wegen des rhythmischen Pochens in seinem Schädel stand er langsam auf und schlurfte quer durch den Raum zum Fensterladen. Er nahm die Schnur von dem gebogenen Nagel, der die beiden Holzflügel an Ort und Stelle festhielt, und stieß den zerbrochenen Laden auf. Vom Quietschen der abgenutzten Angeln begleitet, ergoss sich das Licht ins Zimmer, und Macro kniff die Augen vor der plötzlichen Helligkeit zusammen. Aber nur ganz kurz. Wieder einmal lag die inzwischen allzu bekannte Aussicht auf Rom vor ihm, und unwillkürlich empfand er Ehrfurcht beim Anblick der größten Stadt der Welt. Die obersten Zimmer des auf der billigen Seite des Esquilin gelegenen Mietshauses blickten über das wahnsinnige Gedränge und das Elend der Subura hinweg auf die hoch aufragenden Tempel und die Plätze, die das Forum umgaben, und dahinter auf die Lagerhäuser am Ufer des Tiber. Man hatte ihm gesagt, dass beinahe eine Million Menschen sich innerhalb der Mauern Roms drängten. Von dort, wo Macro stand, war das nur zu leicht zu glauben. Ein geometrisches Chaos von Dachziegeln zog sich vor ihm den Hügel hinunter, und die schmalen Gassen, die zwischen den Häusern verliefen, ließen sich nur erahnen, wo die schmuddeligen Backsteinmauern der oberen Geschosse sichtbar wurden. Ein Schleier von Holzrauch hing über der Stadt, und sein beißender Geruch übertönte sogar den Gestank aus der Gerberei am Ende der Straße. Selbst jetzt, nach drei Monaten in der Großstadt, hatte Macro sich noch nicht an die hier herrschenden abscheulichen Gerüche gewöhnt. Und auch nicht an den Dreck in den Straßen: ein dunkles Gemisch aus Exkrementen und faulenden Essensresten, in denen nicht einmal der ärmste Bettler wühlen würde. Und überall das dichte Gedränge der Menschen in den Straßen: Sklaven, Händler, Kaufleute und Handwerker. Die aus dem ganzen Imperium zusammengekommenen Passanten waren noch immer gemäß ihrer eigenen Kultur gekleidet, sodass ein exotisches Durcheinander von Farben und Stilen herrschte. Dazwischen trieben sich die erschlafften Massen frei geborener Bürger herum, die nach irgendeiner Unterhaltung Ausschau hielten, mit der sich die Zeit vertreiben ließ, solange sie nicht für die kostenlose Getreideverteilung anstanden. Hier und dort wurden die Sänften der Reichen vorbeigetragen, herausgehoben aus dem restlichen Rom, und ihre Besitzer hielten sich Duftsalben unter die Nasen, um in den fauligen Schwaden der Stadt wohltuendere Gerüche einzuatmen.
So sah das Leben in Rom aus, und es überwältigte Macro. Er staunte, dass eine solche Unzahl von Menschen eine derartige Beleidigung der Sinne duldeten und sich nicht nach der Freiheit und Frische eines Lebens fern der Stadt sehnten. Er war sich sicher, dass Rom ihn nur zu bald verrückt machen würde.
Macro stützte sich mit den Ellbogen auf das abgenutzte Fensterbrett und spähte nach unten in die schattige Straße, die entlang des Mietshauses verlief. Sein Blick glitt die schmuddelige Backsteinmauer hinunter, die unter seinem Fenster in eine schwindelerregende Tiefe führte, in der die Passanten nur noch wie vierbeinige Insekten wirkten – so fern waren sie und so unbedeutend erschienen sie, wie sie im trüben Licht über die Straße huschten. Ein höheres Gebäude als dieses Zimmer im fünften Stock des Mietshauses hatte Macro noch nie betreten, und es schwindelte ihm ein wenig.
»Scheiße …«
»Was ist Scheiße?«
Macro drehte sich um und sah, dass Cato nun wach war, sich die Augen rieb und ungeniert herzhaft gähnte.
»Ich. Ich fühle mich beschissen.«
Cato betrachtete seinen Freund mit einem missbilligenden Kopfschütteln. »Du siehst auch beschissen aus.«
»Danke vielmals.«
»Besser, du bringst dich mal in Ordnung.«
»Warum denn? Wozu? Es ist sinnlos, sich Mühe zu geben, wenn den Rest des Tages dann ohnehin nichts zu tun ist.«
»Wir sind doch Soldaten. Wenn wir jetzt alles schleifen lassen, werden wir nie wieder auf Zack sein. Außerdem, einmal Legionär, immer Legionär. Das hast du mir selbst gesagt.«
»Ach, wirklich?« Macro zog eine Augenbraue hoch und zuckte dann mit den Schultern. »Da muss ich wohl betrunken gewesen sein.«
»Wie soll man das merken?«
»Riskier mal keine dicke Lippe«, knurrte Macro, der spürte, wie sein Kopf sich sanft zu drehen begann. »Ich muss noch mal schlafen.«
»Du kannst jetzt nicht schlafen. Wir müssen uns fertig machen.« Cato griff nach seinen Stiefeln, zog sie an und begann, die Lederriemen zu schnüren.
»Fertig machen?« Macro wandte sich ihm zu. »Wozu denn das?«
»Hast du es vergessen?«
»Vergessen? Was habe ich vergessen?«
»Unseren Termin im Palast. Ich habe dir gestern Nacht davon erzählt, als ich dich in dieser Taverne gefunden habe.«
Macro versuchte mit gerunzelter Stirn, die Einzelheiten des Saufgelages vom vergangenen Abend zu rekonstruieren. »In welcher denn?«
»Im Hain des Dionysos.« Cato sprach geduldig. »Du hast mit einigen Veteranen aus der Zehnten gebechert, und ich bin dazugekommen und habe dir gesagt, dass ich ein Vorstellungsgespräch bei dem Prokurator arrangieren konnte, der für die Abkommandierung der Legionäre zuständig ist. Zur dritten Stunde. Uns bleibt also nicht viel Zeit, zu frühstücken, uns zu waschen und unsere Ausrüstung anzulegen, bevor wir uns zum Palast aufmachen müssen. Heute findet im Circus Maximus ein Wagenrennen statt; wir müssen früh aufbrechen, wenn wir den Menschenmassen zuvorkommen wollen. Du könntest etwas zu essen gebrauchen. Etwas, das deinen Magen beruhigt.«
»Schlaf«, erwiderte Macro leise, ließ sich auf seinen Strohsack fallen und deckte sich mit seinem Umhang zu. »Schlaf ist genau das Richtige für meinen Magen.«
Cato schnürte seine Schuhe fertig und stand auf, mit eingezogenem Kopf, um ihn nicht am Deckenbalken anzustoßen, der quer durch den Raum verlief; das war eine der wenigen Gelegenheiten, wo es sich als Nachteil erwies, einen Kopf größer als Macro zu sein. Cato griff nach dem Ledersack mit gemahlener Gerste, der neben ihrer übrigen Ausrüstung bei der Tür an der Wand lehnte. Er schnürte ihn auf, gab je eine Portion in ihre beiden Essgeschirre, drehte den Sack oben sorgfältig zu und verknotete die Schnüre wieder, damit die Mäuse draußen blieben. »Ich gehe jetzt und koche den Brei auf. Du kannst unterdessen schon mal anfangen, die Rüstung zu polieren.«
Als die Tür hinter seinem Freund zugefallen war, schloss Macro erneut die Augen und versuchte, nicht auf den Schmerz in seinem Schädel zu achten. Sein Magen fühlte sich wund und leer an. Eine Mahlzeit würde ihm guttun. Die Sonne war höher gestiegen, und er schlug erneut die Augen auf. Er stöhnte, warf den Umhang zur Seite und trat zu den Stapeln von Panzern und Ausrüstungsgegenständen, die neben der Tür lehnten. Obgleich sie beide den Rang eines Centurios bekleideten, hatte Macro Cato über ein Dutzend Jahre Erfahrung voraus. Manchmal empfand er es als merkwürdig, dass er plötzlich eine Anweisung des jungen Mannes befolgte. Aber sie waren ja nicht mehr im aktiven Dienst, wie Macro sich erbittert in Erinnerung rief. Der Rang war jetzt praktisch ohne Bedeutung. Vielmehr waren sie einfach zwei Freunde, die ums Überleben kämpften, bis sie endlich von den geizigen Beamten der kaiserlichen Finanzverwaltung ihren ausstehenden Sold erhielten. Solange sie noch darauf warteten, abkommandiert zu werden, mussten sie daher jede Sesterze zweimal umdrehen. Keine leichte Aufgabe, da Macro dazu neigte, die wenigen Ersparnisse, die er besaß, für Wein auszugeben.
Das schmale Treppenhaus wurde bei jedem zweiten Treppenabsatz durch Öffnungen in der Mauer erhellt, und Cato, der beide Hände voll hatte, musste die alten, knarrenden Holzstufen vorsichtig hinuntersteigen. Um sich herum hörte er, wie andere Mieter aufstanden: das Geschrei kleiner Kinder, das unbeherrschte Brüllen ihrer Eltern und das leise, verdrossene Gemurmel derer, die irgendwo in der Stadt einem langen Arbeitstag entgegensahen. Obgleich er in Rom geboren und im Palast aufgewachsen war, bis er alt genug gewesen war, zur Legion geschickt zu werden, hatte Cato nie Grund gehabt, die Elendsviertel aufzusuchen, geschweige denn eines der hohen Mietshäuser zu betreten, in denen die Armen der Hauptstadt hausten. Er war schockiert gewesen, als er begriff, dass frei geborene Bürger so leben konnten. Ein solches Elend hatte er sich niemals vorgestellt. Selbst den Sklaven im Palast ging es besser. Wesentlich besser.
Am Fuß der Treppe bog Cato nach innen ab und trat in den düsteren Hof, wo der gemeinsame Kochherd des Mietshauses stand. Ein verhutzelter alter Mann rührte auf der Herdstelle in einem großen, verrußten Topf, und in der Luft hing der Geruch von Getreidebrei. Selbst zu dieser frühen Stunde stand schon jemand vor Cato an, eine magere, blasse Frau, die mit ihrer großen Familie unmittelbar unter Macro und Cato in einem einzigen Zimmer lebte. Ihr Mann arbeitete in den Lagerhäusern; ein riesiger, mürrischer Kerl, der, wenn er betrunken war, herumbrüllte und Frau und Kinder schlug, was im Zimmer darüber deutlich zu hören war. Als sie Catos genagelte Stiefel auf den Steinplatten hörte, blickte sie sich nach ihm um. Ihre Nase war vor einiger Zeit gebrochen worden, und heute waren ihre Wangen und Augen von Schlägen geschwollen. Trotzdem huschte ein Lächeln über ihre Züge, und Cato zwang sich aus Mitleid zurückzulächeln. Sie mochte jedes Alter zwischen zwanzig und vierzig haben, aber die anstrengende Arbeit des Kindergroßziehens und die Anspannung, immer auf Zehenspitzen um ihren brutalen Mann herumzugehen, hatten sie sehr mitgenommen. Sie war nur noch ein Bündel Verzweiflung, wie sie da barfuß in einer zerlumpten Tunika vor ihm stand, den Bronzekessel in der einen Hand, während sie mit der anderen einen schlafenden Säugling an die Hüfte drückte.
Cato, der keinen weiteren Blickkontakt wünschte, setzte sich ans andere Ende der Bank, um darauf zu warten, bis er am Herd an die Reihe kam. Unter den Steinbögen auf der anderen Seite des Hofs waren bereits die Sklaven einer Bäckerei an der Arbeit und feuerten die Öfen für die ersten Brotlaibe des Tages an.
»Hallo, Centurio.«
Cato blickte auf und sah, dass die Frau des Bäckers aus ihrer Tür getreten war und ihn anlächelte. Sie war jünger als Cato und bereits seit drei Jahren mit dem schon recht betagten Besitzer des Geschäfts verheiratet. Für das hübsche, aber derbe Mädchen aus der Subura war das eine gute Partie gewesen, und sie hatte Pläne für das Geschäft, wenn ihr Mann erst einmal verstorben war. Natürlich würde sie zur gegebenen Zeit vielleicht einen Partner brauchen, um bei ihrem ehrgeizigen Vorhaben mitzuziehen. Das hatte sie Cato ungehemmt mitgeteilt, kaum dass er in das Mietshaus gezogen war, und was dabei mitschwang – nun, das war wohl sonnenklar.
»Guten Morgen, Velina.« Cato nickte. »Schön, dich zu sehen.«
Vom anderen Ende der Bank war deutlich ein Schnaufen der Verachtung zu hören.
»Achte nicht auf sie.« Velina lächelte. »Frau Gabinius hält sich für etwas Besseres. Wie läuft es mit diesem Bengel Gaius? Steckt er seine Nase immer noch überall rein, wo er nicht erwünscht ist?«
Die Magere wandte sich von der Frau des Bäckers ab und drückte ihr Kind fester an die Brust, ohne etwas zu erwidern. Velina stemmte die Hände in die Hüften und warf in höhnischem Triumph den Kopf hoch, bevor sie ihre Aufmerksamkeit wieder Cato zuwandte.
»Wie geht es meinem Centurio denn heute? Irgendetwas Neues?«
Cato schüttelte den Kopf. »Bisher sind wir noch nirgendwohin abkommandiert worden. Aber heute Vormittag suchen wir jemanden im Palast auf. Vielleicht habe ich ja später gute Nachrichten.«
»Oh …« Velina runzelte die Stirn. »Dann sollte ich dir wohl viel Glück wünschen.«
»Das wäre nett.«
Sie zuckte mit den Schultern. »Ich begreife allerdings nicht recht, warum du so dahinter her bist. Wie lange bist du jetzt schon hier? Fünf Monate?«
»Drei.«
»Was,wennsienichtsfürdichhaben?Dusolltesteinmaldarübernachdenken,etwasanderesmitdeinemLebenanzufangen.EtwasLohnenderes.«SiewölbteeineAugenbraueundzogkurzeineSchnute.»EinjungerMannwiedu könnte es in der richtigen Gesellschaft weit bringen.«
»Vielleicht.« Cato spürte, wie er rot wurde, und blickte sich nach dem Herd um. Die unverhohlene Aufmerksamkeit, die sie ihm schenkte, war ihm peinlich, und er wollte unbedingt den Hof verlassen, bevor sie ihre Pläne für ihn noch weiter entwickelte.
Der alte Mann, der seinen Brei gerührt hatte, hob den dampfenden Topf von der eisernen Herdstelle und ging vorsichtig zur Treppe. Die Frau von Gabinius griff nach ihren Töpfen.
»Entschuldige bitte.« Cato stand auf. »Würde es dir etwas ausmachen, mich vorzulassen?«
Sie blickte auf, und ihre eingesunkenen Augen fixierten ihn kurz mit einem kalten Blick.
»Wir haben es heute Morgen eilig«, erklärte Cato rasch. »Wir müssen uns so schnell wie möglich fertig machen und aufbrechen.« Er machte ein bittendes Gesicht und neigte den Kopf leicht in Richtung der Frau des Bäckers. Die Magere verzog die Lippen zu einem Lächeln, blickte zu Velina und registrierte mit kaum verhohlener Freude deren Enttäuschung.
»Natürlich, Herr. Wenn du es so eilig hast, hier wegzukommen.«
»Danke.« Cato nickte verbindlich und stellte die beiden Essgeschirre auf die heiße Platte. Er gab etwas Wasser aus dem Wassertrog dazu, vermischte es mit der gemahlenen Gerste und rührte in dem sich erhitzenden Brei.
Velina schnaufte verächtlich, machte kehrt und marschierte zur Bäckerei zurück.
»Dann macht sie dir also immer noch schöne Augen?« Grinsend wischte Macro sein Essgeschirr mit einem Stück Brot aus.
»Leider.« Cato hatte seine Mahlzeit bereits beendet und rieb mit einem alten Lumpen Wachs in seinen ledernen Harnisch. Die versilberten Orden, die er sich in der Schlacht verdient hatte, glänzten dort, wo sie vom Harnisch herunterhingen, wie neue Münzen. Er trug bereits seine dicke Militärtunika und seinen Schuppenpanzer und hatte seine Unterschenkel mit glänzenden Beinschienen bewehrt. Noch einmal gab er etwas Wachs auf den Lumpen und rubbelte das schimmernde Leder.
»Wirst du die Sache verfolgen?«, fuhr Macro fort, der sich ein Lächeln verbiss.
»Kommt nicht infrage. Ich habe auch so schon genug Sorgen. Wenn wir hier nicht bald rauskommen, werde ich noch verrückt.«
Macro schüttelte den Kopf. »Du bist jung. Du hast bestimmt noch zwanzig oder fünfundzwanzig gute Dienstjahre vor dir. Mehr als genug Zeit. Für mich sieht es anders aus. Noch höchstens fünfzehn Jahre. Der nächste Posten wird wahrscheinlich meine letzte Chance sein, genug Geld für den Ruhestand in die Hand zu bekommen.«
Die Sorge in seiner Stimme war unverkennbar, und Cato hielt inne und blickte auf. »Dann sollten wir wohl das Beste aus diesem Morgen machen. Ich habe mich tagelang vor dem Büro des Sekretärs auf die Lauer gelegt, um diesen Termin zu bekommen. Da sollten wir uns jetzt nicht verspäten.«
»Schon gut. Kapiert. Ich mache mich fertig.«
Kurz darauf trat Cato von Macro zurück und begutachtete ihn mit kritischem Blick.
»Wie sehe ich aus?«
Cato musterte seinen Freund und spitzte die Lippen. »Gut genug. Und jetzt lass uns gehen.«
Als die beiden Offiziere aus dem dunklen Treppenhaus auf die Straße vor dem Mietshaus traten, drehten die Leute sich nach den glänzenden Rüstungen und den leuchtend roten Umhängen um. Beide Offiziere hatten ihren Helm aufgesetzt, und die schönen Pferdehaarkämme prangten über dem schimmernden Metall. Den Rebstab in der einen Hand, während die andere auf dem Schwertgriff ruhte, richtete Cato sich auf und machte den Rücken gerade.
Jemand stieß einen bewundernden Pfiff aus, und als Cato sich umdrehte, sah er Velina am Türpfosten der Bäckerei ihres Mannes lehnen.
»Also da schau sich einmal einer euch beide an! Ich könnte mich wirklich für einen Mann in Uniform erwärmen …«
Macro grinste sie an. »Da lässt sich bestimmt was arrangieren. Ich schau mal bei dir vorbei, wenn wir vom Palast zurückkommen.«
Velina lächelte matt. »Das wäre schön … euch beide zu sehen.«
»Aber mich zuerst«, sagte Macro.
Cato ergriff ihn beim Arm. »Wir verspäten uns noch. Komm jetzt.«
Macro zwinkerte Velina zu und schritt mit Cato zusammen aus. Seite an Seite marschierten sie beherzt den Hügel hinunter zum Forum und den schimmernden Säulen des riesigen Kaiserpalasts, der sich auf dem Palatin erhob.
KAPITEL 3
Centurio Macro und Centurio Cato?« Der Prätorianer betrachtete stirnrunzelnd die vor ihm auf dem Schreibtisch liegende Wachstafel. »Ihr steht nicht auf der Liste.«
Macro lächelte ihn an. »Schau noch einmal nach. Schau gut nach, wenn du weißt, was ich meine.«
Der Prätorianer hob mit einem müden Seufzer die Schultern, um klarzumachen, dass er das alles schon tausendmal erlebt hatte. Er lehnte sich vom Schreibtisch zurück und schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, Herr. Ich habe meine Befehle. Keiner darf den Palast betreten, dessen Name nicht auf der Liste steht.«
»Aber wir stehen auf der Liste«, beharrte Cato. »Wir haben einen Termin im Armeeamt. Beim Prokurator, der für die Vergabe der Legionsposten zuständig ist. Und zwar jetzt, lass uns also durch.«
Der Wächter zog eine Augenbraue hoch. »Weißt du, wie oft die Leute es damit schon bei mir versucht haben, Herr?«
»Es stimmt aber.«
»Es stimmt nur, wenn ihr auf der Liste steht, Herr. Ihr steht aber nicht auf der Liste, also habt ihr auch keinen Termin.«
»Momentmal.«CatokonzentriertesichganzaufdenPrätorianer.»Schaumal,daistoffensichtlicheinFehlerpassiert.Ichversicheredir,dasswireinenTerminhaben.IchhabeihngesternmitdemSekretärdesProkuratorsvereinbart.Demetriusheißter.SchickihmeineNachricht,dass wir hier sind. Er wird unsere Aussage bestätigen.«
Der Wächter wandte sich einer kleinen Gruppe von Knaben zu, jungen Sklaven, die neben dem Säuleneingang des Palasts in einer Nische kauerten. »Du da! Geh zum Armeeamt. Suche Demetrius und richte ihm aus, dass diese Offiziere hier behaupten, einen Termin beim Prokurator zu haben.«
»Danke«, murmelte Cato, zog Macro vom Schreibtisch des Wächters weg und lenkte ihn zu den Bänken, die sich zu beiden Seiten des Eingangs an der Wand entlangzogen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!