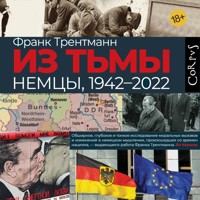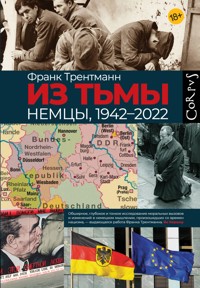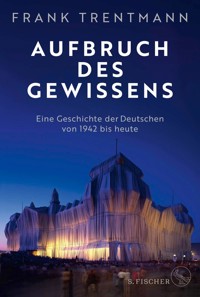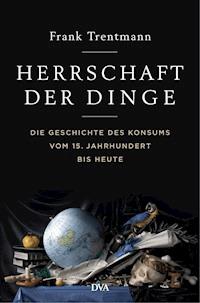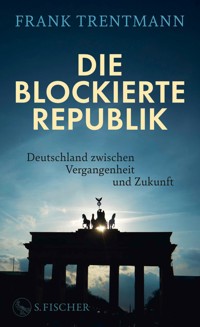
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Populismus, Migration, Wirtschaft, Krieg – wohin steuert Deutschland? Das Buch zur Lage der Nation: Der deutsch-britische Historiker Frank Trentmann stellt Deutschland auf den Prüfstand. Wie sind wir in die Krise geraten, und wie kommen wir wieder heraus? Frank Trentmann findet Antworten durch den Blick in die Geschichte und über die nationalen Grenzen hinaus. Er beleuchtet Stärken und Schwächen von Demokratie, Wirtschaft und deutscher Erinnerungskultur. Er zeigt, dass die Alterung der Gesellschaft und Migration zusammengedacht werden müssen und dass im Osten wie im Westen verzerrte Bilder der Realität in DDR und Bundesrepublik zur Polarisierung beitragen. Frank Trentmann analysiert die Ursachen der gegenwärtigen Krise historisch und blickt zugleich nach vorn, indem er die Chancen für künftige Veränderungen aufzeigt. Entscheidend wird schließlich sein, welche Rolle Deutschland in Europa und der Welt übernehmen will. Sein Fazit: Wir können uns mehr zumuten und mehr zutrauen, als wir glauben, die Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos. Nötig sind mehr Mut zu Reformen, mehr Zuversicht und Pragmatismus. Umlenken heißt Umdenken!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Frank Trentmann
Die blockierte Republik
Deutschland zwischen Vergangenheit und Zukunft
Über dieses Buch
„Eine pointierte historische Intervention zur gegenwärtigen Lage Deutschlands – ein großartiges Buch, um die deutsche Gegenwart aus der jüngsten Geschichte heraus zu verstehen.“ Frank Bösch, Autor von Deals mit Diktaturen: Eine andere Geschichte der Bundesrepublik.
Populismus, Migration, Wirtschaft, Krieg – wohin steuert Deutschland? Das Buch zur Lage der Nation: Der deutsch-britische Historiker Frank Trentmann stellt Deutschland auf den Prüfstand. Wie sind wir in die Krise geraten, und wie kommen wir wieder heraus? Antworten findet er durch den Blick in die Geschichte und über die nationalen Grenzen hinaus. Er beleuchtet Stärken und Schwächen von Demokratie, Wirtschaft und deutscher Erinnerungskultur. Er zeigt, dass die Alterung der Gesellschaft und Migration zusammengedacht werden müssen und dass im Osten wie im Westen verzerrte Bilder der Realität in DDR und Bundesrepublik zur Polarisierung beitragen.
Frank Trentmann analysiert die Ursachen der gegenwärtigen Krise historisch und blickt zugleich nach vorn, indem er die Chancen für künftige Veränderungen aufzeigt. Entscheidend wird schließlich sein, welche Rolle Deutschland in Europa und der Welt übernehmen will.
Sein Fazit: Wir können uns mehr zumuten und mehr zutrauen, als wir glauben, die Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos. Nötig sind mehr Mut zu Reformen, mehr Zuversicht und Pragmatismus. Umlenken heißt Umdenken!
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Frank Trentmann, geboren 1965 in Hamburg, ist Professor für Geschichte am Birkbeck College der University of London und an der Universität von Helsinki. Zuvor lehrte er an der Princeton University. Er erhielt u.a. den Humboldt-Preis für Forschung der Alexander von Humboldt-Stiftung und 2023 den Bochumer Historikerpreis. Sein Buch »Herrschaft der Dinge« wurde 2018 in Österreich Wissenschaftsbuch des Jahres. Frank Trentmann lebt in London.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: KOSMOS - Büro für visuelle Kommunikation
Coverabbildung: Paul Treacy / Millennium Images / Look Photo
ISBN 978-3-10-492218-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Einführung: Mit historischem Blick nach vorn
Die deutsche Krise
Der Charakter der Krise
Der schiefe Blick auf die Vergangenheit
Eine offene Geschichte
1 Demokratie auf dem Prüfstand
Populismus mit deutschem Akzent
Was Ost und West trennt … und verbindet
Die gute alte Bundesrepublik
Demokratischer Realismus
2 Grenzen der Erinnerungskultur
Erinnerungskämpfe
Das deutsche Problem mit der Empathie
Was ist antisemitisch?
Was wir vergessen
Die Zukunft der Erinnerung
3 Alt und bunt: Alterung und Migration zusammendenken
Frau und Fürsorgearbeit
Wer soll das bezahlen?
Konflikt der Generationen?
Willkommensgrenze
Wie ausländische Fachkräfte uns sehen
Schrumpfen oder Zuwanderung
4 Stillstand und Neustart
Realitätscheck
Exportweltmeister
Untergangspanik
Das Problem mit der Produktivität
Strukturwandel ist immer
Ostdeutsche Erfolge
Der Papierkram
Digitales Entwicklungsland
Sakrosankte Schuldenbremse?
Die Wiederkehr des Staatskapitalismus
Die Macht der Bedürfnisse
Auf die Zukunft setzen
5 Welt im Wandel
Zurück zur alten Ordnung
Gefahr aus dem Osten
»Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner geht hin«
Wertekonflikt
Was heißt eigentlich Staatsräson?
Schluss: Zwischen den Zeiten
Dank
Einführung: Mit historischem Blick nach vorn
Deutschland steckt in der Krise. Die Wirtschaft schwächelt, und die politischen und gesellschaftlichen Spannungen im Land nehmen zu. Fünfunddreißig Jahre nach dem Mauerfall ist die Wiedervereinigung zwischen Ost und West noch immer eine Baustelle. Viele Ostdeutsche fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) erreichte bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 20,8 Prozent. Besorgte Stimmen warnen vor dem Zerfall der Demokratie. Andere prophezeien – mit Blick auf die Migration –, dass Deutschland sich selbst abschaffe. Gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter, das Land bräuchte junge Arbeitskräfte aus dem Ausland. Und so schwankt die Republik zwischen Offenheit und Abschottung ebenso wie zwischen dem ökologischen Umbau und dem Festhalten am gewohnten fossilen Lebensstil.
Doch damit nicht genug. Das Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 und seine Folgen haben das Selbstverständnis der Bundesrepublik schwer erschüttert, hat sie doch die Sicherheit Israels zur »Staatsräson« erklärt. Wofür setzt sich Deutschland ein: für die Verteidigung Israels oder für die Menschenrechte der Zivilbevölkerung in Gaza? Auch der Krieg in der Ukraine ist zur Zerreißprobe geworden. Im Laufe des Jahres 2022 hat die Bundesregierung sich zu Waffenlieferungen an die Ukraine durchgerungen, im März 2025 zu massiven Investitionen in Infrastruktur, Aufrüstung und Klimaschutz. Das war überfällig, aber ob Deutschland das sicherheitspolitische Vakuum füllen will und kann, indem es selbst eine Führungsrolle übernimmt, ist offen.
Die Probleme scheinen übermächtig. Die Krisenstimmung im Land ist allenthalben zu spüren. Dieses Buch stellt Deutschland auf den Prüfstand. Es geht um die Frage, wie wir in die Krise geraten sind und wie wir wieder herausfinden können. Dabei hilft der Blick in die eigene Vergangenheit und über die nationalen Grenzen hinaus. Um die gegenwärtige Situation zu verstehen, müssen wir sie einordnen, historisch und vergleichend.
Die deutsche Krise
Kein anderes europäisches Land hat in so kurzer Zeit so stark an Ansehen verloren wie die Bundesrepublik. Noch in den 2010er Jahren wurde Deutschland für seine stabile Demokratie und seine Wirtschaftskraft bewundert und die deutsche Erinnerungskultur als vorbildlich angesehen. Warum Deutschland es besser macht und Von den Deutschen lernen lauteten zwei Buchtitel Anfang der 2020er Jahre.[1] Inzwischen hat sich das Bild gewandelt. In internationalen wie in deutschen Medien und Publikationen gilt Deutschland als der »kranke Mann Europas«: Deutschland sei übersättigt, nichts sei mehr so, wie es mal war, »Kontrollverlust« wohin man schaut.[2] Aber stimmt das?
Die blockierte Republik bietet eine historische Einordnung der gegenwärtigen Situation Deutschlands. Damit unterscheidet sich dieses Buch von den meist kurzfristigen Diagnosen, die zu fatalistischer Untergangsstimmung neigen. Die historisch-vergleichende Perspektive ist erhellend und provozierend zugleich, weil sie bequeme Denkmuster in Frage stellt und vergessene oder gar verdrängte Handlungsmöglichkeiten aufzeigt. Die Bundesrepublik sah sich schon immer mit großen Herausforderungen konfrontiert. Ein Blick in die Geschichte kann uns lehren: Wir können uns mehr zumuten, wenn wir nur wollen.
Warum tut sich Deutschland so schwer mit Veränderungen? Diese Frage wird oft mit der zunehmenden Komplexität unserer modernen Welt erklärt. Die Welt werde immer schneller, flüchtiger und vielschichtiger. Die Klimakrise und andere große Herausforderungen würden die Politik überfordern. Gleichzeitig seien westliche Gesellschaften träge und der alte Fortschrittsglaube verloren gegangen. Die Verluste, die mit einem Wandel einhergehen, lassen sich nicht mehr so leicht verdrängen, und es komme zu einer regelrechten »Verlusteskalation«.[3]
Vieles an diesen Beobachtungen ist klug und einleuchtend, aber sie sind zugleich so umfassend und allerklärend, dass sie Zweifel aufkommen lassen. Klagte man nicht schon um 1900, dass die Welt immer schneller, immer komplexer werde? Das damalige europäische Bündnisgeflecht war keineswegs einfach gestrickt. Und dass die nationale Politik den globalen wirtschaftlichen Kräften hinterherhinkte, war eine Grunderkenntnis aus dem Ersten Weltkrieg. Bereits in den 1960er Jahren entwickelte der libertäre Ökonom Friedrich Hayek seine Theorie komplexer Phänomene, um zu zeigen, dass Wirtschaft und Gesellschaft unmöglich auf dem Reißbrett geplant werden konnten.[4] Im folgenden Jahrzehnt warnten kritische Wissenschaftler und Bürger, dass man der Logik der Abschreckung nicht mehr vertrauen könne, weil die nuklearen Waffensysteme zu komplex geworden seien. Ist unsere gegenwärtige Verlusterfahrung wirklich so viel intensiver als die der Weltkriegsgenerationen? Und was die attestierte Trägheit westlicher Gesellschaften betrifft: Ist das ihr Wesenszustand? Im Umgang mit der Klimakrise mag das zutreffen, im Umgang mit der sogenannten Flüchtlingskrise weniger. In den westlichen Gesellschaften bewegt sich einiges, nur nicht unbedingt in eine liberal-demokratische und klimafreundliche Richtung. Die AfD, die Brexit-Befürworter und Donald Trump mögen vieles sein, aber träge sind sie nicht, und den Glauben an die eigene Größe haben sie ebenso wenig verloren wie ihr eher spezielles Fortschrittsverständnis.
Der Charakter der Krise
Eine Krise führt nicht automatisch zum Kollaps. Krisen entstehen aus der Wechselwirkung von materiellem, gesellschaftlichem und politischem Druck. Die Weltgeschichte ist voll von Wirtschaftsflauten und Umweltkatastrophen. Für uns ist interessant zu beobachten, wie sie wahrgenommen werden und wie das jeweilige politische System auf sie reagiert: Kann die Politik mit den Problemen umgehen oder verstärkt sie diese noch und macht sie so zu einer existentiellen Krise?
In Deutschland ebnete die Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1932 Adolf Hitler den Weg an die Macht, in den Vereinigten Staaten führte sie zum New Deal des Demokraten Franklin D. Roosevelt. In China sah sich die Qing-Dynastie (1644–1912) zu Beginn ihrer Herrschaft mit der Kleinen Eiszeit, Dürre und Hungersnöten konfrontiert, federte den Druck aber mit einem starken Staat und öffentlichen Getreidespeichern ab. Anders in der zweiten Hälfte, als interne Streitigkeiten und Korruption China erst in einen blutigen Bürgerkrieg und dann in eine Revolution stürzten. Umgekehrt können Krisen auch in wirtschaftlich guten Zeiten auftreten. Das deutsche Kaiserreich und das britische Empire waren in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg die engsten Handelspartner, und liberal gesinnte Internationalisten waren überzeugt, dass die Folgen eines Krieges so verheerend sein würden, dass er sinnlos sei. Ihr Wortführer, der Brite Norman Angell, nannte es The Great Illusion und verkaufte zwei Millionen Exemplare seines Buchs dieses Titels.[1] Das hielt Großbritannien nicht davon ab, dem Deutschen Reich am 4. August 1914 den Krieg zu erklären.
Heute bezeichnet man gleichzeitig auftretende, sich verstärkende Krisen als Polykrise. Der Begriff kam in der Wissenschaft um das Jahr 2000 auf. Er thematisierte die globale Verflechtung von Klimakrise, Umweltzerstörung und sozialer Ungerechtigkeit. Nach 2016 gewann er an Popularität, insbesondere durch Jean-Claude Juncker, den Präsidenten der Europäischen Kommission, der auf die Interaktion von Migration, Finanzkrise, Sicherheitsrisiken und Brexit hinwies. Seit 2020 sind Pandemie, Inflation, Krieg und die Energiekrise hinzugekommen.[2]
Die Bundesrepublik ist dieser globalen Polykrise ebenso ausgesetzt wie ihre europäischen Nachbarn. Ihre Bilanz der Krisenbewältigung ist durchaus respektabler als ihr Ruf. Auch wenn während der Corona-Pandemie 2020 bis 2022 Fehler gemacht wurden, starben im Verhältnis zur Bevölkerung weniger Menschen an dem Virus als in Großbritannien oder Italien. Die Inflation hielt sich in Grenzen, es gab großzügige Hilfen, und auch nach dem russischen Gaslieferstopp gingen die Lichter nicht wie befürchtet aus. Das alles half der seit Dezember 2021 regierenden Ampelkoalition wenig. Es machte sich der Eindruck breit, das Land gehe den Bach runter, und dieses subjektive Gefühl war letztlich entscheidend für den Vertrauensverlust der Regierung und die Abkehr von den drei beteiligten Parteien. Dies zeigt, wie objektive Schwierigkeiten durch eine ausgeprägte Krisenwahrnehmung besonders erdrückend erscheinen können.
Was aber macht eigentlich eine Krise aus? Über diese Frage streiten sich die Geister seit der Antike. Für die alten Griechen war die Krise ein Moment, in dem eine »Entscheidung« (krísis) unausweichlich wurde: entweder – oder. In der Neuzeit weitete sich das Empfinden von Krisen deutlich aus – statt eines Moments umfassen sie inzwischen ganze Epochen und Gesellschaften, wie die Zeit der Aufklärung und vor allem die Moderne. Für Karl Marx war die Krise sowohl ein immanentes wiederkehrendes Problem des Kapitalismus als auch der unvermeidliche große Knall, der das System schließlich zum Explodieren bringen wird. Liberale Beobachter hingegen sahen die Krise eher als Übergangsphase auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Eine Krise kann einen offenen Ausgang haben und gemeistert werden.[3] Heutige Wissenschaftler definieren die aktuelle Polykrise als eine plötzlich auftretende Reihe von Ereignissen mit schwerwiegenden, unmittelbaren Folgen.[4]
In der Bundesrepublik kommen zu den akuten globalen Krisen hausgemachte Schwierigkeiten hinzu: die Entfremdung zwischen Ost- und Westdeutschland; Antisemitismus und Erinnerungskämpfe; Investitions- und Fachkräftemangel; eine rapide alternde Gesellschaft bei gleichzeitigen Vorbehalten gegenüber Migranten; geopolitische und militärische Selbstverzwergung und die daraus resultierenden Probleme bei der Übernahme einer Führungsrolle in Europa. Die Krise ist in vielerlei Hinsicht eine Selbstblockade.
Wie bei den globalen Polykrisen haben wir es auch hier mit einem Zusammenspiel von Kräften zu tun: Die populistische Abkehr von demokratischen Grundwerten und die Skepsis gegenüber internationalen Bündnissen wie der Nato oder der EU gehen einher mit Sympathien für aggressive Autokraten. Gleichzeitig verschärfen Migrations- und Integrationsprobleme die ohnehin schon schwierige Situation, was den Fachkräftemangel betrifft, aber auch hinsichtlich der Zukunft der Rente, der Pflege und damit auch der Gleichstellung der Geschlechter. Umgekehrt verstärken internationale Konflikte die inneren Auseinandersetzungen, wie die hitzigen Debatten um die deutsche Unterstützung für Israel und die Ukraine zeigen.
Der schiefe Blick auf die Vergangenheit
Der historische Blick ist von doppelter Bedeutung. Zum einen erhellt er die Ursachen von Problemen. Das ist die klassische Aufgabe des Historikers. Zum anderen ist es wichtig, gegen eine nostalgische Verklärung der Vergangenheit vorzugehen. Wenn wir uns von den Problemen der Gegenwart überfordert fühlen, dann nicht zuletzt deshalb, weil wir uns die Nachkriegsjahre bis 1990 gerne als eine Zeit vorstellen, in der angeblich noch alles in Ordnung war. Die deutsche Debatte leidet unter diesem verzerrten Blick auf die Vergangenheit. Ob bei Klimawandel, Populismus oder Antisemitismus, ob Ukrainekrieg oder schwächelnde Wirtschaft: die Diagnose der Gegenwart erfolgt stets vor diesem Hintergrund. So gesehen erleben wir einen Epochenbruch: den Bruch zwischen einer vermeintlich stabilen, geordneten Moderne und einer »flüchtigen«, sich auflösenden Post- oder Spätmoderne.[1] Seit den 2010er Jahren, so die These, liegt das Problem im beharrlichen Festhalten an einer Normalität, deren Zeit abgelaufen ist. Deutsche Politiker und Bürger, so heißt es, betrachten diese Normalität als eine Art Anrecht, dabei sei sie nur eine Phase, die unwiederbringlich vorbei ist. Der Tenor lautet: Die verlorene Normalität wird nicht zurückkehren, und je eher man sich damit abfindet, desto besser.[2]
Aber diese Normalität hat es so nie gegeben. Es handelt sich um die Projektion einer idealisierten Vergangenheit. Das ist ebenso ein westdeutsches wie ostdeutsches Problem. So wie die »Ostalgie« die DDR-Zeit verklärt, so überstrahlt das »Wirtschaftswunder« die Geschichte der alten Bundesrepublik.
Dieses verzerrte Geschichtsbild mag ein Gefühl von Identität und Heimat vermitteln, hat aber einen hohen Preis. Indem es die verbliebenen Ungleichheiten zwischen Ost und West auf die Zeit nach der Wiedervereinigung verschiebt und von der Zeit vor 1990 entkoppelt, verhärtet es die Polarisierung zwischen Ost und West. Die tieferen Ursachen von Strukturschwäche, Bevölkerungsrückgang, geringerem Vermögen und Populismus im Osten werden ausgeblendet, die Folgen der DDR-Diktatur für Mensch und Umwelt unter den Teppich gekehrt. Die weichgespülte Erinnerung an die alte Bundesrepublik indessen forciert eine unrealistische Erwartungshaltung. Denn das Wirtschaftswunder ging bereits in den 1970er Jahren zu Ende, und Arbeitslosigkeit, Industrieabbau und Wohnungsnot gehören ebenso zur westdeutschen Geschichte wie hohe Wachstumsraten – ebenso wie die Ostvertriebenen und ihre schwierige Integration oder die Konflikte um die Wiederbewaffnung und die Stationierung von nuklearen Waffen, ebenso wie Antisemitismus und Terrorismus (von rechts wie links) sowie das Aufkommen neuer sozialer Bewegungen und der Ruf nach Basisdemokratie.
In dieser Amnesie liegt eine gewisse Ironie, denn Deutschland hat eine ausgeprägte Erinnerungskultur, die für eine ehrliche Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit steht. Das kollektive Gedächtnis befindet sich jedoch zunehmend unter Druck, von links wie rechts. Die Erinnerung an das verbrecherische NS-Regime mag den direkten Weg zu einer Rückkehr nach 1933 erschweren – den Nationalstolz der Populisten hat es nicht aufhalten können. Ein Opfer der »Erinnerungskriege« ist die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Wiedervereinigung. »Ostalgie« wie »Westalgie« haben sich hier breit gemacht. Die damit verbundene Flucht vor der Realität führt zu einer gewissen Mutlosigkeit. Dass man sich früher Herausforderungen ebenso stellen musste wie heute, ist vergessen. Statt Probleme anzugehen, weicht man ihnen aus.
Der öffentliche Appell an die Geschichte steht in einem Spannungsverhältnis zur Herangehensweise des Historikers. Für viele Bürger ist die Geschichte vor allem ein Fundus an Lehren und Mahnungen für die Gegenwart. Wie es im vielzitierten Spruch heißt: »Wer nicht aus der Geschichte lernt, ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen.« Der dahinterstehende Gedanke, Ereignisse könnten sich wiederholen, führt dazu, Parallelen zwischen heute und damals zu suchen. Die Vergangenheit soll der Gegenwart dienen, soll Antworten auf heutige Fragen geben. Darin liegt ihre Relevanz. Die meisten Historiker blicken genau in die entgegengesetzte Richtung. Sie versuchen, die Gegenwart hinter sich zu lassen und in eine vergangene Welt einzutauchen, um die damaligen Mentalitäten, Gewohnheiten und Machtverhältnisse zu rekonstruieren.[3] Der Reiz der Vergangenheit liegt hier in ihrer Andersartigkeit, nicht in ihrer Ähnlichkeit. Dieses so unterschiedlich motivierte Interesse an der Geschichte, das der Öffentlichkeit und das der Historikerzunft, birgt jeweils eigene Gefahren. Übertreibt man den Historismus, wird Geschichte zum therapeutischen Zufluchtsort vor der Gegenwart und verliert jegliche Relevanz. Schaut man wiederum nur mit der Brille der Gegenwart auf die Vergangenheit, verschwinden die damaligen Denk- und Verhaltensweisen aus dem Blick.
Für die deutsche Debatte ist dieses Spannungsverhältnis aufgrund der zentralen Rolle der Hitlerjahre als dem historischen Bezugspunkt der deutschen Geschichte von besonderer Bedeutung. Ohne Zweifel waren der Holocaust und der Vernichtungskrieg im Osten singuläre Verbrechen, die einen besonderen Platz in der Erinnerung verdienen. Aber Erinnerung und historische Perspektive sind nicht dasselbe. »Nie wieder!« ist ein gutes Leitmotiv, das uns daran erinnert, wo wir nicht enden wollen. Doch 1933 ist nicht unbedingt der beste historische Bezug, um die heutige Situation einzuschätzen. Weder politisch noch wirtschaftlich, weder geistig noch international stehen wir an einem Wendepunkt wie kurz vor 1933. Allein auf dieses Jahr zu schauen, kann zu einem Tunnelblick führen.
Eine offene Geschichte
Die blockierte Republik vollzieht eine Art Doppelschritt: einen Schritt zurück, um die Ursachen der gegenwärtigen Blockaden zurückzuverfolgen und sie in größere historische Bögen einzuordnen. Aber auch einen Schritt vorwärts, in die Zukunft, um – mit dem historischen Wissen im Hinterkopf – nach vorne zu blicken und die Chancen für Veränderungen aufzuzeigen. Hier liegt der entscheidende Mehrwehrt des historischen Vorgehens. Statt die Hindernisse nur strukturell zu betrachten, lenkt es unseren Blick auf ihre Entstehung und die vorhandenen Handlungsspielräume. Die gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind weder naturgegeben noch Schicksal. Sie sind menschengemacht. Es hat sie in der Geschichte der Bundesrepublik immer gegeben, und die Menschen haben sich ihnen immer wieder mutig gestellt. Eine Auseinandersetzung mit unserer Geschichte zeigt: Veränderung ist möglich.
1Demokratie auf dem Prüfstand
Der Aufstieg des Populismus in Deutschland ist bemerkenswert. In weniger als zehn Jahren wuchs die 2013 gegründete »Alternative für Deutschland« (AfD) von einem liberal-konservativen Zirkel, der die Euro-Rettungspolitik kritisierte, zu einer rechtspopulistischen Volkspartei heran. 2017 zog sie mit 12,6 Prozent der Zweitstimmen in den Bundestag ein. Zwei Jahre später wurde sie bei der Landtagswahl in Sachsen mit 27,5 Prozent zweitstärkste Kraft, knapp hinter der CDU. Viele hofften, dass Enthüllungen rechtsextremer »Remigrations«-Pläne im Januar 2024 und die anschließenden Massendemonstrationen gegen rechts den Zulauf stoppen könnten – doch das Gegenteil geschah. Bei der Landtagswahl 2024 erreichte die AfD in Thüringen mit einem Drittel der Stimmen Platz eins. Gleichzeitig trat mit dem »Bündnis Sahra Wagenknecht« (BSW) eine populistische Bewegung auf, die sozialistische mit nationalistischen Positionen verbindet. In Sachsen, Brandenburg und Thüringen erreichte das BSW zwischen 12 und 16 Prozent. Fast jede zweite Stimme in diesen Ländern ging somit an Populisten. Im Westen ist der Anteil geringer, doch bei der Bundestagswahl im Februar 2025 erzielte die AfD landesweit stolze 20,8 Prozent und in den östlichen Bundesländern sogar 38 Prozent. Das BSW verpasste mit 4,97 Prozent haarscharf den Einzug in den Bundestag.
Vollzieht sich vor unseren Augen der Niedergang der Demokratie? In der jungen Bundesrepublik wurde immer wieder betont: Bonn ist nicht Weimar. Richtig. Aber Berlin ist nicht Bonn. Hat sich nach fast achtzig Jahren Bundesrepublik – dem längsten demokratischen Kapitel in der deutschen Geschichte – die Demokratie aufgezehrt? Oder ist sie stark genug, sich zu erneuern?
Zweifellos ist die parlamentarische Demokratie in Deutschland, wie anderswo, an einem Scheideweg angelangt. Um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, müssen wir zunächst fragen, wer die Menschen sind, die für die AfD stimmen, und was sie bewegt. Darüber hinaus ist der Vergleich mit anderen Ländern wichtig, denn Populismus ist ein internationales Phänomen. Damit ist aber nicht gesagt, dass er ein und derselben Quelle entspringt und in ein und dieselbe Richtung fließt. Neben Gemeinsamkeiten gibt es Abweichungen und Unterschiede, die von der speziellen Ost-West-Konstellation Deutschlands sowie seiner besonderen wirtschaftlichen Lage und politischen Kultur geprägt sind.
Um die Zukunftschancen unserer parlamentarischen Demokratie einschätzen zu können, ist ein Blick in die Vergangenheit notwendig. Die Umwälzungen nach der Wiedervereinigung haben maßgeblich zur aktuellen Misere beigetragen. Es greift aber zu kurz, die Diagnose wie üblich erst ab 1990 zu stellen. Damit werden wichtige Entwicklungen übersehen. Die Ostdeutschen kamen in die schwierige Transformationszeit nach 1990 mit Erwartungen und Frustrationen, die sie vor 1990 in der DDR gesammelt hatten. Nicht weniger wichtig ist es, die alte Bundesrepublik miteinzubeziehen. Krisen und Konflikte gab es auch hier vor 1990 mehr als genug. Sie zu sehen hilft, unser – sagen wir es offen – idealisiertes, weichgezeichnetes Bild der Demokratie der Wirklichkeit anzupassen. Konflikte gehören zur Demokratie dazu, und wir sollten uns daran erinnern, dass solche Herausforderungen bewältigt werden können und in der Vergangenheit bewältigt wurden.
Populismus mit deutschem Akzent
Deutschland ist in Sachen Rechtspopulismus ein Nachzügler. In Frankreich agiert der »Front National« seit 1972 – da war Alice Weidel noch nicht einmal geboren. Jörg Haider übernahm 1986 das Ruder der »Freiheitlichen Partei Österreichs« (FPÖ). Viktor Orbán gründete »Fidesz« in Ungarn 1988 und wurde zehn Jahre später zum ersten Mal Ministerpräsident. Die »Lega Nord« in Italien existiert seit 1991, und Geert Wilders’ »Volkspartei für Freiheit und Demokratie« (PVV) in den Niederlanden seit 2006. Donald Trump hatte zwei Wegbereiter in Ross Perot und Pat Buchanan – den US-Präsidentschaftskandidaten in den Jahren 1992 und 1996. Auch in Deutschland gab es Vorboten, mit der in München gegründeten Partei »Die Republikaner« (REP) Anfang der 1980er Jahre und 2000 mit der »Partei Rechtstaatliche Offensive« (»Schill-Partei«) in Hamburg. Beide waren aber zu klein und zerstritten, um den Sprung auf die Bundesebene zu schaffen. Das sollte erst der AfD gelingen.
Was sagt der späte populistische Durchbruch über den Zustand der Demokratie in Deutschland aus? Die Gründe für den internationalen Vormarsch der Populisten sind vielfältig. Allen Ländern gemeinsam sind die zunehmende Distanz vieler Wähler zu gewählten Repräsentanten und Entscheidungsträgern und das damit einhergehende Gefühl der Machtlosigkeit. Dies resultiert sowohl aus der Verlagerung von politischen Entscheidungen auf Zentralbanken und internationale Organe, die hinter verschlossenen Türen tagen, als auch aus einer wachsenden Kluft zwischen Politikern und Bürgern. Gewählte Volksvertreter werden zunehmend als Angehörige einer Großstadtelite wahrgenommen, die sich mehr um andere globale Eliten kümmern als um die »eigenen Leute« daheim. Schon 2004 konstatierte der britische Politikwissenschaftler Colin Crouch, dass Globalisierung und der Niedergang der Arbeiterbewegung zu einer »Post-Demokratie« führen würden. Dass sich die etablierten Parteien in ihren Positionen einander angenähert haben, hat das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie weiter sinken lassen: Warum zur Wahl gehen, wenn die neue Regierung am Ende doch nur die gleiche Politik macht wie die Regierung zuvor? Sinkende Wahlbeteiligung und der Mitgliederschwund der etablierten Parteien seit den 1990er Jahren waren wichtige Vorboten der populistischen Wende. Soziale Medien verschärfen die Polarisierung und verschieben mit ihren Echokammern die Grenzen des Sag- und Machbaren. Schließlich verweisen viele Beobachter auf die wachsende Ungleichheit im Zeitalter der Globalisierung. Warum sich für ein System einsetzen, das einen zum Verlierer macht? Populisten entpuppen sich als die wahren Nutznießer des Neoliberalismus und seiner sozialen Kosten.[1]
Betrachtet man Deutschland, so fallen einige Parallelen ins Auge. Seit 2000 haben die alten Parteien eine Million und damit fast die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Die Wahlbeteiligung ging zurück, wenn auch etwas später als in den meisten Nachbarländern. Die AfD formierte sich 2013 ganz gezielt als Protest gegen die nicht gewählten »Bürokraten in Brüssel« sowie Angela Merkels Euro-Rettungspolitik, die von der Kanzlerin stets als »alternativlos« hingestellt wurde. Seitdem wurden regelmäßig alle Teile des parlamentarischen Systems als undemokratisch angegriffen: Bundestagsabgeordnete seien »korrupt«, die Kanzlerin sei eine »Diktatorin« und Minister die »Erfüllungsgehilfen« internationaler Organisationen. Wie anderswo sind die alten Volksparteien näher aneinandergerückt und haben so ihre markante Positionierung verloren – die ehemals radikalen Grünen träumten davon, Volkspartei zu werden, eine CDU-Kanzlerin setzte sich für Migration ein. Statt großer Alternativen gab es große Koalitionen. Die AfD nennt es »Parteienkartell«. So betrachtet, kann der Durchbruch des Populismus in Deutschland kaum verwundern.
Doch so einfach liegen die Dinge nicht. Die landläufigen Erklärungen des Populismus pflegen auf die bekannten Schwachstellen im demokratischen System hinzuweisen, oft auf so dramatische Weise, dass dessen Niedergang fast vorprogrammiert erscheint. Die Thesen sind überfrachtet – »überdeterminiert«, wie man in der Wissenschaft sagt. Sie verleiten zu Fatalismus.
Wenn man die Entwicklung genauer betrachtet, ergibt sich eine andere Lesart. Beginnen wir mit der Zeit vor der Corona-Pandemie. Jedes Jahr wird das Vertrauen der Europäer in das politische System ihres Landes gemessen. Während es in Italien, Spanien und Griechenland zwischen 2004 und 2018 absackte, nahm das Vertrauen in Deutschland zu. Und zwar im Osten wie im Westen, wenn auch auf unterschiedlichem Niveau. Im Jahr 2005 erklärten 63 Prozent der Ostdeutschen, die Demokratie sei »die beste Staatsform« (85 Prozent der Westdeutschen), 2019 waren es 79 Prozent (im Westen 91 Prozent). Zum ersten Zeitpunkt glaubten noch 22 Prozent, es gäbe »eine andere Staatsform, die besser ist« (im Westen 6 Prozent), später waren es nur noch 10 Prozent (im Westen 4 Prozent).
Man mag entgegnen, dass Idee und Wirklichkeit zweierlei sind. Aber auch in Bezug auf die demokratische Praxis stieg die Befürwortung. Ein Jahr nach der Wiedervereinigung waren lediglich 40 Prozent der Ostdeutschen »sehr« oder »ziemlich zufrieden« damit, wie die »Demokratie in Deutschland funktioniert« (im Westen 70 Prozent). Im Jahr 2005 sank dieser Wert gar auf einen Tiefstand von 30 Prozent (im Westen 60 Prozent). Danach ging es allerdings bergauf, 2014 erreichte die Zufriedenheit 60 Prozent (im Westen 75 Prozent), bevor sie 2023 wieder abfiel – auf 40 Prozent. Dass es in diesen Jahren allerlei Versäumnisse gab, die den Deutschen heute das Leben erschweren, änderte nichts an der überwältigenden Zustimmung, die die alten Parteien damals genossen. Angela Merkel hat sich nicht selbst zur Kanzlerin gewählt. Von einer unausweichlichen Entfremdung vom demokratischen System kann in den Jahren vor Corona keine Rede sein. Im Gegenteil: Die Mehrheit der Deutschen zeigte sich zufrieden mit der Demokratie. Nur eine Minderheit wandte sich ab.[2]
Der Populismus wird gerne als Zufluchtsort für die Verlierer der Globalisierung dargestellt. Das mag die Erfolge von Donald Trump in den USA und Marine Le Pen in Frankreich erklären. Für Deutschland macht das wenig Sinn. Wenn ein Land von der Globalisierung profitierte, dann war es Deutschland. Die 2010er Jahre, in denen die AfD Fuß fasste, waren gute Jahre. Der Erfolg war zum Teil auf Treibsand gebaut, wie noch zu sehen sein wird. Damals allerdings warf der Exportboom beträchtliche Gewinne ab. Die Wirtschaft wuchs im Durchschnitt um rund 1,5 Prozent zwischen 2009 und 2018, und mit ihr die Zahl der Arbeitsplätze. Lag die Arbeitslosenquote 2005 noch bei 21 Prozent im Osten (11 Prozent im Westen), war sie 2019 auf 7 Prozent gefallen (5 Prozent im Westen). Die Angst, arbeitslos zu werden, nahm ab. Was blieb, war die Sorge um die eigene finanzielle Absicherung – auch in der Mitte der Gesellschaft.[3] Vermögensunterschiede sind seit 2014 leicht zurückgegangen, aber die Einkommen klafften weiter auseinander. Allerdings sind die Löhne in Deutschland zwischen 2013 und 2020 inflationsbereinigt um 20 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: In Großbritannien stagnieren sie seit 2008, in Italien sind sie sogar gesunken. Dank des 2015 eingeführten Mindestlohns hatten selbst Geringverdiener zumindest etwas mehr Geld in ihrer Lohntüte. Weniger Menschen sind seitdem im Niedriglohnsektor beschäftigt, nicht mehr. Trotz Ungleichheit ging es also am Vorabend der Pandemie fast allen Menschen besser als in den ersten zehn, fünfzehn Jahren nach der Einheit.[4]
Die AfD ist nicht die Partei des Prekariats. So hätte sie es 2017 nie in den Bundestag geschafft. Im Gegenteil, vielen ihrer Wähler geht es gar nicht so schlecht. Sie gehören nicht zu den wirklich Abgehängten der Globalisierung. Was sie zur AfD trieb, war die Angst, abgehängt zu werden. Das internationale Narrativ von den Verlierern der Globalisierung entwickelte eine Eigenlogik, die die Selbstwahrnehmung färbte. Bei der Bundestagswahl 2017 erhielt die AfD überdurchschnittlich viele Stimmen von Wählern, die sich zu den Verlierern zählten. Dabei war die AfD im Westen in Baden-Württemberg und Bayern und erneut nach der Wahl 2025 am stärksten – leistungsstarke Industriestandorte, für die der Weltmarkt besonders lukrativ war und ist. Doch wie lange noch? Viele Facharbeiter waren verunsichert. Im Osten feierte die AfD ihren größten Erfolg ebenfalls im dynamischsten Bundesland, in Sachsen.[5] Hier speiste sich die Angst aus der Erinnerung an die Wirren nach der Wende und die Arbeitslosigkeit. Wie sicher war das Leben, das man sich so mühsam wiederaufgebaut hatte? AfD-Wähler waren eher Gewerkschaftsmitglieder mit guten Jobs als Gelbwesten und Teilzeitarbeiter mit »shit jobs«. Hier liegt ein wichtiger Unterschied zu Trumps Attraktivität im deindustrialisierten »rust belt«, ebenso wie zu Le Pens Rückhalt im strukturschwachen Norden Frankreichs.
Wie man sieht, hängt das Urteil darüber, wie stark oder schwach die Demokratie ist, zu einem großen Teil davon ab, welchen Zeitrahmen man wählt. Nimmt man einen kurzen Zeitraum, sagen wir von 2020 bis 2025, sieht es sehr düster aus. Es wimmelt nur so von Wutbürgern, Verschwörungstheorien und populistischen Erfolgen bei Landtags- und Kommunalwahlen. Geht man zehn, fünfzehn Jahre zurück, gewinnt das Bild an Farbe. Die momentane Krise der Demokratie fühlt sich besonders dramatisch an, weil sie auf eine lange Phase wachsender Zustimmung folgt. Deutschland ist nicht Italien, Spanien oder Griechenland, wo das Vertrauen in das politische System seit 2000 stetig schwindet. Das macht die deutsche Krise nicht weniger bedeutsam, weist aber auf ihre besondere Dynamik hin.
Der Umschwung wurde maßgeblich durch zwei Ereignisse ausgelöst: die Migrationswelle 2015 sowie die Corona-Pandemie. Die Ankunft von fast einer Million Flüchtlinge polarisierte die deutsche Gesellschaft spürbar. Während 55 Prozent der Bevölkerung den Flüchtlingen halfen – ein historisches Ausmaß von Hilfsbereitschaft –, reagierten andere mit Angst, Ablehnung und Abwehr, nicht nur, aber vor allem im Osten des Landes, wo fremdenfeindliche Tendenzen stärker ausgeprägt waren und sind. Die Unzufriedenheit mit der Flüchtlingspolitik übertrug sich auf das politische System im Ganzen – im Laufe des Jahres sank die positive Einstellung gegenüber der Demokratie im Osten um 12 Prozent ab (4 Prozent im Westen).[6] Merkels Flüchtlingspolitik galt vielen als »Volksverrat«. Und das »Volk« erhob sich gegen seine Vertreter. Im Oktober 2015 errichteten Demonstranten in Dresden selbstgebastelte Galgen für die Bundeskanzlerin und ihren Vize Sigmar Gabriel. Für die demokratische Kultur war es ein Dammbruch. Schlimmeres sollte folgen. Angriffe auf Asylbewerber und ausländische Mitbürger nahmen dramatisch zu. Am 2. Juni 2019 wurde Walter Lübcke, der Regierungspräsident von Kassel, vor seinem Haus erschossen. Er hatte sich für Flüchtlinge und gegen Populisten eingesetzt. Die Fronten verhärteten sich.
Die Pandemie bot Populisten einen zusätzlichen Resonanzboden. Lockdowns beeinträchtigten das bereits geschwächte Ökosystem des demokratischen Lebens und verringerten die politische Beteiligung. Das Vereinsleben – die Vorschule demokratischer Tugenden – litt. Hatte 2018 noch jeder fünfte Bürger in Ost und West Kontakt mit Politikern, war es 2020 nur noch jeder achte. Was sich hielt, waren Demonstrationen, nur dass diese sich jetzt zunehmend gegen die politische Elite richteten. Zum anderen förderte die Pandemie in Deutschland wie andernorts Verschwörungstheorien aller Art, in denen gewählte Entscheidungsträger zu Handlangern fremder Interessen – Big Pharma, dem jüdischen Kapital, einer Weltregierung – wurden und die Pandemie benutzten, um die staatliche Macht auszuweiten. Kritiker der Impfkampagnen stilisierten Bürger zu Opfern staatlicher Willkür. In Ostdeutschland lagen die Impfraten ein Viertel unter denen im Westen, auch weil die Naturheilkunde hier besonders verwurzelt ist.[7] Das Misstrauen gegen die Schulmedizin verstärkte das Misstrauen gegen den Staat und Impfungen. In allen europäischen Ländern sind Einschränkungen und Impfpolitik heftig diskutiert worden, aber in keinem scheint diese Zeit so tiefe Gräben hinterlassen zu haben wie in Deutschland und Italien. Die Einsetzung eines Corona-Untersuchungsausschuss war ein zentrales Wahlkampfthema von AfD und BSW bei den Landtagswahlen 2024 und von Giorgia Melonis rechten Brüdern Italiens (Fratelli d’Italia). Der Verdacht eines geplanten Überwachungsstaates findet im Land der früheren Stasi besonders Gehör.
Wladimir Putins Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 und die dadurch ausgelöste Flüchtlingskrise und die Debatte, inwieweit die Bundesrepublik Kiew militärisch unterstützen soll, haben den Populisten neue Angriffsflächen geliefert. Es ist vor allem das Schlüsselthema der Migration, mit dem sich viele Ängste triggern lassen: in Bezug auf Kriminalität und nationale Sicherheit, »Überfremdung« und die Erosion des Sozialstaats durch »Schmarotzer«. Die deutschen Ressentiments gleichen den Äußerungen Donald Trumps – mit einem wichtigen Unterschied: Für Trump stellen Migranten unter anderem eine Gefahr dar, weil sie amerikanische Jobs »stehlen«. Für deutsche Populisten sind sie umgekehrt ein Problem, weil sie angeblich keinen Job wollen. Man kann dies mit der unterschiedlichen wirtschaftlichen Lage erklären. Aber es weist auch auf eine spezifisch deutsche Moralvorstellung hin, die den »faulen Fremden« braucht für das Selbstverständnis vom »tüchtigen Deutschen«. Die Debatten zu Abschiebungen, Sachleistungen statt Geld für Asylbewerber und zur Kürzung des Bürgergelds für ukrainische Flüchtlinge sind allesamt von dem Bild geprägt, dass fremde Menschen nach Deutschland kommen, um hier in der »Hängematte« zu liegen. Eine fixe Idee mit fatalen Folgen für eine alternde Gesellschaft.
Wie Trump wollen AfD und BSW das eigene Land aus dem Ukrainekrieg heraushalten. Ihr Isolationismus drückt jedoch unterschiedliche Gefühle aus. Für Trump ist der Rückzug als globale Ordnungsmacht ein Ausdruck von Stärke: »Make America Great Again«. Deutsche Populisten dagegen betreiben Angstpolitik: Deutschland könnte in einen nuklearen dritten Weltkrieg hineingezogen werden. Paris, London und Amsterdam liegen ebenfalls in Reichweite russischer Interkontinentalraketen, aber dort herrscht weniger Angst. Die AfD und das BSW kapitalisieren lange kultivierte Emotionen.[8] Millionen protestierten gegen die Stationierung von atomaren Waffen in den 1950er und 80er Jahren. Die Grünen haben sich von diesem Teil ihrer Geschichte gelöst, aber in weiten Teilen der Bevölkerung lebt die Angst fort. Antiamerikanismus und ein im Osten besonders ausgeprägtes Verständnis für Putin führen dazu, dass ein russischer Angriff vielen Menschen dort eher gerechtfertigt und damit auch greifbarer erscheint. Während Putins nukleare Drohungen von unseren Partnern als Bluff abgetan werden, fallen sie in Deutschland auf fruchtbaren Boden.
Die AfD ist zu einer Volkspartei angewachsen. Nach einer sozio-ökonomischen Interessengruppe zu suchen, ist wenig sinnvoll. Ihr Krisendiskurs bedient verschiedene Milieus. Arbeiter wählen die Partei ebenso wie Selbstständige, junge Menschen ebenso wie Rentner. Sie mag vorwiegend Männer ansprechen, aber Frauen sind auch nicht immun. Bei der Landtagswahl 2024 in Sachsen wählte jede vierte Frau die AfD, um nur ein Beispiel zu nennen. Bürger mit Hauptschulabschluss mögen bevorzugt zur AfD finden, aber nichtsdestoweniger gaben in Sachsen 26 Prozent aller Wähler mit Abitur und 16 Prozent jener mit Hochschulabschluss der Partei ihre Stimme.[9] Die Gründe für den Erfolg von Populisten werden häufig in Defiziten ihrer Wählerschaft gesucht – einem Mangel an Wissen, Geld und Sicherheit. Damit machen wir es uns zu bequem, als ob die Ursachen nur am Rande der Gesellschaft zu finden wären. Es lenkt davon ob, wie verbreitet und attraktiv rechtsextreme Werte innerhalb der »normalen« Gesellschaft sind. Jüngste Studien zeigen, wie rechtsradikale Bewegungen in Europa mit ihrem Versprechen von Gemeinschaft, Heimat und Opferbereitschaft auch Jugendliche aus bürgerlichen Familien anziehen.[10] Die Frage ist nicht, was diesen Gruppen fehlt, sondern warum die demokratischen Parteien es nicht schaffen, sie mit vergleichbar attraktiven Idealen zu gewinnen.
Der Vormarsch der Populisten stellt die parlamentarische Demokratie vor ein Dilemma. Bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland zwischen 2004 und 2014 blieb jeder zweite Bürger zu Hause, im Westen lag die Wahlbeteiligung zwar um zirka 10 Prozent höher als im Osten, nahm aber ebenfalls ab. Ein Armutszeugnis für ein politisches System, das seine Legitimität durch Wahlen erhält. So betrachtet, haben AfD und BSW einem geschwächten System einen wichtigen Schub gegeben. Bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im Herbst 2024 gingen 74 Prozent der Bürger zur Wahl – ein historisches Hoch –, und bei der Bundestagswahl 2025 kletterte die Wahlbeteiligung auf fast 83 Prozent, unerreicht seit 1987.[11]
Natürlich ist es gut, wenn mehr Menschen an Wahlen teilnehmen. Es ist auch gut, wenn die Parteien um ihre Stimmen kämpfen müssen, nur tun sich die etablierten demokratischen Parteien damit schwer, vor allem im Osten, wo sie nie recht Wurzeln geschlagen haben. Bei der Bundestagswahl 2017 schnappte die AfD der CDU und SPD nicht nur 1,5 Millionen Wähler weg, sondern mobilisierte weitere 1,5 Millionen Nichtwähler. Damit erreichte die junge AfD mehr Nichtwähler als die alte SPD. Bei der Landtagswahl in Thüringen 2024 strömten mehr als dreimal so viele Nichtwähler zur AfD als zur CDU, und bei der Bundestagswahl 2025 doppelt so viele. Verdrossene Bürger hatte es natürlich auch früher schon gegeben, aber jetzt gab es für sie eine Partei. Frühere Nichtwähler und Protestwähler wurden zu Stammwählern.[12]
Zeit für ein Zwischenfazit: Brandmauer und Massendemonstrationen haben die AfD nicht eindämmen können. Zwar bleibt die Partei weiterhin von jeglicher Regierungsbeteiligung ausgeschlossen, aber sie ist gleichzeitig gewachsen und weiter nach rechts gerückt. Die ständige Mahnung »Nie wieder 1933« hat sich als kontraproduktiv erwiesen. In die rechte Ecke gestellt zu werden, hat den Trotz der frustrierten Wähler und Wählerinnen nur verstärkt. Als Stigma hat der Begriff »faschistisch« viel von seiner Kraft eingebüßt. Das hätte man vorhersehen können. Seit Jahren weisen Untersuchungen darauf hin, wie verbreitet rechtsgerichtete Haltungen sind. Direkte Vergleiche mit 1933 sind aber auch historisch problematisch. Deutschland steckt weder in einer Weltwirtschaftskrise mit einem Heer von Bedürftigen, noch halten einheimische Eliten die Steigbügel für die AfD bereit – das ist auch ein wichtiger Unterschied zu Trump mit seinem Rückhalt in der Tech- und Finanzwelt. Die AfD hat zweifellos ebenso autoritäre wie »völkische« Züge, aber Krieg steht nicht wie bei Hitler im Zentrum ihrer Weltanschauung.[13]
Das macht die AfD nicht weniger gefährlich, bedeutet aber, dass Vergleiche mit populistischen Bewegungen anderswo vielleicht aufschlussreicher wären. Diese mahnen zu nüchternem Realismus. Darauf zu hoffen, dass sich eine gemäßigte, verfassungstreue Fraktion in der Partei durchsetzt, erscheint wenig wahrscheinlich. Das zeigt etwa der Blick nach Finnland: Mit der Spaltung der »Wahren Finnen« (»Perussuomalaiset«, PS) hat der extreme Flügel 2017 das Ruder übernommen. Das Mitregieren führt nicht zwangsläufig zur Mäßigung. In Italien mag sich Giorgia Meloni gezügelt haben, aber die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) ist nach zwei Regierungsbeteiligungen genauso extremistisch wie zuvor. In einer sich fragmentierenden Parteienlandschaft halten Brandmauern nicht ewig. In Finnland schloss die bäuerlich-liberale Zentrumspartei 2015 ein Bündnis mit den Populisten, um regieren zu können. In Schweden ist die konservativ-liberale Minderheitsregierung seit 2022 von den rechtspopulistischen »Schwedendemokraten« abhängig. In beiden Ländern haben Populisten die Migrationspolitik verschärft und den Sozialetat gekürzt, aber sie rütteln nicht an den Grundpfeilern der Demokratie. Wahlen, unabhängige Justiz und freie Medien stehen nicht zur Disposition. Anders in Polen, Ungarn, Argentinien oder den Vereinigten Staaten. Hier sind die durch Ungleichheit angetriebene Polarisierung und das politische Misstrauen so weit fortgeschritten, dass die Demokratie selbst auf dem Spiel steht.[14]
Für Deutschland fällt der Befund gemischt aus. Das Vertrauen in die Verfassung und Justiz ist weiterhin vergleichsweise hoch, das in den Staat (»Kontrollverlust«) und die Medien (»Lügenpresse«) ist jedoch am Schwinden. Den alten Parteien gelang es in Zeiten des Wirtschaftswachstums nicht, den Aufstieg der AfD zu stoppen. In schwierigen Zeiten wird der Kampf umso härter.