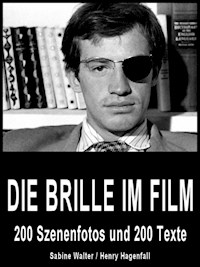
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Brille im Film: ein interessantes Thema! Warum? Wenn man Filme unter diesem Aspekt betrachtet, wird deutlich, dass sich in der Filmgeschichte auf unterhaltsame Weise die Brillengeschichte widerspiegelt. Und gelegentlich wird im Kino sogar Brillengeschichte geschrieben, etwa wenn eine Filmbrille die Brillenmode im wirklichen Leben beeinflusst. Kein Film-Accessoire ist geeigneter, um einen Schauspieler visuell besser zu charakterisieren als eine Brille. Die Brille sitzt nun mal genau da, wo jeder Schauspieler seine größte Ausdrucksmöglichkeit hat, nämlich vor den Augen; was wäre ein Schauspieler ohne ausdrucksvolles "Augenspiel"? Manchmal werden im Film sogar ganz individuelle Brillengeschichten erzählt, etwa wenn ein Schauspieler seine unvorteilhafte Brille durch eine modische Brille ersetzt und so eine persönliche Entwicklung deutlich gemacht wird. Noch sehr viele andere unterhaltsame Beispiele, wie auf die eine oder andere Weise die Brille im Film eingesetzt wird, werden Sie in diesem Buch finden. In den Anfängen des Films war die Brille einfach ein Unterscheidungsmerkmal. Später charakterisierte sie oftmals Sonderlinge oder Intellektuelle. Und in einigen Genres, wie etwa dem Western, war sie früher fast tabu: Ein Westernheld mit Brille hätte es nicht einfach gehabt, vom Publikum akzeptiert zu werden - Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. Was die Schauspielerinnen betrifft, mussten die Regisseure sogar noch bis in die 1970er Jahre viel Überzeugungsarbeit leisten, bevor sie ihnen eine Brille aufsetzen durften. Die Akzeptanz der Brille hat aber auch bei den Schauspielerinnen längst enorm aufgeholt. Es ist daher heutzutage deutlich einfacher geworden, eine Schauspielerin mit Brille agieren zu lassen; viele in diesem Buch aufgeführte hübsche Schauspielerinnen mit ebenso hübschen Brillen beweisen das. All dies und noch viel mehr wird in diesem Buch anschaulich erläutert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE BRILLE IM FILM
von
Sabine Walter und Henry Hagenfall
VORWORT
Die Brille im Film: ein interessantes Thema! Warum? Wenn man Filme unter diesem Aspekt betrachtet, wird deutlich, dass sich in der Filmgeschichte auf unterhaltsame Weise die Brillengeschichte widerspiegelt. Und gelegentlich wird im Kino sogar Brillengeschichte geschrieben, etwa wenn eine Filmbrille die Brillenmode im wirklichen Leben beeinflusst. Kein Film-Accessoire ist geeigneter, um einen Schauspieler visuell besser zu charakterisieren als eine Brille. Die Brille sitzt nun mal genau da, wo jeder Schauspieler seine größte Ausdrucksmöglichkeit hat, nämlich vor den Augen; was wäre ein Schauspieler ohne ausdrucksvolles “Augenspiel”? Manchmal werden im Film sogar ganz individuelle Brillengeschichten erzählt, etwa wenn ein Schauspieler seine unvorteilhafte Brille durch eine modische Brille ersetzt und so eine persönliche Entwicklung deutlich gemacht wird. Noch sehr viele andere unterhaltsame Beispiele, wie auf die eine oder andere Weise die Brille im Film eingesetzt wird, werden Sie in diesem Buch finden.
Die Zeiten, in denen Brillen etwas Ungewöhnliches waren, sind schon lange vorbei. Ungefähr jeder Zweite trägt heute stets oder gelegentlich Brille. Diese rasante Entwicklung lässt sich auch an der Geschichte des Films ablesen. In den Anfängen des Films war die Brille einfach ein Unterscheidungsmerkmal. Später charakterisierte sie oftmals Sonderlinge oder Intellektuelle. Und in einigen Genres, wie etwa dem Western, war sie früher fast tabu: Ein Westernheld mit Brille hätte es nicht einfach gehabt, vom Publikum akzeptiert zu werden - Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. Was die Schauspielerinnen betrifft, mussten die Regisseure sogar noch bis in die 1970er Jahre viel Überzeugungsarbeit leisten, bevor sie ihnen eine Brille aufsetzen durften. Die Akzeptanz der Brille hat aber auch bei den Schauspielerinnen längst enorm aufgeholt. Es ist daher heutzutage deutlich einfacher geworden, eine Schauspielerin mit Brille agieren zu lassen; viele in diesem Buch aufgeführte hübsche Schauspielerinnen mit ebenso hübschen Brillen beweisen das.
Dieses Buch erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, bei der enormen Vielzahl an bebrillten Schauspielern ist das auch gar nicht möglich. Natürlich mussten wir unter den vielen Filmen, in denen Brillen vorkommen, eine Auswahl treffen. Dabei haben wir uns bemüht, einigermaßen repräsentativ vorzugehen. Aber keine Frage, jede Auswahl ist zu einem guten Teil subjektiv. Wie Sie bemerken werden, sind die meisten Filme in diesem Buch nur einmal vertreten, einige wenige Filme werden aber auch durchaus mehrmals herangezogen. Das hat nichts mit unserer Vorliebe für diesen oder jenen Film zu tun, sondern einfach damit, dass manche Filme mehr als eine interessante Brille zu bieten haben. Es gibt mittlerweile eben eine ganze Menge Regisseure und Schauspieler, welche die vielen Ausdrucksmöglichkeiten von Brillen sehr zu schätzen wissen. Unser Ziel konnte es bei Zusammenstellung dieses Buches daher nicht sein, für jeden Filmjahrgang oder jedes Filmjahrzehnt immer die gleiche Anzahl Brillen abzubilden, denn wie wir bei der Arbeit an diesem Buch feststellen mussten, gibt es gute “Brillenjahre” und eher mäßige “Brillenjahre”. Woran das liegt? Als Teil der Mode unterliegt die Brille den gleichen Mode-Schwankungen: In manchen Jahren gibt es nur Modelle, die man schon hundert Mal gesehen hat. In anderen Jahren tauchen dagegen plötzlich neue reizvolle Brillenmodelle auf. Neben vielen Beispielen aus Kinofilmen finden Sie in diesem Buch übrigens auch einige wenige Beispiele aus TV-Filmen, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollten.
Jeder Film, der in diesem Buch mit einer Brille aufgeführt wird, wurde von uns sehr aufmerksam gesichtet. Bei allen Brillenbildern handelt es sich dementsprechend immer um Szenenbilder und nicht um die verbreiteten Standfotografien, die zwar oft hübsch anzuschauen sind, doch im jeweiligen Film gar nicht vorkommen. Bei Fertigstellung waren alle in diesem Buch aufgeführten Filme im Handel erhältlich (Stand: 2011), um Lesern, die beim Blättern Lust bekommen, sich den ein oder anderen Film anzusehen, dazu die Möglichkeit zu geben.
Zu guter Letzt: Wer im Film Brille trägt, macht so oder so auf sich aufmerksam. Denn in unseren Beispielen hat das Brilletragen immer eine Bedeutung. Wann, wo und wieso - das erfahren Sie in diesem Buch. In einem vergnüglichen Bilderbogen präsentieren wir Ihnen Filmszenen aus der vergangenen und aktuellen Filmgeschichte, in denen die Brille stets mehr war als ein bloßes Requisit, sondern eine nicht unwichtige Rolle übernimmt: sozusagen die Brille als Darsteller.
Wie die Brille zum Film kam
Die Verwendung der Brille im Film ist fast so alt wie der Film selbst. Es ist daher sicherlich nicht uninteressant, kurz zu erläutern, wie der Film zur Brille kam - oder die Brille zum Film. Als der Film in den 1890er Jahren das Laufen lernte, bestand sein Repertoire für einige Jahre im Wesentlichen aus dokumentarischen Aufnahmen und kurzen Gags. Um 1900 kamen dann langsam die ersten kurzen Spielhandlungen auf; abendfüllende Spielfilme setzten sich aber erst nach dem Ersten Weltkrieg durch. Jedenfalls, als ab ungefähr 1900 die ersten kurzen Spielhandlungen aufkamen, standen die damaligen Filmemacher vor einem fundamentalen Problem. Obwohl diese Spielhandlungen der frühen Stummfilme nur wenige Minuten lang waren, bemerkten die Filmemacher, dass das Publikum den Handlungen oft nicht folgen konnte, weil es damit beschäftigt war, auf der Leinwand die verschiedenen Personen auseinanderzuhalten: Wer war wer? Das war eines der Hauptprobleme des Stummfilms, solange es ihn gab. Um dem abzuhelfen, setzten die damaligen Filmemacher auf eine starke äußere Typisierung der Rollencharaktere, und dazu wurde natürlich auch die Brille verwendet. Diese Typisierung, die sich im Laufe der Jahre immer weiter entwickelte, konnte dann abhängig von Zeit und Stummfilm ungefähr so aussehen:
# Der Schurke trug einen Schnurrbart.
# Der jugendliche Liebhaber war glattrasiert und elegant gekleidet.
# Das brave Mädchen war ganz in weiß gekleidet.
# Die leichtfertige Frau rauchte Zigarette (skandalös!).
# Ärzte, Schriftsteller und sonstige Akademiker trugen Brille.
# Ältere Männer trugen Zwicker.
# Großbürger und Adlige trugen Monokel - ihre Frauen Lorgnon.
Solche äußere Typisierung half dem Stummfilmpublikum, die Rollencharaktere auseinanderzuhalten. Wie wir oben gesehen haben, wurde dazu - abhängig vom Rollencharakter - auch die Brille samt ihrer verschiedenen Abwandlungen verwendet. Damit wurde die Brille ein wichtiges symbolisches Hilfsmittel im Stummfilm.
Die Brille im Tonfilm
Als der Tonfilm Ende der 1920er Jahre aufkam, glaubten viele Filmemacher, nun würden einige symbolische Hilfsmittel des Stummfilms wegfallen, da man ja jetzt alles sehr schnell durch Dialoge erklären konnte, zum Beispiel Berufe: “Guten Tag, Herr Oberarzt!” Doch wie sich schnell herausstellte, war diese Hoffnung zu einem beträchtlichen Teil ein Irrtum. Auch im Tonfilm behielten viele Filmschurken über Jahrzehnte ihre Schnurrbärte, Jungfrauen ihre weißen Kleidchen, alte Männer ihre Zwicker usw. Die Filmemacher hatten nämlich schnell bemerkt, dass das Publikum auch im Tonfilm jede visuelle Hilfe benötigte, um die Figuren nachhaltig unterscheiden zu können; das ist heutzutage bei den meisten Filmen auch nicht anders.
So verwundert es auch nicht, dass auch in unserer Zeit die Filmemacher gewöhnlich streng darauf achten, dass verschiedene Hauptdarsteller im gleichen Film deutlich unterscheidbare äußere Merkmale tragen. Achten Sie mal darauf, es stimmt wirklich. Der eine trägt Schnurrbart, der andere nicht; einer ist schlank, der andere ist dick; einer trägt Hut, der andere nicht; einer ist schwarz, der andere weiß; einer trägt helle Kleidung, der andere dunkle usw. Tonfilm hin oder her, auch heutzutage wird also von den Filmemachern stark mit visuellen Unterschieden gearbeitet. Und zu diesen visuellen Unterschieden gehört natürlich auch die Brille. Dabei werden allerdings oftmals Klischees bedient. Dementsprechend tragen auch in vielen heutigen Filmen Akademiker Brillen, selbstbewusste Frauen gewagte Brillen, alte Männer große Brillen, junge Leute modische Brillen, Buchhalter biedere Brillen, Unternehmer oder Militärs kantige Brillen usw. All das natürlich nicht in allen Filmen, aber in auffallend vielen. Und warum auch nicht, es sind ja nicht nur Klischees, teilweise spiegeln diese Brillen ja tatsächlich einigermaßen die Wirklichkeit wider. Aber selbst wenn nicht, es ist ja schließlich nicht die Aufgabe von Spielfilmen, die Wirklichkeit zu zeigen, denn sonst wären sie - Dokumentarfilme. Sind sie aber nicht. Und wenn es dem Publikum hilft und diese Brillen die Filmpersönlichkeit unterstreichen und gleichzeitig die Unterscheidbarkeit der Schauspieler erleichtern, ist der Zweck ja erfüllt und alle sind zufrieden.
Die Brille und die Akademiker
Wie bereits erwähnt, Akademiker - also Ärzte, Architekten, Lehrer, Schriftsteller, Wissenschaftler usw. - wurden im Stummfilm sehr oft mit Brillen ausgestattet. Das war damals kein Vorurteil, denn Akademiker trugen damals auch in der Wirklichkeit öfter Brille als manche andere Berufsgruppe, und zwar aus zwei Gründen: Erstens brauchten Akademiker - sofern sie eine Sehschwäche hatten - unbedingt eine Brille, weil ihr Beruf ständige Lektüre voraussetzte. Und zweitens konnten sich Akademiker Brillen eher leisten als manche andere Berufsgruppe. Die bebrillten Filmakademiker retteten sich dann Ende der 1920er Jahre problemlos in den Tonfilm herüber. Doch seit langer Zeit ist der stets bebrillte Filmakademiker zum Filmklischee geworden: Im Gegensatz zu früher gibt es schon lange keine Berufsgruppe mehr, die wirklich wesentlich öfter Brille tragen würde als andere Berufsgruppen. Dennoch hat sich das Klischee, dass Akademiker öfter als andere Berufsgruppen Brille tragen, im Film bis in die heutige Zeit erhalten. Die Frage stellt sich also: Warum setzen auch heutzutage Regisseure ihren Schauspielern, sofern sie Ärzte, Lehrer, Wissenschaftler usw. spielen, so gerne Brillen auf? Nun, die Regisseure wissen schon, warum sie das tun: Die Brille wird schlicht und einfach als Intelligenzverstärker eingesetzt, und genau so wirkt sie auch aufs Publikum. Ein Schauspieler, der zum Beispiel einen Arzt spielt, soll für die Zuschauer im Kino auch wirklich intelligent wirken, sonst ist er in seiner Rolle unglaubwürdig. Eine passende Brille ist hier ein sicher wirkendes Patentmittel, um beim Publikum die Wirkung zu erzielen, der Schauspieler sei auch tatsächlich intelligent. Trotzdem scheint es etwas heikel, dass der Film Klischees am Leben hält, statt - wenigstens in diesem Punkt - mit der Wirklichkeit einigermaßen gleichzuziehen. Andererseits, wenn man es genau bedenkt, bedienen sich viele Filme sowieso einer großen Anzahl von Klischees, um problemlos ganz bestimmte Erwartungshaltungen oder Spannungszustände beim Publikum hervorzurufen. Jeder kennt das:
# Der Actionheld stirbt auch im heftigsten Kugelhagel nicht.
# Der Hauptbösewicht wird erst am Ende des Films erledigt.
# Bombenentschärfungen gelingen erst in den letzten Sekunden.
# Die heftigsten Schlägereien hinterlassen beim Hauptdarsteller nur eine rote Strieme (und nicht, wie es in der Wirklichkeit wäre, ausgeschlagene Zähne oder eine gebrochene Nase).
# Außerirdische scheinen von den USA magisch angezogen zu werden, daher landen sie bevorzugt dort.
# Jede Tastatureingabe wird stets mit irgendwelchen Pieptönen quittiert (das würde einen in Wirklichkeit wahnsinnig machen).
# Schurken oder Unsympathen fahren in US-Filmen auffallend häufig Mercedes-Benz. Dafür fahren in französischen Filmen die Schurken auffallend häufig US-Autos.
# Verschlossene Türen lassen sich mit einem einzigen Schuss öffnen (in Wirklichkeit klappt das fast nie).
# Auch auf Sand quietschen Autoreifen beim Beschleunigen oder Bremsen.
# Leute können völlig unbeschadet durch Scheiben springen (dabei verursacht so etwas oft fürchterliche Verletzungen).
# Die Welt wird meistens von Amerikanern gerettet (außer in Bond-Filmen, da sind es Briten).
# Die Guten benutzen auffallend oft einen Apple-Computer (die Bösen fast nie) usw.
So könnte das hier noch ellenlang weiter gehen. Gemessen an diesen hartnäckigen und teilweise recht einfältigen Filmklischees scheint das Akademiker-Brillen-Klischee so harmlos wie sympathisch, denn welches andere Film-Accessoire außer der Brille könnte sonst noch den Anschein von Intelligenz transportieren? Uns fällt da kein anderes ein.
Die Brillen der Superhelden
Es fällt auf, dass die bekanntesten Superhelden, nämlich Superman, Spiderman, Batman (und die scharfe Catwoman) in ihrem Privatleben stets Brille tragen. Warum? Nun, als Superheld muss man ständig Autogramme geben, Interviews führen, Autohäuser einweihen, all das nervt gewaltig. Daher verständlich, dass diese Leute, wenn nicht gerade wieder mal die Welt zu retten ist, gerne inkognito bleiben und sich ein ruhiges und unbehelligtes Privatleben wünschen. Mit dem Tragen einer Brille im Privatleben spekulieren die Superhelden auf gleich zwei unterschiedliche und wohlbekannte Wirkungen der Brille auf die Umwelt, und auf diese beiden Wirkungen gehen wir jetzt kurz ein.
Erstens soll mit dem Tragen einer Brille eine gewisse Schwäche an die Umwelt übermittelt werden. Besonders arg treibt es in dieser Hinsicht Superman, der in seinem Privatleben als Clark Kent immer wieder versucht, sich durch betont harmloses Verhalten den Anschein zu geben, er wäre zweifellos der allerletzte, der Superman sein könnte. Seine Brille dient Clark Kent dabei sozusagen als Verstärker seines Verhaltens: Seht her, ich habe eine Sehschwäche, ich kann daher unmöglich Superman sein.
Zweitens spekulieren die Superhelden mit dem Tragen einer Brille noch auf ein weiteres Vorurteil ihrer Umwelt: Brillenträger müssen einfach intelligent sein! Ein Mensch mit Brille ist dementsprechend bestimmt zu intelligent, um ein Superheld zu sein. Schließlich ist die übliche Tätigkeit von Superhelden durch eine beachtliche Rustikalität gekennzeichnet, da zählen Beweglichkeit und Muckis, nicht graue Zellen. Die Superhelden scheinen also keine Skrupel zu haben, sich privat intelligenter erscheinen zu lassen als in ihren Jobs als Superhelden, was immerhin für eine gewisse Selbstironie spricht. Dennoch scheint es etwas naiv, dass diese Superhelden seit vielen Jahrzehnten unverdrossen immer wieder versuchen, ihrem Privatleben Glaubwürdigkeit zu verleihen, indem sie sich Brillen aufsetzen. Sehen Superhelden denn nie Verfilmungen von Superhelden-Geschichten? Jeder weiß doch, wer die Superhelden privat sind. Ergo sollten die Superhelden sich langsam mal zur privaten Tarnung etwas Besseres einfallen lassen. Was, wissen wir aber auch nicht.
Die Sonnenbrille
Die Sonnenbrille erfüllt im Film in der Regel andere Aufgaben als eine normale Brille. Sonnenbrillen sind im Film meist einfach nur ein modisches Accessoire und kein Ergebnis einer korrekturbedürftigen Sehleistung. Im Gegenteil: Sonnenbrillen transportieren, vor allem bei männlichen Schauspielern, oft Stärke oder sogar Gefährlichkeit. Denken Sie nur an die vielen Szenen, in denen einem Darsteller offenbar nur deshalb eine Sonnenbrille auf die Nase gesetzt wird, damit dieser cool oder bedrohlich wirkt. Allerdings, was die Sonnenbrille dann verspricht, muss die Ausstrahlung des Darstellers dann auch mit abgenommener Sonnenbrille halten; selbst Stan Laurel sieht mit Sonnenbrille cool aus, aber wenn er sie dann absetzt, ist er doch nur: der gute alte Doof. Und natürlich dient eine Film-Sonnenbrille auch oft als Augenversteck, wenn sich ein Schauspieler nicht in die Karten schauen lassen will.
Die Sonnenbrille hat im Film gegenüber der normalen Brille einen Nachteil: Sie kann nicht über den ganzen Film getragen werden, denn modisch und cool hin oder her, man bezahlt weltweit bekannten Hauptdarstellern keine gewaltigen Gagen, damit diese einen ganzen Film lang ihre wichtigsten schauspielerischen Mittel verstecken, nämlich ihre Augen. Also kommt bei Hauptdarstellern die Sonnenbrille meist nur zeitweise zum Einsatz und bei der ersten besten Gelegenheit nehmen sie die Sonnenbrillen dann ab. Bei billigen Filmproduktionen und besonders im TV-Bereich kann es aber durchaus schon mal vorkommen, dass ein Nebendarsteller - meist ein Unterbösewicht - die Sonnenbrille gar nicht abnimmt. Macht nichts, denn dessen Gesicht kennt sowieso keiner, da kann er es auch verstecken; außerdem werden solche Unterbösewichte in der Mitte des Films sowieso erschossen. Ein noch schnelleres Ende nehmen heutzutage Bösewichte mit Sonnenbrillen, wenn sie auch noch rauchen: Da kennt vor allem die US-Filmindustrie keine Gnade mehr, die vielen Filmhelden der früheren Tage wie zum Beispiel James Cagney, Humphrey Bogart, Gary Cooper, Clark Gable, James Dean, Steve McQueen, Paul Newman usw. hätten heutzutage rauchenderweise keine Chancen auf Hauptrollen und wären vom Tabakwind verweht.
Die Grenzen der Filmbrille
Man sollte den symbolischen Gehalt einer Filmbrille nicht überschätzen. Eine Filmbrille kann, genau wie im wirklichen Leben, die Persönlichkeit des Trägers unterstreichen, mehr nicht. Eine Filmbrille für sich allein, so chic und stilvoll sie auch sein mag, hat keine Persönlichkeit. Wenn es beim Schauspieler daran hapert, wird ihm keine Brille der Welt dazu verhelfen können. Der symbolische Gehalt einer Filmbrille ist also durchaus vorhanden, sollte aber nicht überstrapaziert werden. Interessanterweise steigt der symbolische Gehalt einer Brille, wenn sie ohne Träger abgebildet wird. Nun, wozu sollte man im Film eine Brille ohne Träger zeigen? Gewöhnlich wird das gemacht, weil der Träger tot ist. Die “Todesbrille” (wir nennen sie jetzt mal so) ist und war im Film ein beliebtes Mittel, um einen Todesfall anzuzeigen. Davon finden Sie in diesem Buch mehrere Beispiele im Kapitel “Die letzte Brille”.
Und bedenken Sie, dass Filmbrillen, ebenso wie viele andere Film-Accessoires, gelegentlich einfach gedankenlos oder schlampig ausgewählt werden. Da hilft dann kein noch so tiefsinniges Grübeln, was ein Ausstatter oder Regisseur sich bei der Auswahl dieser oder jener Brille wohl gedacht haben mag, wenn die sich dabei - gar nichts gedacht haben. Oder etwas, auf das außer ihnen niemand kommen wird. Darüberhinaus sind die meisten Filme recht einfach gestrickte Angelegenheiten und geben daher keinen übermäßigen Raum für Interpretationen. Das es auch ganz anders geht, erfahren Sie in den Filmbeispielen dieses Buchs. Der überschaubare Symbolcharakter der Filmbrille wird auch dadurch deutlich, dass sie kaum als Filmzitat taugt, im Gegensatz etwa zu Dialogfilmzitaten. Nichtsdestotrotz ist die Filmbrille ein sehr wichtiges Film-Accessoire, das eine ganze Menge über den Rollencharakter aussagen kann, und genau deshalb werden Schauspielern von Regisseuren Brillen auf die Nasen gesetzt. Filmbrillen können also keine Geschichten erzählen, sie können sie aber auf verschiedene Arten deutlich illustrieren, und das ist eine ganze Menge für einen Ausstattungsgegenstand. Und nun viel Spaß bei den folgenden Filmbrillen, ihren Schauspielern und den Szenen, innerhalb derer die Filmbrillen verwendet werden.
DIE NORMALE BRILLE
Das Cabinet des Dr. Caligari
Dr. Caligari (Werner Krauss) stellt auf Jahrmärkten ein schlafwandlerisches Medium namens Cesare aus. Dr. Caligari ist also sozusagen im Showgeschäft, und dementsprechend auffällig gibt er sich. Die Figur des Dr. Caligari ist mit seinem Zauberhut, seinen zippeligen langen Haaren und seinem schwarzen Pelerinenmantel schon merkwürdig genug, doch darüberhinaus bekam er vom Filmausstatter auch noch eine auffallend große Brille auf die Nase gesetzt. Durch die große runde Brillenform in Verbindung mit dem ausdrucksvollen Augenspiel von Werner Krauss erhält man den Eindruck, Dr. Caligari beobachte seine Umwelt mit der nie nachlassenden Aufmerksamkeit eines Uhus - und genau das tut er.
Das Cabinet des Dr. Caligari, Deutschland 1920. Regie: Robert Wiene. Darsteller: Werner Krauss (Dr. Caligari), Conrad Veidt (Cesare), Friedrich Feher (Francis), Lil Dagover (Jane), Hans Heinrich von Twardowski (Alan) u. a.
Girl Shy
Harold Meadows (Harold Lloyd) ist beherrscht von einer schier unüberwindlichen Schüchternheit gegenüber Frauen - daher der Filmtitel “Girl Shy”, also ungefähr “Scheu vor Mädchen”. Nur abends, in seiner kleinen Kammer, besiegt Harold seine Schüchternheit. Da schreibt er nämlich ein Buch, in dem er sich selbst als größten und skrupellosesten Liebhaber aller Zeiten darstellt, mit einer Unzahl von Affären - warum auch nicht, die Gedanken sind frei. Hier steht Harold gerade im Büro eines Verlegers, doch der teilt ihm auf grobe Art mit, dass sein Buch ein lächerlicher Witz wäre und er es keinesfalls verlegen würde. Daher der entgeisterte und traurige Blick von Harold, der sich etwas voreilig schon in den schönsten Dichter-Illusionen gewiegt hatte. Harold Lloyd war nicht nur einer der beliebtesten Stummfilmstars, er ist auch immer noch einer der bekanntesten Brillenträger der Filmgeschichte. Er trug nicht nur in den meisten seiner Filme Brille, sondern auch fast immer das gleiche Modell, nämlich eine sogenannte Pex-Brille. Das war ein Brillendesign, das Anfang der 20er Jahre in Mode kam. Die Pex-Brille zeichnete sich durch runde Gläser aus, die in ein relativ breites und meist schwarzes Zellhorngestell eingefasst waren. Durch die breite Einfassung wirkte die Pex-Brille ziemlich auffällig, vor allem bei jemandem, der wie Harold Lloyd in seinen Rollen stets sehr hell geschminkt war. Gerade diesen Kontrast schätzte Harold Lloyd sehr, da er nicht zuletzt dadurch beim Publikum einen hohen Wiedererkennungswert besaß. Harold Lloyd gab in seinen Komödien in der Regel ganz normale Bürger, die allerdings ununterbrochen von Missgeschicken heimgesucht wurden. Er spielte also keine Habenichtse oder Tramps wie Chaplin oder geistig etwas schwerfällige Typen wie Stan Laurel und Oliver Hardy. Und als ganz normaler Bürger konnte er in seinen Filmen auch Brille tragen, was damals für Filmkomiker unüblich war. Die von Harold Lloyd bevorzugte Pex-Brille galt darüberhinaus, in den 1920er Jahren, als die bevorzugte Brille der Intellektuellen. So unterstrich Lloyd also in seinen Filmkomödien mit dem Tragen der Pex-Brille: Seht her, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, ich bin ein bürgerlicher Typ und ich will keinen Ärger. Das wiederum unterstrich die Komik der haarsträubenden Situationen, in die er in seinen Filmkomödien ständig geriet, und genau wegen dieser Komik-Verstärkung schätzte er die Pex-Brille sehr. Der Kniff mit der Brille zahlte sich aus: Im Jahr 1928 erzählte Harold Lloyd, dass seine Brille ihm wöchentlich 19.970 Dollar einbringen würde, eine damals nahezu unfassbare Summe. Er meinte, ohne die Pex-Brille würde er nur die übliche Gage eines Schauspielers verdienen, nämlich wöchentlich 30 Dollar. Und dann würde hier wahrscheinlich auch kein Text über Harold Lloyd stehen.
Girl Shy, USA 1924. Regie: Fred C. Newmeyer und Sam Taylor. Darsteller: Harold Lloyd (Harold Meadows), Jobyna Ralston (Mary Buckingham), Richard Daniels (Jerry Meadows), Carlton Griffin (Ronald De Vore) u. a.
Leoparden küsst man nicht
Cary Grant spielt hier den Dinosaurierforscher Dr. David Huxley. Doch statt mit Dinosauriern hat er gerade die innige Bekanntschaft mit einer LKW-Ladung Hühnern gemacht, weswegen er hier etwas mitgenommen aussieht. Da Grant einen Wissenschaftler spielt, bekam er natürlich gemäß des unausrottbaren Filmklischees, dass Wissenschaftler grundsätzlich Brillenträger sind, eine kreisrunde Sehhilfe auf die Nase gesetzt. Sicherlich ist es kein Zufall, dass in dieser Komödie Grants Brille stark an das Brillenmodell erinnert, das der Stummfilmkomiker Harold Lloyd stets trug.
Leoparden küsst man nicht, USA 1938. Regie: Howard Hawks. Darsteller: Katharine Hepburn (Susan Vance), Cary Grant (Dr. David Huxley), Charles Ruggles (Horace Applegate), Walter Catlett (Constable Slocum) u. a.
Die Frauen
Der Intrigantin und Klatschbase Sylvia (Rosalind Russell) geht gerade ein Licht auf, und deshalb guckt sie auch so verdutzt aus ihrer Brille. Vor ihr sitzt Miriam (Paulette Goddard) hoch zu Ross, deshalb schaut Sylvia so nach oben. Alle zusammen befinden sich im Scheidungsparadies Reno, um ihre Ehen zu beenden. Soeben begreift Sylvia, warum Miriam sich scheiden lassen will: Um Sylvias Mann zu heiraten! Das empört Sylvia aufs Äußerste. Es entspinnt sich folgender Dialog:
Sylvia: “Sie lausige kleine…”
Miriam: “Kommen Sie mir ja nicht mit Kraftausdrücken, sie Park-Avenue-Playgirl, ich kenne sehr viel mehr als Sie!” (Sylvia zieht Miriam erbost vom Pferd, Gekreisch, Handgemenge.)
Sylvia: “Schlagen Sie mich ja nicht ins Gesicht, ich habe eine Brille auf!”
(Miriam nimmt ihr rasch die Brille ab.) Miriam: “Jetzt aber nicht mehr”! (Miriam gibt Sylvia eine kräftige Ohrfeige. Gekreisch, Handgemenge usw.)
Sehr schön. Sylvias Brille macht einen Wandel in der Brillengeschichte deutlich. Bis in die 1920 Jahre sahen Damen- und Herrenbrillen noch weitgehend gleich aus, doch dann ging das Design von Damen- und Herrenbrillen langsam getrennte Wege. So auch hier, im Prinzip handelt es sich zwar immer noch um das alte runde Unisex-Modell, doch lassen seitliche Verzierungen diese Brille feiner und femininer wirken, sie ist damit eindeutig zur Damenbrille geworden.
Die Frauen, USA 1939. Regie: George Cukor. Darsteller: Norma Shearer (Mary), Joan Crawford (Crystal Allen), Rosalind Russell (Sylvia), Mary Boland (Flora), Paulette Goddard (Miriam), Joan Fontaine (Peggy), Phyllis Povah (Edith) u. a.
Tote schlafen fest
Zum täglichen Geschäft eines Privatdetektivs gehört es, in andere Rollen zu schlüpfen, um so Informationen zu erlangen, die man nie bekommen hätte, wenn man einfach seine Hundemarke gezeigt hätte. So auch hier: Philip Marlowe (Humphrey Bogart) möchte wissen, was es mit diesem verdächtigen Buchladen auf sich hat. Dazu klappt er sich vor der Tür einfach seinen Hutrand nach oben und setzt sich eine getönte Brille auf (eine Lesebrille war nicht zur Hand), in der Hoffnung, in dieser Aufmachung irgendwie als intellektueller Bücherwurm durchzugehen. Na ja, etwas schlampige Tarnung, und sehr überzeugt schien die angebliche Buchhändlerin (Sonia Darrin) davon nicht. Aber Marlowe riecht sowieso schon Lunte, denn eine Buchhändlerin ohne Brille, da stimmt etwas nicht - jedenfalls in Hollywood-Filmen. Und tatsächlich, Marlowe ertappt sie, denn sie wunderte sich gar nicht darüber, dass er eine Ben-Hur-Ausgabe von 1860 verlangte. Das bewies Marlowe, dass mit diesem Buchladen (und dieser Buchhändlerin) etwas oberfaul sein musste, denn der Roman Ben Hur erschien erst 1880. Damals hätte das jede amerikanische Buchhändlerin gewusst.





























