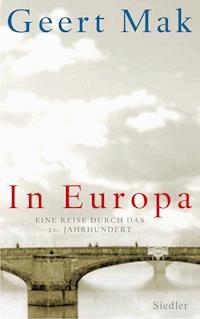Inhaltsverzeichnis
I – SCHWARZER WIND
II – STURM DER GERÖSTETEN WALNÜSSE
III – STURM DER SCHWÄNE
IV – STURM DER AMSELN
V – STURM DER WINDMÜHLEN
VI – FISCHSTURM
Danksagung
LITERATUR
Copyright
»Auf der Brücke schließt man keine Freundschaften;
Von der Brücke aus schaut man zu.«
Sait Faik
I
SCHWARZER WIND
Auf der Brücke rechnet man nur in Millionen. »Gestern hab ich für zwanzig Millionen gefangen, lauter Sardinen.« »Drei Millionen für das schönste Foto Ihres Lebens!« »Zwei Tee, das macht dann eine halbe Million, vielen Dank.« »Ich steh’ hier schon seit dem frühen Morgen; vier Millionen, wann kommt endlich mal wieder Geld über die Brücke?« »Echtes Chanel, fünf Millionen!«
Die hohe Stimme der Losverkäuferin schallt durch die Ladenpassage: »Wer spielt mit um hundert Milliarden? Wer spielt mit?« In dem Schaufenster hinter ihr warten Zeus-, Super-, Kral- 2000-Magnum- und Blue-Compact-Pistolen auf Käufer, nicht zu vergessen die kleineren Damenpistolen, die elegante Geax und die Class-mini. Schon für zehn Raten zu je fünfundzwanzig Millionen hat man die Macht über Leben und Tod in der Tasche.
Die Brücke bietet alles, was der Mensch so braucht: Kämme, Gesundheitssandalen, Zigaretten, tanzende Mädchenpuppen, Gucci-Tassen und Rolex-Uhren für lächerliche zwanzig Millionen, Nokia-Handys von fragwürdiger Herkunft, Regenschirme, mit üppigen Blumenwiesen bedruckt, Rasierpinsel, Kondome und endlos vorwärtsrobbende Infanteristen aus graugrünem Plastik, die alle zehn Sekunden eine Salve herunterrattern. Eine Million ist ungefähr einen halben Euro wert. Eigentlich ist es altes Geld aus der Zeit vor der großen Währungsreform, aber die Brücke hat ihre eigene Währung. Und den Fisch gibt es als Zugabe, als Geschenk der Brücke. Immer hängen Angeln über dem Geländer.
Heute ist der Tag der dicken Sardinen. Es ist ein Rätsel, woher sie so plötzlich kommen, aber unter der Brücke müssen sich gerade gewaltige Schwärme aufhalten – nächste Woche beißen dann wieder nur ein paar magere Fischlein an. Eine resolute Dame zieht Fisch um Fisch aus dem Wasser, während Ausflugsboote und rostige Schlepper unter der Brücke herbrummen und Straßenbahnen die Gehwege erzittern lassen. Früher war sie Krankenschwester, ist dann in Rente gegangen, arbeitet jetzt im Computerhandel. Seit zehn Jahren angelt sie hier schon, innerhalb weniger Stunden fischt sie das Abendessen für ihre Familie zusammen. »Für mich ist das eine Form von Meditation.« Sie zündet sich eine Zigarette an und reicht mir ihre riesige Angel. »Fühlen Sie mal, es entspannt.« In der Ferne schieben sich Tanker vorbei, rote Schüttgutfrachter auf dem Weg von der Krim nach Europa, weiße amerikanische Kreuzfahrtschiffe.
So wie manche Regionen ein gutes Dutzend Wörter für Regen, Schnee oder Nebel kennen, so unterscheidet diese Stadt fast zwanzig Arten von Wind, und die Fischer haben jeder dieser Arten ihren eigenen Namen gegeben. Wenn der Angenehme Sturm, der Sturm der Amseln oder der Sturm der Kuckucke von Westen kommt, wird das Frühjahr mild und trocken. Östliche Winde wie der Fischsturm bringen mit ihrem Morgennebel in der Hitze des Sommers Abkühlung und zu allen Jahreszeiten Regen. Der Boreas, aus Nordost, treibt im Winter den Schnee in die Stadt.
Jetzt warten alle auf die Frühjahrsstürme, die Stürme der Schwalben und der Schwäne. Die Stadt hat schon eine Tourismuskampagne gestartet. Drei Millionen Tulpen sind gepflanzt worden: Wo man hinschaut Tulpen, sogar oben auf den Hubtürmen der Brücke wiegen sie sich in der kalten Luft, dicke Blasen aus rotem und gelbem Kunststoff.
Aber vorerst kommt das Wetter noch vom Schwarzen Meer, der Schwarze Wind weht und bringt mit schöner Regelmäßigkeit heftige Schauer. Die Angler haben sich in Plastik, Segeltuch und alte Kunstdüngersäcke gehüllt. Fähren pendeln durchs Grau, Möwen fliegen vorbei, glänzend schwarze Schirme schaukeln über die Brücke, das andere Ufer versteckt sich in weißem Nebel. Am Nordkai werden die schweren Motoren der Prof. Dr. Aykut Barka und der Mehmet Akif Ersoy angelassen, ihre Schornsteine spucken fettigen, schwarzen Qualm, eine rasante Drehung, und die beiden Fährschiffe brausen davon. Auf den Fernsehschirmen der Cafés unter der Brücke schwimmen den lieben langen Tag Korallenfische hin und her, und sie bleiben heute auch die Einzigen, die den Kellnern Gesellschaft leisten.
Alle haben in den Unterführungen vor und hinter der Brücke Schutz gesucht. Auf der Altstadtseite riecht es wie immer nach Bratfisch, aber kein Kunde lässt sich blicken. Die jungen Zigarettenverkäufer, übellaunig vom Nichtstun, spielen an diesem Vormittag verrückt. Jeder Ausländer, jeder Hinkende, der vorbeikommt, wird zur Zielscheibe ihrer Scherze. Der Parfümverkäufer hat sich im Windschutz eines vorstehenden Abflussrohrs an eine alte Mauer gedrückt: ein Mann in einem zu großen Jackett, die Taschen vollgestopft mit billigen Imitationen; eine von den Gestalten, um die man am liebsten einen Bogen macht, wenn man über die Brücke geht, mit denen man aber zufällig ins Gespräch kommt, weil es regnet und man ohnehin nichts anderes tun kann.
Er erzählt von seinem Dorf, er erzählt wahrscheinlich immer von seinem Dorf. »Es lag in den Bergen, es klebte am Hang, zwölf Häuser, Ziegen, Schafe, ein paar kleine Kartoffeläcker, Bohnen für die Armee, manchmal Tomaten für die Stadt, wir kamen gerade so über die Runden.« Schon mit sieben musste er arbeiten, im Sommer Schafe hüten, dann Brennholz sammeln, bis der erste Schnee fiel. »Spielzeug kannten wir nicht. Wir haben mit Steinen gespielt.«
Heute gibt es sein Dorf nicht mehr, die Familien, die es bewohnten, sind alle fortgezogen, sogar aus den offiziellen Statistiken hat man es gestrichen. Zu groß waren die Familien geworden, manchmal kamen auf jedes Haus zehn, fünfzehn Menschen, und so viele hungrige Mäuler konnte das Dorf nicht stopfen. »Ich werde nie vergessen, wie wir in einer Winternacht von einem Wolfsrudel überfallen worden sind, bestimmt zwanzig Schafe haben sie gerissen. Danach sind alle weggegangen, was hätten wir sonst machen sollen?«
Was aus den zwölf Familien geworden ist, weiß der Parfümverkäufer auch nicht so genau, ja, die meisten sind nach Europa gegangen, einer in die Niederlande. Er selbst fand Gelegenheitsjobs in der Stadt: in einem Schießstand, einem Restaurant, einem Frisörladen. Er verkaufte Wasser, Obst, Fisch, Socken und Armbanduhren. Er heiratete, wurde geschieden; er wohnt in einem Gasthaus und lebt für die seltenen Sonntagnachmittage, an denen er mit seinem kleinen Sohn ein paar Stunden durch die Stadt spazieren darf. Die Brücke ist sein Los, daran ist nichts zu ändern. »Schule oder Studium, das hätte meine Familie nicht bezahlen können, sie war arm, so einfach war das. Ich kann meinen Verpflichtungen nachkommen, ich kann gerade eben für mich selbst sorgen, ich bin allein, deshalb.«
Nachts lebt er nun wieder öfter in dem Dorf mit den zwölf Häusern, dann hört er die Stimmen des Morgens – Vögel, Schafe, den Wind, den Fluss; das Gras raschelt unter seinen Schritten, er spielt mit den Steinen. Jetzt wartet er wie eine nasse Katze darauf, dass der Regen aufhört: Morgen, sagt der Wetterbericht, denn dann kommt Schnee.
Die Brücke ist kaum zu übersehen. Man fliegt auf die Stadt zu, auf diese zehn Millionen Seelen; auf ihre Villen und Wohntürme, die wie Wellen die Hügel überziehen; auf die Meerengen und Buchten, die diese Stadt durchschneiden; auf die Hängebrücken zwischen Europa und Asien, über die sich die Konvois der Fernlaster schieben, Stoßstange an Stoßstange; auf die Schiffe, die zu Dutzenden vor den Hafeneinfahrten liegen und schon seit Ewigkeiten vor sich hin zu rosten scheinen; auf die verfallenen Bastionen und Stadtmauern des versunkenen Imperiums; auf die Blaue Moschee, über der immer weiße Vögel segeln, scharf abgehoben vom Abendhimmel. Und dann fällt der Blick unweigerlich auf die Brücke.
Oder man stößt unerwartet auf die Brücke. Man geht die schmalen Straßen am Basar hinunter, vorbei an den Ständen mit Käselaiben und Oliven, an den Ladentischen, die überquellen von Gläsern mit Honig und eingemachten Früchten; an den Eisenwarenhandlungen, an den Läden mit Sägen, Öfen und Teekannen; an den Männern, die sich mit würdiger Miene hinter Kartons voller Kugelschreiber und Papiertaschentücher postiert haben; an den Metzgereien mit Würsten, Mägen und Ziegenköpfen in der Auslage; an den Losverkäufern, die Glück feilbieten. Oder man geht über den Kai mit den Fähranlegern, wird Teil der unüberschaubaren Menge, die morgens in die Stadt strömt; bahnt sich einen Weg durchs Gewimmel der Geschäftsleute, Lastträger, Sekretärinnen, Bäuerinnen, durch die Parade der Aktentaschen und abgetragenen Jacketts, begleitet vom Dröhnen der Motoren, dem Laufschritt der jungen Frauen, den Rufen der Verkäufer; Lichter tanzen auf dem Wasser, jeden Tag anders, rastlos; die Möwen schreien, und dann, wenn man um die Ecke biegt, hinter den Kiosken und Treppen, steht man auf einmal vor der Brücke.
Eigentlich ist die Brücke gar nicht schön. Eine Betonkonstruktion, gut einen halben Kilometer lang, zwei Gehwege, vier Fahrstreifen und eine zweigleisige Straßenbahn breit, mit einem Hubteil in der Mitte und Unterführungen und Ladenpassagen neben und unter den Rampen. Die Fahrbahn steigt zur Mitte hin sanft an, dort können die kleineren städtischen Schiffe problemlos durchfahren. Unter der Fahrbahn, dicht überm Wasser, liegt eine zweite Ebene mit einer langen Reihe von Restaurants und Teehäusern – als Fußgänger kann man also auch unten entlanggehen, dort ist es behaglicher, nur muss man auf halber Strecke, am Hubbrückenteil, ein paar zusätzliche Treppen auf und ab. Und vieles entgeht einem: die Weite, das Meer, die Nebel im Herbst, die Delphine, die manchmal aus einer fernen Woge auftauchen.
Die Brücke überspannt ein vor Urzeiten versunkenes Flusstal, eine langgestreckte Meeresbucht, die wiederum die beiden ältesten Stadtviertel trennt und damit zugleich die beiden Mentalitäten der Stadt: Die Südseite ist konservativ und dem Osten zugewandt, der nördliche Teil, mit seinen jahrhundertealten Botschaftsgebäuden und Kaufmannspalästen, ist geprägt von der Denkweise des Westens und der Leichtigkeit des modernen Lebens.
Ein beliebter Schriftsteller dieser Stadt – wir werden noch einigen anderen begegnen – hat die Häusermassen der beiden Stadtteile einmal mit den »weit ausgebreiteten Flügeln eines kleinen Vögelchens mit zerbrechlichem Leib« verglichen. Das ist noch immer ein treffendes Bild. Die Brücke ist dieser kleine Leib zwischen den beiden riesigen Flügeln. »Die Brücke ist klein, winzig, verletzlich, aber wenn man sie fortnimmt, brechen diese riesigen Flügel auf beiden Seiten ab, dann können sie sich nicht mehr bewegen, nicht mehr in die Luft erheben!«
Ohne die Brücke wäre die Stadt nichts. Außerdem ist die Brücke selbst eine Stadt, aber man darf sie auch wieder nicht mit der Stadt verwechseln, die Brücke ist nicht die Stadt, und die Stadt ist nicht das Land, keinesfalls. Die Brücke ist vor allem sie selbst, einigen wir uns darauf.
Jetzt reckt und streckt sich die Brücke. Der Vormittag ist vorbeigeplätschert, der Regen hat aufgehört. Die Brückenbelegschaft hat sich um einen Schuhputzer erweitert und um einen Mann, der wie eine lebende Kleinanzeige wirkt; er möchte eine fast neue elektrische Bohrmaschine verkaufen. Dazu hat er sich auf dem Gehweg postiert, den Schlagbohrer vor seinen Füßen, den Bohrersatz lose daneben, und nun wartet er. Jeder wartet in dieser Stadt, immer, und manchmal hilft es sogar.
In der Unterführung tauchen Männer mit einem neuen Spielzeug auf: Miniatur-Smarts, die zu fröhlicher Musik ihre Runden drehen und mit den winzigen Türen schlagen wie Vögel mit den Flügeln. Fünf Millionen. In einer Ecke warten drei glänzend neue Koffer auf große Abenteuer. Auf der Treppe hat sich ein alter Bettler niedergelassen. Wenn man ihn anspricht, hebt er den ausgezehrten Kopf und zeigt auf ein Metallplättchen an seiner Kehle. Darunter hat einmal seine Stimme gewohnt, die ist nun rausgeschnitten und fort für immer.
Die Taschenspieler gehen in Stellung. Sie benutzen einen Stuhl, einen Packen Spielkarten und eine alte Zeitung. Ansonsten ist es das gleiche Prinzip wie überall: ein Mann, der Karten verteilt, um ihn herum drei oder vier Komplizen, die dem Publikum mit Händeklatschen und Freudentänzchen vorgaukeln, dass sie dauernd gewinnen, im äußeren Kreis ein paar Taschendiebe, die den arglosen Dörfler, wenn er sich unter die Umstehenden mischt, fachmännisch ausplündern, sofern ihn nicht schon das Spiel selbst von der Last seines Bargelds befreit. Nur dass die Männer auf der Brücke eine Kleinigkeit übersehen, die sie verrät: Sie stammen ganz offensichtlich alle aus derselben Gegend, vielleicht sogar aus derselben Familie, alle haben sie die gleichen ledernen Gesichter, alle tragen sie die gleichen erbärmlichen Regenmäntel über staksigen Beinen; da hilft auch kein Tänzchen.
Im Jahr 1878 überquerte der italienische Schriftsteller Edmondo de Amicis die Brücke – die Vorvorgängerin der heutigen – und richtete dabei den Blick auf den damals noch bretternen Brückenbelag oder besser gesagt auf das Gewimmel der Füße: »Alles Schuhzeug der ganzen Erde, von dem Adams bis zu den Stiefelchen der neuesten Pariser Mode, geht vorüber: die gelben Pantoffeln der Türken, die rothen der Armenier, die blauen der Griechen, die schwarzen der Israeliten, Sandalen, Stiefel aus Turkestan, albanesische Gamaschen, ausgeschnittene Schuhe, ›Gambari‹, in tausend Farben, wie sie die Hirten und Pferdeführer aus Kleinasien tragen, goldgestickte Pantoffeln, ›Alpargatas‹, auf spanische Weise gemacht, Stiefel von Atlas, von Stricken, von Lumpen, von Holz folgen sich so dichtgedrängt, daß, wenn man auf das eine Paar blickt, sich schon hundert andere dazwischen stellen.«
Fast anderthalb Jahrhunderte später sehe ich einen endlosen Zug von Sportschuhen, die Händlern, Touristen, Spielern und Dieben gehören. Ich sehe die schwarzen Halbschuhe der Kellner. Die schmutzigen Slipper eines Lastträgers mit riesigem Gemüsekorb auf dem gebeugten Rücken. Die weißen Pumas des Straßenfotografen, dessen Revier die Brücke ist. Die spitzen Goldschuhe und Silbersandalen von zwei selbstbewussten Mädchen, die in modischen, türkis- und orangefarbenen Kleidern promenieren, um die Köpfe knallbunte Tücher gewickelt. Die nackten, braunen, von schwarzen Ölflecken bedeckten Füße eines Klebstoffschnüfflers. Die Holzschuhe zweier schwarz gewandeter Strenggläubiger. Die halbhohen Turnschuhe, in denen ein Mädchen – halblange Haare, Life-T-Shirt, Büchertasche über der Schulter – durchs Leben wirbelt. Die silbernen Pantöffelchen eines winzigen Karnevalsprinzleins, eines kleinen Jungen, der heute seine Beschneidung feiert. Die verschlissenen Salonschleicher des Parfümverkäufers.
Edmondo de Amicis musste immer Acht geben, um nicht umgestoßen zu werden, ein solches Gedränge herrschte auf der Brücke. »Da ist ein Wasserträger mit einem colossalen Schlauch auf dem Rücken, hier eine russische Dame zu Pferde, dann ein Fähnlein Kaiserlicher Soldaten, wie Zuaven gekleidet und anzusehen, als ob sie zu einer Belagerung auszögen; hier eine Schaar armenischer Lastträger, die zu zweien auf den Schultern lange Stangen tragen, an denen Ballen von Kaufmannsgütern hängen...«
Heute verteilt sich das Brückengedränge auf mehrere Spuren: die Straßenbahn für die Mittelklasse, die Autostraße für die Reichen, die Gehwege für die Verlierer, Abweichler und Touristen. Das Gehen ist langsamer geworden, es ist eher ein Trotten und Flanieren. Und die Angler sind Gestalten, die sich gar nicht vom Fleck rühren, undenkbar auf de Amicis beweglicher Brücke. Zu seiner Zeit wurde auf der Brücke kaum geangelt, es gab genug bessere Stellen dafür. Erst Mitte der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, als die Stadt wieder einmal von Massenarbeitslosigkeit heimgesucht wurde, entwickelte sich die Brücke zum beliebten Angelplatz.
»Man konnte sich ins Teehaus setzen, mit Freunden um etwas Geld spielen«, erzählt einer der Angler der ersten Stunde, »aber auf die Dauer konnte sich das niemand leisten. Und so haben wir mit dem Angeln angefangen. Das kostete fast nichts, es brachte sogar noch was ein, und Sie sehen ja, wie gesund ich bin und dass ich zur Ruhe gekommen bin!« Er hat sich aus seinem Geschäft zurückgezogen, jetzt ist er immer auf der Brücke zu finden, und immer mit Baseballmütze und kariertem Hemd. Aber berufsmäßiger Fischer ist er nie geworden, und das gilt für die meisten Dauerangler auf der Brücke.
Wenn man sie kennenlernt, stellt man fest, dass die meisten von ihnen Rentner oder Büroangestellte sind und dass die Brücke ihnen vor allem ein paar Stunden Erholung schenkt. »Jeden Tag angeln, das lehrt einen Geduld«, meint ein Bankangestellter. »Es ist ein Teil meiner Lebensphilosophie geworden. Und immer dranbleiben, auch im November abends um acht, wenn der Regen einem die Knochen zerfrisst, o ja, auch das gehört dazu!« »Es ist pure Meditation«, glaubt eine Frau, die von ihren familiären Problemen erzählt. »Ich hatte dauernd Magenschmerzen von all dem Ärger, das Meer hat mir über alles hinweggeholfen.«
Das alte spanische Ehepaar, das sein Lager immer bei den westlichen Hubtürmen aufschlägt, gehört zu den Ausnahmen. Die beiden angeln erst seit etwa drei Jahren und müssen davon leben. »Natürlich geht das«, sagt er, während er einen Eimer Wasser hochzieht. »In einer halbwegs anständigen Saison geht das sogar sehr gut. Nur in den Monaten, in denen wir fast nichts fangen, da sitzen wir wirklich in der Klemme.« Jeden Morgen geht es um sechs Uhr los, pro Tag verdienen sie zehn, fünfzehn Millionen. Er spult bedächtig eine neue Schnur ab, sie dreht eine Zigarette für ihn, das Hündchen der beiden wohnt in einer alten Tasche neben den Köderfischen. Die Seeluft hat ihre braune Haut gegerbt. »Ja, natürlich haben wir finanzielle Probleme. Ein Sohn unterstützt uns ein bisschen, ganz von sich aus, er kommt gut zurecht. Die anderen Kinder übrigens auch, sie haben alle drei studieren können. Aber wir bitten sie doch nicht um Geld!« Und dann erzählen sie von dem Tag, an dem sie sich zum ersten Mal begegnet sind, in Venedig, vor so vielen Jahren – sie war Fabrikarbeiterin, er Lastwagenfahrer ohne feste Anstellung -, und wie es dann weiterging: zuerst Spanien, schließlich die Brücke. Und immer noch ist da dieses Leuchten in ihren Augen, wenn sie sich ansehen.
Alle professionellen Angler fangen zuerst ein paar Köderfische. Die werden der Länge nach durchgeschnitten, und dann beginnt die eigentliche Arbeit. »Aber so große Fische wie in der Zeit unserer Eltern, die fängt man nicht mehr«, sagen alle. »Die werden jetzt von den Trawlern weiter draußen weggefischt, und außerdem ist das Meerwasser auch nicht gerade sauberer geworden.« Der Bankangestellte, der das Angeln von seinem Vater gelernt hat, beobachtet seit langem, dass die Fische Jahr für Jahr weniger werden: »Früher gab es hier so viele Fische, man hätte sie einfach mit dem Kescher holen können, von jeder Sorte, alles, was man sich vorstellen kann. Man brauchte auch kaum etwas dafür zu tun, es ging ganz ohne Köder. Noch vor zehn Jahren konnte man hier immer große Fische fangen, Blaubarsche und andere Schwergewichte. Heute beißen hauptsächlich Sardinen an, und man braucht schon eine gute Ausrüstung, wenn man noch was Vernünftiges fangen will.« Er greift unter den Proviantbehälter und zieht sein Handwerkszeug hervor: Angelschnüre und Haken in allen Varianten und Größen, Haken mit schweren Bleigewichten für starke Strömungen, ultradünne Schnüre fürs Grundfischen, Haken mit kleinen Federbüscheln, die weit ausgeworfen werden, Haken für Sardinen, Haken für Blaubarsche, Haken für Makrelen, Schnüre für schönes Wetter, schlechtes Wetter, Sturm, Regen, Sommer, Herbst.
Unter den Daueranglern kennt man sich mehr oder weniger, einer hilft dem anderen, wenn ein Fisch am Haken Schwierigkeiten macht, und Neulingen erteilt man gute Ratschläge. »Aber wenn sie nichts auf die Reihe bekommen, tun sie uns den größten Gefallen, wenn sie wieder verschwinden.« Sie selbst stehen am liebsten ganz nah bei den Hubtürmen, da schießt hin und wieder noch ein fetter Brocken vorbei. Nur hält sich hier auch gern das Grüppchen zorniger Männer auf, verbitterte ehemalige Bauern, die in der Stadt gescheitert sind und die man besser nicht anspricht, weil sich dann gleich ihre ganze aufgestaute Wut entlädt. »Sie können sich nicht benehmen«, knurrt der Bankangestellte. »Auch nicht Frauen gegenüber. Nicht einmal, wenn die ein Kopftuch tragen. Die Stadt ist inzwischen voll von unzivilisierten Hinterwäldlern!«
Die abendliche Hauptverkehrszeit beginnt. Aus den Straßen der Nordseite strömen abgekämpfte Verkäuferinnen, Arbeiter und Büroangestellte zur Brücke. Sie müssen zu den Fähren oder trotten weiter zu einem der ärmlichen Viertel der Altstadt. Hinter den Minaretten färbt sich die Sonne rot. Der Fotograf wandert trübsinnig auf und ab, dick eingepackt gegen den Wind, die Kapuze hochgeschlagen, die abgenutzte Polaroidkamera in den frierenden Händen. Um ein Uhr heute Mittag hat er angefangen; fünf Stunden gestanden, zwei Kunden. »Ich kann mich jetzt nicht mehr mit euch unterhalten. Sechs Millionen, davon kann ich nicht leben. Ein paar Millionen muss ich noch verdienen.«