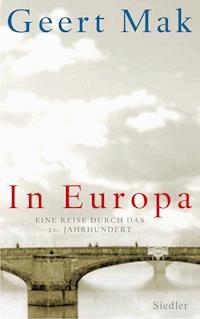3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine mitreißend lebendige Familiengeschichte um einfache Leute vor dem Hintergrund der großen historischen Ereignisse
Am Mikrokosmos seiner Familie schildert Geert Mak das 20. Jahrhundert in den Niederlanden: das Landleben um 1900, den Ersten Weltkrieg, die Not und Entbehrungen, die Zwischenkriegszeit, die Zerstörung Rotterdams, die deutsche Besetzung 1940, und schließlich den Aufstieg des Landes zwischen Meer und Marsch zu einem Musterland Europas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 815
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Für Anna, Cas, Gjalt, Tineke, Koosje und Hans Für meine Brüder und Schwestern, für die lebenden und die toten
Erinnerungen sind aus wundersamem Stoff gemacht – trügerisch und dennoch zwingend, mächtig und schattenhaft. Es ist kein Verlaß auf die Erinnerung, und dennoch gibt es keine Wirklichkeit außer der, die wir im Gedächtnis tragen. Jeder Augenblick, den wir durchleben, verdankt dem vorangegangenen seinen Sinn. Gegenwart und Zukunft würden wesenlos, wenn die Spur des Vergangenen aus unserem Bewußtsein gelöscht wäre. Zwischen uns und dem Nichts steht unser Erinnerungsvermögen, ein allerdings etwas problematisches und fragiles Bollwerk.
Klaus Mann, Der Wendepunkt
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1
Zwart Nazareth
Gerüche. Teer und Taue, das müssen die ersten Dinge gewesen sein, die mein Vater gerochen hat. Frische, neue Taue, Segeltuch und Teer. Außerdem war da der Geruch von Salz und Wellen, von Großsegeln, Vorsegeln, Focksegeln, Bramsegeln, Rahsegeln und Sturmfocken, die in der Werkstatt zum Trocknen hingen. Es gab eine Küche, in der es nach Milch und Brot roch und später am Tag nach Grieben und gebratenem Fisch. Und schließlich war da noch ein Hauch von Holz und von der Kälte des Stahls.
Die ersten Geräusche. Im Haus war manchmal aus der Werkstatt das Rattern eines Flaschenzugs zu hören oder das Schleppen einer Segeltuchrolle. Hin und wieder die Stimmen meines Großvaters und seiner beiden ältesten Söhne, Koos und Arie. Draußen hörte man die Schritte auf der Straße, das Rumpeln der Karren und das Bimmeln der Pferdebahn.
Und da waren all die in der Nähe arbeitenden Menschen, in der Schmiede und der Blockmacherei, ein Stückchen weiter, wo der Bruder meines Großvaters Masten und Flaschenzüge herstellte, oft draußen, auf dem Kai, weil seine Werkstatt zu klein war.
Abends dann die Schritte der wenigen späten Spaziergänger, die Stimme des Blockmachers, der zu einem kleinen Schnack herübergekommen war, der Wind in den Kastanien, das Scheuern der Schoner und Kutter an der Kaimauer, das Tuten eines kräftigen Horns, zweimal, in der Ferne das Flüstern von Heckwellen und Dampfmaschinen, ein merkwürdiges, fernes, hell erleuchtetes Schloss, das vorüberfuhr, auf dem Weg in eine andere Welt.
Mein Vater wurde am 28. September 1899 in Schiedam geboren, besser bekannt als Zwart Nazareth, einem nasskalten, verräucherten Nest an der Mündung der Maas, das man kaum als Stadt bezeichnen konnte. Es war vielmehr die Ansammlung kleiner Gemeinschaften mit jeweils eigener Färbung und Beschränkung.
Die Leute lebten zum größten Teil von der Geneverherstellung. In Reisebeschreibungen kann man lesen, die Stadt liege inmitten des saftiggrünen Weidelands wie ein »speiender Vulkan«, überall Feuer von Brennereien und Flaschenfabriken, umringt von Dutzenden von turmhohen Mühlen mit sich schnell drehenden Flügeln, als würde im Innern der Mauern nicht schon genug geschuftet.
Manchmal hatte man den Eindruck, Schiedam sei eine einzige Spelunke. Brennereiarbeiter füllten, wenn sie nach Hause gingen, ihre Trinkflaschen mit Schnaps, um sich den Feierabend zu versüßen. Am Waschtag, wenn die Frauen beim Kessel der Brennereien warmes Wasser holen durften, kam statt Wasser Genever in die Eimer, die dann mit einem dampfenden Aufnehmer zugedeckt wurden. Hunde tranken Genever, die Kühe soffen ihn mit dem Abwasser und torkelten über die Weide.
Die meisten Viertel waren verfallen. Die Verarmung, die zuerst in der Innenstadt grassierte, hatte sich wie eine Krankheit ausgebreitet und war scheinbar durch nichts und niemanden aufzuhalten.
Die Fabrikmauern sonderten einen lauen Gestank ab, die Kanäle dampften, die Augen der Arbeiter schwammen im Alkohol, die Frauen waren mager und schwanger, die Kinder husteten sich die Lungen aus dem Leib – das war das Zwart Nazareth von 1899.
Die Niederlande waren damals im Vergleich zu heute menschenleer, und die Welt war voller Gewissheiten. Dreiviertel der fünf Millionen Einwohner lebten auf dem Land; in ganz Europa waren es über neunzig Prozent. Auf der mit Klinkern gepflasterten, kaum vier Meter breiten Straße von Amsterdam nach Haarlem kam dann und wann ein Auto vorbei. Städte und Dörfer waren morsch. Zahlreiche Häuser, Bauernhöfe und andere Gebäude aus dem 17. und 18. Jahrhundert wurden immer noch genutzt.
Straßenbahn und Fahrrad waren noch nicht allgemein verbreitet. Die Infrastruktur von Stadt und Land orientierte sich an Entfernungen, die zu Fuß bewältigt werden konnten: Jedes Dorf war das Zentrum eines Gebiets, das man in einer Stunde durchqueren konnte, in jeder großen Stadt lebten viele Menschen auf engstem Raum. Jeder Landstrich hatte bis 1909 sogar seine eigene Zeit: Zwischen dem Osten und dem Westen der Niederlande gab es mindestens fünfzehn Minuten Zeitunterschied. Insgesamt gab es 12 000 Telefone.
Europa war das selbstverständliche Zentrum der modernen Welt. Der Zar regierte über Russland, der Kaiser über Deutschland und Abraham Kuyper »der Gewaltige« über die kleinen Niederlande. Der Schnellzug Paris – Calais war mit 93 Stundenkilometern das schnellste Fortbewegungsmittel auf dem Kontinent. In 32 Tagen konnte man einmal um die Erde reisen. Es sollte noch neun Jahre dauern, bis zum ersten Mal ein Flugzeug seine Runden über niederländischem Boden drehte, noch dreizehn Jahre, bis der Untergang der Titanic das Ende des alten Europa ankündigen würde.
Mein Vater hatte eine Zwillingsschwester. Catrinus und Catrien waren das sechste und siebte Kind einer am Ende zwölfköpfigen Familie. Abgesehen von der Zeit im Schoß meiner Großmutter, hatten Bruder und Schwester nichts gemein. Vom Moment der Geburt an verliefen ihre Lebenslinien in unterschiedlicher Richtung, und sie berührten sich erst wieder am Schluss, wie eine Ellipse die Welten umspannt.
Das Rotterdamsch Nieuwsblad, das an diesem Tag erschien, berichtet über den Atjeh-Krieg, die Affäre Dreyfus, die Yagui-Indianer, die sich in Los Angeles eine Schlacht mit der mexikanischen Armee lieferten, und über eine Versammlung des Allgemeinen Niederländischen Zuavenverbands, auf der dagegen protestiert wurde, dass man dem Papst die Gewalt über die Stadt Rom entzogen hatte. Und dann stoße ich, in einer Reportage über eine Bootsfahrt der jungen Königin Wilhelmina auf der Maas, auf eine Beschreibung der hellen Seite von Zwart Nazareth: die zum Wasser hin gelegene. »Vor uns der leuchtend graue Fluss mit grünen, silbernen und goldenen Tönen und weißen Schaumkronen, auf dem sich die Boote und Schiffe wiegen. Und in der Ferne, in sehr großer Ferne, im Nebelschimmer, die ragenden Brücken, die Riesenbrücken mit ihren hohen Pfeilern. Links die Stadt, in düsteren, braunen und dunklen Farben, dann plötzlich hier und da von einem dünnen Strahl der Sonne beleuchtet.«
Ein kräftiger Wind wehte von Westen her, der große Schaumflocken von den Wellen des Flusses aufwirbelte. In der Ferne sah der Reporter die kleine Stadt liegen, den Hafen, die schlanken Schiffe, einen Wald von Masten, ein Netz aus Rahen, Tauen und Schoten. Dazwischen standen träge, gemütliche Dampfschiffe, an deren Top dann und wann etwas Rauch zu sehen war. Und überall waren Flaggen, Hunderte, »in der Ferne vor dem grauen Himmel zu einer harmonischen Farbmischung verschmelzend«.
So muss es an dem Nachmittag gewesen sein, als mein Vater 1899 geboren wurde.
Anhand der im Gemeindearchiv von Schiedam aufbewahrten Erinnerungen einer seiner Schwestern, meiner Tante Maart, kann man die frühe Kindheit meines Vaters recht gut rekonstruieren. Was sah er als zwei- oder dreijähriges Kind?
Zunächst die Segelmacherei meines Großvaters, ein niedriges Haus mit einer Glastür, auf beiden Seiten große Fenster und dahinter eine Werkstatt, die bis zum Garten reichte. Oben gab es Segelspeicher und Schlafzimmer und hinten eine hübsche Kammer, der Stolz meiner Großmutter. Ein Badezimmer hatte man nicht; die Jungen wuschen sich sommers wie winters draußen auf dem Hof, wo sie das Wasser aus einem Hahn über Kopf und Nacken laufen ließen.
Der Nachbar war ein Wasserwärmer, jemand, der ausschließlich mit heißem Wasser handelte und mit glühenden Kohlen, mit denen man das Feuer im Ofen anzündete. Daneben lag eine große Wäscherei, aus deren Fenster es immer dampfte. Davor standen ein Karren, mit dem die Wäsche ausgefahren wurde, ein Pferd und ein Kutscher, dahinter befanden sich ein Stall für das Pferd und eine Wohnung für den Kutscher, denn den Begriff Rationalisierung kannte man damals noch nicht. Dann gab es noch einen Petroleumhändler, einen Zigarrenladen, einen Schmied, der fast immer draußen Pferde beschlug, eine Brennerei, eine Kneipe mit betrunkenen Männern, ein Mützengeschäft, einen hübschen Laden mit Kaffee und Tee, wieder ein paar Brennereien – Schauermänner schulterten die Getreidesäcke und trugen sie über Leitern auf den Speicher, wo die Gerste gären sollte – und schließlich einen Bäcker, der samstags für drei Cent Teilchen mit Eischnee verkaufte.
Auf der anderen Seite der Segelmacherei stand ein kompletter Bauernhof. In vielen Städten gab es damals noch Reste von Ländlichkeit, und das war auch hier der Fall. Der Bauer wohnte mit seinen Töchtern vorne, in einem Haus mit einer großen, etwas höher gelegenen Vorratskammer, die vollkommen leer war, wenn man von draußen hineinsah. Erst wenn man reinging, entdeckte man die Milchkannen, die Butter und die Käse, die hier gemacht wurden. Hinter dem Haus lag das Hofgelände, mit Heuböden, Karren und Misthaufen, wie bei jedem Bauernhof. Das Weideland war nur ein paar Minuten entfernt, am Deich.
Neben dem Hof war ein Pferdestall, wo die Kinder oft zuschauten. Die Pferde gehörten einem Fuhrunternehmer, der ein paar Häuser weiter wohnte. Wenn dort ein Pferd ausgespannt wurde, dann lief es ganz allein in den Stall. Das wunderte die Kinder immer: ein Pferd, das einfach so durch ein Tor zwischen den Häusern lief, das einem plötzlich entgegenkommen konnte, und dann stand man auf einmal so einem großen, einsamen Tier gegenüber. Etwas weiter befand sich ein Teegarten, in dem Frauen in langen Kleidern und Männer mit Strohhüten saßen und auf den Fluss hinaus sahen, auf dem Tisch eine bauchige Flasche für fünf Cent. Und auf der Ecke, gleich am Deich, stand das »Schreiershuisje«, ein kleiner Schuppen, in dem sich die Fischerfrauen bei schlechtem Wetter drängelten, um ihren Männern Lebewohl zu winken.
Ein Foto vom Kai: Mein Vater muss zu der Zeit fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein. Masten, Tjalken, Logger, in der Ferne eine Mühle, Duckdalben, ein Karren, ein paar Fässer, dann eine Reihe von Bäumen, Straßenbahngleise, Pflastersteine, ein schmaler Bürgersteig, hier und da eine Lampe an einem Haus. Im Vordergrund steht ein Mädchen vor einer Tür und wartet, sie trägt einen schwarzen Rock, darüber eine lange weiße Schürze. Von weitem kommt ein Junge angelaufen, graue Jacke, kurze schwarze Hose, Mütze.
Die Farben müssen in Wirklichkeit ebenso grau gewesen sein, wie es das Foto vermuten lässt. Alle in der Nachbarschaft trugen nur graue oder bräunliche Kleider, erzählte mir meine Tante Maart. Hellere, bunte Sachen hätte man viel öfter waschen müssen, und das schaffte eine durchschnittliche Hausfrau meistens nicht. Manche wuschen ihre Wäsche sogar noch im Fluss, von einem Boot aus.
Auch die Kinder waren bräunlich und grau. Ich fragte meine Tante, was sie so spielten. »Wir spielten mit dem Kreisel und hüpften«, sagte sie. »Die Mädchen sprangen Seil und schleuderten singend ihren Diabolo, eine Art Kreisel, der auf einem Bindfaden in Drehung versetzt wurde, in die Luft.« Sie erinnerte sich noch an das dazugehörige Lied und summte es leise.
Mein Vater war fast ein halbes Jahrhundert alt, als ich geboren wurde. Ich war ein echter Nachkömmling, eine Zugabe anlässlich der Befreiung, und seine jungen Jahre lagen damals schon so weit zurück, dass er nur ganz selten davon erzählte. In dieser Hinsicht habe ich ihn schlecht gekannt.
Er stammte aus einer typischen Familie der Schiedamer Mittelschicht. »Eine selbstständige, nicht besonders bemittelte Mittelschicht mit einem mäßigen Einkommen galt als das Rückgrat jeder zivilisierten Gesellschaft, vor allem der demokratischen.« So treffsicher beschrieb das Historikerehepaar Jan und Annie Romein die soziale Klasse, die die Zeit des Umbruchs zwischen den Jahrhunderten dominierte und zu der auch mein Großvater gehörte. Die Ladeninhaber, Handwerker, die kleinen Betriebe, in denen der Meister zusammen mit seinen ältesten Kindern und einem oder zwei Helfern arbeitete, sie gehörten zum Kern der Gesellschaft. Probleme der Mittelschicht bezeichnete man als »soziale Rückenmarkschwindsucht«. Ohne den Puffer der Mittelschicht hätten sich extreme Armut und extremer Reichtum in ihrer ganzen Härte gegenübergestanden, und das hätte das Ende aller Beständigkeit bedeutet. So meinte man im Allgemeinen, denn das war schon seit dem Mittelalter so.
Die Maks waren schweigsame Handwerker, und sie arbeiteten viel und hart. Im 18. Jahrhundert waren sie Schiffer und Lachsfischer auf der Maas, und seit Beginn des 19. Jahrhunderts vermeldet das Schiedamer Gemeindearchiv eine Segelmacherei und Seilerei am Hoofd. Seitdem gab es in der Familie immer Segelmacher. Eine scharfe Trennung zwischen dem Meister und seinen Gesellen existierte in derartigen Betrieben nicht. Die Maks waren zwar Besitzer und hatten es sogar zu einem gewissen Wohlstand gebracht, aber sie arbeiteten hart mit, machten sich die Hände schmutzig und standen, was ihre gesellschaftliche Position betraf, den Arbeitern näher als den höheren Schichten.
Der älteste Bruder meines Großvaters hatte ein Lebensmittelgeschäft mit großen Fenstern und einer schönen Schneidemaschine, sehr modern für die damalige Zeit. Ein anderer Bruder war Blockmacher, ein dritter war Binnenschiffer auf der Strecke nach Amsterdam, und ein vierter war Buchhalter. Er war der Erste in der Familie, der morgens zu einer bestimmten Zeit ins Büro ging und abends ebenso pünktlich wieder nach Hause kam. Er war wohl auch der Erste in der Familie, für den es so etwas wie Freizeit gab, so kurz diese in unseren Augen auch gewesen sein mag.
Die Nähe zur Arbeit war immer und überall spürbar, und jeder war von Kindesbeinen an damit vertraut. Die Schoner und Logger lagen im Hafen; die Kinder erbettelten bei den Schiffern des Öfteren ein Stück harten, nahrhaften Schiffszwieback. Beim Schmied, beim Blockmacher, in der Segelmacherei und in den Brennereien standen die Türen meistens offen. Wenn der Blockmacher einen Mast umdrehen musste, dann bat er die Passanten, ihm kurz zu helfen. Wenn der Hufschmied sich verhauen und ein Pferd verletzt hatte, dann kam er schweigend in die Werkstatt meines Großvaters und langte in das Teerfass. Teer war das Heilmittel gegen alle Krankheiten und Entzündungen. Wer gerade nichts zu tun hatte, blieb einfach stehen und sah den Leuten bei der Arbeit zu; wer etwas mehr Zeit hatte, der setzte sich auf die Bank, um zu plaudern.
Der Lebensrhythmus am Kai wurde von den Bewegungen der Schleuse beherrscht. Das Hoofd war ein Schulbeispiel für das, was manche Historiker als »Ökonomie der Stagnation« bezeichnen, als eine Wirtschaft des Wartens und des Aufenthalts, die es um 1900 immer noch gab, vor allem am Wasser. Stagnation hatte, von den Nachteilen abgesehen, auch große Vorteile in der täglichen Praxis. Die ganzen Zölle (manche wurden erst in den fünfziger Jahren aufgehoben), Schleusen, Brücken, Dämme und Sandbänke, all die Orte, an denen man warten und umsteigen musste, sie waren jahrhundertelang eine ebenso respektable Einnahmequelle wie der Transport selbst, und eine ganze Reihe von Herbergen, Märkten und auch Dörfer und Städte verdanken diesem Umstand ihre Existenz.
Deshalb erhob sich auch stets Widerstand gegen neue, schnelle Verbindungen. In der Welt von 1900 gab es nicht nur ein großes Interesse an Geschwindigkeit, sondern auch am Verweilen. Haltepunkte waren Orte, an denen kleine Reparaturen ausgeführt, wo Erfahrungen ausgetauscht und Geschichten erzählt wurden. Es gab also auch so etwas wie eine Kultur der Stagnation. Und es besteht kein Zweifel daran, dass der Betrieb meines Großvaters dazugehörte.
Dies bedeutet nicht, dass in der Segelmacherei Mak & Söhne nur rumgetrödelt wurde. »Bei uns waren immer alle beschäftigt«, erzählte mir meine Tante Maart. »Wir hatten keine Zeit, lange rumzureden.« Ihre jüngste Schwester, Nel, erinnert sich, dass Koos und ihr Vater manchmal mit ihr spielten, doch meistens »vibrierten sie vor Eile«.
Die Söhne, Koos und Arie, hatten nie eine Berufsschule besucht, mein Großvater hatte ihnen alles beigebracht, und er hatte alles von meinem Urgroßvater gelernt. So hatte sich das Fachwissen in der Familie angesammelt, von Generation zu Generation. Außerdem besaßen sie die Intuition des guten Fachmanns und ein hervorragendes Gefühl für Mathematik, unverzichtbar für einen Segelmacher. »Manchmal hockten sie stundenlang auf dem Speicher und rechneten, bevor sie sich daranmachten, ein Segel zuzuschneiden, mit lauter Linien und Dreiecken, regelrechte Millimeterarbeit«, erinnerte sich Tante Maart. »Koos war von seinem Beruf total besessen. Er ging sonntags nach Delftshaven, nur um sich die Takelage irgendeines Dänen anzusehen. Wenn er dann einen Knoten entdeckte, den er nicht kannte, frickelte er so lange rum, bis er den auch beherrschte.«
Die Segel wurden, seit alters, von Hand genäht. Für ein mittelgroßes Segel brauchten vier Leute ungefähr zehn Tage. Die Segelmacher trugen ein Kuhhorn mit Fett am Gürtel, und jedesmal mussten sie die Nadel da kurz hineintauchen, weil sie sonst nicht das dicke Segeltuch durchstechen konnten. An der Hand trugen sie ein Lederstück, das am Daumen mit einer geriffelten Stahlplatte versehen war, damit sie genug Kraft ausüben konnten. Meistens brannte in der Werkstatt ein Ofen, um die Segel geschmeidig zu halten. Und die Gaslampen summten von morgens fünf bis abends sieben.
Mein Großvater war ein altmodischer Handwerker, jemand, für den sein Handwerk dasselbe wie Kunst war: ein Wert an sich, wichtiger als Geld. In der Familie sind ein paar Notizbücher erhalten geblieben, in denen Aufträge und rasch hingekritzelte Kalkulationen verzeichnet sind:
Für den Russen Carlotte, einen Außenklüver …Für den Dänen Marig, Kapitän Rasmussen, einenBinnenklüver …Ein Stagsegel und ein Sprietsegel für die Quintos, Vander Elst …Eine Matratze repariert und mit Seegras gefüllt,70 Cent …Alle Seile und Taue der Mühlen der Verenigde PoldersSchiebroek, Berg en Broek …Neues Luggersegel, 36 Ellen, wie von Jacob Dijkshoorn …Alles in bester Qualität und präzise gearbeitet.
So war es in den Augen meines Großvaters gut, und mehr war nicht nötig. Der technische Fortschritt hielt erst in den Betrieb Einzug, als der älteste Sohn Koos sich dafür einsetzte. Er hielt es für unsinnig, Nähmaschinen, die auch für die Segelmacherei entwickelt worden waren, nicht zu benutzen. Mein Großvater war anderer Ansicht, und schließlich schaffte Koos die Maschine 1906 von seinem eignen Geld an. Adler stand darauf.
Mein Großvater war nicht der Einzige, der sich halb unbewusst der Mechanisierung und Industrialisierung, der Hast und der Geschwindigkeit der neuen Zeit widersetzte. Um die Jahrhundertwende herum gab es noch ein Unternehmertum, das die Konkurrenz nicht gnadenlos unterbot und nicht den größtmöglichen Profit bei den Kunden machen wollte, das das Spiel von Angebot und Nachfrage nicht bis zum Äußersten trieb und keine Werbung nötig hatte, weil nämlich der gute Name des Handwerkers und die Qualität seiner Produkte genügten.
Oft half man sich gegenseitig mit Krediten aus. Dem Mann, der die Nähmaschine reparierte, lieh mein Großvater Geld, damit dieser ein Nähmaschinengeschäft eröffnen konnte. Doch den Katwijker Heringsfischer, der sich Geld für einen Schiffsmotor borgte – er war der Einzige, der bislang noch ausschließlich Segel verwendete, ein sehr frommer Mann –, sahen die Maks nie wieder.
Wenn mein Großvater einen Auftrag annahm, nannte er immer einen sehr niedrigen Preis. Einmal sogar so niedrig, dass der Auftraggeber persönlich in die Werkstatt kam und sagte, das gehe nicht: »Pack noch hundert Gulden obendrauf, und du kriegst den Auftrag trotzdem.« In der Familie erzählt man sich die Geschichte, dass mein Großvater eines Abends nach der Arbeit ein Vergnügungsboot in den Hafen einlaufen sah, für das er ein paar Wochen zuvor neue Segel angefertigt hatte. Als das Schiff angelegt hatte, ging er zum Besitzer und erkundigte sich, ob die neuen Segel in Ordnung seien – »hervorragend, wirklich hervorragend« –, und fragte dann, ob er sie dennoch mit in die Werkstatt nehmen dürfe. Er habe vorhin eine ausgebeulte Stelle im Segel entdeckt, und das gefalle ihm nicht. Am nächsten Morgen mussten alle Söhne und Knechte ran, die Nähte des Segels wurden aufgetrennt und alle Bahnen um wenige Millimeter versetzt wieder zusammengenäht. Nach zwei Tagen unbezahlter Arbeit war die Ehre der Segelmacherei gerettet.
Es ist kein Zufall, dass ich in den Unterlagen meines Großvaters fast ausschließlich Kladden und Berechnungen fand und fast keine offiziellen Verträge, obwohl es mitunter um ansehnliche Beträge ging. Die Betriebsführung basierte fast vollständig auf mündlichen Absprachen, auf dem Wort, auf Vertrauen, ein Unternehmertum, das mehr im 17. Jahrhundert als im 20. wurzelte.
Schiedam lag wie die meisten holländischen Städtchen in einem Netz aus Kanälen, Bächen, Entwässerungsgräben und was sonst noch so Richtung Fluss strömte. Für viele Niederländer war das Wasser der Feind Nummer eins. Die Deiche waren oft schmal, und durch offene Einbuchtungen konnte das Meer überall das Land überfluten. Auf vielen Poldern war das Leben Winter für Winter eine Abfolge von Beinah-Tragödien und kleinen Katastrophen. Der Teil Schiedams um das Hoofd herum war in dieser Hinsicht besonders gefährdet. Regelmäßig drückten Nordweststürme das Meerwasser in den Fluss, so dass die Ufer überflutet wurden. Den einzigen Schutz stellten Flutbretter dar, die an allen Häusern vor die Türen und Fenster geschoben und mit Lehm abgedichtet wurden. Die Häuserreihe fungierte dann als eine Art Notdeich, der im Übrigen der einzige Schutz für ein ganzes Arbeiterviertel war.
In einem Schulaufsatz meines Vaters – ich fand das vergilbte Heft vor ein paar Jahren in einer Schachtel auf dem Speicher – wird eine solche Sturmnacht beschrieben. Es fängt damit an, dass ein paar Polizisten meinen Vater »mit lautem Hola-ho-Rufen« wecken. Erst als er »all right« brüllt – »das schallt am besten, weißt du« –, gehen sie weiter zu den Nachbarn. Er weckt einen seiner Brüder: »He, Mann, raus aus dem Bett, wir müssen abhauen« – und als das seelenruhige Schnarchen des Bruders nicht aufhört, zerrt er an der Decke und sagt lauter: »Raus jetzt, das Wasser steht schon bis zu den Straßenbahnschienen.«
Alle Nachbarn wurden geweckt, in so einer Nacht versuchte jeder, sein Hab und Gut zu retten, eine Kette von gespenstischen Lichtlein, links und rechts, so weit das Auge reicht. Am nächsten Morgen stand das ganze Ufer unter Wasser, die Boote trieben beängstigend hoch vor den Fenstern. Doch stets sank das Wasser auch wieder, und das Städtchen fiel wieder in seinen Dämmerschlaf zurück.
In einem anderen Schulaufsatz beschreibt mein Vater nur die Aussicht, die er von seinem Arbeitszimmer aus hat. Es ist eine Art geschriebenes Stilleben: das gläserne Dach, die breite Regenrinne, die graue Mauer, die Krone eines Apfelbaums im Garten des Nachbarn. Vor ihm ein Tintenfass, Federn und Federhalter, daneben Bücher und ein Taschenkalender. In der Regenrinne die vertrockneten Schalen einer Apfelsine. »Ich könnte dir genau den Dachziegel zeigen, unter dem diesen Sommer eine Spatzenfamilie gewohnt hat.«
Wenn er seinen Blick schweifen ließ, sah er eine Ansammlung niedriger, eintöniger Häuschen, die der Rauch der Brennereien schwarz gefärbt hatte. Am Rand standen hier und da große, rechteckige Gebäude: Fabriken, eine Kirche, ein stattliches Verwaltungsgebäude.
»Ein großer Bankrott scheint sich über die Stadt gesenkt zu haben«, so beschrieb der Schiedamer Schriftsteller Frans Netscher seine Stadt im Jahr 1900. »Das Elend hängt an den Giebeln, die Verkommenheit lugt aus den spitzen Pflastersteinen hervor. Und überall in den Häfen erblickt das Auge geschlechtslose, vieldeutige Fassaden mit kleinen Türen, durch die Männer mit aufgekrempelten Hosenbeinen und roten Wollunterhemdärmeln eifrig rein- und rausgehen, Fässer rollen, mit Wasser spritzen.« Ein Stück weiter schufteten die Frauen in Korken- und Flaschendeckelfabriken. Die Kinder spielten auf den Fässern und brachten ihren Eltern das Essen im emaillierten Henkelmann, der in ein buntes Handtuch gewickelt war. Wer nicht in der Brennerei selbst beschäftigt war, arbeitete als Böttchergehilfe oder verkaufte den Bauern die Schlempe. Eine Möglichkeit, diesem Leben zu entkommen, gab es fast nicht, denn was sollte ein alkoholabhängiger, ungelernter Arbeiter mit Familie sonst machen?
Das Schiedam, in dem mein Vater zu Beginn des Jahrhunderts aufwuchs, war eine beengende, total erschöpfte Gemeinschaft. Es war eine Stadt, die zwischen einer konservativen Bauern- und Fischergemeinde und der Dynamik einer schnell wachsenden Weltstadt stand – und hierin spiegelt die kleine Stadt die Mentalität großer Teile der damaligen Niederlande wider. Permanent standen sich Konservatismus und Erneuerung gegenüber, und dieser Konflikt trat immer wieder zu Tage, in tausend Formen von Stillstand und Bewegung.
Zwei Minuten von der Segelmacherei meines Großvaters entfernt stand die neueste Sensation der Stadt: das Fahrradgeschäft mit angeschlossener überdachter Radfahrschule, das von der Simplex Automatic Machine Company eingerichtet worden war. Die Säle, in denen die Fahrstunden erteilt wurden, schmückten Palmen und Sträucher. Die Schüler wurden in ein ledernes Korsett mit Handgriffen gesteckt, von zwei uniformierten Assistenten festgehalten und, begleitet vom munteren Klimpern eines Pianisten, auf dem Fahrrad durch den Saal gerollt.
Auf der anderen Seite befand sich der Petroleumladen von Sjouk Lolkes. Lolkes hatte ein lahmes Bein, das er hinter sich herzog. Bei einer großen Werft durfte er das Gelände fegen, und dies war seine einzige feste Einnahmequelle. In seinem Laden, wo er auch wohnte, stand in der Ecke ein großes rotes Fass Petroleum, das er literweise verkaufte. Man brauchte es für die Petroleumlampen, die damals noch allgemein üblich waren. Im Regal standen außerdem noch eine blaue Büchse mit der Aufschrift »Van Nelle Koffie« und eine Kiste Zigarren. Letztere verkaufte er einzeln an die vorbeikommenden Seeleute. Im Schaufenster lagen Holzbündel. Das Holz hatte er in seiner Freizeit aus dem Fluss gefischt, in seinem Innenhof getrocknet und samstags zu Brennholz zerhackt. Sonst verkaufte er nichts. Zusammen mit seiner Frau Aaltje und einem Dutzend Kinder humpelte er so durchs Leben.
In der Werkstatt meines Großvaters machten Arie und Henk sich den ganzen Tag lang über Lolkes lustig, bis meine Großmutter rief: »Jungs, das gehört sich nicht!« Darüber lachen musste sie aber dennoch.
Eines Tages bekam Aaltje noch ein Kind. Kurze Zeit später fand man es tot in seiner Wiege, eine Ratte hatte es in den Nacken gebissen.
Mein Vater konnte sich an einen einzigen Moment erinnern, in dem er all dies hinter sich lassen konnte – am Ende seines Lebens sprach er manchmal darüber. Als er ungefähr zwölf Jahre alt war, durfte er eine Woche lang auf dem Frachtschiff seines Onkels Jacob und seiner beiden Cousins mitfahren, bis nach Zaandam und zurück. Er muss unterwegs eine wasserreiche Landschaft mit vielen Windmühlen gesehen haben – in der Umgebung von Zaandam gab es damals noch Hunderte von Mühlen: Sägemühlen, Ölmühlen, Farbmühlen, ein komplett aus Holz errichtetes Industriegebiet des siebzehnten Jahrhunderts.
An Einzelheiten konnte er sich nicht mehr erinnern, und von der ganzen Reise waren ihm nur zwei Dinge im Gedächtnis geblieben.
Zum einen handelte es sich um einen Unfall. Die kleine holländische Stadt war in seiner Erinnerung in die Farben eines Sommerabends getaucht. Sie lagen vor einer Schleuse und warteten darauf, daß sie an der Reihe waren. Die ungestümen Söhne von Onkel Jacob lümmelten auf der Kaimauer herum. Dort stand auch ein Bäckerjunge mit einem Lastenfahrrad. »Lässt du uns mal mit dem Rad fahren?«, fragte einer der Söhne. Er durfte, hatte aber noch nie auf einem Fahrrad gesessen. Er fuhr einen großen Bogen und landete prompt im Schleusenbecken. Der Tumult in der Abendstille, der klatschnasse Junge. Die Brote, alle verdorben. Onkel Jacob, der wütend zum Bäcker geht, um den Schaden zu bezahlen. Die Aufschneiderei, hinterher.
Zum anderen erinnerte er sich an eine bestimmte Situation: Er saß auf dem Vordeck in der Sonne, die Wasseroberfläche des Kanals lag höher als das Land drum herum, und auf dem Polder wurde gerade gemäht. Im Kern bestand seine Erinnerung nur aus Geräuschen: dem Glucksen des Wassers am Bug, dem Rauschen beim Mähen, hin und wieder der helle Klang einer Sense, die gedengelt wird. Mehr eigentlich nicht. Aber die Wärme der Sonne damals und die spärlichen Geräusche in der holländischen Landschaft, die blieben ihm präsent, bis in seine schlaflosen Nächte, siebzig Jahre später.
Im fernen Paris wurde indessen der Ton für ein Jahrhundert, in dem alles anders werden würde, der Ton von Bewegung, Geschwindigkeit und Licht angestimmt. Als mein Vater fast ein Jahr alt war, fand die revolutionäre Weltausstellung statt, auf der Dutzende von neuen Erfindungen präsentiert wurden. Fast alle gezeigten Apparate liefen mit Strom, es gab Lampenkaskaden, Dynamos, so groß wie kleine Fabriken, und rollende Bürgersteige, auf denen man flanieren konnte, ohne einen Schritt zu gehen. Die Besucher, die zu Hause meist noch Kerzen und Petroleumlampen hatten, waren tief beeindruckt und bestaunten den »Lichtwalzer« und die zitternden Lichtbilder von der tanzenden Sarah Bernhardt.
Den Insidern fiel jedoch die bemerkenswerte Qualität der Produkte aus den Vereinigten Staaten, aus Deutschland und aus Japan auf. Das war kein Zufall.
Das 19. Jahrhundert hatte mit der Französischen Revolution begonnen, auf die eine Zeit der Reaktion und des Widerstands gegen fast jede Form von Modernisierung folgte. Danach hatte es in beinah allen europäischen Ländern eine Periode vorsichtiger Reformen gegeben. Gegen Ende des Jahrhunderts begannen die einzelnen Mächte, einander immer aufmerksamer zu beobachten. Sie schlossen eine Allianz nach der andern, sie wetteiferten bei der Eroberung immer neuer Kolonien miteinander, sie rüsteten erneut auf, Rivalität bestimmte den Tenor. In dieser Situation machten sich die drei Neulinge daran – auch Deutschland war erst seit dreißig Jahren eine Nation –, sich allmählich als Großmächte zu profilieren.
Auf dem Hoofd erfuhr man von diesen internationalen Entwicklungen vermutlich nur gerüchteweise und aus gelegentlichen Berichten im Rotterdamsch Nieuwsblad. Von den Maks hat meines Wissens nie jemand Tagebuch geführt, doch ich fand die Notizen eines Schiedamer Schiffers aus der Zeit, und ich nehme an, dass das Weltgeschehen auf die Menschen am Hoofd ähnlich wirkte wie auf Teunis Boere:
29. April. kaltes Wetter und zum Markt gewesen. Nie gibt’s Arbeit. Es gibt so wenig Arbeit, weil zwischen Italien und der Türkei Krieg herrscht, und darum können die Schiffe nicht fahren, wegen der treibenden Dinamietbomben, die unter Wasser liegen. Vor England liegen 86 Hochseeschiffe. 4. Mai. Jetzt haben die Hochseeschiffe noch 17 Tage Arbeit, bevor sie in Rotterdam sind, und schon wieder ist ein Unglück passiert, mit der Texas, vollständig in die Luft geflogen auf einer treibenden Mine. Das iss Dinamiet, wobei wieder 120 Menschen im Meer ertrunken sinn.
So wird man auch über die Berichte über den fernen Russisch-Japanischen Krieg von 1904/05 gesprochen haben, in dem zum ersten Mal eine erschöpfte europäische Großmacht durch die Dynamik eines nicht-europäischen Lands besiegt wurde, das sich die westliche Technik zu Eigen gemacht hatte. So wird man über Paulus Krüger und den Burenkrieg im »stammesverwandten« Südafrika diskutiert haben, durch den viele Niederländer so anti-englisch wurden, dass sie jahrzehntelang pro-deutsch blieben.
Der eigenen Haustür näher waren die Probleme des niederländischen Königshauses und die Befürchtung, dass Königin Wilhelmina kinderlos sterben könnte. Fürstenhäuser spielten in der Politik noch eine zentrale Rolle, und es konnte große politische Folgen haben, wenn der Thron an irgendeinen entfernten deutschen Erben fiele.
1902 erkrankte Wilhelmina an Typhus und schwebte monatelang zwischen Leben und Tod. Die Möglichkeit, dass die Niederlande in absehbarer Zeit Teil des deutschen Kaiserreichs werden könnten, war damals nicht nur rein hypothetisch. Das drohende Unglück konnte nur durch Hoffen und Beten abgewendet werden.
Das Brot, das meine Großeltern aßen, stammte meist noch aus den Niederlanden, doch das Getreide dafür kam bereits zum größten Teil aus Russland und Amerika, die Baumwolle für die Segel wurde aus Afrika und Amerika importiert und der Kaffee aus Brasilien.
Zwischen 1880 und 1910 verzehnfachte sich das Transportaufkommen von Eisen- und Straßenbahn. Die ganzen Niederlande wurde mit einem dicht geknüpften regionalen und lokalen Schienennetz überzogen. (Als in den dreißiger Jahren der Omnibus aufkam, wurde es übrigens ebenso schnell wieder abgebaut.) Zwischen 1890 und 1910 wurden weltweit rund 400 000 Kilometer Schienen verlegt; die ökonomischen Folgen dieser Entwicklung waren bald überall zu spüren.
Unmerklich entstand langsam so etwas wie eine Weltwirtschaft. Manche Betriebe passten sich an und wurden allmählich zu internationalen Konzernen. Kleine Unternehmer wie mein Großvater, die im 19. Jahrhundert das Rückgrat der Nation gebildet hatten, wurden bereits um 1900 immer seltener. 1850 war noch die Hälfte der niederländischen Bevölkerung in irgendeiner Form selbstständig, 1899 nur noch ein Fünftel. Der Rest arbeitete bei großen Firmen oder bei (halb-)staatlichen Organisationen.
Auf diese Weise entstanden eine unabhängige, aber aussterbende Mittelschicht und eine neue, abhängige Mittelschicht aus Aufsehern, Technikern, Mechanikern, Lehrern, Abteilungsleitern. Auf den ersten Blick unterschieden sich die beiden Gruppen kaum, die zweite entstammte in vielen Fällen sogar der ersten. Doch in Wirklichkeit lagen Welten zwischen ihnen.
Die alte Mittelschicht meines Großvaters dachte in dem Sinne kapitalistisch, als sie mit eigenem – kleinen – Kapital für das Ideal einer unabhängigen Existenz mit einer sicheren Altersversorgung arbeiten wollte. Die Industrialisierung und das große Geld durchkreuzten diesen Traum. Deshalb setzte die alte Mittelschicht dem großen Kapital auch so oft heftigen Widerstand entgegen. Die neue Mittelschicht hingegen entschied sich für die Abhängigkeit von gerade eben diesem großen Kapital – und identifizierte sich auch oft damit –, um auf diesem Umweg soziale Sicherheit zu erlangen. Hinzu kommt noch, dass man in den neuen Betrieben nicht mehr auf überlieferte Techniken, Werte, Normen und die Autorität älterer Generationen bauen konnte wie in der Segelmacherei. Man musste sich selbst Wissen aneignen und es ständig erweitern und anpassen. Darum war die neue Mittelschicht auch viel offener für jede Form von Bildung.
Die alte Mittelschicht war meist patriarchalisch und human. Die Gesellen meines Großvaters waren mehr oder weniger ein Teil der Familie, und nach Auskunft meiner Tante Maart wurde nie jemand fortgeschickt, ohne dass er etwas zu essen bekommen hätte. Als aber ihre Ideale zerstört wurden, da legte die alte Mittelschicht ihr Wohlwollen ab – was schließlich zu einem ausgeprägten Konservatismus führte.
Der Haltung der neuen Mittelschicht hingegen war von Anfang an eine gewisse Härte eigen. Sie konnte nicht mehr in aller Ruhe warten, bis sie durch harte Arbeit einen gewissen Wohlstand erworben hatte. Nein, jeder Einzelne musste sich seinen Platz erobern, indem er jede sich bietende Gelegenheit beim Schopfe ergriff, sich aus der Masse zu erheben. Nicht nur sein Körper und seine Zeit, auch seine Seele wurde vom rasenden Räderwerk der neuen Industrie und Bürokratie erfasst.
Der erste neue »Mittelschichtler« in der Familie war, wie bereits erwähnt, der Onkel meines Vaters, der als Buchhalter arbeitete. Der zweite war sein etwas jüngerer Bruder Aart, der ebenfalls kein Geschäft aufmachte, sondern ins Büro ging. Der dritte, der die alte Welt verließ, war mein Vater.
Das erste der beiden frühesten Fotos von meinem Vater ist ein Familienporträt, aufgenommen bei der Kupfernen Hochzeit meiner Großeltern im Herbst 1900. Das Bild ist unscharf, die Kopie einer Kopie, doch mein Vater, gerade ein Jahr alt, ist deutlich zu erkennen. Er trägt ein weißes Kleidchen – damals die übliche Babykleidung –, sitzt auf dem Schoß meiner Großmutter, beißt sich in die linke Faust und schaut mit schwarz-weißen Augen in die Welt.
Auf dem zweiten Foto vom Frühjahr 1914 sehe ich einen Jugendlichen im Sonntagsanzug, ein Jackett mit breiten Revers und einer kurzen Hose, den Kopf fast kahl rasiert, mit großen Händen und einer gewissen Zurückhaltung im Blick. Die andern – es handelt sich um ein Gruppenbild der ganzen Familie, die sich um eine Vase mit fünf armseligen Nelken herum aufgestellt hat – nehmen Haltung an (meine Großmutter und ihre älteste Tochter Saar), unterdrücken mühsam ein freches Grinsen (Arie), schauen besorgt drein (der kleine Aart), gucken auf den hintersten Winkel der Zimmerdecke (Catrien), warten ruhig ab, was passiert (Koos und Henk), oder sind drauf und dran, vom Stuhl zu springen und wieder spielen zu gehen (die kleine Maartje).
Mittendrin sitzt mein Großvater, Schnurrbart, welliges Haar, auf Hochglanz geputzte Schuhe, ruhig und solide wie die Bank von England, jedoch mit demselben Argwohn im Blick wie mein Vater. Nein, ganz offensichtlich war es nicht seine Idee, zum Fotografen zu gehen, davon bin ich überzeugt. Das war eher ein Wunsch meiner Großmutter, und in seiner ganzen Gutmütigkeit hat er sich darein gefügt.
Die Zeit von 1900 bis 1914 wurde, so Stefan Zweig, als ein »goldenes Jahrhundert der Sicherheit« empfunden. Zweig, Österreicher, vor allem aber Europäer, hat in den Erinnerungen an seine Kindheit die intime Welt des europäischen Bürgertums wie kein anderer beschrieben. »Jeder wußte, wieviel er besaß oder wieviel ihm zukam, was erlaubt und was verboten war. Alles hatte seine Norm, sein bestimmtes Maß und Gewicht. […] Wer ein Haus besaß, betrachtete es als sichere Heimstatt für Kinder und Enkel, Hof und Geschäft vererbte sich von Geschlecht zu Geschlecht; während ein Säugling noch in der Wiege lag, legte man in der Sparbüchse oder der Sparkasse bereits einen ersten Obolus für den Lebensweg zurecht, eine kleine ›Reserve‹ für die Zukunft.«
Für Millionen von Europäern war dieses Gefühl der Sicherheit der höchste Besitz, und Millionen andere strebten mit ganzer Kraft danach wie nach einem gemeinschaftlichen Lebensideal. Auch mein Großvater gab jedem Enkel noch in der Wiege etwas mit auf den Weg: eine goldene Zehn-Gulden-Münze. Wenn man auf der gesellschaftlichen Leiter aufgestiegen war, sorgte man zuerst dafür, dass man Sicherheit ausstrahlte: durch Kleidung, die einen älter wirken ließ, durch eine würdevolle Art, sich zu bewegen, durch seine Lebensweise und schließlich durch die Wohnungseinrichtung.
Betrachten wir zum Beispiel einmal, wie meine Großmutter ihre »gute Stube« eingerichtet hatte: die Decke mit Stuckverzierungen, Tapete mit großen Blumen, ein teurer Teppich, der Kamin aus schwarzem Marmor und darauf Porzellanhündchen, Flaschen und allerhand Nippes, Landschaftsbilder und Seestücke, auf Hochglanz polierte Schränke und Stühle aus Mahagoni, überall gehäkelte Deckchen, auf dem Tisch ein dicker Läufer, kurzum: ein typisches Wohnzimmer der damaligen Mittelschicht, das Ergebnis des ständigen Hin-und-her-gerissen-Seins zwischen Putz und Sparsamkeit, zwischen dem Hochhalten des eigenen Stands und der Realität des Lebens, zwischen dem Willen zum Vorwärtsstreben und dem Bekräftigen der Ordnung der Dinge.
Heute wissen wir, dass diese Welt der Sicherheit eine Illusion war, dass die Kräfte, die sie über den Haufen werfen würden, schon mit aller Macht am Werke waren, als mein Vater noch in der Wiege lag, dass drei der fünf Großmächte hinweggefegt werden würden, während er noch zur Schule ging, und dass das alte Europa in Blut und Barbarei getaucht würde, noch ehe er erwachsen war. Doch der Rückblick trübt das Bild, denn im Morgenlicht des 20. Jahrhunderts ahnte das niemand. Meine Großeltern lebten wie Hunderttausende niederländischer Familien in bescheidenem Wohlstand, mit dem Wissen, dass es Katastrophen nur in der Ferne gab und dass Kriegsgräuel seit Menschengedenken an diesem Land vorübergegangen waren.
Sie lebten nicht nur in einer Zeit der Gewissheit, sie waren sogar davon überzeugt, dass ihre Gewissheit die Zeiten überdauern würde. Und hinzu kam noch, dass diese Gewissheit von den wärmenden Sonnenstrahlen des Fortschritts beschienen wurde. »Es ist vielleicht schwer, der Generation von heute, die in Katastrophen, Niederbrüchen und Krisen aufgewachsen ist, […] den Optimismus, das Weltvertrauen zu schildern, die uns junge Menschen seit jener Jahrhundertwende beseelten«, schrieb Stefan Zweig. Europa hatte seit Jahrzehnten in Frieden gelebt – und für die Niederlande und einige andere Staaten währte diese Friedenszeit noch länger –, die Technik hatte dem Leben Flügel verliehen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse machten die Menschen stolz und selbstbewusst.
Fast alle großen Städte erlebten zwischen 1880 und 1914 eine stürmische Entwicklung: Boulevards und Plätze wurden angelegt, Neubauviertel errichtet, Warenhäuser, Museen, man baute Theater und Stadien so groß wie Kathedralen. Der Gesundheitsstandard der Menschen stieg, der Komfort nahm zu, sie hatten immer mehr Freizeit, und dank der besseren Ernährung und Hygiene sahen sie besser aus. Um 1910 hing in den meisten Städten und Dörfern bei den vornehmeren Leuten ein Telefon an der Wand. Ein Telegramm konnte innerhalb weniger Sekunden auf die andere Seite der Erde übermittelt werden. Am Morgen des 17. Dezember 1903 machten die Fahrradfabrikanten Wilbur und Orville Wright auf dem Kill Devil Hill in North Carolina die ersten vier Flüge mit einer selbst gebauten Flugmaschine; ihr weitester Flug ging über eine Strecke von 255 Metern. Um die Jahrhundertwende herum verkündeten einige Mediziner das »absehbare Ende« aller Krankheiten, und manche hofften nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen im Jahre 1895 sogar, es würde möglich sein, die Seele zu fotografieren.
Die Zeit von 1900 bis 1914 beherrschte eine bis dahin unbekannte Dynamik, die Ruhe und Ehrwürdigkeit nur scheinbar verdeckten. Im Haus am Hoofd machte man noch mit Gas- und Öllampen und auch mit Kerzen Licht, doch im Rotterdamsch Nieuwsblad tauchten immer häufiger Artikel auf, die über die in der Stadt verlegten elektrischen Leitungen berichten, und 1913 war es dann auch am Hoofd so weit: Elektrisches Licht, das mit dem Drehen des Schalters aufleuchtete, die Bequemlichkeit eines Staubsaugers und eines Bügeleisens, eine neue Klarheit, eine neue Leichtigkeit des Lebens hielten Einzug.
In dieser Zeit traf man auch die ersten Entscheidungen, die viel später zu einem – nie ausgesprochenen – Bruch in der Familie führen sollten: Mein Vater wurde weitgehend von der Arbeit in der Segelmacherei freigestellt, um die höhere Schule zu besuchen. Und auch die kleine, aufgeweckte Maartje durfte weiter zur Schule gehen, bis meine Großmutter sie drei Jahre später im Haushalt brauchte: eine Entscheidung, die als vollkommen selbstverständlich empfunden wurde.
Und um es noch einmal ganz deutlich zu sagen: Auch was das Private angeht, war die Familie eine typische holländische Durchschnittsfamilie um die Jahrhundertwende, mit allem was dazugehörte. Sexualität spielte keine Rolle, besser gesagt, durfte keine Rolle spielen. Arie scheint einmal einem Dienstmädchen den Hof gemacht zu haben, doch ansonsten war im Hause Mak von Erotik nichts zu sehen. »Meine Mutter habe ich nie anders als in schwarzen Kleidern gesehen oder im Sommer in dunkelblauen mit violetten Punkten. Rumgealber oder Zärtlichkeiten zwischen meinen Eltern, das sah man nie. Hin und wieder zwar ein herzliches Wort oder ein Lächeln, das schon, aber sonst nichts. Als Kinder dachten wir nicht einmal an solche Sachen. Sex, darüber hörten wir nur sehr unbestimmte Dinge, von Freundinnen«, erzählte meine Tante Maart.
Einer der Brüder, Henk, brachte einmal das schönste Mädchen der Stadt mit nach Hause, doch die Verbindung hielt nicht lange, weil Henk ein wenig flamboyanter Liebhaber war. Ihr Abschiedsbrief lautete:
Sehr geehrte Familie. Es tut mir für Sie und Henk sehr Leid, doch ich finde, Henk ist ein zu ruhiger junger Mann. Ich habe festgestellt, dass ich dies auf die Dauer nicht ertrage, und ich bin deshalb nach langem Ringen zu diesem Entschluss gekommen. Ich danke Ihnen für die sehr herzliche Aufnahme und grüße Sie sehr herzlich als Ihre Machteld de Ronde
In der Familie war mein Großvater der stille, schwer Arbeitende im Hintergrund. Zu anderen Menschen hatte er kaum Kontakt, abgesehen vom sonntäglichen Kirchgang mit seinem Bruder, dem Blockmacher. Wenn einer seiner Brüder Geburtstag hatte, ging er kurz hin, um zu gratulieren, doch die Brüder meiner Großmutter besuchte er nie. Nie setzte er sich in die gute Stube, um mit Leuten zu plaudern. Und wenn er selbst Geburtstag hatte, dann kamen sie alle gern, besonders die Männer, denn sie bekamen eine Zigarre, Gebäck und einen Becher heiße Schokolade, die damals noch oft statt Kaffee getrunken wurde. Anschließend gab es dann ein Glas Wein. Sogar an den Namen konnte sich eine meiner Tanten erinnern: Muscatel d’Algarve.
Die Familie war als solche auch eine Fertigungsstätte. Die meisten Kleider wurden selbst gemacht, ebenso wie das Essen: eingewecktes Gemüse, Marmeladen, in Salz eingelegter Fisch und gepökeltes Fleisch. Hier war meine Großmutter die Achse, um die sich alles drehte. Sie muss, nach allem was ich hörte, eine sehr liebe Frau gewesen sein, die nie ein böses Wort über jemand anderen fallen ließ. Dennoch fürchtete sie sich immer vor dem Jüngsten Gericht. Als sie von der kalvinistisch-reformierten Hervormde Kerk zur orthodox-kalvinistischen Gereformeerde Kerk übertrat1, folgten ihr fast alle Kinder. Sie war erfüllt von Schuld und Sündenfall, Adam und Gnade, Kampf und Bekehrung. Ihren Mann ließ das alles recht kalt. Die Kinder hingen dazwischen.
Schon seit ihrer Eheschließung strebten meine Großeltern religiös vollkommen auseinander. Mein Großvater bezog seine Weltanschauung vor allem von bestimmten Predigern, denen er sich verbunden fühlte. Er gehörte der »modernen Richtung« innerhalb der kalvinistisch-reformierten Kirche an, einer Strömung, die eine aufgeklärte, rationale Theologie verkündigte, die schließlich zur heutigen Entfremdung von der Kirche führte. Atheistisch und antireligiös war diese Strömung jedoch keinesfalls. Aus den Predigten in seiner Kirche klang vor allem Zweifel heraus, Unsicherheit, die anschließend mit schönen Sätzen und edlen, hehren Gedanken verbrämt wurde.
Nun war der Tod in der Zeit, als mein Vater aufwuchs, noch allgegenwärtig, er schlug überall rasch und unerwartet zu. Eine »gewöhnliche« Lungenentzündung konnte tödlich sein. Berufe wie der des Fischers oder des Hafenarbeiters waren äußerst riskant. Die Kindersterblichkeit war hoch, praktisch jedes Jugendbuch aus dieser Zeit enthielt eine tränenrührende Sterbeszene. Sogar in der relativ wohlhabenden Familie meiner Großeltern starben zwei Mädchen, eines an Diphtherie, das andere an einer heute harmlosen Kinderkrankheit. Und später sollte die zweite Freundin, die der stille Bruder Henk mit nach Hause brachte, innerhalb einer Nacht an einer Hirnhautentzündung sterben. Man konnte also jeden Moment, wie fromme Menschen es ausdrückten, »vor den Richterstuhl des Herrn gerufen werden«. Und wie würde Sein Urteil dann lauten? Diese Frage beschäftigte viele, auch meine Großmutter, ohne Unterlass.
Jeden Morgen legte im Hafen die Fähre vom anderen Flussufer an. Als Erste ging immer eine Frau von Bord, die ein Joch auf der Schulter trug, an dem zwei Körbe mit frischen Eiern hingen. Dann kamen die Übrigen: Fischer, Bauern, die Milch und Käse an der Haustür verkauften, Männer mit Gemüse und Kartoffeln. Das waren Menschen, die drüben auf den Inseln lebten, und meine Großmutter unterhielt sich gern mit ihnen über das Leben bei Gott, nach dem Tod.
Vor allem ein Eierhändler machte großen Eindruck auf sie. Dieser Mann war sich nicht sicher, ob er nun ein Kind Gottes war oder nicht, er marterte seinen Geist mit allerlei Texten und kämpfte um sein Seelenheil, bis die Bekehrung kam. Die kleine Maartje, die schweigend mithörte, berichtete mir, dass vor allem die letzte Geschichte ihr immer wieder Alpträume bereitete. Der Eierhändler beschrieb darin, wie er mit dem Engel gerungen hatte wie Jakob am Jabbok-Fluss, durch Schlamm und Pfützen war er gekrochen, und stundenlang hatte er ängstlich gefleht und gejammert. Bis das Licht aufleuchtete und auch dieser Eierhändler wußte, dass er ein Kind Gottes ist.
Meine Großmutter konnte von seinen Erzählungen nicht genug bekommen. Denn, ach das Urteil, und dann die Ewigkeit! Einmal lotste sie ihn ins Haus, weil sie vom Stehen müde war. Doch in diesem Augenblick griff mein Großvater ein, der das Ganze von der Werkstatt aus beobachtet hatte. Er verbot dem Eierhändler, das Haus zu betreten, nannte ihn einen Drecksack und rief, er wolle ihn nie wieder sehen.
Ehrlich gesagt, glaube ich, dass bei dem Zwischenfall mit dem Eierhändler nicht nur religiöse Motive eine Rolle spielten. Für gewöhnlich regten sich die Maks bei Fragen des Glaubens nicht so auf. Im Allgemeinen lebten sie ihren Glauben im Gleichmut des 19. Jahrhunderts, als das alltägliche Leben noch von den christlichen Lehrsätzen bestimmt, die Kirche als selbstverständliche Institution betrachtet wurde und praktisch alle Niederländer an Gott glaubten, egal, ob sie sich nun einer modernen, einer orthodoxen oder gar keiner Richtung zugehörig fühlten.
Die »Versäulung«, die soziale Trennung zwischen den einzelnen Konfessionen und politischen Gruppierungen, welche die Niederlande bis in die siebziger Jahre prägten, hatte am Ende des 19. Jahrhunderts gerade eben erst angefangen. Man konnte sich nicht einmal in die eigene »Säule« zurückziehen, weil die jeweiligen Vereine, Verbände, Schulen und Universitäten zum größten Teil erst noch gegründet werden mussten. Bei der Volkszählung 1899 bekannten sich nur 2 Prozent der Niederländer öffentlich dazu, keiner Kirche anzugehören. Es war ganz selbstverständlich, dass jeder das amtliche Gebet, womit öffentliche Versammlungen häufig eröffnet wurden, problemlos aufsagen konnte. Als Königin Wilhelmina 1908 endlich ein Kind erwartete, wurden die Kirchen von Staats wegen dazu angehalten, für einen guten Verlauf der Schwangerschaft zu beten – eine Aufforderung, die ebenso wenig Verwunderung auslöste wie ein medizinischer Eingriff heute.
Kurzum: Der Glaube war für die meisten Menschen kein theologisches Konstrukt, sondern alltägliche, nicht hinterfragte Realität. Meine Großmutter erzählte immer – nie ohne zu weinen –, wie eines ihrer verstorbenen Kinder kurz vor dem Ende fragte: »Koos, wirst du die Leiter auch gut festhalten, wenn ich in den Himmel hinaufsteige?« Und so wird sie ihren eigenen Glauben auch erlebt haben, so real wie die Erde und das Wolkendach.
Bei den ältesten Familienunterlagen fand ich einen auffallenden Brief, der so voller frommer Ausdrücke war, dass ich zunächst nicht wusste, was ich damit anfangen sollte. Er stammte von meinem Urgroßvater, und dieser hatte ihn seinem Vater zu dessen 81. Geburtstag im Januar 1867 geschrieben.
Es ist kein behaglicher Brief. Absatz für Absatz wird mein Ururgroßvater ermahnt und aufgefordert, sich zu bekehren, ehe es zu spät ist. Die Reise zur Ewigkeit sei schließlich nicht mehr weit, und Gottes Urteil stehe unmittelbar bevor. »Komm, Vater, mach dich mit all deinen Sünden und all deiner Last rasch auf zu Jesus«, schrieb mein Urgroßvater. »Doch beeile dich, verschiebe es nicht auf morgen, denn für dich ist die elfte Stunde bereits gekommen, und immer noch steht der liebreiche Jesus an der Tür deines Herzens und klopft an …« So geht es drei Seiten lang weiter, über den kommenden Tod – »Verwesung ist zunächst mein Los« – und danach, hoffentlich, die ewige Seligkeit.
Ich lese den Brief ein zweites und ein drittes Mal, und mir fällt auf, dass der Text voller halbritueller Formeln und Liedfragmenten ist, die ihm einen fast beschwörenden Rhythmus verleihen. Hier wird eindeutig ein Jargon benutzt, ein andersartiger Jargon als der, den später die Marxisten verwandten, aber dennoch ein Jargon.
Doch ich kann mir keinen rechten Reim auf den Brief machen. Er klingt sehr orthodox, und doch werden immer wieder auch Lieder zitiert anstatt der Psalmen, was in den Augen der meisten Strenggläubigen eine Sünde ist. Und auch aus dem scheinbaren Konflikt zwischen Vater und Sohn über den leichtsinnigen Lebenswandel des letzteren werde ich nicht schlau. Schließlich bitte ich jemanden, der selbst aus extrem orthodoxen Kreisen des niederländischen Protestantismus stammt, um Rat. Es ist verblüffend zu beobachten, wie er diese Sprache, den Kode und die Aussage auch nach hundertdreißig Jahren noch auf Anhieb versteht und den Brief auf der Stelle einordnen kann: »Dieser Brief stammt von einem Mitglied der pietistischen Strömung, die es schon seit dem 17. Jahrhundert in der Reformierten Kirche gibt. Außerdem stand er in Kontakt zur Réveil, der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert, die von den Dichtern Isaac Da Costa, der vom Judentum zum Christentum übergetreten war, und Willem Bilderdijk ausging.« Von einem Konflikt zwischen Vater und Sohn könne, seiner Meinung nach, keine Rede sein. »In diesem Milieu galt dies als ein wunderschöner Geburtstagsbrief, und deshalb ist er wahrscheinlich auch aufbewahrt worden.« Er erklärt mir, dass diese Sorge um das Seelenheil der Lieben ein Ausdruck großer Zuneigung war. »Mein Vater hätte viel darum gegeben, einen solchen Brief von mir zu bekommen, aber ich hätte es nicht über mich gebracht.«
ENDE DER LESEPROBE