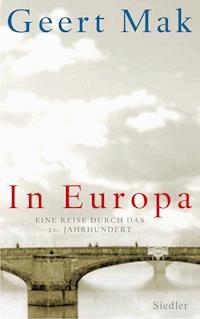
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Europa erfahren – Geert Mak auf den Spuren des zwanzigsten Jahrhunderts
Für dieses Buch ist Geert Mak ein Jahr lang kreuz und quer durch Europa gereist. Zunächst besucht er Paris, wo das 20. Jahrhundert mit der großen Weltausstellung seinen optimistischen Anfang nahm. Zuletzt befinden wir uns in den Ruinen Sarajevos, die das Ende des blutigen Jahrhunderts markieren. In jedem Monat seiner Reise nimmt sich Mak einen weiteren Abschnitt des 20. Jahrhunderts vor und sucht die Orte auf, an denen die Geschichte in besonderer Weise Spuren hinterlassen hat. Ein bewegendes, kluges Buch, das uns zu Augenzeugen des 20. Jahrhunderts macht.
Geert Mak, der große Erzähler unter den Historikern unserer Zeit, legt mit diesem Buch sein bisheriges Hauptwerk vor. Seine Geschichte des 20. Jahrhunderts ist als ein Reisebericht angelegt und als eine Bestandsaufnahme Europas am Ende eines katastrophenreichen Jahrhunderts zu lesen. Wie kein Zweiter versteht es Mak, der Geschichte Europas im 20. Jahrhundert ein Gesicht zu geben, sie in zahllosen Details sichtbar, fühlbar, sinnlich wahrnehmbar zu machen.
Auf seiner Reise sprach er mit Schriftstellern und Politikern, mit Dissidenten und hochrangigen Offizieren, mit einem Bauern aus den Pyrenäen und mit dem Enkel des letzten deutschen Kaisers sowie mit zahlreichen anderen Europäern, die ihm ihre Erfahrungen und Erinnerungen anvertraut haben. Dieses kluge und bewegende Buch macht uns zu Augenzeugen des letzten Jahrhunderts und lässt uns Europa in seiner heutigen Form besser begreifen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1657
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Geert Mak
In Europa
Eine Reise durch das 20. Jahrhundert
Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke und Gregor Seferens
Pantheon
Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel »In Europa« bei Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen.
Die Übersetzung ins Deutsche wurde vom Autor gekürzt; für die vorliegende Auflage wurde der Text durchgesehen und der Epilog aktualisiert.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich daraufhin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Zehnte Auflage
Pantheon-Ausgabe Februar 2007 Copyright © 2004 by Geert Mak Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2005 by Siedler Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: Jorge Schmidt, München, nach einer Idee von Rothfoss + Gabler, Hamburg Lektorat: Margret Plath Satz: Ditta Ahmadi, Berlin Karten: Peter Palm, Berlin
eISBN: 978-3-641-20225-5V001
www.pantheon-verlag.de
www.randomhouse.de
FÜR MIETSIE
Inhaltsverzeichnis
Jemand nimmt sich vor, die Welt zu zeichnen. Im Lauf der Jahre bevölkert er einen Raum mit Bildern von Provinzen, Königreichen, Gebirgen, Buchten, Schiffen, Inseln, Fischen, Zimmern, Instrumenten, Gestirnen, Pferden und Menschen. Kurz bevor er stirbt, entdeckt er, daß dieses geduldige Labyrinth aus Linien das Bild seines eigenen Gesichts wiedergibt.
JORGE LUIS BORGES
Prolog
Niemand im Dorf hatte jemals das Meer gesehen – außer dem Bürgermeister und Jószef Puszka, der im Krieg gewesen war. Die Häuser lagen um einen schmalen Bach herum, eine Hand voll weiße Bauernhöfe, grüne Gärten, bunte Apfelbäume, zwei kleine Kirchen, alte Weiden und Eichen, Holzzäune, Hühner, Hunde, Kinder, Ungarn, Schwaben, Zigeuner.
Die Störche waren bereits fortgezogen. Ihre Nester ruhten still und verlassen auf den Schornsteinen. Der Sommer glühte langsam aus, der Bürgermeister mähte schwitzend die Gemeindewiese. Kein Maschinengeräusch war zu hören, nur Stimmen, ein Hund, ein Hahn, Gänse, die die Straße überquerten, ein hölzerner Pferdewagen, der knarrend vorüberfuhr, die Sense des Bürgermeisters. Am späten Nachmittag wurden die Öfen angezündet; ein dünner blauer Rauchschleier zog über die Dächer. Hin und wieder quiekte ein Schwein.
Es waren die letzten Monate des Jahrtausends, und ich reiste im Auftrag meiner Zeitung, des NRC/Handelsblad, ein Jahr lang kreuz und quer durch Europa und schrieb Tag für Tag einen kurzen Artikel, der unten rechts auf der Titelseite veröffentlicht wurde. Es war eine Art abschließende Inspektion: Wie sieht der Kontinent am Ende des 20. Jahrhunderts aus? Zugleich war es auch eine Reise durch die Zeit: Ich folgte, soweit das möglich war, dem Lauf der Geschichte, auf der Suche nach den Spuren, die sie hinterlassen hatte. Und tatsächlich fand ich ihre stummen Zeugen, zu Dutzenden: eine zugewachsene Mulde an der Somme, einen von Maschinenpistolenkugeln zerfetzten Türpfosten in der Oranienburger Straße in Berlin, einen schneebedeckten Wald bei Vilnius, ein Zeitungsarchiv in München, einen Hügel hinter Barcelona, eine kleine, weiß-rote Sandale in Auschwitz. Doch diese Reise hatte auch etwas mit mir zu tun. Ich wollte raus, Grenzen überschreiten, erfahren, was dieser nebulöse Begriff »Europa« bedeutet. Europa, das wurde mir im Laufe dieses Jahres klar, ist ein Kontinent, auf dem man mühelos in der Zeit hin und her reisen kann. Die verschiedenen Phasen des 20. Jahrhunderts sind alle noch irgendwo existent. Auf den Fähren in Istanbul herrscht das Jahr 1948, in Lissabon 1956. Am Gare de Lyon in Paris fühlt man sich wie im Jahr 2020; in Budapest haben junge Männer die Gesichter unserer Väter.
In dem südungarischen Dorf Vásárosbéc ist die Zeit bei 1925 stehen geblieben. Dort leben ungefähr zweihundert Menschen, und mindestens ein Viertel von ihnen sind Zigeuner. Die Familien bekommen Sozialhilfe – etwa sechzig Euro pro Monat –, und die Frauen gehen mit Körben und irgendwelchen Waren von Tür zu Tür. Ihre Häuser zerfallen nach und nach, die Türen sind nurmehr Tücher, manchmal fehlt gar der Türrahmen, weil er wohl in einem kalten Winter verheizt worden ist. Noch ärmer sind die rumänischen Zigeuner, die manchmal mit hölzernen Wohnwagen ins Dorf kommen. Und ärmer als arm sind die umherziehenden albanischen Zigeuner. Sie sind außerdem die Parias aller anderen Armen, die größten Schlemihle Europas.
Ich wohnte bei Freunden. Sie hatten nach dem Tod des alten József Puszka, der früher der Dorffrisör gewesen war, dessen Haus bezogen. Auf dem Dachboden fanden sie ein winziges Notizbuch, das mit Bleistiftgekritzel aus dem Frühjahr 1945 gefüllt war, in dem Ortsnamen wie Aalborg, Lübeck, Stuttgart und Berlin vorkamen. Jemand entzifferte ein paar Zeilen:
Im Gefangenenlager Hagenau. O mein Gott, ich habe niemanden auf dieser Welt. Vielleicht gibt es, wenn ich wiederkomme, nicht einmal mehr ein Mädchen für mich im Dorf. Ich bin wie ein kleiner Vogel, der in der Ferne ruft. Niemand schaut nach der lieben Mutter und dem kleinen Vögelein. O mein Gott, hilf mir bitte, nach Hause zu kommen, zu Vater und Mutter. So weit entfernt von meinem Land, so weit entfernt von jedem Weg.
Mitten im Dorf, neben einem schlammigen Weg, stieß ich auf einen verwitterten Betonklotz, der mit einer Art Ritterfigur und zwei Jahreszahlen versehen war: 1914 und 1918. Darunter sechsunddreißig Namen, sechsunddreißig junge Männer, so viele wie in die Dorfkneipe passen.
1999 war das Jahr des Euro gewesen, Mobiltelefone hatten allgemeine Verbreitung gefunden, das Internet war zum Allgemeingut geworden, in Novi Sad hatten die Alliierten Brücken bombardiert, die Effektenbörsen in Amsterdam und London feierten; der September war der wärmste seit Menschengedenken gewesen, und man fürchtete sich vor dem Millennium-Bug, der am 31. Dezember alle Computer ins Chaos stürzen würde.
In Vásárosbéc war 1999 das Jahr, in dem der Müllmann seine Runde zum letzten Mal mit Pferd und Wagen machte. Zufällig war ich Zeuge dieses historischen Augenblicks. Er hatte sich einen Lastwagen gekauft. Im selben Jahr hatten vier arbeitslose Zigeuner damit begonnen, ein weiteres Stück Sandweg zu planieren; vielleicht würde es ja asphaltiert werden. Und der Glöckner wurde entlassen: Er hatte die Pension der Mutter des Bürgermeisters unterschlagen. Auch das geschah 1999.
In der Dorfkneipe traf ich sie alle: den Bürgermeister, die wilde Maria, den Zahnlosen (den man auch »den Spion« nannte), den betrunkenen Nichtsnutz, die Zigeuner, die Frau des Postboten, die bei ihrer Kuh wohnte. Ich machte Bekanntschaft mit dem Veteranen, einem großen, freundlichen Mann im Tamanzug, der seine Alpträume mit Alkohol und berauschenden Pilzen vertrieb. Er spreche Französisch, behaupteten alle, doch das einzige Wort, das ich ihn sagen hörte, war »Marseille«.
Später am Abend sangen der neue Glöckner und der Müllmann alte Lieder, und die anderen schlugen dazu auf den Tischen den Takt:
Wir arbeiteten im Wald, frühim ersten Morgenlicht,als der Tag noch voller Nebel und Tau war,arbeiteten wir bereits zwischen den Stämmen,hoch oben am Hang, mühsam mit Pferden den Hang hinauf …
und:
Wir arbeiteten an der Strecke von Budapest nach Pécs,an der großen, neuen Eisenbahnstrecke,am großen Tunnel bei Pécs …
In diesem Jahr des Herumreisens durch Europa hatte ich den Eindruck, alte Farbschichten abzuschaben. Stärker als je zuvor wurde mir bewusst, dass Generation um Generation eine Kruste der Distanz und der Entfremdung zwischen Ost- und Westeuropäern gewachsen war.
Haben wir Europäer eine gemeinsame Geschichte? Zweifellos, und jeder Student kann die Stichwörter und Daten aufsagen: Römisches Reich, Renaissance, Reformation, Aufklärung, 1914, 1945, 1989. Doch die individuellen historischen Erfahrungen der Europäer sind sehr verschieden: In Danzig traf ich einen älteren Taxifahrer, der in seinem Leben viermal eine neue Sprache hatte lernen müssen; ich schloss Bekanntschaft mit einem deutschen Ehepaar, das ausgebombt und anschließend lange Zeit durch Osteuropa gehetzt war; ich besuchte eine baskische Familie, die Heiligabend in einen heftigen Streit über den Spanischen Bürgerkrieg geraten war und danach nie wieder ein Wort darüber verlor; gleichzeitig stieß ich bei den Niederländern, Dänen und Schweden auf eine friedliche Sattheit: An ihnen waren die Stürme meistens vorübergegangen. Man setze Russen, Deutsche, Briten, Tschechen und Spanier an einen Tisch und lasse sie die Geschichte ihrer Familien erzählen. Lauter verschiedene Welten. Und doch sind sie alle Europa.
Die Geschichte des 20. Jahrhunderts war schließlich kein Theaterstück, dessen Vorstellung sie besuchten, es war ein größerer oder kleinerer Teil ihres – und unseres – eigenen Lebens. »Wir sind ein Teil dieses Jahrhunderts. Und dieses ist ein Teil von uns«, schrieb Eric Hobsbawm zu Beginn seiner großen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Für ihn selbst zum Beispiel war der 30. Januar 1933 nicht nur – und er betont, dass wir dies nie vergessen dürfen – der Tag, an dem Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, sondern auch ein Winternachmittag in Berlin, an dem ein fünfzehnjähriger Junge mit seiner Schwester von der Schule nach Hause ging und irgendwo unterwegs die Schlagzeile einer Zeitung sah: »Ich kann sie noch immer, wie im Traum, vor mir sehen.«
Für meine hochbetagte Tante Maart in Schiedam, die damals sieben Jahre zählte, war zum Beispiel der 3. August 1914, der Tag, an dem der Erste Weltkrieg ausbrach, ein warmer Montagnachmittag, auf den sich plötzlich ein starkes Gefühl der Beklemmung legte. Arbeiter standen in Gruppen vor den Häusern und diskutierten, Frauen wischten sich die Augen mit einem Zipfel ihrer Schürze, ein Mann rief einem Freund zu: »Mensch, Krieg!«
Für Winrich Behr, der später in diesem Buch zu Wort kommen wird, war der Fall von Stalingrad das Telegramm, das er als deutscher Verbindungsoffizier erhielt: »31. 1. 07.45 Uhr Russe vor der Tür. Wir bereiten Zerstörung vor. AOK 6, Ia. 31. 1. 07.45 Uhr. Wir zerstören. AOK 6.«
Für Ira Klejner aus Sankt Petersburg bedeutete der 6. März 1953, der Tag, an dem Stalins Tod bekannt gegeben wurde, eine Küche in einer kommunalen Wohnung, ein zwölfjähriges Mädchen, die Angst, nicht weinen zu können, und die Erleichterung darüber, dass doch noch eine Träne von der Wange fiel, genau in den Dotter des Spiegeleis auf ihrem Teller.
Für mich, den neunjährigen Jungen, der ich damals war, roch der November 1956 nach Paprikaaufläufen, jenen merkwürdigen Gerüchen, die die ungarischen Flüchtlinge in unser gediegenes Leeuwarder Grachtenhaus mitbrachten – stille, schüchterne Menschen, die mit Donald Duck-Heften Niederländisch lernten.
Nun ist auch das 20. Jahrhundert Geschichte geworden, unsere persönliche Geschichte und die der Filme, Bücher und Museen. Während ich dies schreibe, werden die Kulissen des Welttheaters rasend schnell umgebaut. Machtzentren verschieben sich, Bündnisse zerbrechen, neue Koalitionen entstehen, andere Prioritäten rücken in den Mittelpunkt.
Vásárosbéc bereitet sich auf den Beitritt zur Europäischen Union vor. Innerhalb von drei Jahren sind weitere sechs Niederländer hierher gezogen, die zusammen mindestens ein Dutzend Häuser gekauft haben. Die meisten wurden von den niedrigen Preisen in Osteuropa angezogen, einige hat es aufgrund von Problemen an diesen Ort verschlagen. Menschen mit einer solchen Vergangenheit trifft man überall an den Rändern des Kontinents: Steuerschulden, eine katastrophale Scheidung, ein Familienproblem, Ärger mit der Justiz.
Im Garten eines der Niederländer steht ein großer deutscher Adler aus Gips. Auf eine der Seitenmauern hat der Besitzer ein Porträt von sich malen lassen: hoch zu Ross, mit einem Cowboyhut winkend, bereit, den Wilden Osten zu unterwerfen. Ein anderer hat sein Haus für 200 000 Euro zu einem kleinen Landgut umbauen lassen, auf dem er alljährlich drei oder vier Wochen Urlaub macht. In der übrigen Zeit steht das Haus leer. Doch ein kleiner Fehler ist ihm unterlaufen: Sein direkter Nachbar ist der Räuberhauptmann des Dorfes, der mit acht Kindern in einem Haus wohnt, das eher an einen Schweinestall erinnert. Vorsichtig beginnen die Kleinen nun, an den verschlossenen Läden dieses Eldorados zu rütteln. »Wir haben ein Schwimmbad!« verkünden sie in der Dorfkneipe.
In der Kneipe hatte man meinen Freund gefragt, was das eigentlich bedeute, dieses neue Europa. Nachdem einem kreischenden Zigeuner und seinem Akkordeon Schweigen auferlegt worden war, hatte er ihnen erklärt, dass dieser Teil Europas durch den Lauf der Geschichte immer stärker verarmt sei; man schaue zum reichen und mächtigen Westen auf und wolle nun selbstverständlich auch dazugehören.
Doch zuerst, sagte mein weiser Freund, müsse man hier durch ein tiefes Tal mit noch größerer Armut gehen, um in den zehn Jahren danach vielleicht zum Wohlstand des Westens aufzuschließen. »Und außerdem werdet ihr sehr wertvolle Dinge verlieren: Freundschaft, die Fähigkeit, von wenig Geld zu leben, die Fertigkeit, kaputte Sachen selbst zu reparieren, die Möglichkeit, Schweine zu halten und sie zu Hause zu schlachten, die Freiheit, so viel Reisig zu verbrennen, wie ihr nur wollt, und noch einiges mehr.«
»Was?«, hatten die Leute gesagt. »Nicht mehr selber schlachten? Kein Reisig mehr verbrennen?« Sie sahen einander ungläubig an – sie wussten damals noch nicht, dass sie bald in der Kneipe auch nicht mehr würden rauchen dürfen. »Der Glöckner war inzwischen rausgegangen«, hatte mein Freund uns geschrieben, »und läutete nun die Glocke, denn die Sonne war untergegangen. Trotz allem: Das Leben geht einfach weiter.«
Die Weltordnung des 20. Jahrhunderts – soweit man dabei von »Ordnung« sprechen kann – scheint endgültig der Vergangenheit anzugehören. Und doch: Berlin kann man unmöglich verstehen, wenn man Versailles nicht kennt; London versteht man nicht ohne München, Vichy nicht ohne Verdun, Moskau nicht ohne Stalingrad, Bonn nicht ohne Dresden, Vásárosbéc nicht ohne Jalta, Amsterdam nicht ohne Auschwitz.
Maria, der Glöckner, Winrich Behr, Ira Klejner, der Bürgermeister, der Zahnlose, meine alte Tante Maart, mein weiser Freund – wir alle tragen, ob wir wollen oder nicht, das erschütternde 20. Jahrhundert in uns. Seine Geschichten werden flüsternd weitergegeben, über Generationen hinweg, die zahllosen Erfahrungen und Träume jener Zeit, die Augenblicke des Mutes und des Verrats, die Erinnerungen voller Angst und Schmerz, die Bilder des Glücks.
Januar 1900–1914
1
Als ich am Morgen des 4. Januar 1999 zu meiner Reise aufbrach, heulte in Amsterdam ein heftiger Sturm. Er riffelte das Wasser auf dem Pflaster, steckte den Wellen des IJ Schaumkämme auf, pfiff unter dem Dach des Hauptbahnhofs hindurch. Einen Augenblick dachte ich, Gottes Hand würde das Eisen kurz anheben und wieder fallenlassen.
In dem großen schwarzen Koffer, den ich hinter mir herzog, waren ein Notebook, ein Mobiltelefon, mit dem ich meinen täglichen Kurzbeitrag verschicken konnte, ein paar Hemden und Toilettensachen, eine CD-ROM mit der Encyclopaedia Britannica und bestimmt fünfzehn Kilo Bücher als Nervennahrung. Ich wollte mit den neubarocken Städten von 1900 anfangen, mit der Leichtigkeit der Pariser Weltausstellung, mit Königin Victoria, die über ein Imperium von Gewissheiten geherrscht hatte, mit dem aufstrebenden Berlin.
Die Luft war von Lärm erfüllt: dem Klatschen der Wellen, dem Kreischen der Möwen, die sich von den Böen tragen ließen, dem Toben des Sturms in den Ästen der kahlen Bäume, dem Getöse der Straßenbahnen, des Verkehrs. Das Licht war schwach. Die Wolken jagten als dunkelgraue Schemen von Westen nach Osten. Einmal trugen sie rasch ein paar Töne mit sich fort, das zerzauste Viertelstundenmotiv eines Glockenspiels. Die Zeitungen berichteten, dass die Morseschrift endgültig ausgedient habe und dass am Flugplatz Ostende tief fliegende Iljuschins regelmäßig die Dachpfannen von den Dächern saugten. Auf den Finanzmärkten gab der Euro ein glanzvolles Debüt. »Euro startet mit Herausforderung an Hegemonie des Dollars« titelte Le Monde, und am Morgen kostete die Währung sogar kurzzeitig 1,19 Dollar. Aber in den Niederlanden regierte an diesem Tag der Wind, die letzte ungezähmte Kraft, die überall, im Norden, Osten, Süden, Westen, ihre Spuren eingegraben und mit ihrem unablässigen Hämmern die Formen von Seen und Poldern bestimmt hat, den Lauf der Kanäle, der Deiche, der Straßen und sogar der Bahnstrecke, auf der ich durch das nasse Polderland Richtung Süden fuhr.
Neben mir saß ein junger Mann mit blauer Krawatte und freundlichem Gesicht, der gleich sein Notebook aufklappte, reihenweise Tabellen hervorzauberte und mit seinen Kollegen zu telefonieren begann. Er hieß Peter Smithuis. »Die Deutschen wollen eine Hundert-Prozent-Lösung, die anderen Europäer nur fünfundsiebzig«, sprach er ins Leere. »Wir können jetzt in Richtung Fünfundsiebzig-plus-X-Option gehen, wobei wir die Deutschen neutralisieren, indem wir sie doch wieder auf hundert Prozent bringen … oh, hmmm. Also die Produktion steht schon seit Juli still? … Du weißt, wenn sie zu schnell entscheiden, fährt man sich fest, sei vorsichtig.«
Der Regen prasselte gegen die Fenster des Waggons, an der Moerdijkbrücke tanzten die Schiffe auf den Wellen, bei Zevenbergen stand ein früher Baum in Blüte, tausend rote Pünktchen im Wasser. Ab Rosendaal waren die Oberleitungsmasten rostig: die einzige verbliebene Grenzmarkierung zwischen den ordentlichen Niederlanden und dem übrigen Europa.
Vor meiner Abreise hatte ich ein langes Gespräch mit dem ältesten Niederländer geführt, den ich kannte. Von all den Menschen, denen ich in diesem Jahr begegnen sollte, hatte er als Einziger das ganze Jahrhundert erlebt – abgesehen von Alexandra Wassiljewa (1897) aus Sankt Petersburg, die den Zar noch gesehen und als Debütantin im Mariinski-Theater geglänzt hatte.
Er hieß Marinus van der Goes van Naters, wurde aber »Der rote Junker« genannt. Er war Jahrgang 1900 und hatte einmal eine bedeutende Rolle in der sozialdemokratischen Partei gespielt.
Er hatte mir von Nimwegen erzählt, der Stadt, in der er aufgewachsen war und in der damals sage und schreibe zwei Autos fuhren, ein De Dion-Bouton und ein Spijker, beide bis ins Detail handgefertigt. »Mein Bruder und ich rannten ans Fenster, wenn einer von ihnen vorbeikam.« Die Besitzer der Autos hatte er nie leiden können. »Es waren die gleichen Leute, die man heute auf der Straße in tragbare Telefone sprechen sieht.«
Die soziale Frage. »Irgendwann waren wir voller Begeisterung für die neuen Verhältnisse, die kommen würden. Ein Arbeiter, mit einem Arbeiter wollten wir sprechen, aber wir kannten keinen einzigen. Auf Umwegen kamen wir schließlich in Kontakt mit einer Arbeiterfrau, die uns aus einer Zeitung vorlas. Ich frage mich noch heute, warum wir nicht einfach einen Arbeiter auf der Straße ansprachen, wenn wir doch so gern einen kennen lernen wollten.«
Die Technik. »Mein Freund und ich beschäftigten uns ständig mit dem Phänomen Elektrizität. Wir hatten ein Buch für Jungen, in dem ein Apparat vorkam, mit dem konnte man sich mit beliebigen Menschen drahtlos verständigen, egal über welche Entfernung. Unglaublich schien uns das. Wir haben Lämpchen installiert, Telefone gebaut, über die wir uns bis ins übernächste Zimmer hören konnten, wir haben die Funken knallen lassen, wir haben Erfindungen gemacht, richtige Erfindungen!«
Mein Gastgeber zog ein in Auflösung begriffenes Buch aus dem Schrank. Edward Bellamy, In het jaar 2000, Amsterdam 1890. »Hierüber haben wir gesprochen, über solche Dinge.« Die Geschichte war einfach: Ein Mann aus dem 19. Jahrhundert fällt nach einer Hypnose in Tiefschlaf und erwacht erst im Jahr 2000. Er findet sich in einer Stadt voller Standbilder, Springbrunnen, überdachter Gehwege, Herren mit Zylinder und Damen im Abendkleid wieder. Dank des allgegenwärtigen elektrischen Lichts gibt es keine Dunkelheit mehr. Die Nacht ist abgeschafft. Jedes Haus hat ein Musikzimmer, das über eine Telefonleitung mit einem der städtischen Konzertsäle verbunden ist.
»Lesen Sie mal, was so ein Mensch des 20. Jahrhunderts sagt: ›Zu Hause haben wir unsere Bequemlichkeit, aber der Glanz unseres Daseins, an dem wir alle gemeinsam teilhaben, zeigt sich erst in unserm geselligen Leben.‹ Ja, das war eine Welt nach unserem Geschmack, dieses Jahr 2000. Geld würde nicht mehr die geringste Rolle spielen. Alle Bürger wären vor ›Hunger, Kälte und Blöße‹ beschützt, Waren und Dienstleistungen würden über ein geniales Kreditsystem ausgetauscht, Essen in großen zentralen Restaurants zubereitet und wenn nötig per Rohrpost ins Haus geliefert, die Jungen würden ›stark‹, die Mädchen ›frisch und kräftig‹ sein, die Geschlechter würden frei und ungezwungen miteinander umgehen, private Läden wären verschwunden, Reklameschilder gäbe es nicht mehr, Verlage wären Gemeinschaftsbesitz, Zeitungsredakteure würden von den Lesern gewählt, Kriminalität und Selbstsucht wären gebannt und, lesen Sie nur, ›Erziehung und gute Sitten‹ wären ›nicht mehr das Monopol einiger weniger, sondern allen gemeinsam‹. Hier, dieses Zitat: ›niederkniend, mein Angesicht im Staube, bekannte ich mit Tränen, wie wenig ich wert sei, die Luft dieses goldenen Jahrhunderts zu atmen‹. Und hier: ›Der lange und traurige Winter der Gattung ist vorüber. Ihr Sommer hat begonnen. Die Menschheit hat ihre Puppenhülle durchbrochen. Der Himmel liegt vor ihr.‹ Was für ein Buch!«
Das Winterlicht fiel auf die vergilbte Tapete des Arbeitszimmers, auf die ausgebleichten Bücher im Schrank, die Lampe mit Stofflappen und Quasten, die kräftigen Hände meines Gastgebers, die leicht fleckige Haut, die klaren Augen.
»Was ich von diesem Jahrhundert halte, jetzt, wo es fast vorbei ist? Ach, so ein Jahrhundert, ist das nicht nur eine mathematische Konstruktion, ein Phantasiegebilde des Menschen? Damals dachte ich in Monaten, bis zu einem Jahr im Höchstfall. Jetzt rechne ich in Zeiträumen von zwanzig Jahren, für mich ist das gar nichts mehr. Man wird verwöhnt, wenn man so unverschämt alt ist. Zeit kümmert einen nicht mehr …«
2
Das neue Jahrhundert ist weiblich, darüber waren sich um 1900 alle einig. Man betrachte nur einmal das Titelbild zu dem englischen Lied »Dawn of the Century«, einem »March & Two Step«, der von einem gewissen E. T. Paul stammt. In einem goldenen Wolkenhimmel balanciert eine Frau auf einem geflügelten Rad; um sie herum schweben eine Straßenbahn, eine Schreibmaschine, ein Telefon, eine Nähmaschine, eine Kamera, eine Dreschmaschine, eine Lokomotive, und am unteren Rand biegt sogar ein Auto um die Ecke.
Auch die europäischen Metropolen sind weiblich. Schon wegen der wuchernden Formen der vielen tausend Bürgerpalais, die an den neuen Boulevards und Wohnstraßen gebaut wurden, mit ihren Schnörkeln und Ornamenten, in allen Neo-Stilen, die man sich nur vorstellen konnte: eine brünstige Üppigkeit, der man von Berlin bis Barcelona begegnet.
Das Titelblatt des Katalogs der Pariser Weltausstellung von 1900 zeigte natürlich eine Frau, eine recht kräftige diesmal, mit wehendem Haar und einer Fahne in der Hand. Auf dem Eingangstor stand eine sechs Meter hohe Frauengestalt aus Gips in einem weiten Mantel und einem Abendkleid des Couturiers Paquin. Bei der Eröffnung sprach der französische Präsident Émile Loubet von den Tugenden des neuen Jahrhunderts: Gerechtigkeit und menschliche Großzügigkeit. Sein Handelsminister erwartete noch mehr Gutes: Sanftmut und Solidarität.
Fünfzig Millionen Besucher kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Es wurden Röntgenapparate präsentiert, mit denen man durch Mann und Frau hindurchsehen konnte, es gab eine Automobilausstellung, Geräte für drahtlose Telegraphie konnten bewundert werden, und draußen fuhr die erste unterirdische Linie der Metropolitain, die in weniger als anderthalb Jahren zwischen Porte de Vincennes und Porte Maillot gebaut worden war. Vierzig Länder beteiligten sich an der Weltausstellung. Kalifornien hatte ein begehbares Modell einer Goldmine graben lassen, Ägypten kam mit einem Tempel und einer antiken Grabkammer, das Vereinigte Königreich präsentierte sich mit all seinen Kolonien, Deutschland zeigte eine Dampflokomotive, die 120 Stundenkilometer fahren konnte, Frankreich stellte ein Motorflugzeug von Clément Ader aus, eine riesige Fledermaus mit fünfzehn Meter Spannweite, denn irgendwann würde der Mensch sich in die Lüfte erheben können.
Es gab ein Tanzpalais, in dem ununterbrochen alle möglichen Arten von Ballett aufgeführt wurden, ein Grand Palais mit bildender Kunst aus Frankreich und ein Gebäude, in dem die Besucher für zwei Francs auf einer Plattform durch die ganze Welt »reisen« konnten: von den japanischen Blumengärten über die Akropolis bis hin zu den Küsten Spaniens; die Kulisse war von dem Maler Dumoulin und seinen Mitarbeitern mit großer Kunstfertigkeit hergestellt worden. Es gab ein Cineorama, eine Art Panorama, in dem man die Aussicht aus einem Luftschiff oder einem Waggon der Transsibirischen Eisenbahn genießen konnte. Die militärische Abteilung präsentierte die neuesten Errungenschaften der Waffentechnik: die Maschinenpistole, den Torpedo, den Panzerturm, die Apparate für die drahtlose Telegraphie, Automobile für den Armeegebrauch. Außerdem gab es, vollkommen neu, ein Phono-Cinematheater, in dem, begleitet von den Klängen eines Phonographen, Nachrichtenfilme gezeigt wurden. Die zitternden Bilder der Firma Pathé Frères zeigten unter anderem – hochaktuell! – die Familie Rostand während der Premiere von »L’Aiglon« in der Loge; ansonsten waren die Sensationen der damaligen Zeit zu sehen: der Probeflug des ersten Luftschiffs des Grafen Zeppelin, die Einweihung einer Eisenbahnlinie durch Afrika, neue Baumwollfabriken in Manchester, triumphierende Briten im Burenkrieg, eine Ansprache des deutschen Kaisers, der Stapellaufeines Schlachtschiffs.
Auf der Übersichtskarte des Katalogs kann man ganz deutlich das Ausstellungsgelände erkennen, das vom Grand Palais über die Straßen mit den Pavillons an beiden Ufern der Seine bis hin zum Eiffelturm und den großen Ausstellungshallen auf dem Champ de Mars reichte. Die Weltausstellung war ein Teil der Stadt. Das Paris mit seinen Boulevards, wie es seit 1853 unter dem Präfekten Georges Haussmann entstanden war, ging nahtlos in die Ausstellung über, weil es selbst zu einer permanenten Ausstellung geworden war, zum Schaufenster Frankreichs, zur Staatsstadt des neuen Jahrhunderts. Und beide – auch das zeigen die Aufnahmen im Katalog – waren wie geschaffen für den neuen Stadtbewohner par excellence, den Flaneur, den Schauspieler und Zuschauer des Theaters der Straße, den jungen Mann mit Apanage, den adligen Grundbesitzer, den vermögenden Offizier, den jugendlichen Bourgeois, den keine Geldsorgen drückten.
»Das Wetter ist so warm, so schön, daß ich nach dem Abendessen wieder ausgehe, obwohl ich schon zum Umfallen müde bin«, notiert der junge Schriftsteller André Gide im Sommer 1905. »Zuerst auf den Champs-Élysées, wunderbar in der Nähe der Cafés: ich stoße vor bis zum Rond-Point, komme längs des Élysée zurück: die Menge ist festlich gestimmt, immer zahlreicher und belebter bis zur Rue Royale.« An anderen Tagen fährt er auf dem Oberdeck eines Omnibus umher, spaziert durch den Bois de Boulogne, besucht die Oper oder geht in eine neue Ausstellung von Gauguin, van Gogh und Cézanne. »Unmöglich, heute nicht in den Louvre zu gehen.«
Der Heimathafen des boulevardier war das Café, das Marmortischchen mit Kirsch, warmem Kakao und Freunden um sich herum, der demokratische Nachfolger des aristokratischen Salons. Seine bedeutendste Qualität war ein untrügliches Gefühl für das richtige Timing: zum besten Zeitpunkt im besten Lokal zu sein. Das Flanieren war ein Spiel zwischen der alten und der neuen Zeit, ein Untertauchen in der Anonymität der Masse, um sich dann wieder in die alte Geborgenheit des eigenen Stands zurückfallen zu lassen. Es war eine Lebensform, die überall in der Literatur auftauchte, ein modernes höfisches Wesen, das alle großen europäischen Städte eroberte.
André Gide, 1. September 1905: »Ich verliere von neuem den Boden unter den Füßen; ich lasse mich von der eintönigen Flut dahinrollen, vom Lauf der Tage davontragen. Eine große Schläfrigkeit betäubt mich vom Aufstehen bis zum Abend; das Spiel durchbricht sie manchmal noch, aber langsam verlerne ich die Anstrengung.«
Ich gehe über das Champ de Mars, spaziere an der Seine entlang, vorbei am rasenden Verkehr an beiden Ufern, bis zum vernagelten Eingang des halb leeren Grand Palais. Auf dem Eiffelturm steht mit großen, leuchtenden Buchstaben: »Noch 347 Tage bis zum Jahr 2000«. Von der Weltausstellung existieren heute noch der Grand Palais, der Petit Palais und der Pont Alexandre III., mit vier Säulen an den Ecken, riesigen goldenen Pferden darüber, an den Seiten Verzierungen mit bronzenen Laternen, die Gläser wie Diamanten haben.
Im April 1900, als der Pont Alexandre III. und die Weltausstellung eröffnet wurden, rief die antisemitische Tageszeitung La Libre Parole zu Spenden für einen Satz Degen auf. Sie waren für den Judenhasser Raphael Viau bestimmt, um ihn für sein zwölftes Duell »im Dienste der guten Sache« zu ehren. Viau äußerte die Hoffnung, dass sie »nicht lange jungfräulich bleiben« würden.
Drei große Skandalprozesse erschütterten die europäischen Hauptstädte um die Jahrhundertwende. Es waren Risse in der Fassade, die ersten Verwerfungen in einer festgefügten Welt der Ränge und Stände. In London war 1895 der brillante Schriftsteller Oscar Wilde wegen »perverser Aktivitäten« verurteilt worden. In Berlin gab es zwischen 1907 und 1909 einen vergleichbaren Skandal, bei dem Philipp Fürst zu Eulenburg, ehemaliger Botschafter in Wien und enger Vertrauter des deutschen Kaisers, die Hauptrolle spielte. Der weitreichendste Skandalprozess aber war die Affäre Dreyfus.
Keine Frage beschäftigte die Franzosen in den Jahren von 1897 bis 1899 mehr als die mögliche Rehabilitierung des zu Unrecht verurteilten Alfred Dreyfus. Der Hauptmann jüdischer Abstammung war auf die Teufelsinsel verbannt worden, weil er angeblich für die Deutschen spioniert hatte. Nach und nach stellte sich jedoch heraus, dass die Offiziere des Kriegsgerichts in seinen Akten herumgepfuscht hatten, um aufkommende Zweifel an seiner Schuld zu entkräften, und auch später noch weitere Fälschungen an ihnen vorgenommen hatten. Die Armeespitze wusste davon, unternahm aber nichts. Den Skandal zuzugeben, wäre ein Sakrileg gewesen, eine Besudelung der gloire militaire.
Ganz Europa verfolgte atemlos den Fortgang der Affäre. Nachdem Émile Zola am 13. Januar 1898 mit einem Artikel in L’Aurore dafür gesorgt hatte, dass die Sache neu verhandelt wurde – sein flammendes J’accuse hatte in erster Linie den Zweck, eine Anklage wegen Beleidigung zu provozieren –, beschäftigten sich viele europäische Autoren und Intellektuelle mit der Affäre. Was war wichtiger? Die Rechte des Einzelnen oder die Ehre von Armee und Nation? Die fortschrittlichen Prinzipien der Aufklärung oder die alten Werte der Konterrevolution aus der glorreichen Zeit vor 1789?
Nach Ansicht der Historikerin Barbara Tuchman fiel die moderne Welt durch die Affäre Dreyfus für zwei Jahre zurück »in die Agonie der früheren Auflösungstendenzen«. Während dieser Zeit »schien es, als stünde das Leben still«, schrieb der spätere Ministerpräsident Léon Blum. »Es war, als ob sich … alles auf eine einzige Frage konzentrierte. Die tiefsten Gefühle der Menschen, ihre persönlichen Beziehungen untereinander wurden unterbrochen, umgekrempelt und neu formuliert … Die Affäre Dreyfus war eine Krise der Menschheit, die zwar weniger umfassend und zeitlich nicht so ausgedehnt war wie die Französische Revolution, dieser aber an Ungestüm und an Bedeutung in nichts nachstand.«
Freunde trafen sich nicht mehr: Wie eine Handgranate lag die Affäre Dreyfus zwischen ihnen. Verwandte mieden einander. Berühmte Salons gingen auseinander. Ein gewisser Monsieur Pistoul, ein Kistenfabrikant, wurde von seiner Schwiegermutter nach einer Familiendiskussion über Dreyfus vor Gericht gebracht. Er hatte sie als »Intellektuelle« beschimpft, sie hatte ihn »Henker« und »Betrüger« genannt, er hatte sie geschlagen; die Tochter reichte die Scheidung ein. Marcel Proust saß während des Wiederaufnahmeverfahrens jeden Tag mit Kaffee und belegten Broten im Gerichtssaal, um ja keine Sekunde zu verpassen. Zusammen mit seinem Bruder Robert half er, eine Petition mit der Überschrift »Protest der Intellektuellen« auf den Weg zu bringen, die von dreitausend Menschen unterschrieben wurde, darunter der Kunstpapst Anatole France, André Gide und Claude Monet. Für Monet bedeutete die Petition das Ende der Freundschaft mit seinem Kollegen Edgar Degas, Vater Proust sprach vor Wut eine Woche lang kein Wort mit seinen Söhnen.
Die Affäre Dreyfus war, genau wie die Skandale um Oscar Wilde und Philipp Fürst zu Eulenburg, von einer Zeitung aufgedeckt worden. Und so war sie auch in erster Linie ein Zeitungskrieg. Aufgrund des Phänomens »Massenblatt« bekam die Affäre eine bis dahin unbekannte Dynamik. Überall in Europa tauchten damals Sensationsblätter auf, die in Auflagen von mehreren Hunderttausend Exemplaren gedruckt wurden und bis in die fernsten Winkel des Landes Verbreitung fanden. Allein in Paris erschienen um die Jahrhundertwende zwischen fünfundzwanzig und fünfunddreißig Tageszeitungen, die alle möglichen Nachrichten brachten und machten. In Berlin gab es sogar sechzig Tageszeitungen, von denen zwölf zwei Ausgaben pro Tag hatten. In London kostete die Daily Mail kaum mehr als einen Cent. Das Blatt hatte eine Auflage von gut einer halben Million, elfmal so viel wie die altehrwürdige Times. Durch diese Zeitungen entstand eine neue Macht, die »öffentliche Meinung«, und schon bald verstanden es die Zeitungsmagnaten, mit dem Empfinden des Volkes wie auf einer Kirchenorgel zu spielen. Sie bauschten Gerüchte auf, unterschlugen Fakten; alles war erlaubt, wenn es um höhere Auflagen, politische Macht oder das pure Adrenalin der Neuigkeit ging.
Aber: Warum reagierte die französische Öffentlichkeit gerade auf diese Geschichte so empfindlich? Ein Grund dafür war Antisemitismus. Die Anti-Dreyfus-Presse berichtete täglich über die perfiden Machenschaften des »Syndikats«, über das große Komplott von Juden, Freimaurern, Sozialisten und Ausländern, die Frankreich durch List, Betrug, Bestechung und Lüge vernichten wollten. Als Dreyfus degradiert wurde, schrie die Menge vor den Absperrungen: »À mort! À mort les juifs!« Der jüdische Korrespondent der Zeitung Neue Freie Presse aus Wien war so entsetzt, dass er nach Hause ging und die ersten Zeilen seines Traktats Der Judenstaat schrieb. Darin forderte er einen eigenen Staat für die Juden. Der Name des Mannes: Theodor Herzl. Der Keim für die Entstehung Israels liegt in der Affäre Dreyfus.
Im Kern war die Affäre Dreyfus jedoch vor allem der Zusammenstoß zweier Frankreichs: Das alte, statische Frankreich der Symbole und gottgegebenen Ordnung kollidierte mit dem modernen, dynamischen Frankreich der Presse, der öffentlichen Diskussion, des Rechts und der Wahrheit. Oder anders ausgedrückt: Es handelte sich um den Konflikt zwischen dem Frankreich der Palais und dem Frankreich der Boulevards.
Das Merkwürdige war, dass die Affäre plötzlich ein Ende fand. Am 9. September 1899 wurde Dreyfus erneut verurteilt, obwohl das Beweismaterial offenkundig manipuliert worden war. Europa war erschüttert darüber, dass im aufgeklärten Frankreich so etwas passieren konnte. »Frevelhaft, zynisch, barbarisch und voller Hass«, schrieb der Korrespondent der Times. Langsam wurde den Franzosen klar, dass das Bild Frankreichs im Ausland durch die Affäre immer größeren Schaden nahm. Und das ausgerechnet am Vorabend der Weltausstellung, die die größte aller Zeiten werden sollte. Man bot Dreyfus die Begnadigung an, die dieser, zermürbt wie er war, annahm.
1906 wurde er von der Armee rehabilitiert, man beförderte ihn zum Major und verlieh ihm das Kreuz der Ehrenlegion. Zola starb 1902. 1908 wurde seine Asche ins Pantheon überführt. Als Dreyfus wieder frei war, zeigte es sich, dass er weit weniger idealistisch war als diejenigen, die sich für ihn eingesetzt hatten. »Wir waren bereit, für Dreyfus zu sterben«, sagte einer seiner entschiedensten Anhänger später. »Doch Dreyfus selbst war das nicht.« Als eine Gruppe Intellektueller den betagten Dreyfus in den zwanziger Jahren bat, einen Appell gegen das Todesurteil für Sacco und Vanzetti zu unterschreiben, die Opfer eines politischen Prozesses in den Vereinigten Staaten geworden waren, reagierte er wütend: Mit derlei Dingen wollte er nichts mehr zu tun haben.
Während der ersten Tage in Paris lasse ich mich von einem Baedeker aus dem Jahr 1896 leiten. Die Avenue Jean Jaurès heißt in meinem Reiseführer noch Rue d’Allemagne, die Kirche Sacré Cœur ist erst zur Hälfte fertig, der bedeutendste Kunstmaler ist Louis Meissonier, die Moulin de la Galette hat ihre Arbeit als Windmühle gerade erst eingestellt. Ich lasse mich in einer der dreizehntausend Kutschen herumfahren oder nehme eine der vierzig Omnibuslinien, welche die Stadt durchkreuzen. Alles funktioniert und bewegt sich mit Pferdekraft, Zehntausende von Pferden vor Mietkutschen, Omnibussen, Pferdewagen, Kaleschen; mein ganzer Baedeker riecht nach Pferd. All diese Pferde müssen untergebracht, gefüttert und getränkt werden – daher auch die vielen Heu- und Hafermärkte und die insgesamt zweitausend öffentlichen Brunnen. Von dem Pferdemist gar nicht erst zu reden.
Es ist sonnig und mild. Von meinem Hotelzimmer aus schaue ich über die Zinkdächer von Montmartre, die Reste einer alten Windmühle. In der Ferne sehe ich in Nebel gehüllte Hügel. Unter meinem Fenster liegen ein paar alte Gärten mit hohen Bäumen, ein Haus mit einem Wintergarten. Die frühen Frühlingsgesänge der Amseln, Spatzen und Stare dringen an mein Ohr. Es wird langsam dunkel. Zwischen dem Grau des Abendhimmels und den Dächern tauchen immer mehr gelbe Lichter auf Die Stadt summt leise.
Die Wasser sind blau und die Gewächse sind rosa; der Abend ist süß anzuschauen;Man geht spazieren.Die großen Damen gehen spazieren; hinter ihnen ergehen sich kleine Damen.
Mit diesem Gedicht des Vietnamesen Nguyen-Trong-Hiep auf Paris aus dem Jahr 1897 beginnt der umherziehende europäische Schriftsteller Walter Benjamin seinen Essay »Paris, die Hauptstadt des neunzehnten Jahrhunderts«. Warum gab er, wie viele andere auch, Paris diesen Titel? Warum sprach um 1900 herum die ganze Welt von Paris, während die Macht doch längst in London beheimatet war, die Industrie in Berlin, die gute und die schlechte Zukunft in Wien? Warum wurde das Paris des 19. Jahrhunderts weithin als der Auftakt der Moderne betrachtet?
Grund dafür waren in erster Linie die neuen Baumaterialien und Bautechniken, das Eisen und das Glas, das nirgendwo so verschwenderisch und kunstvoll eingesetzt wurde. Man betrachte nur die Palais, den Eiffelturm, die Metrotunnel unter der Seine mit ihren riesigen eisernen Treppenhäusern und Aufzügen, die früher einmal so groß wie ein halber Eisenbahnwaggon waren. Und überall stieß man auf die berühmten Passagen, die »Innenboulevards«, die Benjamin zum Ausgangspunkt für sein wichtigstes Werk machte.
Die großzügigen Interieurs der Bürgerhäuser – »das Etui des Privatmanns«, wie Benjamin schreibt – wurden Zufluchtsorte der Kunst. Die aufkommende Fotografie – auch auf diesem Gebiet war Paris führend – zwang die Maler zur Suche nach vollständig neuen Formen. Man malte nun das Glitzern einer Bewegung oder den Eindruck, den ein Nachmittag in der Phantasie hinterlassen hatte. Die Impressionisten bereiteten den Weg für Maler wie Pablo Picasso, die, auf der Suche nach der Struktur der Dinge, später Szenen und Objekte buchstäblich auseinandernahmen.
Die Beziehungen zwischen den Künstlern waren intensiv, der Markt war gierig. Claude Monet konnte seine ersten Gemälde umgehend für dreihundert Francs verkaufen; ein Lehrer verdiente im Monat nur halb so viel. Woche um Woche beschreibt André Gide in seinem Tagebuch neue Ausstellungen. Das waren die Orte, die jeder besuchte, über die jeder sprach.
Überwältigend war Paris auch wegen seiner Boulevards und der eindrucksvollen Ordnung, die der Präfekt Haussmann damit der Stadt auferlegt hatte, in der, so Benjamin, »die Institute der weltlichen und geistlichen Herrschaft des Bürgertums, in den Rahmen der Straßenzüge gefaßt, ihre Apotheose finden« sollten. Tatsächlich hatten Haussmanns grands travaux einen militärischen Hintergrund – bei einem Aufstand konnten die Einheiten der Armee nun sehr viel leichter eingreifen –, doch war dies nicht das wichtigste Ziel. Die Boulevards waren vor allem als moderne Verbindungswege zwischen den unterschiedlichen Warenzentren gedacht, denn in Paris herrschte, ebenso wie in London oder Brüssel, ein unüberschaubares Verkehrschaos aus Pferden, Karren, Equipagen, Kutschen und Omnibussen. Außerdem dienten sie als Sichtachsen zwischen Denkmälern und großen staatlichen Gebäuden, nationale Symbole, die von Einwohnern und Besuchern respektvoll bewundert werden sollten und deshalb sehr viel Platz brauchten. Die Boulevards bildeten innerhalb der Stadt eine Trennlinie zwischen dem Bürgertum und dem einfachen Proletariat, zwischen den wohlhabenden Arrondissements und den schmutzigen, rauchenden Vorstädten. Zugleich aber hatten Haussmanns Pläne eine ungeahnte Dynamik zur Folge, weil sie erstmals von einer alles umfassenden Vision des Phänomens Stadt ausgingen.
»Das moderne Paris konnte nicht existieren im Paris von früher«, schrieb der Dichter und Journalist Théophile Gautier jubelnd. »Die Zivilisation bahnt sich breite Wege inmitten des düsteren Labyrinths aus Straßen, Kreuzungen und Sackgassen der alten Stadt; sie fällt Häuser, wie die Pioniere in Amerika Bäume fällen.« Paris sollte so zum Brückenkopf der neuen Zeit werden, zum Leuchtzeichen des modernen Geistes, zum Licht in der provinziellen Finsternis, zum Gloriengesang Frankreichs, zur Staatsstadt des neuen Europa.
Keine Metropole ist so durch und durch Stadt und gleichzeitig so verwachsen mit der Provinz wie Paris. Auf dem dreiminütigen Fußweg von meinem Hotel zum Boulevard zähle ich sechs Gemüsehändler, fünf Bäcker, fünf Schlachter und drei Fischhändler. Vor jedem Geschäft stehen Kisten: Äpfel, Apfelsinen, Salate, Kohlköpfe, Lauchstangen, leuchtend in der Wintersonne. Die Schlachtereien hängen voller Würste und Schinken, der Fisch liegt in Wannen auf dem Bürgersteig, die Bäckereien duften nach Hunderten von Brotsorten, glänzend und knusprig.
Das Verhältnis der Pariser zu ihren mysteriösen bäuerlichen Wurzeln, la France profonde, war schon immer kompliziert und zugleich sehr eng. Ein Großteil der Pariser stammt aus der Provinz, und wenn nicht sie selbst, dann ihre Eltern oder Großeltern. Heute bekennen sich die Franzosen durchaus dazu, sie kultivieren diese Herkunft sogar, haben Wochenendhäuser auf dem Land und kaufen Produkte »von zu Hause«. Das alles gehört zur l’exception française, auch wenn mittlerweile ein Drittel der Pariser Bevölkerung aus dem Ausland stammt.
Um die Jahrhundertwende wollten die Leute vom Land, einmal in Paris angekommen, die Provinz so rasch wie möglich abschütteln. Auch in dieser Hinsicht konnte man von zwei französischen Nationen sprechen. Je stärker sich die großen Städte zu Maschinen voller Licht und Bewegung entwickelten, umso finsterer und verschlafener wirkte die Provinz.
Bauern wurden von den Parisern durchweg als Wilde und Barbaren betrachtet. Überall konnte man sie an ihren polternden und klappernden Holzschuhen erkennen, und auch wenn sie Lederschuhe trugen, fielen sie in der Stadt jedem aufgrund des merkwürdigen Gangs ins Auge, den sie sich wegen der schweren Holzschuhe angewöhnt hatten. Diese Trennung gab es überall in Europa, doch nirgendwo waren die Unterschiede so groß wie in Frankreich.
In den Pyrenäen, den Alpen und dem Zentralmassiv, in den Dörfern und Flusstälern, wo heute alle Welt Urlaub macht, hatten um 1880 viele Menschen noch nie einen Wagen oder eine Karre gesehen. Alles wurde mit Pferden oder Mauleseln transportiert. Lokale Dialekte gaben den Ton an. Aus offiziellen Zahlen geht hervor, dass noch 1863 ein Viertel aller Franzosen kaum ein Wort Französisch sprach. In vielen Regionen benutzte man Maß- und Gewichtseinheiten und sogar Münzen, die ein Jahrhundert zuvor bereits offiziell abgeschafft worden waren. Wer irgendwann einmal, und sei es auch nur für einen Tag, in Paris gewesen war, trug für den Rest seines Lebens den Ehrentitel »Pariser«.
Das »ursprüngliche« Leben der französischen Bauern war wenig romantisch. Die Berichte der Provinzgerichte zeugen immer wieder von einer unmenschlichen Armut und Härte. Da wird eine Schwiegertochter ermordet, weil sie »kränklich ist und wir nichts von ihr haben«. Eine Schwiegermutter wird in den Brunnen geworfen, um ihr nicht mehr die jährlichen fünfundzwanzig Francs und drei Scheffel Getreide zahlen zu müssen. Ein alter Vater wird von seiner Frau und seiner Tochter mit einem Stampfer, einem Hammer und einer Harke verprügelt, weil sie ihn nicht länger versorgen wollen. Kindern wie dem kleinen Rémi aus Hector Malots Roman Ein Kind allein (1878) konnte man überall begegnen. Noch 1905 zogen etwa 400 000 Bettler durch die französische Provinz.
Während in Paris eine enorme Infrastruktur für die Versorgung mit Frischwasser und die Entsorgung der Abwässer angelegt worden war – auch heute noch gibt es kleine unterirdische Seen –, wurde in französischen Provinzstädten wie Rouen und Bordeaux das Schmutzwasser einfach in den Rinnstein geleitet. In Rennes, heute eine Stadt mit siebzigtausend Einwohnern, gab es um 1900 exakt dreißig Badewannen und zwei Häuser mit einem Badezimmer. In der Literatur der Zeit findet man vermehrt Klagen über den Gestank, den zum Beispiel im Haus wohnende Dienstboten oder Mitreisende verbreiteten.
Doch auch auf diesem Gebiet brach nun eine Zeit rascher und tiefgreifender Veränderungen an. Ab den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts investierte der französische Staat viele Millionen Francs in die Entwicklungspläne von Charles de Saulces de Freycinet, dem engagierten Minister für Landesentwicklung. Er wollte die Kluft zwischen Paris und der Provinz mit dem Bau von Schulen und Straßen schnellstmöglich verkleinern und zugleich der stagnierenden Wirtschaft neue Impulse geben.
Die Auswirkungen waren schon bald spürbar. Nach 1900 war das berüchtigte Schwarzbrot, das Symbol größter Armut und Rückständigkeit, fast nirgendwo mehr zu finden. Die steife, traditionelle Kleidung wurde innerhalb von zwei Jahrzehnten durch bequeme Konfektionsmode ersetzt. Um 1909 sah ein Bauernmädchen auf einem Jahrmarkt kaum anders aus als ein städtisches Fabrikmädchen, das sich herausgeputzt hat. Auch die Stände der öffentlichen Schreiber verschwanden: Ab 1880 lernte jedes Bauernkind lesen und schreiben, und damit endete eine Abhängigkeit, von der wir uns kaum noch eine Vorstellung machen können.
Der Provinzschriftsteller Émile Guillaumin hat das Schicksal von fünf Knechten beschrieben, die an einem heißen Sommertag des Jahres 1902 auf einem Rübenfeld bei Moulins Unkraut harkten. Acht Jahre später arbeitete einer als Portier, der zweite lebte in Vichy, der dritte verdingte sich in einer Möbelfabrik, der vierte war Lakai geworden, und nur der fünfte arbeitete noch in der Landwirtschaft. Ich wage zu behaupten, dass von ihren hundert Großenkeln heute noch höchstens zwei in der Landwirtschaft tätig sind. Mindestens dreißig leben in Paris, und den Parisern scheint dies auch deutlicher bewusst zu sein als den Einwohnern jeder anderen Weltstadt: dass sie alle Nachkommen von Unkrautharkern bei Moulins sind und dass sie Rüben und Harker in Ehren halten müssen.
An der Metrostation Opera komme ich mit Pierre Maillot ins Gespräch. Er hat einen grauen Bart und eine treuherzige Brille und steht in einem der Metrogänge mit einer Dose und einem Pappschild in den Händen: »Ich schäme mich. Aber ich habe Hunger.« Auf diese Weise verdient er etwa hundert Francs (etwa fünfzehn Euro) am Tag; das reicht für ein Bett und eine einsame Mahlzeit mit einem Viertel Wein. Die älteren Leute geben viel, die jüngeren sind geizig. »Meinen einzigen Freund habe ich hier«, sagt er und holt eine in roten Kunststoff eingeschlagene Bibel aus der Innentasche. Dann erzählt er mir eine komplizierte Geschichte über Gefängnisse, eine Scheidung, Probleme im Kopf, verschwundene Sozialhilfe und andere unkontrollierbare Dinge, die im Leben eines Menschen passieren können.
Über der Erde wird demonstriert. Meines Wissens gibt es keine Stadt in Europa, deren Zeitungen – als handele es sich um den Wetterbericht – täglich einen Stadtplan veröffentlichen, dem zu entnehmen ist, wo es zu Menschenansammlungen kommen könnte: illegale Einwanderer, Studenten der Zahnmedizin, Royalisten, Angestellte der Telekommunikationsunternehmen. Ich treffe auf eine Gruppe von Schülern, die wütend ist, weil die Stellen ihrer Lehrer gestrichen wurden, während die Kurse noch liefen. Philippine Didier erklärt mir, dass sie in Griechisch jetzt keine Abschlussprüfung mehr machen kann. Wie ihre Klassenkameraden möchte sie zur École Nationale d’Administration (ENA), der Kaderschmiede für die Elite Frankreichs in Verwaltung und Politik. »Der Minister hasst uns«, sagt Philippine überzeugt. »Wie man hört, ist er früher mal durch die Prüfung gerasselt.« Plötzlich betrachte ich die verschlissenen Jacken, schiefen Brillen, samtenen Hütchen und rührenden Rucksäckchen mit etwas anderen Augen: Das also ist die französische Elite des Jahres 2030, denke ich, die Minister, die Spitzenbeamten, das stählerne Netzwerk, auf dem Frankreich treibt, die zukünftige Ordnung.
Das alltägliche Verkehrsaufkommen in Paris ist beeindruckend. Das gilt vor allem für den öffentlichen Nahverkehr. Der Großraum Paris hat ein Nahverkehrssystem, über das Städte wie London, Amsterdam oder Berlin erst in dreißig, vierzig Jahren verfügen werden. Alles zeugt von einem beispiellosen Qualitätsbewusstsein: die automatische Kartenkontrolle, die Einheitlichkeit der Fahrpreise, die klare Beschilderung, die hohe Taktfrequenz, die Geschmeidigkeit, mit der die Züge die vielen Menschen durch die Stadt katapultieren.
Nur vereinzelt sieht man jemanden zum Zug rennen, denn nach zwei bis vier Minuten kommt bereits der nächste. Selten fühlt man sich unsicher; immer sind Menschen in der Nähe, die Bahnen werden intensiv genutzt. Hin und wieder nur ist man geneigt, das Auto zu nehmen; nichts kommt an die Schnelligkeit der RER-Verbindung zwischen dem Eiffelturm und Versailles zum Beispiel heran. Das Bemerkenswerteste an diesem System ist, dass es schon seit so vielen Jahren problemlos funktioniert. Wer die Zukunft sehen will, fahre einfach einen Nachmittag lang in Paris und Umgebung herum.
Allmählich bekommt mein alter Baedeker dann doch Probleme. Die Pariser Vorstädte sind ein Dschungel aus Fabriken, Lagerhallen und Wohnsilos, doch die auffaltbare Karte in meinem Reiseführer zeigt lindgrüne Felder und Wäldchen und Dörfer wie Neuilly, Pantin und Montreuil. Le Bourget ist ein Marktort an einem Nebenfluss der Seine. Später wurde dort der bekannteste Flugplatz von Paris angelegt, der inzwischen zu einem Museum geworden ist.
Meine Expedition nach Le Bourget galt dem Flugzeug, mit dem Louis Blériot am 25. Juli 1909 als Erster den Kanal überquert hat. Aber dann bleibe ich den ganzen Vormittag bei den Fluggeräten seiner Vorgänger, den Stümpern und Blendern, hängen. Hierauf basiert also der Fortschritt: Klugheit, Nonkonformismus und vor allem Schneid. Zum Beispiel das Dampfflugzeug von Félix du Temple aus dem Jahr 1857. Ich weiß nichts über diesen Mann, aber ich sehe ihn vor mir, in seiner Werkstatt. Sein Flugzeug ist eine Art Schwalbe mit sich auf und ab bewegenden Flügeln; oben auf der Flugmaschine ist ein Schiffsruder montiert, daneben ein Kupferkessel mit Dampfpfeife. Oder das viereckige Gefährt von Trajan Vuia, ein Flügel auf einer Art Kinderwagengestell, mit dem am 18. März 1906 der erste Flug mit einem Monoplan in Frankreich gelang, zwölf Meter weit und fünfzig Zentimeter hoch.
Und das Flugzeug von Louis Blériot selbst. Ich fand einen Bericht des Telegraph-Korrespondenten Alexander Cohen über eine Reihe von Flugversuchen auf dem Übungsgelände von Issy-les-Moulineaux, die am dämmerigen Nachmittag des 22. November 1907 unternommen worden waren. Er hatte Herrn Farman in einem »Rieseninsekt« aus Leinen, Bambus und Aluminium vom Boden abheben und einige hundert Meter weit fliegen sehen. Das tat das »fliegende Tier« von Blériot nicht. »Die ›Libellule‹ brummte zwar blitzschnell über das Gelände und machte ein paar hübsche Kurven, aber sie hob nicht einen Zentimeter vom Boden ab.«
Gut anderthalb Jahre später flog Blériot in diesem mit Leinwand bespannten Gestell nach England. Kurz vor dem Start drohte das Flugzeug auseinander zu fallen: Der Fischleim, der alles zusammenhielt, löste sich nach und nach. Bevor er in die Luft stieg, fragte er beiläufig, in welcher Richtung Dover eigentlich liege.
Und dann die Fotos der Flugpioniere. Vaniman (1909, mit Mütze) schaut entschlossen nach vorn; hinter ihm steht ein Motor, der so aussieht, als sei er für ein Frachtschiff bestimmt. Coudron (1910, mit bretonischem Barett) strahlt Ungezwungenheit aus; der hat eine Chance. Gilbert (1910, Anzug und Krawatte) liegt wie ein ordentlicher Familienvater in einer Art Hängematte unter seinem Bambusflugzeug. Das ganze Ding ist mit Troddeln verziert. Ich schaue Octave Gilbert in die Augen. Seine väterlichen Hände halten angespannt die dünnen Steuerseile fest, die mit den beiden Rädern des Fahrwerks verbunden sind und an einem Fahrrad gute Dienste leisten würden. Angst, Würde, alles an ihm ordnet sich dem Fortschritt unter. Sein Gesichtsausdruck ist voller Mut und Verzweiflung.
3
»Ich ergötze mich immer wieder neu an dem Staunen junger Menschen, sobald ich ihnen erzähle, daß ich vor 1914 nach Indien und Amerika reiste, ohne einen Paß zu besitzen oder überhaupt je gesehen zu haben«, schrieb StefanZweig 1941.
Auch mein Baedeker hält den Besitz eines Passes nicht für notwendig, »aber sie sind sehr oft ein praktisches Mittel zur Feststellung der Identität des Reisenden, wenn es darum geht, Zugang zu Museen auch an solchen Tagen zu erhalten, da sie nicht für das breite Publikum geöffnet sind«.
Westeuropa hat nicht einmal ein Jahrhundert mit Pässen gelebt; schon sause ich im superschnellen Eurostar wieder ohne Halt über die Grenzen. (Nicht dass die Behörden mich ignorierten, auf vielerlei Weise werde ich elektronisch überwacht und mein Weg verfolgt, aber das ist eine andere Geschichte.) Nur Großbritannien hält die alten Grenzgepflogenheiten noch in Ehren. Sorgfältig begutachten ernste Herren in Zivil meine Papiere, im Namen Ihrer Majestät.
Für England begann das Jahrhundert mit einem Begräbnis, und so vertiefe ich mich gleich am Morgen nach meiner Ankunft in London in die Zeitungsregister der neuen British Library, eines gigantischen Gedankenspeichers aus rotem Backstein. Das Begräbnis Königin Victorias fand am Freitag, dem 1. Februar 1901 statt, lese ich in der Sonder- und Sammelausgabe (2 Pence) der Yorkshire Post. Unter Anteilnahme von Hunderttausenden bewegte sich der Trauerzug durch London, voran die Dudelsackspieler der Irish und Scots Guards. Post-Reporter John Foster Fraser gab sich alle Mühe, den Klang der mit Trauerflor behängten Trommeln genau wiederzugeben: »Rumble – rattle rumble – rattle.« Danach spricht sein Bericht hauptsächlich von der Familie, die dem Katafalk folgte: der neue König Edward – »aschfahle Wangen, die Augen matt und müde« –, sein Neffe Wilhelm II., Kaiser von Deutschland – »mit abwärts gebogenem Schnurrbart« –, sein Vetter Leopold II., König der Belgier, sein Schwager, der griechische König Georg I., der »blonde und blauäugige« Neffe Heinrich von Preußen, der »wohlgebaute« Großherzog von Hessen »mit seinem kräftigen Kinn«, und so schlurfte das gesamte Haus Hannover plus Anhang durch London, allen voran Kaiser Wilhelm.
Das war der Europagipfel anno 1901, als Außenpolitik noch Sache der Herrscherfamilien war; die kleine, resolute, immer in schwarzen Satin gehüllte Königin Victoria war jahrzehntelang buchstäblich die »Großmutter Europas« gewesen, besser gesagt, des Familiennetzwerks europäischer Monarchen. Zwischen den Monarchen gab es zwar größere und kleinere Konflikte, aber sie trafen sich bei den unzähligen Hochzeiten, Festen und Begräbnissen innerhalb ihres Netzwerks und posierten für Fotos, auf denen einer die Uniform des anderen trug: König George V. eine preußische, Kaiser Wilhelm eine britische, Kaiser »Willy« eine russische, Zar »Nicky« eine preußische. So starb Victoria am 22. Januar 1901 wie eine Urmutter (ich folge dem Augenzeugenbericht Lord Reginald Eshers): »Die Königin erkannte ab und zu die Umstehenden und sprach sie mit Namen an … Reid, der Arzt, legte seinen Arm um sie und stützte sie. Der Prince of Wales kniete neben dem Bett. Der Deutsche Kaiser stand still am Kopfende neben der Königin. Alle Kinder und Enkel waren versammelt, in Abständen riefen sie ihre Namen. Die Königin schlief friedlich ein. Als der König nach London fuhr, kümmerte sich der Kaiser um alles.«
Schließlich hob Kaiser Wilhelm zusammen mit seinem Cousin, dem englischen König, seine Großmutter Victoria eigenhändig in ihren Sarg. So ging es zu in der ewigen Familie, dem europäischen Haus.
ENDE DER LESEPROBE





























