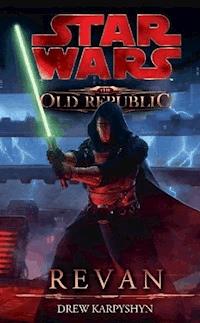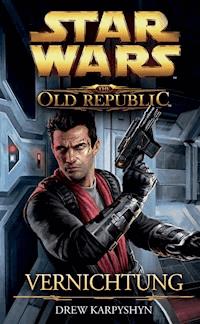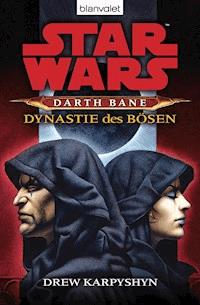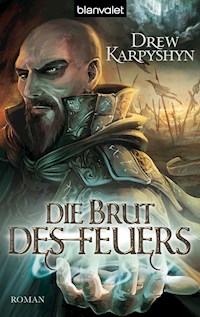
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kinder des Chaos
- Sprache: Deutsch
Sie gaben ihm alles – aber er wollte mehr!
Vor langer Zeit vertrauten die Götter einem großen Krieger drei Talismane an, um diesen gegen die Mächte des Chaos zu wappnen und die Welt der Sterblichen zu beschützen. Aber Daemron wandte sich gegen das Gute – und forderte die Götter selbst heraus. Als Strafe wurde er verbannt und hinter einem magischen Siegel eingesperrt. Um dieses Siegel zu brechen, pflanzt Daemron einen Samen in vier Kinder: die Brut des Feuers. Sobald sie das Siegel niedergerissen und Daemron befreit haben, wird die Welt der Sterblichen unter seiner Rache erzittern …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 816
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Vor langer Zeit vertrauten die Götter einem großen Krieger drei Talismane an, um diesen gegen die Mächte des Chaos zu wappnen und die Welt der Sterblichen zu beschützen. Aber Daemron wandte sich gegen das Gute und forderte seine Schöpfer heraus. Als Strafe wurden ihm die Talismane entrissen und er selbst hinter ein magisches Siegel gesperrt. Um dieses zu brechen, pflanzt Daemron nun einen Samen in vier Kinder: die Brut des Feuers. Scythe, Vaaler, Keegan und Cassandra wachsen in verschiedenen Winkeln des zerstörten Landes auf – ein jedes Kind trägt einen Teil der zerstörerischen Macht Daemrons in sich. Wenn sie zusammentreffen, kann das Siegel niedergerissen und Daemron befreit werden. Doch werden Scythe, Vaaler, Keegan und Cassandra sich ihrem dunklen Schicksal fügen oder ihren eigenen Platz in der Welt der Sterblichen fordern?
Autor
Drew Karpyshyn ist der New-York-Times-Bestsellerautor des Star-Wars-Universums und fraglos auch der erfolgreichste. Vor allem durch seine Darth-Bane-Romane schuf er sich eine große Fangemeinde. Er arbeitet zudem als Videospiel-Entwickler. Nachdem er den Großteil seines Lebens in Kanada verbracht hat, hatte er irgendwann genug von den langen kalten Wintern dort und zog nach Süden. Drew Karpyshyn lebt heute mit seiner Frau in Texas.
Bei Blanvalet sind von Drew Karpyshyn bereits erschienen:
Star Wars™ Darth Bane 1. Schöpfer der Dunkelheit
Star Wars™ Darth Bane 2. Die Regel der Zwei
Star Wars™ Darth Bane 3. Dynastie des Bösen
Die Brut des Feuers
Drew Karpyshyn
Die Brut des Feuers
Roman
Aus dem Amerikanischen von Wolfgang Thon
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »Children of Fire« bei Del Rey / Random House, Inc., New York
Deutsche Erstveröffentlichung August 2014 bei Blanvalet,
einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München
Copyright © 2013 by Drew Karpyshyn
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014
by Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München
Umschlaggestaltung: © Inkcraft
Redaktion: Rainer Michael Rahn
BL · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN: 978-3-641-12439-7V002www.blanvalet.de
Für Jennifer,meine Liebe und mein Leben
Prolog
Alle Dinge sind aus dem Feuer geboren. Die Flammen des Chaos sind der Quell allen Lebens und der Schöpfung. Sie sind die Ursache für jede Art von Tod und Vernichtung. Die Gesamtheit der Welt der Sterblichen wurde aus dem Inferno der Brennenden See geschmiedet, und das Chaos wurde von der Macht der Alten Götter geformt und gebunden, um eine Insel der Ruhe zu schaffen, die in einem Ozean von Flammen trieb.
Zuerst kamen die Pflanzen und Bäume. Danach die Fische des Ozeans, dann die Vögel der Luft und die Tiere des Landes. Schließlich erschufen die Alten Götter die Frau und den Mann, und diese vermehrten sich, um die neu geformte Welt zu bevölkern.
Aber das Chaos rebelliert gegen das Gefüge und die Ordnung, und selbst die Magie eines Gottes kann es nicht für immer in Fesseln legen. Nichts währt ewig.
– Salidarr, Gründer und erster Pontiff des Ordens
Nichts dauert ewig.
Daemron der Schlächter wusste das besser als jeder andere. Von den Göttern aus den Reihen der Sterblichen erhoben und von der unendlichen Macht des Chaos selbst in einen Gott verwandelt, wurde er schließlich wieder verstoßen. Viel zu lange war er in diesem Niederreich von Rauch und Schatten gefangen, nur wegen seiner unverzeihlichen Sünde, es gewagt zu haben, die göttliche Autorität infrage zu stellen. Aber jetzt sind die Alten Götter verschwunden, und nur er ist zurückgeblieben.
Und auch jetzt ist er allein, eine einsame Gestalt auf einer verlassenen, aschefarbenen Ebene. Trockene, rissige Erde unter einem grauen, gleichförmigen Himmel. Er steht vor einem Springbrunnen aus weißem Marmor – ein einfaches, etwas über einen Meter hohes Podest, darauf eine große, tiefe Schale. Er fährt mit seiner Klaue über den Rand der Schüssel und zeichnet die letzten geheimen Symbole des Rituals mit dem Blut nach, das von seinem Nagel tropft. Seinem Blut, dem Blut eines Unsterblichen. Dieses Opfer wird ihn zum Krüppel machen, er wird schwach und verletzlich sein, während die Magie von seiner Macht zehrt. Aber es wird seinem Bann Kraft verleihen.
Sein Blut ist nicht das einzige, das den Brunnen rot färbt. Ein Dutzend seiner Gefolgsleute, Auserwählte von den Nachfahren jener, die mit ihm ins Exil getrieben wurden, sind für diesen Bann gestorben. Ursprünglich hatte er gehofft, sie würden ohne Protest zu ihm kommen, ihr Leben freiwillig opfern, damit andere die Chance bekämen, dieser Einöde zu entkommen und in die Welt ihrer Vorväter zurückzukehren.
Früher einmal hätten seine Anhänger zweifellos ihr Leben für ihn gegeben. Doch im Laufe der Jahrhunderte ist ihr Glaube schwächer geworden. Die Saat der Unzufriedenheit und Rebellion hat bei ihnen Wurzeln geschlagen, und niemand war bereit, das Opfer freiwillig zu erbringen. Aber in dieser öden Unterwelt gilt sein Wille nach wie vor ohne Einschränkung, und jene, die für das Ritual auserwählt wurden, konnten sich seinem Ruf nicht widersetzen. Ihr Lebensblut füllt jetzt die Schüssel des Brunnens, und ihre zerschmetterten Knochen säumen das Podest.
Der Brunnen erzittert unter seiner Berührung. Die rote Flüssigkeit kräuselt sich unter der Macht des Chaos. Genug Macht, um ihn zu retten. Oder ihn zu vernichten.
Das Leben seiner Anhänger steht auf dem Spiel, genau wie das seine. Sollte die Magie ihn verzehren, werden sich die Bewohner dieses Reiches gegenseitig in Stücke reißen, um seinen verwaisten Thron zu erobern. Aber es sind nur Sterbliche, was also sollte das Leben ihnen schon bedeuten? Wie viel mehr riskiert ein Unsterblicher? Er allein vermag die Konsequenzen dessen zu begreifen, was er im Begriff ist zu tun. Ein kalkuliertes Spiel, eines, das er spielen muss. Eine Alternative gibt es nicht.
Denn er ist schon zu lange gezwungen gewesen, einfach dazusitzen und zuzusehen, tatenlos, vergeblich darauf wartend, dass das Vermächtnis, die Barriere, welche die Welt der Sterblichen von seiner und der seiner Anhänger trennt, zerfällt. Tag um Tag, Jahr um Jahr, Jahrhundert um Jahrhundert hat er zugesehen, wie seine Macht langsam schwächer wurde, hat darauf gewartet, dass dieser letzte Zauberspruch der Alten Götter endlich versagt. Doch die Magie eines Gottes stirbt nur langsam. Das Vermächtnis ist immer noch stark, und jetzt beginnt er selbst zu welken und zu sterben. Das Risiko dessen, was er da tut, ist sehr groß, aber er kann nicht länger warten.
Er umfasst mit seinen schuppigen Händen die beiden Seiten der Schale und legt den Kopf in den Nacken, blickt in den leeren Himmel hinauf und schließt die Augen. Mit leiser Stimme beginnt er die Anrufung, rezitiert die mystischen Worte, welche die Macht des Chaos beschwören sollen, um sie durch seinen Körper in den Brunnen zu leiten.
Er hält die sich sammelnde Magie so lange in sich, wie er es vermag, so lange, bis die Macht in einem heißen Schwall aus ihm herausbricht. Das Blut in der Brunnenschale siedet und kocht. Dicke Blasen platzen mit einem widerlichen Ton und sondern Wolken aus rotem Dampf ab. Die Haut seiner Handflächen wird von dem glühenden Stein des Schalenrandes versengt. Er beißt die spitzen Zähne zusammen und erträgt den glühenden Schmerz in stummer Qual, während die Farbe der Flüssigkeit durch die Hitze verbrennt und sich das Blut in kristallklares Wasser verwandelt.
Erst dann lässt er los, taumelt zurück und ringt nach Luft, während das Wasser rasch abkühlt. Die Spitzen seiner großen ledernen Schwingen zucken vor Erwartung, während er beobachtet, wie die blubbernde Oberfläche des Wassers sich beruhigt und zu einem makellosen Spiegelbecken wird. Das Ritual hat begonnen.
Er greift mit einer verbrannten, von Blasen überzogenen Hand nach dem faustgroßen schwarzen Stein, der an seinem Hals hängt. Er hat ihn viele Jahre an dieser dünnen goldenen Kette getragen, die er durch das winzige Loch in seiner Mitte gezogen hat. In all den Jahrhunderten hat er ihn immer bei sich gehabt, hat Geduld und Stärke daraus gezogen, während er auf diesen Tag wartete, den Tag, der heute endlich gekommen ist.
Mit einem scharfen Ruck reißt er den Stein von seinem Hals, ohne darauf zu achten, dass sich die goldene Kette in die Haut seines Nackens gräbt, bis sie bricht und ihm vor die Füße fällt.
Der Stein fühlt sich kalt an, erwärmt sich aber rasch in seiner Faust. Auf die glatte dunkle Oberfläche sind mit Blut Symbole gezeichnet. Mit seinem Blut. Runen in der alten Sprache. Sie repräsentieren die vier Aspekte von allem, was er einst gewesen ist: Hexer, Krieger, Prophet und König. Der Stein enthält seine göttliche Essenz, ist sein Samen. Der Geist seines ungeborenen Kindes ist darin gefangen, eines Kindes, dem es bestimmt ist, das Vermächtnis niederzureißen.
Er tritt vor und wirft einen Blick in die Schale. Er sieht die Welt der Sterblichen. Die Vision eines Reiches, das immer noch auf eine quälende Art und Weise außerhalb seiner Reichweite liegt. Er ignoriert den Schmerz seiner verletzten Handflächen, packt den dunklen Stein fest mit beiden Händen und hebt ihn hoch über den Kopf, als er eine weitere Anrufung anstimmt.
Ein zweites Mal sammelt sich die Magie in ihm, strömt die Hitze durch seine Adern. Und wieder beginnt das Wasser in der Schale zu blubbern und zu kochen. Die Vision der Welt der Sterblichen verschwindet und wird von dem lodernden Flammenmeer des Chaos ersetzt.
Der Stein pulsiert vor Hitze in einem stetigen Rhythmus, im Einklang mit seinen Herzschlägen. Seine Stimme wird lauter, und seine Worte lenken die Macht des Bannes, der diesen Stein über diese See aus Flammen tragen wird, auf dass er die Gestade der sterblichen Welt berühre. Dort wird er Wurzeln schlagen, und irgendwo wird ein Kind geboren werden. Sein Kind. Ein Kind geboren aus dem Feuer des Chaos.
Sein Körper beginnt vor Anstrengung zu zittern, und seine Anrufung gerät ins Stocken. Im selben Augenblick bricht das Chaos aus. Der Stein explodiert in seinen Händen, zerbirst in vier Teile und reißt dabei die bereits verletzte Haut seiner Klauenfinger auf. Er zuckt zurück und schreit in den leeren Himmel hinauf, als ihm die Stücke aus den Händen fallen und in der Schale verschwinden, ohne dass sich die Wasseroberfläche auch nur im Geringsten kräuselt.
Doch als sie die Flüssigkeit berühren, erhebt sich eine fauchende Säule blauer Flammen aus der Schale. Er wirft sich zur Seite, bringt sich in Sicherheit, als diese Säule aus Feuer das Podest und die Knochen davor umhüllt, sie vollkommen verzehrt, bevor sie eine Sekunde später mit einem Donnerschlag verschwindet.
Er liegt zusammengekauert am Boden, keuchend, die Schwingen über den Kopf gefaltet, während er in einer instinktiven Reaktion versucht, sich vor der mörderischen Hitze dieser Flammen zu schützen. Langsam teilen sich die Schwingen, und er späht unter ihnen hervor. Er betrachtet die verbrannte Erde, den kleinen Haufen schwarzer Asche. Ein demütiger Gott. Das Chaos kann man nicht bändigen, nicht beherrschen.
Aber er spürt, dass nicht alles verloren ist. Der Stein wurde gespalten, seine Essenz ist zerbrochen. Aber die vier Teile wurden von dem Feuer des Bannes verzehrt. Die Wirkung wird gedämpft und schwach sein, da sie sich über die unendliche Weite des ChaosMeeres erstrecken muss. Aber dennoch werden diese Kieselsteine Wellen erzeugen, die an die Gestade der Welt der Sterblichen schlagen werden.
Nicht ein Kind, sondern vier, und jedes berührt von der Macht seiner Magie, jedes gezeichnet, um in den Flammen von Streit und Leiden geboren zu werden. Sterbliche, denen die brennende Essenz eines verbannten und vergessenen Gottes eingeimpft ist, deren vier Leben unausweichlich verbunden und miteinander verschränkt sind. Selbst er kann ihr endgültiges Schicksal nicht vorhersehen. Erlösung und Zerstörung sind perfekt ausbalanciert. Das Ergebnis ist unsicher, und seine Visionen sind undeutlich.
Aber als er seine Schwingen entfaltet und sich aufrichtet, ist er sich einer Sache gewiss: Das Chaos wurde von ihm auf die Welt der Sterblichen losgelassen.
1
Ein unsichtbarer Zweig schlängelte sich durch die Dunkelheit der Nacht und schnappte mit trockenen, hölzernen Fingern nach Nyras Knöchel. Sie stolperte nach vorn, weil ihr dicker Bauch sie ungelenk und behäbig machte. Der schwere Schal, den sie sich um die Schultern geschlungen hatte, fiel zu Boden, als sie die Hände ausstreckte, um ihren Sturz abzufangen.
Als sie auf der hart gefrorenen Erde landete, zuckte ein kurzer Schmerz durch ihr linkes Handgelenk. Scharf, aber nicht bedrohlich. Sie richtete sich mühsam auf die Knie auf, wobei sie mit den Händen ihren Bauch umklammert hielt. Unwillkürlich versuchte sie, das ungeborene Kind in ihrem Leib zu trösten. Sie flüsterte tröstende Worte, während sie ihren gewölbten Bauch durch die dicke Wolle ihres Winterkleides streichelte. Dann betete sie zu den Alten und Neuen Göttern darum zu fühlen, wie das Baby wegen des unerwarteten Sturzes protestierend zutrat oder sich zumindest bewegte.
Nichts. Sie kniete weiter auf der kalten Erde und weigerte sich, die ausbleibende Reaktion ihres Kindes zu akzeptieren. Die Nachtkälte drang vom Boden durch ihre Knie in ihre müden Schenkel. Der eisige Winterwind brannte auf ihren Wangen und Schultern. Aber sie wollte nicht weinen. Noch nicht. Nicht, solange sie noch Hoffnung für ihr Ungeborenes hatte.
Langsam drehte sie sich um und griff nach dem Schal, um ihn sich gegen die Kälte der Nacht wieder umzulegen. In den Südlanden gab es nur selten Schnee, aber ihr Dorf war nur wenige Tagesritte von den Steppen des Eisigen Ostens entfernt. Den beißenden Frost des hiesigen Winters fühlte man weit unten in den Südlanden nie so deutlich wie hier.
Sie nahm den Schal und warf ihn sich über die Schultern. Ein kurzer Stich durchzuckte ihr linkes Handgelenk. Bei dem unerwarteten Schmerz biss sie die Zähne zusammen. So gut es in der Dunkelheit ging, untersuchte sie die Verletzung.
Das Handgelenk ist verstaucht, entschied sie schließlich. Nur verstaucht.
Mühsam richtete sie sich wieder auf und griff wieder mit der Hand an ihren Bauch. Das Kind blieb weiterhin still. Sie ignorierte ihre verkrampften Muskeln in Waden und Schenkeln, den ständigen Schmerz in ihrem Rücken, die Knoten in ihrem Hals und ihren Schultern und setzte ihren Weg fort.
Aber jetzt ging sie vorsichtiger. Der Halbmond verbarg sich hinter dem Gewirr aus schwarzen, kahlen Zweigen über ihrem Kopf, und der Wald warf irritierende Schatten auf den überwucherten Pfad, dem sie folgte. Aber sie wusste, dass dies nicht der einzige Grund für ihr Straucheln war.
Tagsüber hätte man diesem Pfad, der von den Leuten aus den Dörfern ringsum breit ausgetreten war, spielend leicht folgen können. All die Frauen und Männer, die hierherkamen, um ihre Bitten vorzutragen, hielten den Weg frei von Gestrüpp und Pflanzen. Im Sonnenlicht hätte sogar ein Reiter auf einem trittsicheren Pferd diesen Pfad nutzen können.
Aber die Hexe mochte keine nächtlichen Besucher, und ihre Zauberkünste machten den Weg erheblich schwieriger, als er eigentlich sein sollte. Unter dem Mantel der Dunkelheit veränderte das Chaos das Gelände. Der Boden wurde rau und uneben, und die Wurzeln und Zweige der Bäume schienen sich auszustrecken, um die Frau am Fortkommen zu hindern.
Nyra hatte ihr Pony vor mehr als einer Meile an einen Baum gebunden, weil sie wusste, dass sie den Rest des Weges zu Fuß zurücklegen musste. Sie ging zügig weiter, denn die Zeit wurde knapp. Sie hatte keine Wahl, als im Schutze der Nacht hierherzukommen, während ihr Ehemann schlief. In den zwanzig Jahren nach dem Ende der Säuberung waren die meisten Gesetze gegen die Ausübung von Magie aufgehoben worden. Aber Gerrit betrachtete noch immer alle, die über die Gabe verfügten, mit Argwohn.
Sie konnte es ihm nicht verübeln. Er war älter als sie, alt genug, dass er sich noch an die Säuberungen erinnern konnte. Als Kind hatte er die öffentlichen Hinrichtungen durch den Orden beobachtet. Seine frühsten Erinnerungen waren die an Hexen und Häretiker, die laut schreiend auf den Scheiterhaufen verbrannten. Die Zeiten hatten sich geändert. Die ChaosMagie wurde toleriert, obwohl sich der Orden immer noch offiziell gegen ihre Gefahren aussprach. Und wie die meisten Einwohner in den Südlanden hatte Gerrit nicht das geringste Interesse daran, etwas zu tun, das dem Orden missfiel. Er hätte zweifellos versucht, ihr diesen Besuch auszureden.
»Das Baby war gesund«, hätte er eingewendet. »Wir haben gefühlt, wie es in dir gestrampelt und sich bewegt hat und kaum erwarten konnte, geboren zu werden. Diesmal war es anders als bei den vorigen Malen.«
Das stimmte, jedenfalls zunächst. Aber kurz nach dem achten Monat ihrer Schwangerschaft war das Baby ruhig geworden. Wie die anderen davor. Gerrit wusste nichts davon. Sie hatte es ihm nicht gesagt, und so die Götter wollten, musste sie das auch niemals tun.
Nyra stolperte weiter und stürzte oft zu Boden. Ihre Knie waren wund und wurden steif, ihre Hände rot und rau, weil sie sich bei jedem Sturz auf den eisigen, unebenen Boden verletzten. Einmal stieß sie sich das Kinn an einem hervorstehenden Ast, ihre Lippen platzten auf, und sie biss sich auf die Zunge. Der Geschmack des Blutes erschreckte sie. Denn er erinnerte sie an das Blut bei der Geburt. In ihrem Fall an viel zu viel Blut. Aber sie spuckte nicht aus. Und sie weinte auch nicht. Sie ließ keine Tränen zu, jedenfalls noch nicht. Nicht, solange noch Hoffnung bestand. Unbewusst fuhr sie sanft mit der Hand über ihren Bauch.
Nach einer weiteren Meile sah sie das Flackern eines kleinen Feuers unmittelbar hinter dem Kamm einer kleinen Anhöhe. Plötzlich schien der Pfad ebener zu werden. Die tückischen Wurzeln schienen in der glatten Erde zu verschwinden, und die Zweige, die nach ihr gegriffen hatten, zogen sich ein Stück zurück. Der eisige Wind um sie herum wurde von der verführerischen Wärme des Feuers gelindert, die der Wind flüsternd zu ihr trug. Nyra kroch die kleine, aber steile Anhöhe hinauf und nahm dabei die Hände ebenso zu Hilfe wie die Füße, um ihren unförmigen, schweren Körper über den Kamm zu wuchten.
Auf der anderen Seite führte ein sanfter Hang zu einer kleinen Lichtung hinab. Dort befand sich am Rand eine winzige Kate, kaum mehr als eine Hütte aus Holz und Glas. In der Mitte der Lichtung brannte ein Lagerfeuer, in sicherer Entfernung von den Bäumen und dem trockenem Schilf der winzigen Behausung. Die Flammen flackerten blau und violett, dann plötzlich rot und orange. Grüne und gelbe Funken knackten und knallten in diesem widernatürlichen Feuer.
Eine alte Frau kniete daneben und schürte die Kohlen mit einem dünnen, gebogenen Stock. Sie trug einfache dunkle Gewänder in dicken Schichten übereinander, um die Winterkälte fernzuhalten, die das Feuer nicht einzudämmen vermochte. Sie hatte graue Haare, und ihre Haut war talgig. Neben ihr lag ein Haufen von kleinen Tierknochen. Nyra zögerte unsicher, bis die Hexe aufblickte.
»Bist du den ganzen Weg gekommen, nur um jetzt zu zaudern?«, fragte Gretchen, die Hexe. Ihre Stimme war nicht mehr als ein trockenes, raues Flüstern.
Nyra näherte sich langsam den seltsamen Flammen, bis sie endlich am Feuer stand, der uralten Hausherrin gegenüber.
»Setz dich«, forderte die alte Frau sie auf.
Mühsam ließ Nyra ihren unförmigen Körper zu Boden sinken. Sie bewegte die Beine, um es sich auf der harten Erde einigermaßen bequem zu machen, aber es war verschwendete Mühe.
»Sprich«, befahl Gretchen. Das offenkundige körperliche Unbehagen der Schwangeren schien die Hexe nicht zu bemerken. Stattdessen stocherte sie mit dem Stock in den Flammen herum.
»Ich … Ich bin wegen meines Kindes gekommen«, begann Nyra.
»Wegen eines anderen oder wegen dieses Kindes?« Die alte Frau deutete mit dem Stock auf Nyras geschwollenen Bauch.
»Wegen dieses. Es gibt kein anderes. Mein Ehemann und ich haben es zweimal versucht, aber beide Babys wurden tot geboren.«
Gretchen schnaubte. »Tot geboren. Ich kann die Toten nicht zum Leben erwecken.«
Seit ihrer letzten Schwangerschaft war mehr als ein Jahr verstrichen, trotzdem taten Nyra die Worte der Hexe weh. Dennoch weigerte sie sich zu weinen. Nicht um dieses Kind. Noch nicht.
»Dieses Baby ist nicht tot. Es hat noch in der Nacht des letzten Vollmondes getreten, das habe ich gespürt. Bei den anderen Schwangerschaften war es anders. Da spürte ich nichts als das Gewicht des Kindes, als wäre ein kalter Stein in meinem Bauch.«
Gretchen legte ihren Stock zur Seite und hob einen kleinen Knochen von dem Haufen neben sich auf. Dann brach sie ihn mit ihren dünnen, knorrigen Fingern in zwei Teile und saugte das Mark heraus. Mit ihren verfaulten Zahnstümpfen kaute und lutschte sie an den beiden gesplitterten Enden, und bei dem schmatzenden Geräusch, das sie dabei erzeugte, verzog Nyra angewidert das Gesicht.
Endlich hob die Hexe ihren Stock hoch, stocherte damit in dem Feuer und spie in die Flammen. Funken stoben auf, und ein stinkender, fauliger Geruch waberte in einer Wolke aus gelbem Rauch empor.
»Das war vor vierzehn Tagen«, erklärte die Hexe, die die Wahrheit in den Flammen sah. »Das Kind in dir ist bereits tot. Dagegen kann ich nichts tun. Es wird geboren werden wie die anderen: leblos und kalt.«
Nyra hätte diese stinkende, verbitterte Frau am liebsten angeschrien, aber sie wusste, dass Hysterie sie nicht weiterbringen würde. Sie holte tief Luft, bevor sie antwortete. »Das Kind lebt noch in mir. Ich weiß es.«
»Woher?«, wollte Gretchen wissen. »Hast du gefühlt, wie es sich bewegt?«
Im Licht des verzauberten Feuers wäre eine Lüge sinnlos gewesen.
»Das Kind lebt. Ich weiß es einfach.«
Die Hexe nickte und legte den Stock beiseite, um einen weiteren Knochen vom Haufen zu nehmen. Während sie ihn zerbrach und aussaugte, bemerkte Nyra, dass auch der Stock, den die Hexe benutzte, um die Glut zu schüren, ein langer, dünner Tierknochen war. Er war vom langen Gebrauch im Rauch und den Flammen des Hexenfeuers geschwärzt.
Erneut spie Gretchen in die Flammen. Wieder stoben Funken hoch, aber diesmal war der Rauch blau. Er roch schwach nach dem fruchtbaren Dung, den Nyras Ehemann auf den Feldern verteilte.
»Was hast du mir mitgebracht?«
Nyra griff in die tiefe Tasche auf der Vorderseite ihres Kleides und tastete nach dem kleinen Lederbeutel, den sie dort hineingesteckt hatte, bevor sie aufgebrochen war. Es war nicht einfach für sie, um ihren großen Bauch herumzugreifen und in der Tasche zu suchen, während sie auf dem Boden saß. Eine Sekunde lang konnte sie die Börse nicht finden und fürchtete, sie hätte sie bei einem ihrer zahlreichen Stürze unterwegs verloren. Dann jedoch ertastete sie die Zugschnur unter ihren Fingern. Sie holte den Beutel heraus und hielt ihn hoch, damit die Hexe ihn sehen konnte.
Gretchen griff gierig über das Feuer und packte die Gabe, ohne sich von der Hitze der Flammen beeindrucken zu lassen. Sie riss den Beutel aus Nyras Hand und kippte den Inhalt in ihre runzlige Handfläche.
Die kleine Sammlung von Münzen und Juwelen stellte einen beträchtlichen Wert dar. Nyras Ehemann war zwar nicht reich, aber er arbeitete hart und war erfolgreich. Und er kaufte für seine Frau sehr gerne schöne und interessante Schmuckstücke von den reisenden Händlern, die durch ihr kleines Dorf kamen. Bevor Nyra in dieser Nacht aufgebrochen war, hatte sie die wertvollsten Gegenstände aus ihrer Sammlung ausgewählt, zusammen mit einem kleinen Stapel von Goldmünzen, die sie im Lauf der Jahre gespart hatte.
»Das ist nicht genug«, erklärte Gretchen, nachdem sie die Münzen und den Schmuck geprüft hatte.
»Ich … Mehr habe ich nicht mitgebracht«, stammelte Nyra verblüfft.
Sie hatte erwartet, dass sie mit diesem großzügigen Angebot jede Forderung würde begleichen können. Was sie der Hexe anbot, entsprach dem Zweijahreslohn eines Knechtes auf ihrem Hof.
Die Hexe betrachtete sie, und ein gieriger Ausdruck schimmerte durch ihre vom grauen Star getrübten, milchigen Augen hindurch. »Dein Ring.«
Nyra wich zurück und faltete die Hände über ihrem Hochzeitsring, als könnte sie ihn vor dem gierigen Blick der Hexe verstecken. Sie hatte gehofft, dass Gerrit den Schmuck nicht vermissen würde, den sie mitgenommen hatte. Aber wenn sie ohne den Ring zurückkehrte, den er ihr bei ihrer Vereinigung gegeben hatte, würde ihm das ganz gewiss auffallen.
»Nein! Mein Ehemann wird fragen, was passiert ist. Er darf nicht herausfinden, dass ich hier gewesen bin.«
Gretchen zuckte mit den Schultern. »Der Ring oder nichts. Das ist der Preis für dein Kind.«
Nyra hasste sie, diese böse alte Frau, die das Leben ihres ungeborenen Babys in ihren hässlichen, knorrigen Händen hielt. Langsam und mit Mühe zog sie den Ring von ihrem geschwollenen Finger. In einer Aufwallung von Trotz schleuderte sie den Ring der Hexe entgegen, mit aller Kraft, die ihr schwacher Arm aufbrachte. Die Hand der alten Frau zuckte hoch, so schnell wie eine Schlange, und schnappte sich den Ring aus der Luft.
Nachdem die Hexe den Ring kurz untersucht hatte, stopfte sie ihn in eine verborgene Tasche ihrer Gewänder, zusammen mit dem restlichen Inhalt des Lederbeutels. Den Beutel selbst warf sie ins Feuer, wo er rasch von den widernatürlichen Flammen verzehrt wurde.
Gretchen hob einen weiteren kleinen Knochen hoch und reichte ihn der jungen Frau. Trotz der Angst, die Nyra empfand, nahm sie den Knochen entgegen. Sie drehte ihn in den Fingern und versuchte herauszufinden, von welchem Tier er wohl stammte. Der Knochen war dünn und leicht wie der eines Vogels. Aber er war zu groß, als dass er von irgendeinem Küken hätte stammen können.
»Ein junger Greif«, sagte die Hexe, als hätte sie ihre Gedanken gelesen. »Der Größe nach zu urteilen höchstens ein oder zwei Wochen alt. Noch nicht sehr mächtig, aber es reicht für das hier.«
Nyra blieb nichts anderes übrig, als die alte Frau beim Wort zu nehmen. Sie hatte noch nie einen Greif gesehen; niemand hatte das. Jedenfalls keiner ihrer Zeitgenossen. Greife waren bereits vor Jahrhunderten ausgestorben – falls sie überhaupt jemals existiert hatten. Es hätte Nyra nicht überrascht, wenn Gretchen sie belogen hätte, was den Ursprung des Knochens anging.
»Zerbrich ihn«, wies die Hexe sie an. »Sauge das Mark aus, aber schlucke es nicht herunter. Kaue es und knabbere an dem Knochen. Dann spucke alles ins Feuer.«
Der Knochen war spröde und brach leicht zwischen Nyras Fingern. Sie verzog das Gesicht, als das saure Mark auf ihren spröden Lippen und der Bisswunde in ihrer Zunge brannte. Aber sie tat wie geheißen, kaute und knabberte, bis die Hexe mit einem Nicken auf das Feuer deutete.
Nyra spuckte aus. Das Grau des Knochens vermischte sich mit dem dunklen Rot des Blutes, das immer noch aus den Wunden in ihrem Mund sickerte. Das Feuer flammte auf, hell orange und so heiß, dass sie das Gesicht von dem Blitz abwenden musste. Als sie den Kopf wieder zurückdrehte, sah sie nur ein kleines, weiß schimmerndes Kohlenstück, nicht größer als ein Daumennagel, das mitten in den nun blaugrünen Flammen lag.
»Nimm es!«, befahl Gretchen.
Nyra erinnerte sich daran, wie die Hexe vorhin direkt über das magische Feuer gegriffen hatte, scheinbar ohne die Hitze zu spüren. Also griff sie in die Flammen und packte die weiße Kohle, dann schrie sie vor Schmerz und Überraschung auf und riss hastig den Arm zurück, als die Hitze ihre Haut versengte. Aber sie hatte die Faust um ihre Beute geballt, die überhaupt nicht heiß zu sein schien.
Gretchen kicherte boshaft, als Nyra ihre verbrannte Hand betrachtete. Die Haut war von der Hitze gerötet und zeigte ein paar Brandblasen. Aber es war nichts Ernstes, nichts Dauerhaftes. Sie spürte, wie ihr die Tränen kamen. Tränen des Schmerzes und Tränen wegen der Grausamkeit der Hexe. Ebenso Tränen der Furcht und der Verzweiflung, die sie sich versagt hatte, seit ihr klar geworden war, dass das Kind in ihrem Leib sich nicht mehr rührte. Aber sie würde nicht weinen. Nicht vor dieser boshaften alten Frau. Nicht jetzt, wo es echte Hoffnung für ihr Baby gab. Nyra starrte die Hexe böse an, und das gemeine Gelächter verstummte.
»Schlucke die Kohle. Sie wird dir beim nächsten Mond ein gesundes Kind schenken«, erklärte die Hexe. »Aber du musst wissen, dass du dafür einen weiteren Preis zahlen musst«, fuhr sie leise fort.
Nyra schien die letzten Worte nicht gehört zu haben, zumindest gab sie das vor. Stattdessen legte sie die kleine Kohle in ihren Mund. Sie brannte mit der salzigen Wärme von Leben, als sie durch ihre Speiseröhre rutschte. Sie keuchte vor Überraschung und brach in Freudentränen aus, als sie spürte, wie das Baby plötzlich in ihrem Leib um sich trat.
Zwei Wochen später musste Nyra erneut die Qualen der Geburt ertragen. Sie war am ganzen Körper schweißgebadet. Ein kühles Tuch bedeckte ihre Stirn, aber der Raum war heiß. Die Helferin der Hebamme hatte das Feuer hoch aufgeschichtet, um die Kälte des Winters zu vertreiben, die ohnehin bereits nachließ. Klebriges warmes Blut bedeckte die Innenseiten ihrer Schenkel und sickerte zwischen ihren Beinen hervor. Es hatte die gleiche Farbe wie der Mond am Himmel in diesen letzten drei Nächten.
Der Blutmond, dachte Nyra und atmete hechelnd, als sie sich bemühte, die Kontraktionen zu kontrollieren. Ein schlechtes Vorzeichen.
Plötzlich spürte sie einen Schmerz tief in sich, und sie schrie laut auf.
»Nicht pressen!«, schrie die Hebamme, die zwischen ihren Beinen hockte.
Nyra hörte die Furcht in ihrer Stimme. Sie spürte ihre Hände dort unten; die Hebamme massierte sie und wischte das Blut weg. Nyra wollte Gerrit, wollte seine starken Finger fühlen, mit denen er die ihren hielt, wollte seine geflüsterten, beruhigenden Worte hören. Aber die Frauen hatten ihn irgendwann während der Geburt hinausgeschickt.
Eine der Helferinnen beeilte sich, das Laken auf ihrem Bett zu wechseln. Nyra sah das Entsetzen auf dem Gesicht des jungen Mädchens.
Es ist nicht immer so, wollte Nyra ihr sagen. Es gibt nicht immer so viel Blut, so viel Schmerz. Es ist nicht immer so, nur bei mir. Stattdessen jedoch schrie sie vor Schmerz auf, als sie erneut das Gefühl hatte, von innen zerfetzt zu werden.
»Jetzt!«, schrie die Hebamme. »Pressen, Nyra! Jetzt!«
Und das tat sie, obwohl sie spürte, wie sie in Stücke gerissen wurde. Die Welt löste sich auf, verschwand hinter einem Schleier blendender Qual, und plötzlich begriff sie die letzte Warnung, die ihr die Hexe im Wald gegeben hatte. Jetzt kannte sie den wahren Preis, den die Macht des Chaos von ihr forderte.
Sie hörte den klagenden Schrei ihres Sohnes, die gebrüllten, verzweifelten Befehle der Hebamme, die aufgeregten Helferinnen, die versuchten, die Mutter zu retten, und jetzt endlich weinte Nyra. Sie weinte über das, was sie gesehen, was sie letztendlich begriffen hatte. Sie weinte vor Freude und Leid und vor Entsetzen über den Preis, den sie für das Leben ihres Sohnes zahlen musste. Sie weinte, noch während ihre Welt dunkel wurde und ihr eigenes Leben zwischen ihren Beinen in einer immer stärker anwachsenden Flut von Blut aus ihr herauslief.
2
Das kleine Mädchen hustete einmal und spie einen Klumpen aus Schleim und Blut aus, der ihre Luftröhre verstopft hatte. Es würgte, keuchte, und dann begann es zu weinen. Seine Schreie zerrissen das lastende Schweigen in dem Raum im hinteren Teil des Goldenen Reifs, und Methodis sprach ein kurzes Dankgebet zu den Neuen Göttern, weil das Kind überlebt hatte, im Unterschied zu seiner jungen, unterernährten Mutter. Sie hatte es nicht geschafft.
Das kleine Mädchen war stark, stärker, als Methodis es angesichts der Umstände ihrer Geburt für möglich gehalten hätte. Würde er an solche Dinge glauben, hätte er es ein Wunder genannt, oder eine Tragödie, je nachdem.
Ihre Mutter ist tot, der Vater unbekannt, dachte der Heiler. Sie ist erst wenige Sekunden alt und schon alleine auf der Welt.
Er band die Nabelschnur ab und reichte das Neugeborene der verängstigten Küchenhilfe, die man gezwungen hatte, ihm als Assistentin zu dienen, hier in dem Hinterzimmer des Freudenhauses. Methodis kannte sie ebenso wenig wie die tote Mutter. Es musste eine von Lugers Neuerwerbungen sein.
»Wisch das Kind mit den weichen Tüchern sauber«, erklärte er bedächtig. »Und sei sehr vorsichtig. Dann wickle es in Decken.« Das verstörte Mädchen nickte und nahm das zappelnde, winzige Baby vorsichtig in die Arme. Dann blickte sie auf die Mutter, die in einem Bett lag, das normalerweise für lustvollere Zwecke gedacht war. Hastig wandte sie den Blick von der Leiche mit ihrem zerfetzten, blutigen Unterleib ab.
»Was ist mit Ilana?«, flüsterte das Mädchen bebend.
Methodis schoss der Gedanke durch den Kopf, dass das Mädchen die Mutter vielleicht gut gekannt hatte. Waren sie vielleicht sogar Freundinnen gewesen?
»Du kannst sie mir überlassen. Ich werde sie säubern und für eine ordentliche Beerdigung vorbereiten. Nachdem ich mit Luger geredet habe.«
Methodis machte sich nicht die Mühe, sich selbst zu reinigen, bevor er losging, um mit dem Besitzer dieses Bordells zu sprechen. Er wollte, dass Luger alles sah, das Blut auf seinem Wams, auf seinen Händen und Armen bis hin zu den Ellbogen. So weit hatte er in den Leib der sterbenden Mutter gegriffen, um das Kind herauszuholen. Beim Öffnen der Tür hinterließ er einen roten Handabdruck auf dem Griff.
Luger lehnte, lässig wartend, an der Wand im Gang vor dem Zimmer. Die Pupille seines gesunden Auges weitete sich kurz, ansonsten jedoch zeigte er keine Reaktion auf das gruselige Aussehen des Heilers. Wie immer erinnerten die hässliche Narbe und die leere Augenhöhle auf der linken Seite von Lugers Gesicht Methodis an diese Nacht vor nahezu zwei Jahren. Damals hatte er die Stichverletzung in ebendiesem Flur genäht. Und er hatte sich gehütet, Luger nach dem Schicksal des Gastes zu fragen, der ihm diese Wunde zugefügt hatte.
»Ich habe das Baby schreien hören, weiß also, dass es lebt.« Luger spie ein Stück Kaublatt auf die Bodendielen. »Hätte nicht gedacht, dass das Kleine überlebt. Nicht, wenn es unter dem Blutmond geboren wird.«
Die ganze letzte Woche hatte ein Vollmond von der Farbe frischen Blutes den Himmel über Callastan beherrscht. Es war ein unglaublich seltenes Phänomen, das man seit den Tagen der Säuberung vor zwanzig Jahren nicht mehr gesehen hatte.
Ein altes Sprichwort kam Methodis unwillkürlich in den Sinn. Kinder, die unter dem Blutmond geboren werden, sind vom Chaos gezeichnet. Der Heiler wusste, dass viele Leute dieses kleine Mädchen für verflucht halten würden. Als wenn es nicht schon so genug Probleme hätte.
»Wie geht es Ilana?« Die Frage Lugers unterbrach die Gedanken des Heilers. »Wie hält sie sich?«
Hätte Methodis mit der verängstigten Küchenmagd im Hinterzimmer gesprochen, hätte er seine Worte vorsichtig gewählt, um den Schlag abzumildern. Aber mit dem widerlichen Inhaber dieses Freudenhauses machte er keine Umstände. »Sie ist tot.«
»Tot? Erst lässt dieses dumme Weibsstück sich schwängern, und dann lässt du sie sterben? Weißt du, wie viel sie gekostet hat?«
Luger lehnte nicht mehr länger an der Wand, sondern stand gerade aufgerichtet da. Mit seinen ein Meter fünfundneunzig überragte er den zierlichen Heiler beträchtlich.
»Unter diesen Bedingungen habe ich getan, was ich konnte.« Methodis musste sich zusammenreißen, um ruhig und gelassen zu antworten. Er kannte die Konsequenzen, die es nach sich zog, wenn man Lugers Zorn erregte. Aber er musste an die blauen Flecken und Striemen auf dem Körper der toten Mutter denken, und das machte es ihm schwer, seinen Zorn zu beherrschen. »Ich bin nicht dafür ausgebildet, Kinder im Hinterzimmer eines callastanischen Bordells zur Welt zu bringen.«
»Wofür zum Teufel habe ich dich bezahlt, wenn du nicht einmal imstande warst, sie zu retten? Ich sollte dir das, was sie mich gekostet hat, vom Honorar abziehen!« Luger spie erneut auf den Boden und trat einen Schritt vor. Sein dunkler Schatten fiel über den Heiler. »Bei Gottes Blut, ich sollte dir diesen Besuch sogar in Rechnung stellen! Sie war eines meiner besten Mädchen, bevor sie mit diesem verdammten Kind schwanger wurde!«
»Dann hättest du mich früher holen sollen!«, gab Methodis zurück. Seine Stimme wurde lauter, als sein eigener Zorn zunahm. »Du hast zu lange gewartet. Sie ist verblutet. Dass du ein paar Münzen sparen wolltest, hat sie das Leben gekostet!«
Der Heiler trat trotzig einen Schritt vor und verringerte den Abstand zwischen sich und dem Bordellbesitzer auf wenige Zentimeter.
»Vielleicht«, presste Methodis zwischen den Zähnen hervor, »wäre es besser gewesen, du hättest die schwangere Frau nicht geschlagen, Mistkerl!«
Luger bewegte sich so schnell, dass der kleinere Heiler nicht einmal reagieren konnte. Er riss Methodis vom Boden hoch und presste ihn an die Wand, so fest, dass ihm die Luft wegblieb. Dann schob er sein Gesicht so dicht an das des Heilers, dass der seinen stinkenden Atem riechen und in sein gesundes Auge sehen konnte.
»Niemand redet in meinem Haus so mit mir, kleiner Mann.«
Er hielt den Heiler noch ein paar Sekunden an die Wand gepresst, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, dann ließ er ihn los und trat einen Schritt zurück. Methodis sank auf ein Knie und rang nach Luft. Es dauerte ein paar Sekunden, bis er wieder aufrecht stehen konnte.
»Du sagtest, das Baby wird leben?« Luger sprach so gelassen weiter, als plauderten die beiden Männer auf dem Markt. Luger war sehr jähzornig, vergaß andererseits auch genauso schnell seinen Zorn, sagte man von ihm.
»Das Kind wird leben, obwohl das nicht mein Verdienst ist. Es ist ein kleines Mädchen. Es ist ein paar Wochen zu früh gekommen, so wie es aussieht. Aber es ist eine Kämpferin. Mach dir keine Sorgen, ich werde mich um das Kind kümmern.«
»Du?«, erkundigte Luger sich ungläubig. »Warum solltest du das Kind nehmen? Ich habe eine Amme, die es stillen kann, und ein Dutzend Mädchen, die sich darum kümmern können.«
Dieses Angebot überrumpelte Methodis. »Du … Du willst dieses Kind großziehen? Aber warum?«
»Weil es mir gehört, verdammt!«
Methodis war erstaunt. Der Besitzer eines Freudenhauses schlief nicht mit seinen Mädchen. Das machte man einfach nicht. Nicht nur aus geschäftlichen Gründen, sondern weil es als Zeichen von Schwäche galt. Luger hatte sich seinen rücksichtslosen Ruf redlich verdient und war allgemein für seine Gewissenlosigkeit bekannt. Allein die Vorstellung, dass er mit einem seiner Mädchen zusammen gewesen sein sollte, war nahezu grotesk.
»Bist du etwa der Vater?«, murmelte Methodis verwirrt. Er versuchte immer noch, Lugers Beweggründe zu begreifen.
Der Bordellbesitzer schnaubte verächtlich.
»Ich bin nicht der Vater, Blödmann! Ich lasse mich nicht von meinem Schwanz herumkommandieren. Wenn ich meinen eigenen Huren Kinder mache, kann wohl nichts Gutes dabei herauskommen! Aber ich habe die Mutter gekauft, also gehört das Kind mir. Es ist mein Eigentum.«
Jetzt war Methodis alles klar. Luger war dasselbe widerliche, ekelhafte Geschöpf wie immer. Im tiefsten Inneren war er einfach nur ein Geschäftsmann, der versuchte, seine Unkosten wieder hereinzuholen. Für ihn war dieses kleine Mädchen eine Investition in die Zukunft. Er hatte die Mutter, Ilana, eines seiner besten Mädchen genannt. Zweifellos vermutete er, dass ihre Tochter ihr an Schönheit gleichkommen würde. Und dann konnte sie schon bald in den Hinterzimmern des Bordells ebenso viel verdienen wie ihre Mutter. Sogar mehr, falls Luger tatsächlich so verkommen war, dass er sie verkaufte, bevor sie auch nur halbwegs zur Frau herangereift war.
Aber trotz aller Sünden und Laster, die man in der Hafenstadt Callastan für Geld bekommen konnte, war Sklaverei nach wie vor nicht legal. Methodis erinnerte sich an die ersten mühsamen, aber erfolgreichen Atemzüge des kleinen Wesens außerhalb des Mutterleibes und traf eine überstürzte Entscheidung.
»Die Leiche der Mutter muss weggeschafft und bestattet werden. Die Stadtbüttel werden Fragen stellen, was mit ihr passiert ist.«
Luger zuckte mit den Schultern. »Eine schwere Geburt unter einem verfluchten Mond«, sagte er als Erklärung. »Wenn sie mir das nicht abkaufen, dann stecke ich ihnen ein paar Münzen zu, damit sie ein Auge zudrücken. In diesem Viertel gibt es jede Menge tote Huren.«
»Sie werden auch nach dem Kind fragen«, setzte Methodis nach. »Was mit ihm passiert ist, wer sich darum kümmert. Und möglicherweise sind sie neugierig, warum ein Mann, der nicht der Vater ist, einen Besitzanspruch auf das Mädchen erhebt. Willst du ihnen wirklich sagen, dass du Ilana gekauft hast?«
Mit einer geschmeidigen Bewegung hielt Luger plötzlich ein Messer in der Hand. Er rieb sich mit der flachen Seite der Klinge über das Kinn, als würde er nachdenken.
»Willst du mir vielleicht drohen, Methodis? Hältst du dich wirklich für so unersetzlich für die Menschen in diesem Viertel, dass ich dich nicht auf der Stelle umbringen könnte?«
Der Heiler wog seine nächsten Worte sehr sorgfältig ab.
»Es ist schwer, einen Heiler zu finden, der bereit ist, in einem Bezirk zu arbeiten, der so nah am Hafen liegt wie dieser hier. Bevor du mich tötest, solltest du lieber einen Ersatzmann für mich parat haben. Du bist nicht der Einzige, der meine Dienste regelmäßig benötigt. Die anderen Tavernenbesitzer im Bezirk könnten vielleicht sehr wütend auf dich werden.«
»Ihre Wut kann mit Silber besänftigt werden«, erwiderte Luger. In seinem Auge schimmerte ein gefährlicher Funke.
»Und all das für ein Mädchen?«, erwiderte Methodis. »Denk an die Zeit und die Kosten, die es verschlingen wird, es großzuziehen. Ist es das wirklich wert? Klingt nicht unbedingt nach einem guten Geschäft.«
Der Hauch eines Zweifels zuckte über Lugers Gesicht, obwohl er weiterhin mit dem Messer bedrohlich über sein unrasiertes Kinn schabte.
»Und wie wird das erst hier im Bezirk wirken?« Methodis spielte seine letzte Karte aus. »Du behauptest zwar, dass du nicht der Vater bist, aber trotzdem scheinst du merkwürdig besessen von diesem Kind zu sein. Wenn du es bei dir behältst, wird das Fragen aufwerfen. Und es wird Gerüchte geben, dass Luger seine Hände nicht von seinen Mädchen lassen kann.«
Luger knurrte und warf sein Messer so, dass es unmittelbar vor den Füßen des Heilers landete. »Ich schlafe nicht mit meinen eigenen Huren!«
Methodis blickte auf die Klinge, die fast drei Zentimeter tief in den Holzdielen steckte und immer noch vibrierte.
Dann sah er in Lugers wütend glühendes Auge. »Ich werde die Leiche der Mutter wegschaffen und beerdigen. Und wenn ich gehe, nehme ich das Kind mit.«
»Du kannst dieses kleine Miststück haben!«, zischte Luger, drehte sich um und stürmte wütend durch den Korridor davon.
Der Heiler atmete erleichtert auf, bevor er wieder in das Hinterzimmer zurückkehrte. Überrascht stellte er fest, dass das kleine Kind aufgehört hatte zu weinen. Die Küchenmagd wiegte das Baby sanft in den Armen und kehrte der Leiche im Bett wohlweislich den Rücken zu.
»Du schaffst sie von alldem hier weg?«, fragte das Mädchen, als er hereinkam. »Das Baby, meine ich? Bringst du es in Sicherheit?«
»Du kannst das Kind noch eine Weile halten«, erwiderte Methodis sanft. »Ich muss erst die Mutter säubern.«
»Sie kam von den Wester-Inseln«, flüsterte das Mädchen. »Ihr Name war Ilana. Sie hat mir gesagt, das bedeutete glücklich.«
Methodis nickte. Er hatte die nussbraune Hautfarbe und die mandelförmigen Augen der Mutter bemerkt, als er gekommen war, um bei der Geburt zu helfen.
Schweigend reinigte er die Tote und wickelte sie dann in ein Leichentuch, damit die Behörden sie wegschaffen konnten. Dann zog er seinen blutgetränkten Kittel aus und säuberte Hände und Arme im Becken.
Das Mädchen saß in einer Ecke und wiegte immer noch das Baby. Der Heiler legte ihm eine Hand auf die Schulter, und die junge Frau drehte sich zu ihm herum. Nach unmerklichem Zögern reichte sie ihm das Baby.
»Hast du … Hast du schon einen Namen für sie?«
»Sciithe«, antwortete der Arzt nach kurzer Überlegung. »Das bedeutet in der Alten Zunge Courage.«
Die Küchenmagd lächelte schwach, obwohl Tränen in ihren Augen schimmerten.
»Sie hatte Mut, so viel ist sicher. Leb wohl, du tapferes kleines Schätzchen.« Sie versuchte, den fremdartigen Namen richtig auszusprechen, aber es gelang ihr nicht ganz. »Leb wohl, Scythe.«
Methodis brachte es nicht über sich, sie zu verbessern.
3
Roland saß nervös auf einem stabilen Holzstuhl, den er bei seiner massigen Gestalt auch brauchte, vor Mistress Wyndhams Privatgemächern. Von Zeit zu Zeit veränderte er seine Position, indem er sich vorbeugte, seine schwieligen Hände in hilfloser Frustration verschränkte und zu Fäusten ballte.
Seit nahezu zehn Jahren arbeitete er jetzt für Conrad Wyndham. Anfangs war er wegen seines Schwertes eingestellt worden. Er war ein ehemaliger Soldat, der als zusätzliche Bewachung für die Händlerkarawanen auf den langen Reisen in fremde Länder dienen sollte. Mit der Zeit jedoch hatte der Kaufmann Roland weit größere Verantwortung übertragen. Zum Beispiel die Aufsicht über die Bediensteten des Herrenhauses und der Stallungen sowie die Sorge für die Sicherheit des Heimes und der Familie seines Herrn während dessen langer Geschäftsreisen.
Aber gegen das hier konnte Roland nichts unternehmen. Geburten waren Sache der Frauen, und nachdem er einen Diener losgeschickt hatte, der die Hebamme holen sollte, konnte er nicht viel mehr tun, als zu warten und sich Sorgen zu machen.
Die rote Scheibe, die in dieser Nacht am Himmel hing, verstärkte seine Furcht. Er war von Natur aus kein abergläubiger Mann, aber als er hier hilflos herumsaß, erinnerte er sich unwillkürlich an all die alten Weibergeschichten, die er im Laufe der Jahre gehört hatte. Der Blutmond ist ein Vorbote dunkler Zeiten. Vertrocknetes Getreide. Zweiköpfige Kälber. Seuchen und Pestilenz. Tot geborene Kinder.
Vor einer Stunde hatte er Mistress Wyndhams Schmerzensschreie aus ihrem Schlafgemach gehört. Bei jedem Schrei hatten sich seine Muskeln unwillkürlich zusammengezogen, und seine Hand hatte nach dem Kurzschwert an seiner Taille greifen wollen. Er hatte gedacht, dass es nichts Schlimmeres geben könnte, als diese Schreie zu ertragen, aber er hatte sich geirrt.
Die Hebamme musste Mistress Wyndham etwas gegen die Schmerzen gegeben haben, denn die Schreie waren bis auf ein leises Stöhnen abgeklungen, bis sie schließlich vollkommen aufhörten. In dem folgenden Schweigen war Roland fast verrückt geworden. Er hatte sich entsetzliche Bilder ausgemalt von dem, was dort passiert sein konnte. Etliche Male war er aufgestanden und zur Tür marschiert, fest entschlossen, in den Raum zu stürmen, damit er endlich wusste, was dort geschah. Jedes Mal hatte er innegehalten und war zu seinem Stuhl zurückgekehrt. Ihm war klar geworden, dass seine Einmischung die Arbeit der Hebamme nur erschweren würde.
Als die Tür sich schließlich öffnete und die Hebamme auftauchte, sprang Roland besorgt hoch. Die Hebamme war eine stämmige Frau mittleren Alters. Sie wirkte eher unscheinbar und machte stets einen sehr ernsthaften Eindruck. Im Dorf sagte man, dass sie während ihrer Laufbahn mehr als hundert Kinder zur Welt gebracht hätte. Roland sah, dass ihre Schürze blutbefleckt war, und der ernste Ausdruck auf ihrem Gesicht bestätigte seine schlimmsten Befürchtungen.
»Es tut mir leid«, sagte die Hebamme leise. »Das Mädchen war zu schwach. Es ist gestorben.«
Roland ließ sich schwer auf den Stuhl fallen, beugte sich vor und nahm den Kopf zwischen die Hände. Sir Wyndham würde morgen Abend zurückkehren. Wie konnte Roland ihm sagen, dass seine Tochter tot war?
Er holte tief Luft, schüttelte den Kopf und riss sich zusammen, sodass er zumindest gerade sitzen konnte. »Und was ist mit Mistress Wyndham?« Seine Stimme klang belegt vor Trauer.
»Ich habe ihr etwas gegen die Schmerzen gegeben. Sie schläft jetzt, aber sie wird leben«, erwiderte die Hebamme brüsk, während sie ihre blutbefleckte Schürze abnahm und sie in einen dicken Lederbeutel stopfte, den sie bei ihrer Ankunft neben die Schlafzimmertür gestellt hatte. »Aber sie wird nie wieder gebären können. Die Krankheit, die ihr das Kind genommen hat, hat sie auch unfruchtbar gemacht.«
»Der Blutmond«, flüsterte Roland. Er hatte nicht einmal gemerkt, dass er laut sprach. Aber trotzdem hatte die Hebamme ihn gehört.
»Schiebt es nicht auf Flüche und Magie«, antwortete sie müde. »Sondern gebt dem Fieber die Schuld.«
Roland nickte, wütend über seine eigene Dummheit, und akzeptierte ihre Erklärung als die vernünftigere. Celia Wyndham war nicht die erste Frau aus dem Dorf, die in diesem Monat ihr Kind verlor. Nicht seit dem Ausbruch der Seuche, die sich bis in ihre Provinz ausgebreitet hatte. Trotzdem hatte diese Tragödie Roland unvorbereitet getroffen. Er hatte insgeheim gehofft, dass sie hier im Herrenhaus von der Krankheit verschont bleiben würden, so als würden Krankheit und Tod irgendwie Rücksicht nehmen auf Rang und Namen.
Er sah schweigend zu, wie die Hebamme den Beutel aufhob und wieder in das Schlafgemach ging. Sie bewegte sich mit der Routine langjähriger Erfahrung. Er sah durch die halb geöffnete Tür, wie sie die Salben, Tränke und Cremes einpackte, die sie mitgebracht hatte. Es bedeutete Unglück, wenn ein Mann Geburtsmedizin berührte, also machte Roland keine Anstalten, ihr zu helfen, während sie die Phiolen und Tiegel einsammelte. Sie wickelte jedes Gefäß einzeln in ein Tuch, bevor sie es in dem Beutel verstaute.
»Was hat Mistress Wyndham gesagt?«, rief Roland schließlich. Sein Pflichtgefühl veranlasste ihn, nicht mehr an den tragischen Tod der Tochter seines Lehnsherrn zu denken, sondern an das Wohlergehen von dessen Gemahlin. »Wie war ihre Reaktion, als … als du es ihr gesagt hast?«
»Sie weiß es noch nicht«, antwortete die Hebamme zerstreut. Sie konzentrierte sich darauf, nichts von ihrer Medizin zurückzulassen. »Der Schmerz war zu groß. Sie hat mich gebeten, ihr etwas zu verabreichen, damit sie während der Geburt schlafen kann. Sie wird nicht vor morgen früh aufwachen.«
»War es denn eine so schwere Geburt?« Roland runzelte die Stirn.
»Nicht schwerer als normal«, gab sie zurück, während sie aus dem Raum trat und ihren Beutel mit einem leisen Stöhnen auf dem Boden absetzte. In ihrem anderen Arm hatte sie ein kleines Bündel aus sauberen weißen Decken. »Einige Frauen sind stark und können den Schmerz ertragen. Andere dagegen …« Sie ließ den Satz unvollendet und zuckte mit den Schultern.
Celia Wyndham war jähzornig und ließ das oft an ihren Bediensteten aus, aber trotzdem würde niemand sie für eine starke Frau halten. Ihr ganzes Leben lang hatte man sie vor der harten Realität der Welt beschützt. Aber es bekümmerte Roland, dass sie nicht einmal für die Geburt ihres ersten Kindes hatte wach sein wollen.
Er erhob sich, als die Hebamme den Raum durchquerte und ihm das Bündel hinhielt. Es war das in weiche Decken eingewickelte Kind.
»Es könnte sein, dass sie ihr Kind sehen will, wenn sie aufwacht«, erklärte die Hebamme.
Roland bemerkte, als er das Bündel entgegennahm, dass das kleine Mädchen gesäubert worden war. Aber sein Gesicht war aschfahl. Ganz offensichtlich war es tot. Als er auf den Leichnam des Kindes starrte, fühlte er sich gezwungen, eine weitere Frage zu stellen. Eine, die zu stellen er kein Recht hatte.
»Ich habe gehört, dass die Geburt schwieriger ist, wenn die Mutter nicht helfen kann«, sagte er. Er wählte seine Worte sehr vorsichtig.
Die Hebamme nickte, drehte sich um und ging wieder zu ihrem Beutel, um den Inhalt ein letztes Mal zu überprüfen.
»Manchmal kann die Mutter pressen oder halten, bis ich bereit bin«, gab sie zu.
Nachdem sie sich davon überzeugt hatte, dass alles sicher verpackt war, verschloss sie den Beutel und schwang ihn sich über ihre fleischige Schulter.
»Manchmal macht das einen entscheidenden Unterschied.«
»Aber Mistress Wyndham wollte schlafen«, presste Roland zwischen den Zähnen hervor. »Eine Mutter sollte für ihr Kind kämpfen!«, setzte er dann hinzu.
Die Hebamme zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Manchmal spielt es auch keine Rolle. Ich habe erlebt, wie die Krankheit seit dem letzten Mond vier Kinder das Leben gekostet hat. Zwei Mütter sind dabei ebenfalls gestorben. Wäre die Mistress wach geblieben, um die Geburt durchzustehen, wäre sie jetzt vielleicht ebenfalls tot. Und das hätte das Kind möglicherweise auch nicht retten können.«
Irgendwie störte das Roland noch mehr. »Also ist alles nur Zufall? Eine Laune der Götter?«
»Leben und Tod sind eng miteinander verwoben«, antwortete die Hebamme sachlich. Dann seufzte sie, müde von der langen, anstrengenden Nacht und überdrüssig der Fragen, auf die es keine echte Antwort gab.
»Die Krankheit nimmt die einen und verschont die anderen. Es gibt dafür keine logische Erklärung. Vor vier Nächten hat das Fieber den Gehilfen des Schmieds dahingerafft, einen kräftigen, gesunden Burschen.«
Roland kannte den Gehilfen des Schmieds und wusste, dass sie die Wahrheit sagte. Aber die Weisheit der Hebamme konnte ihn nicht trösten, während er das kalte, bleiche Kind an seine Brust drückte.
»Die Frau des Burschen ist ebenfalls schwanger«, murmelte er. Er erinnerte sich an die Tratschgeschichten, die er von einem der Zimmermädchen gehört hatte.
»Das ist der grausamste Scherz von allen«, erwiderte die Hebamme. Sie trat von einem Fuß auf den anderen, während sie das Gewicht des Beutels auf ihren Schultern verlagerte. Es war offensichtlich, dass sie endlich aufbrechen wollte, aber sie hatte nicht vor, Roland zu beleidigen, indem sie ohne einen angemessenen Abschied ging. »Vor zwei Nächten hat die Witwe eine Tochter geboren. Doch dann hat das Fieber sie ebenfalls dahingerafft.«
Roland schüttelte den Kopf. Er war wie betäubt angesichts der endlosen Liste von Leid und Elend. »Noch ein totes Kind.«
»Nicht das Kind«, widersprach die Hebamme. Eine Spur von Gereiztheit schlich sich in ihre Stimme. »Die Mutter. Die Mutter ist gestorben, das Kind hat überlebt.« Sie schnalzte mit der Zunge. »Das Schicksal kann sehr grausam sein. Nicht einmal einen Tag alt und schon eine Waise. Die meisten würden behaupten, dass das Kind verflucht ist«, setzte sie leise hinzu. »Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt jemanden gefunden habe, der das Kind aufnehmen wollte.«
Roland stand vollkommen durchnässt vor der Tür der kleinen strohgedeckten Hütte. Die Hütte lag am äußersten Rand der Stadt, und der mitternächtliche Regen prasselte in einem dichten Schleier vom Himmel. Trotzdem zögerte Roland, bevor er an die Tür klopfte. Es war nicht die späte Stunde, die ihn innehalten ließ. Er vermutete, dass die Frau in der Hütte noch wach war. Sie war ein Geschöpf der Nacht.
Es war sein eigener Zweifel, der ihn zaudern ließ. Sein Plan war Wahnsinn, aber er konnte den Gedanken nicht ertragen, Sir Wyndham sagen zu müssen, dass sein Kind tot war. Er nahm alle Entschlossenheit zusammen, hob die Faust und klopfte hart an die Tür. Eine Minute später schwang sie auf. Die kleine dürre Gestalt von Bella tauchte in dem Rahmen auf. Sie war die Dorfhexe.
»Wer kommt hier mitten in der Nacht an meine Tür?«, flüsterte sie heiser. Sie hatte die eisblauen Augen zusammengekniffen, um den Besucher in der Dunkelheit und dem Regen erkennen zu können.
Roland kannte sie hauptsächlich aufgrund ihres Rufes. Bella verließ ihr Haus tagsüber nur selten, und da er im Herrenhaus lebte, hatte er bisher noch nie Grund oder auch nur Gelegenheit gehabt, sie um Hilfe zu ersuchen. Er hatte sie ein- oder zweimal auf der Straße gesehen, aber nie aus der Nähe. Es überraschte ihn, wie klein sie ohne ihren Kapuzenmantel und ihren Gehstock wirkte; sie war kaum größer als einen Meter fünfzig.
Etliche Leute aus der Stadt nannten sie die Weiße Hexe, und es war nicht schwer nachzuvollziehen, warum. Sie hatte langes silbergraues Haar, und ihre Haut war so bleich, dass sie aussah, als wäre sie aus Alabaster. Ihre schlichten Gesichtszüge zeigten nur wenige Falten, und diese Linien schienen ihr eher einen Anflug von Weisheit zu verleihen, als von ihrem Alter zu künden. Sie wirkte wie Anfang fünfzig, aber wenn die Geschichten stimmten, musste sie mindestens zwei Jahrzehnte älter sein.
Sie trug ein Neugeborenes in den Armen, ein Mädchen mit rosiger Haut, das sie mit einem sehnigen Arm fest an ihren weißen Busen drückte. Das Baby war nackt, und Bella trug nur eine durchscheinende Tunika, die oben geöffnet war und ihre Brüste entblößte. Das kleine Mädchen im Arm der Hexe saugte hungrig an ihrer Brust.
Roland wollte sich nicht einmal vorstellen, welche bösartigen Künste dazu führten, dass aus der Brust der Hexe Milch floss. Er unterdrückte einen Schauder, als er das Geräusch des nuckelnden Babys hörte, und hob seinen Blick, um Bella anzusehen. »Ich arbeite für Sir Wyndham«, sagte er ruhig.
Bella spitzte die Lippen, und ihre kalten Augen verengten sich zu Schlitzen. »Mistress Wyndham, meinst du wohl.« Sie gab sich keine Mühe, ihre Verachtung für Conrads übermäßig fromme Gemahlin zu verbergen. »Es ist zu spät. Ihr Kind ist tot, und ich kann nichts tun, um es zurückzubringen.«
Sie versuchte, ihm die Tür vor der Nase zuzuschlagen, aber Roland war schneller. Er stellte den Fuß dazwischen, stieß die Tür auf und trat in das Haus.
»Woher weißt du das?«, wollte er wissen. »Die Hebamme hat das Kind erst vor einer Stunde zur Welt gebracht!«
Roland war ein sehr großer Mann mit einer breiten Brust und mächtigen Schultern. Er überragte Bella um einiges. Aber die winzige silberhaarige Frau sah unerschrocken zu ihm hoch, bevor sie sich abwendete und gleichgültig die Tür freigab.
Sie ging zu einer kleinen Wiege in der Ecke, während sie über die Schulter zu ihm zurückblickte. »Ich sehe Dinge«, flüsterte sie bedrohlich. »Ich weiß Dinge. Ich habe Macht.«
»Dann weißt du auch, warum ich hier bin.« Roland ignorierte die Drohung in ihrer Stimme.
Er folgte ihr ins Haus und schloss die Tür hinter sich. Das Haus bestand nur aus einem Raum, der von einer einsamen Kerze erhellt wurde, die auf einem Mauervorsprung in der Nähe der Wiege stand. Dadurch wirkte die kleine Hütte heimelig, wenn auch der größte Teil des Raumes im Schatten lag. Er konnte kaum die Regale an den Wänden sehen, auf denen dicht gedrängt zahlreiche Gläser standen. In einer Ecke stand ein kleiner Tisch, auf dem ein Durcheinander von Flaschen und Phiolen zu sehen war. Darin schwammen irgendwelche Dinge in einer durchsichtigen Flüssigkeit. Wegen des dämmrigen Lichtes war er nicht in der Lage, Einzelheiten zu erkennen, um sie zu identifizieren, was er auch nicht wirklich wollte.
»Ich weiß nicht, warum du hier bist«, gab Bella zu. Sie sprach leise, während sie das Baby in die Krippe legte und es in eine schmutzige Decke wickelte.
Sie band ihre Tunika zu, bevor sie sich zu Roland herumdrehte, sehr zu seiner Erleichterung.
»Die Dinge, die ich sehe, sind nicht immer klar«, erklärte sie. »Nur der Tod ist immer sehr einfach zu verstehen.«
»Du wusstest, dass Mistress Wyndhams Kind sterben würde?«
Bella nickte ein Mal.
»Warum hast du es keinem erzählt?«
»Hätte sie denn auf mich gehört?«, gab sie zurück.
»Es scheint dich nicht sonderlich zu bestürzen, dass ein Neugeborenes gestorben ist«, bemerkte Roland. Er war zwar wütend, aber er sprach leise, um das Kind nicht zu stören.
»Damit hatte ich nichts zu tun!«, fuhr sie ihn an. Auch sie sprach leise. »Diese Provinz wird von einer Seuche heimgesucht, die die Kinder sterben lässt!«
Ihre Reaktion war verständlich. Bella wurde in der Stadt respektiert, aber auch gefürchtet, selbst von jenen, denen sie mit ihren geheimnisvollen Kräften half. Celia Wyndham war eine bekannte Unterstützerin des Ordens und machte aus ihrer Abneigung gegen Bella und ihresgleichen keinen Hehl. Es war nicht gänzlich auszuschließen, dass sie versuchen würde, den Tod ihres Kindes der Hexe anzulasten. Falls Mistress Wyndham herausfand, dass ihr Kind gestorben war.
»Ich weiß, wie du an dieses Kind gekommen bist«, sagte Roland. Er nickte in Richtung Wiege und kam zur Sache.
»Na und?« Bella klang, als müsste sie sich verteidigen. »Ich habe angeboten, das Kind großzuziehen und es mein Handwerk zu lehren.«
»Warum?«, erkundigte sich Roland. »Das Kind ist verflucht. Es wurde unter dem Blutmond geboren.«
Bella schnaubte verächtlich. »Verflucht? Dieses Wort benutzen die Furchtsamen und Unwissenden! Das Kind ist gesegnet. Es ist stark!«
»Es hat die Gabe?«, spekulierte Roland. Jetzt ergab das alles einen Sinn.
Die Hexe weigerte sich, seine Frage zu beantworten. »Wer sonst hätte das Kind aufgenommen?«, sagte sie stattdessen. »Wäre es besser gewesen, es als Waise sterben zu lassen?«
»Der Orden hätte es aufgenommen.«
Bella grinste ihn an und zeigte ihm schimmernde, viel zu perfekte Zähne. Aber es war ein freudloses Lächeln, ein Ausdruck, der ihn verspotten sollte.
»Du weißt, was der Orden Kindern antut, die die Gabe haben?«, fragte sie ihn, um ihn zu ködern. »Sie nehmen ihnen die Augen!«
In gewisser Weise stimmte das. Die blinden Mönche des Ordens waren in den Südlanden ein verbreiteter Anblick. Und dennoch war es eine Lüge. Denn diese Mönche waren mit einer magischen Sicht gesegnet, durch welche sie die Welt um sich herum einwandfrei wahrnehmen konnten. Jeder wusste, dass sie nicht wirklich blind waren.
»Und was wirst du diesem Kind nehmen?« Rolands Stimme wurde etwas lauter.
Er wusste nur wenig über das Wirken des Chaos und der Magie, aber er fürchtete, dass dieses Kind möglicherweise bei einem der dunklen Rituale benutzt werden könnte. Vielleicht sogar, um dieser alterslosen Frau zu helfen, die Jahre noch ein wenig länger in Schach zu halten.
»Ich will diesem Kind nichts Böses«, erwiderte Bella, als würde sie seine Gedanken wittern. »Es hat Macht, Potenzial. Aber dieses Potenzial wird sich niemals entwickeln können, wenn es dem Orden ausgeliefert wird.«
»Ich will das Mädchen nicht dem Orden übergeben«, versicherte ihr Roland.
»Dieses Kind gehört mir«, beharrte Bella ein letztes Mal. »Niemand wollte es. Ich habe es aufgenommen. Ich werde es nicht einfach Miss Hochnäsig übergeben!« Sie machte eine lange Pause. »Zumindest nicht ohne eine gewisse … Entschädigung.«
Als Roland in das Herrenhaus zurückkehrte, hatte es aufgehört zu regnen, und das erste Morgengrauen dämmerte bereits am Horizont. Es tauchte den immer noch sichtbaren roten Mond in ein unheimliches Orange. Mistress Wyndham schlief noch, als er in ihr Zimmer trat. Die Amme, die dort auf ihn wartete, war eine stämmige, einfache junge Frau von einem der umliegenden Höfe. Sie hatte erst vor einer Woche ihr eigenes Kind zur Welt gebracht.