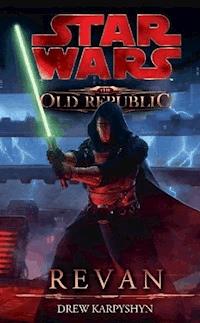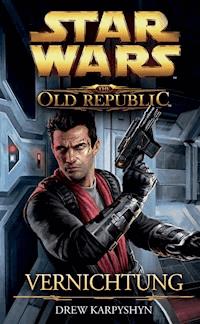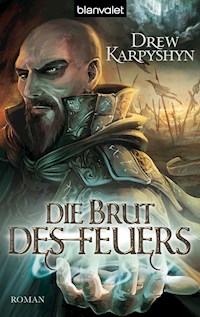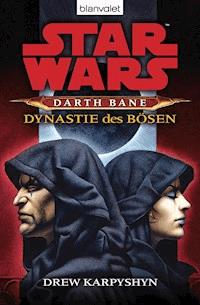8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kinder des Chaos
- Sprache: Deutsch
Der grandiose Abschluss der opulenten High-Fantasy-Trilogie.
Ein junger Magier voller Selbstzweifel. Eine Seherin, die ihre eigene Zukunft fürchtet. Eine Kriegerin, deren einzige Schwäche ihr gebrochenes Herz ist. Und ein König, der sein Reich verloren hat. Sie alle sind Kinder des dunklen Gottes Daemron, der die Welt ins Chaos zu stürzen droht. Doch die vier Geschwister haben eine Waffe gegen ihn: Einzig vier uralte Talismane können ihren dämonischen Erzeuger aufhalten – wenn sie sich in den richtigen Händen befinden. Im Kampf um Callastan wird sich entscheiden, wer siegen wird: die Brut des Feuers über den Vater – oder das Dämonische in seinen Kindern?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Ein junger Magier voller Selbstzweifel. Eine Seherin, die ihre eigene Zukunft fürchtet. Eine Kriegerin, deren einzige Schwäche ihr gebrochenes Herz ist. Und ein König, der sein Reich verloren hat. Sie alle sind Kinder des dunklen Gottes Daemron, der die Welt ins Chaos zu stürzen droht. Doch die vier Geschwister haben eine Waffe gegen ihn: Einzig vier uralte Talismane können ihren dämonischen Erzeuger aufhalten – wenn sie sich in den richtigen Händen befinden. Im Kampf um Callastan wird sich entscheiden, wer siegen wird: die Brut des Feuers über den Vater – oder das Dämonische in seinen Kindern?
Autor
Drew Karpyshyn ist der New-York-Times-Bestsellerautor des Star-Wars-Universums und fraglos auch der erfolgreichste. Vor allem durch seine Darth-Bane-Romane schuf er sich eine große Fangemeinde. Er arbeitet zudem als Videospiel-Entwickler. Nachdem er den Großteil seines Lebens in Kanada verbracht hat, hatte er irgendwann genug von den langen kalten Wintern dort und zog nach Süden. Drew Karpyshyn lebt heute mit seiner Frau in Texas.
Bei Blanvalet sind von Drew Karpyshyn bereits erschienen:
Star Wars™ Darth Bane 1. Schöpfer der Dunkelheit
Star Wars™ Darth Bane 2. Die Regel der Zwei
Star Wars™ Darth Bane 3. Dynastie des Bösen
Die Brut des Feuers
Die Dunkle Flamme
Die Nacht des Dämons
Drew Karpyshyn
Die Nacht des Dämons
Roman
Aus dem Amerikanischen von Wolfgang Thon
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Chaos Unleashed« bei Del Rey / Random House, Inc., New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung März 2018 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © 2015 by Drew Karpyshyn
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 by Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Umschlaggestaltung: Inkcraft unter Verwendung einer Illustration von Andrey Vasilchenko
Redaktion: Rainer Michael Rahn
Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN 978-3-641-21812-6V001www.blanvalet.de
Für meinen Vater Ron, einen wundervollen und höchst erstaunlichen Mann. Obwohl er uns viel zu früh genommen wurde, lebt er in der gemeinsamen Erinnerung und der Liebe seiner Freunde und Familie weiter.
Prolog
Auf den sandigen Gestaden einer Insel am äußersten Rand des Meeres, das die Welt der Sterblichen begrenzt, stehen vier göttliche schimmernde Gestalten in einem engen Kreis rings um einen Obelisken aus schwarzem Obsidian – dem Schlüsselstein. Er erhebt sich mehr als fünfzehn Meter hoch über sie und misst auf jeder Seite mehr als zehn Fuß. In den glatten dunklen Fels sind mächtige Runen gemeißelt, und unter der Oberfläche schimmern Gestalten und Schatten: die lebendige, wogende Macht des ungebändigten Chaos.
Verborgen in seiner Unterwelt, weit jenseits des Meeres des Chaos, beobachtet Daemron der Schlächter die vier Gestalten sehr aufmerksam. Ihre Abbilder werden in dem regungslosen Wasser eines steinernen, mit Blutflecken überzogenen Brunnens reflektiert.
Er ist geschlagen, aber nicht gebrochen. Die Armeen der Alten Götter haben ihn auf dem Schlachtfeld bezwungen, aber es ist ein tönerner Sieg. Denn er lebt immer noch, so wie Legionen seiner Anhänger. Die Alten Götter sind an die Welt der Sterblichen gebunden, die sie erschaffen haben, und konnten ihm hierhin nicht folgen. Deshalb begnügt er sich abzuwarten, in Sicherheit außerhalb ihrer Reichweite, während er seinen Gegenangriff plant. Seine Armeen ruhen sich aus und sammeln Kraft, während er selbst seine machtvolle Magie benutzt, um seine Feinde auszuspionieren.
Als er jetzt über den unendlichen Abgrund aus Raum und Zeit hinwegblickt, erschienen ihm diese vier Gestalten kaum mehr als verschwommene Silhouetten aus goldenem Licht. Aber selbst auf diese Entfernung hin kann er spüren, dass die Macht der Alten Götter schwächer geworden ist. Sie sind verletzt und liegen im Sterben. Es erfüllt ihn mit Stolz, dass selbst Unsterbliche einen so hohen Tribut dafür hatten zahlen müssen, ihn zurückzuschlagen. Hätte er mehr riskiert, wäre er länger an der Front des Kampfes geblieben, hätte er vielleicht die Schlacht zu seinen Gunsten wenden können. Aber zu welchem Preis? Sein Rückzug hat sichergestellt, dass er auch dann noch existieren wird, wenn die anderen Unsterblichen längst vergangen sind. Ihr Ende ist unausweichlich, ebenso wie seine triumphale Rückkehr.
Trotzdem, das Ritual, dessen er gerade Zeuge wird, gibt ihm zu denken. Neugierig und sehr aufmerksam beobachtet er, wie die schimmernden Gestalten ihre Arme ausstrecken und sich in einem Kreis rund um den Schlüsselstein an den Händen fassen. Dabei erheben sie ihre Stimmen zu einem Chor. Bei ihrem tiefen, rhythmischen Gesang beginnt der Monolith zu zittern. Ein paar Sekunden später hüllt ein weißer sanfter Schimmer ihn ein, der tief aus dem Inneren des schwarzen Obelisken selbst zu kommen scheint.
Die Tonhöhe ihres Gesangs verändert sich, wird höher, scheint das anschwellende Chaos zu kontrollieren und umzuformen. Der Schimmer, der von dem Schlüsselstein ausgeht, beginnt zu summen und zu pulsieren und schlägt dabei wie ein lebendiges Herz, als er immer heller wird.
Die Götter heben die Arme, mit verschränkten Händen, und ein Strahl aus reinem weißen Licht zuckt in den Himmel empor. Er steigt höher und höher, wird immer breiter und strahlender, und seine Intensität brennt in Daemrons Augen. Und dann, gerade als er den Blick abwenden will, bricht der weiße Strahl, teilt sich in kleinere Strahlen, die alle Farben des Spektrums widerspiegeln.
Der rituelle Gesang der Alten Götter wird noch höher, und dann so schrill, dass es Daemron kalt über den Rücken läuft. Die bunten Strahlen winden sich und tanzen, als wären sie lebendig, dann schießen sie in alle Richtungen davon. Sie kreuzen sich unaufhörlich, während sie den Himmel bunt färben. Innerhalb von Sekunden wird der ganze Himmel Schicht um Schicht von diesen strahlenden Fäden überdeckt, die sich miteinander zu einer schimmernden Decke verweben.
Die Götter haben aufgehört zu singen. Während der Zauber immer intensiver wird, dringt nur noch ein scharfes hohes Heulen aus ihren Kehlen – Schreie von Unsterblichen, die sämtliche Farbe aus dem mystischen Teppich über ihnen zu saugen scheinen und die Millionen bunter Fäden in einen festen schwarzen Mantel verwandeln. Und dann, bevor Daemron begreift, was da passiert, endet der Zauber. Und errichtet vor seinem Blick auf die Götter und die Welt der Sterblichen eine Barriere aus Dunkelheit: Das Vermächtnis wurde erschaffen.
Daemron der Schlächter schreckt aus dem Schlaf hoch. Seine mächtige Brust hebt und senkt sich unter seinen schnellen, panischen Atemzügen, während sich sein Verstand vor der schwarzen Leere zurückzieht. Desorientiert wirft er seinen gehörnten Schädel rasch hin und her, überfliegt jeden Stein und jeden Ziegel des kahlen kreisförmigen Raumes, seines innersten Heiligtums. Ein einzelner Lichtstrahl fällt durch die kreisrunde Öffnung oben in der Kuppel. Doch der größte Teil des Raums bleibt im Dunkeln. Aber mit seinen glühenden grünen Augen hat er keine Schwierigkeiten, die Dämmerung zu durchdringen.
Nachdem er sich vergewissert hat, dass er allein ist, beruhigt er sich allmählich. Er entfaltet die großen ledrigen Schwingen, mit denen er sich umhüllt hatte, als er in der Mitte des leeren Bodens gehockt war. Dann steht er auf, streckt sich, um die Steifheit aus seinem nackten Oberkörper zu vertreiben, und schwingt langsam seinen langen schlangenartigen Schwanz.
Er schläft nur selten, aber auch ein Gott muss manchmal ruhen, vor allem weil seine Macht während seines Exils allmählich abgenommen hat. Seit Jahrhunderten waren seine unregelmäßigen Schlummerphasen nichts weiter als eine Zeit leerer Dunkelheit. Als die Alten Götter sich opferten, um das Vermächtnis zu erschaffen, haben sie mehr getan, als ihn vom Reich der Sterblichen abzuschneiden: Sie haben ihn blind gemacht für die Visionen des Chaos. Bis jetzt.
Er weiß, dass es vorhin keine einfache Erinnerung gewesen ist, heraufbeschworen von einem Verstand, der verzweifelt in das Land zurückkehren wollte, über das er rechtmäßig herrschen sollte. Er hatte die Erschaffung des Vermächtnisses nicht wirklich mit angesehen, aber er weiß, dass es genauso geschehen ist, wie er es eben sah. Die Bilder in seinem Kopf waren viel zu detailliert, zu lebhaft und zu intensiv, um einfach nur Fiktionen seiner Vorstellung zu sein. Er war einst ein großer Prophet gewesen, und auch wenn es viele Jahrhunderte her ist, kann er immer noch die Anzeichen einer wahren Vision erkennen.
Meine Träume sind zurückgekehrt. Das Vermächtnis ist noch schwächer, als ich es mir vorgestellt habe!
Mit einigen langsamen, mächtigen Schlägen seiner großen Schwingen steigt er zu der kleinen Öffnung in der Kuppel zehn Meter über ihm empor. Es ist der einzige Ein- und Ausgang des kreisförmigen Raumes im höchsten Turm seiner Burg.
Er fliegt über die Kuppel hinweg in den mattgrauen Himmel, der jeden Morgen in seinem verfluchten Reich ankündigt. Weit unter ihm umgibt seine wachsende Armee die tristen Gebäude seiner Hauptstadt. Sie erstreckt sich meilenweit in alle Richtungen, Tausende und Abertausende von Monstern und Mutanten, entstellt und deformiert, weil sie seit Generationen in diesem vom Chaos vergifteten Land vegetieren.
Seine grotesken Legionen gieren nach einer Schlacht; selbst von so hoch oben kann er ihre rastlose Blutgier spüren. Eine Armee ohne einen zu bekämpfenden Feind ist gefährlich. Er weiß, dass viele unter ihnen sich den Rebellen anschließen würden, die versuchen werden, ihn zu stürzen, wenn sie die Chance dazu bekommen. Und je länger sie müßig herumsitzen, desto größer ist das Risiko eines Verrates.
Glücklicherweise hat sein Traum bestätigt, was er längst vermutete. Das Chaos sickert allmählich durch das Vermächtnis. Es wird Zeit, seine Truppen auszusenden, dorthin, wo das Vermächtnis am dünnsten und am verletzlichsten ist. Wenn sie sich dort massieren, können sie sofort zuschlagen, wenn die Barriere bricht. Sie würden in Massen durch die Lücke einfallen, Massen, die die Sterblichen niemals aufhalten könnten.
Daemron legt seinen Kopf in den Nacken und stößt einen durchdringenden Jubelschrei aus, bei dem sich die dämonischen Soldaten weit unter ihm ducken und sich auf den Boden werfen.
Sein langes Exil ist fast zu Ende. Die Zeit seiner Rückkehr ist nahe. Und dann wird die Welt der Sterblichen ihm erneut gehören.
1
Keegans Magen knurrte, aber er bemühte sich, so gut er konnte, es zu ignorieren. Stattdessen konzentrierte er sich darauf, einen Fuß vor den anderen zu setzen, während er unaufhörlich nach Westen marschierte, über das karge Buschland, das sich vor ihm erstreckte, so weit das Auge reichte. Nach Norrs Tod war ihre Zahl auf drei zusammengeschmolzen: Jerrod, Scythe und er selbst. Ein erbärmliches Trio, das langsam über die Tundra des Eisigen Ostens schlurfte.
Er stützte sich schwer auf Rexols Zauberstab mit dem geschnitzten Gorgonenhaupt als Griff und reduzierte dieses mächtige Artefakt so auf einen einfachen Gehstock, mit dem er sich unterwegs behelfen konnte. Er verlagerte das Gewicht des Rucksacks auf seiner Schulter und nahm dabei wahr, wie leicht er geworden war. Sie hatten ihre Nahrungsmittel rationiert, seit sie vor über einer Woche die eisigen Gipfel des Gebietes des Wächters verlassen hatten. Sie hatten gehofft, mit ihren Vorräten bis in die Südlande gelangen zu können.
Und was dann?, fragte sich der junge Magus.
Von dem Wächter hatten sie erfahren, dass Cassandra, die junge Frau, die ihnen unbeabsichtigt dabei geholfen hatte, aus dem Monasterium zu entkommen, jetzt die Krone des Dämonen bei sich führte. Sie hatte das Artefakt gestohlen und war erneut nach Süden geflüchtet, in Richtung der Hafenstadt Callastan, verfolgt von Feinden, die noch gefährlicher waren als Raven, die vogelköpfige Frau, die sie angegriffen hatte, um in den Besitz von Daemrons Schwert zu gelangen.
Aber selbst wenn wir sie vor ihnen finden, warum sollte sie uns helfen?
Nach Ravens Angriff hatte Jerrod erneut seine Interpretation der Prophezeiung revidiert, der er angeblich diente. Als er sah, wie Scythe dieses Schwert benutzte, hatte er akzeptiert, dass es tatsächlich drei Erlöser gab, von denen jeder an einen der Talismane von Daemron gebunden war. Wenn der Schlächter zurückkehrte, hatte der Mönch ihnen erklärt, dann mussten Keegan, Scythe und Cassandra gemeinsam gegen ihn kämpfen, um ihn zu besiegen. Sie mussten sich der Macht des Rings, des Schwertes und der Krone bedienen.
Keegan war nicht ganz davon überzeugt, ob er ihm diese neue Theorie abkaufen sollte. Und er war sich fast sicher, dass Cassandra das nicht tun würde. Der Wächter hatte sie ursprünglich als eine Bedrohung wahrgenommen; angesichts dessen, was im Monasterium geschehen war, würde sie das vermutlich ebenfalls tun. Ob Jerrod überhaupt die Chance bekam, sie davon zu überzeugen, dass er recht hatte, bevor sie die Macht der Krone gegen sie einsetzte?
Allerdings hatte er nicht die geringste Vorstellung, was die Krone genau vermochte. Aber sie war mächtig genug gewesen, um Rexol zu vernichten, Keegans ehemaligen Meister, als dieser versucht hatte, sich ihrer Macht zu bedienen.
Werden wir stark genug sein, um sie zu besiegen? Oder die Feinde, die sie jagen? Sind die Feinde stark genug?
Jerrods Neuinterpretation der Prophezeiung war nicht das Einzige, was Keegan Sorgen bereitete. Auch wenn er es nicht zugab, der Mönch kämpfte ganz offensichtlich immer noch mit der sonderbaren doppelten Sicht, mit der Raven ihn bestraft hatte. Ironischerweise hatte ausgerechnet das Schwert ihn vor den tödlichen Zaubersprüchen des Knechts gerettet, als er gegen sie kämpfte, aber es hatte nicht vermocht, sie davon abzuhalten, ihn von dieser mystischen Blindheit zu befreien, die alle Mitglieder des Ordens befallen hatte. Der graue Schleier, der einst seine Pupillen und seine Iris überzogen hatte, war verschwunden und hatte zwei ganz gewöhnliche braune Augen enthüllt. Ohne dieses Merkmal wirkte Jerrod nicht mehr wie jemand vom Orden. Stattdessen ähnelte er eher einem recht durchtrainierten, aber ansonsten vollkommen unauffälligen Mann mittleren Alters.
Das Einzige, was die Leute an ihnen auffällig finden würden, wenn sie erst die Südlande erreichten, war vermutlich ihre Garderobe, stellte sich Keegan vor. Sie alle drei trugen noch die einfachen Hosen und Hemden, die sie der Patrouille der Danaan abgenommen hatten, als sie auf Vaaler getroffen waren. Sie hatten eine Extraschicht Felle darübergezogen, wie sie die Clans im Osten benutzten, um die Kälte abzuwehren.
Jerrod hatte nicht darüber geredet, was er gerade durchmachte, aber Keegan konnte sich gut vorstellen, wie schwierig es für den Mönch sein musste. Nachdem er sein normales Augenlicht wieder hatte, war seine übernatürliche Wahrnehmung jetzt einem ständigen Bombardement aus Licht, Formen und Farben ausgesetzt. Jerrod bewegte sich nicht mehr mit der akkuraten Präzision, an die Keegan sich bei ihm gewöhnt hatte. Stattdessen schien er zu zögern und vorsichtig zu sein, während sein Verstand immer noch versuchte, mit diesem Übermaß an Reizen klarzukommen. Er hatte seinen Kampf mit Raven zwar überlebt, aber er hatte einen Verlust erlitten, von dem er sich vielleicht nie wieder ganz erholen würde.
Und Scythe ist auch nicht mehr sie selbst.
Die junge Insulanerin folgte dem Mönch dichtauf. Die Waffe, für deren Besitz ihr Geliebter sich geopfert hatte, trug sie auf den Rücken geschnallt. Wie die anderen hatte auch sie einen kleinen Beutel über eine Schulter geschlungen.
Auf den ersten Blick wirkte sie wie immer: eine kleine, schlanke junge Frau mit olivfarbener Haut, mandelförmigen Augen und glattem schulterlangem schwarzen Haar. Das Schwert wirkte fast zu groß für sie, aber das Gewicht schien sie nicht zu behindern. Sie bewegte sich immer noch mit der Anmut eines Raubtieres, ihre Muskeln waren stets gespannt und sprungbereit. Im Gegensatz zu Jerrod waren Scythes Wunden mental, nicht körperlich.
Ravens Angriff hatte sie aus ihrem katatonischen Zustand der Trauer gerissen, aber seit ihr Verstand wieder funktionierte, hatte sie Norrs Tod kein einziges Mal erwähnt. Sie schien zumindest Jerrod nicht mehr länger für ihren Verlust verantwortlich zu machen, denn sie zeigte keinerlei Anzeichen von Interesse an Vergeltung oder Rache. Genau genommen war sie an so gut wie gar nichts interessiert. Sie sprach zwar wieder, aber nur wenn es unbedingt notwendig war. Wenigstens stellte sie nicht jede Entscheidung infrage, die Jerrod traf, sondern schien bereit zu sein, einfach dem Pfad zu folgen, den der Mönch einschlug.
Das sieht ihr gar nicht ähnlich. Früher hat sie schon aus Prinzip immer widersprochen.
Keegan hatte mehrmals versucht, sie aus ihrem Schneckenhaus hervorzulocken, aber sie hatte sich nicht darauf eingelassen. Jedes Mal, wenn er versuchte, ein Gespräch zu beginnen, hörte sie zu, antwortete aber höchstens mit ein oder zwei Worten.
Wenn sie früher allein gelassen werden wollte, dann hat sie mich mit scharfen, schnellen Worten zum Schweigen gebracht. Jetzt macht es fast den Eindruck, als wäre es ihr gleichgültig.
Auch wenn Keegan gelernt hatte, ihre Wutausbrüche zu fürchten, waren sie immer noch weit besser gewesen als ihre derzeitige Apathie. Das Einzige, was er noch nicht versucht hatte, war, mit ihr über das zu reden, was Norr zugestoßen war. Wenn irgendetwas Emotionen in ihr auslösen könnte, dann ganz gewiss das.
Aber was sollte ich ihr schon dazu sagen?
Er wusste aus Erfahrung, dass Allgemeinplätze keinen Trost boten. Als sein Vater getötet worden war, waren Klischees darüber, dass er sich an seine Erinnerungen halten sollte, so ziemlich das Letzte, was er hatte hören wollen.
Aber das ist nur ein Vorwand. In Wirklichkeit bist du ein erbärmlicher Feigling. Du hast nur Angst davor, dass sie die Wahrheit erkennt!
Norr war sein Freund gewesen, aber in einer dunklen finsteren Ecke von Keegans Psyche war er immer schon eifersüchtig auf diesen Hünen gewesen. Etwas in mir wollte, dass Norr aus dem Weg geräumt wird. Etwas in mir wollte, dass er verschwindet, damit ich eine Chance bei Scythe bekomme.
Natürlich hatte er nicht gewollt, dass Norr starb. Im besten Fall hatte Keegan gehofft, dass er vielleicht zu seinem eigenen Volk zurückkehren würde. Und selbst diese Hoffnung war von der Erkenntnis gedämpft worden, dass es nur eine närrische, egoistische Fantasie war. Das heldenhafte Opfer des Hünen hatte ihm nur übermäßig deutlich gemacht, wie erbärmlich und beschämend Keegans Gefühle für Scythe tatsächlich waren … aber auch das konnte sie nicht verdrängen.
Aus Respekt Norr gegenüber hatte Keegan sich geschworen, niemals aufgrund seiner Gefühle zu handeln. Aber Scythe wusste bereits, dass er in sie verknallt war. Wenn sie jetzt einen Versuch, sie zu trösten, als einen ungeschickten Versuch sah, ihr Herz zu gewinnen, jetzt, nachdem sein Rivale tot war? Oder wenn sie ihn als Raubtier sah, das versuchte, ihren emotional verletzlichen Zustand auszunutzen?
Im Moment ist sie kalt und distanziert, aber Apathie ist trotzdem besser als Hass und Verachtung.
Jerrod vor ihnen hob seine Hand und bedeutete ihnen, stehen zu bleiben.
»Wir machen hier eine Pause und essen zu Mittag, dann marschieren wir weiter. Wir nähern uns den Südlanden. Wenn wir Glück haben, dann könnten wir in den nächsten Tagen auf eine der Grenzfarmen stoßen.«
Zu Keegans Bestürzung reagierte Scythe nicht auf seine Worte. Sie widersprach nicht, und sie stritt nicht. Sie nickte nicht einmal. Sie setzte sich einfach nur hin, öffnete ihre Tasche und nahm ein dünnes Stück Dörrfleisch heraus, kaum mehr als ein paar Bissen.
Mit einem unhörbaren Seufzer setzte sich Keegan auf den kalten Boden neben ihr und stützte sich dabei auf Rexols Stab. Sie ignorierte ihn vollkommen, als er seine eigene Ration auspackte.
Jerrod nahm seinen Beutel ebenfalls von der Schulter und ließ ihn auf den Boden fallen. Dann hockte er sich hin und durchwühlte ihn, suchte etwas unter den Decken, die sie benutzten, um die Kälte erträglich zu machen, wenn sie nachts lagerten. Ein paar Sekunden später förderte er ebenfalls ein Stück Dörrfleisch zutage, bot es aber Keegan an.
Der junge Magus schüttelte den Kopf und hob den Stumpf seines linken Arms. Er wies die Nahrung mit einer Hand zurück, die nicht mehr an seinem Arm saß.
»Ich habe selbst genug«, log er.
»Mein Körper kann sich selbst von den kleinsten Rationen ernähren«, erinnerte ihn Jerrod. »Aber du musst essen, um bei Kräften zu bleiben.«
»Gib es Scythe.«
Der Mönch drehte sich leicht in ihre Richtung, und sie antwortete mit einem kaum sichtbaren Kopfschütteln.
»Mehr brauche ich nicht.« Sie hielt den Rest ihres kargen Mahls hoch.
»Das Schwert verleiht ihr Kraft«, spekulierte Jerrod und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf Keegan. »Aber bei dem Ring verhält es sich anders. Er scheint dich auszulaugen. Du wirst immer schwächer.«
»Ich habe das Dörrfleisch satt«, protestierte Keegan, aber er wusste, dass Jerrod recht hatte.
Der Ring baumelte immer noch an einer Kette um seinen Hals, unter seiner Kleidung. Aber auch wenn er nicht zu sehen war, war er in seinem Verstand stets präsent. Er konnte die Macht des Ringes spüren, hörte, wie der ihn rief, ihn drängte, das Artefakt auf den Finger zu schieben und das Chaos auf die Welt der Sterblichen loszulassen. Es war nicht leicht, diesen Ruf zu ignorieren. Er übte einen stetigen Druck auf seinen Verstand aus … und wahrscheinlich auch auf seinen Körper.
»Solange wir keinen Bauernhof erreichen, gibt es nichts anderes«, erinnerte Jerrod ihn. »Und wenn du nicht isst, um bei Kräften zu bleiben, dann wird einer von uns beiden dich tragen müssen.« Keegan begriff, dass es sinnlos war, weiter mit dem Mönch zu streiten. Also nahm er das Stück Dörrfleisch und verschlang es mürrisch. Der Rest der Mahlzeit verlief schweigend, und schon bald brachen sie wieder auf. Trotzdem konnte Keegan nicht aufhören, sich wegen Scythe Sorgen zu machen.
Wenn du selbst zu feige bist, um mit ihr über Norr zu sprechen, dann kannst du ja vielleicht Jerrod überreden, es an deiner Stelle zu tun.
Als die Dunkelheit heraufzog, legten sie sich für die Nacht nieder. Wie üblich übernahm Jerrod die erste Wache. Aber statt einzuschlafen, wartete Keegan, bis er Scythe leises Schnarchen hörte. Dann schälte er sich leise aus den Decken, in die er sich gewickelt hatte, stand auf und winkte dem Mönch, ihm ein kurzes Stück zu folgen.
Sobald sie nicht mehr in Hörweite waren, ergriff der junge Magus das Wort. »Ich mache mir wegen Scythe Sorgen.«
»Jeder bewältigt seine Trauer auf seine eigene Weise«, versicherte ihm Jerrod und tat seine Besorgnis ab.
»Ich glaube nicht, dass sie sie bewältigt«, entgegnete Keegan. »Sie folgt uns einfach nur blindlings wie ein Maultier. Als hätte ein Teil von ihr aufgehört zu existieren.«
»Vielleicht hat Norrs Opfer ihr den wahren Wert unserer Mission klargemacht«, spekulierte der Mönch. »Oder sie hat etwas gefühlt, als sie das Schwert benutzte, um Raven zu töten, und akzeptiert jetzt endlich die Rolle, die sie spielen muss. Vielleicht protestiert sie deshalb nicht länger, weil sie sich entschlossen hat, ihre Bestimmung als einer der drei Erlöser zu akzeptieren.«
Das bezweifle ich, dachte Keegan. Aber vielleicht gab es eine Möglichkeit, Jerrods Glauben zu seinem Vorteil zu nutzen.
»Und wenn sie diese Rolle in ihrem derzeitigen Zustand nicht erfüllen kann?«, überlegte Keegan laut. »Nach Ravens Tod sagtest du, dass die Flammen des Chaos in ihr brennen würden. Das ist es, was Scythe zu dem macht, was sie ist: spontan, eigensinnig, störrisch. Aber so ist sie nicht mehr. Wenn dieses Feuer in ihr jetzt erloschen ist?«
Jerrod zögerte, schüttelte dann jedoch den Kopf. »Das Chaos kann nicht so einfach gelöscht werden. Es ist ein Teil ihres Kerns, brennt in der Essenz ihres Wesens. Das Chaos in ihrem Blut definiert sie, so wie es auch dich definiert.« Er machte eine kurze Pause. »Und Cassandra zweifellos ebenfalls«, setzte er dann hinzu.
»Ich glaube trotzdem, dass du mit Scythe reden solltest.« Keegan wollte nicht aufgeben. »Wenn wir sie dazu bringen können zu akzeptieren, was mit Norr geschehen ist, dann kehrt sie vielleicht zu ihrem alten Selbst zurück.«
»Ein solches Gespräch könnte Konsequenzen haben, die wir nicht bewältigen können«, erwiderte der Mönch gedehnt.
»Worauf spielst du an?«
»Auf die Nachwirkung.« Jerrod senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Du hast den Ring benutzt, um uns vor der Yeti-Haut zu retten. Vielleicht hat die Nachwirkung des Chaos, das du freigesetzt hast, Norrs Tod ausgelöst.«
Diese Vorstellung war nicht neu für Keegan. Er bemühte sich selbst, damit fertig zu werden. Der Gedanke, dass er indirekt für das verantwortlich sein könnte, was Norr zugestoßen war, verstärkte nur sein schlechtes Gewissen wegen seiner Gefühle Scythe gegenüber. Aber niemand konnte mit Gewissheit sagen, dass er die Schuld daran trug, und er hatte bereits für sich beschlossen, dass er diese zusätzliche Bürde nicht auf seine Schulter nehmen würde.
»Hätte er das nicht getan, wären wir alle tot«, erinnerte Keegan Jerrod.
»Dem stimme ich zu. Aber wird Scythe das ebenso sehen? Wenn wir diese Sache ansprechen, könnte es sein, dass sie dich für Norrs Tod verantwortlich macht.«
»Und selbst wenn es meine Schuld gewesen wäre«, erwiderte Keegan mürrisch, »würde Scythe mir nicht die Schuld geben. Sie ist klug genug, um zu erkennen, dass es ein Unfall war.«
»War es das denn?«, erkundigte sich Jerrod.
Keegan war so verblüfft von dieser Anschuldigung, dass er nicht antworten konnte.
»Deine Gefühle für Scythe sind mehr als offensichtlich«, fuhr der Mönch fort. »Deine Macht wächst. Jedes Mal, wenn du den Ring benutzt hast, wurdest du stärker. Du wurdest immer geschickter darin, das Chaos zu kontrollieren und zu steuern. Und wenn deine Eifersucht auf Norr nun dazu geführt hat, dass du unbewusst die Nachwirkung auf ihn gerichtet hast?«
»Das … das ist absolut unmöglich«, stammelte Keegan und schüttelte den Kopf. »Niemand kann die Nachwirkung des Chaos kontrollieren. Aus diesem Grund ist sie ja so gefährlich.«
»Mag sein. Aber du hast bereits sehr viele Dinge getan, die niemand anders jemals hätte bewerkstelligen können.«
»Aber ich habe Norrs Tod nicht verursacht«, erklärte Keegan. »Jedenfalls nicht absichtlich.«
»Es spielt nicht die geringste Rolle, ob du das glaubst«, erinnerte ihn Jerrod. »Ebenso wenig, ob ich das glaube. Es ist nur wichtig, ob Scythe es glaubt. Wenn wir sie wegen Norr befragen, dann könnte sie vielleicht anfangen, nach Gründen zu suchen, warum er gestorben ist. Und sie könnte möglicherweise zu derselben Schlussfolgerung gelangen. Und vielleicht entscheiden, dass du die Schuld daran trägst. Und glauben, dass du dafür mit deinem Leben zu bezahlen hast.«
»Das würde sie nicht tun«, gab Keegan zurück. Aber er klang längst nicht so überzeugt, wie es ihm lieb gewesen wäre.
»Dieses Risiko bin ich nicht bereit einzugehen«, beendete Jerrod den Disput. »Scythe ist stark: Ich glaube, dass ihr Geist schon rechtzeitig zurückkehren wird.«
»Können wir uns wirklich den Luxus leisten, einfach nur darauf zu warten?« Keegan wollte das Thema immer noch nicht ruhen lassen.
Jerrod überlegte eine Weile, bevor er antwortete.
»Du könntest recht haben«, räumte er schließlich ein. »Wenn Scythe in den nächsten Tagen keinerlei Veränderungen zeigt, dann werde ich mit ihr reden.«
Zufrieden nickte Keegan.
»Und jetzt geh schlafen«, sagte der Mönch. »Morgen ist ein langer Tag.«
Nachdem Keegan sich hingelegt hatte, dauerte es nur ein paar Minuten, bis er tief und fest schnarchte.
Scythe achtete sorgfältig darauf, ruhig und gleichmäßig zu atmen, als Keegan aufstand und mit Jerrod sprach. Sie wollte ihn in der Illusion lassen, dass sie friedlich schlief. Aber sie war nicht müde. Seit sie das Schwert genommen hatte, brauchte sie nachts nur eine Stunde Schlaf. Aber sie tat lieber so, als würde sie schlafen, als sich jetzt mit ihren Reisegefährten auseinanderzusetzen.
Und in den seltenen Fällen, in denen sie schlief, träumte sie von Norr. Ihr Geist brachte sie immer wieder zu der Zeit in Praeton zurück, als er noch lebte. Scythe hatte die kleine Siedlung oft entsetzlich langweilig gefunden, aber jetzt sehnte sie sich nach ihren einfachen Vergnügungen. Selbst die Langeweile wäre erträglicher, wenn nur Norr bei ihr wäre.
Aber das ist er nicht. Er ist tot.
Jedes Mal, wenn sie aufwachte, gab es einen kurzen Moment, in dem sie erwartete, dass Norr neben ihr lag und schnarchte, wenn sie sich umdrehte. Dann brach die Realität über ihr zusammen, und der Schmerz traf sie erneut, erneut und hart. Irgendwie war es so, als würde er immer wieder sterben.
Scythe hatte nie viel darüber nachgedacht, was mit einer Person nach ihrem Tod passierte. Viele der neuen Religionen sprachen von irgendeiner anderen Welt, in der die Verstorbenen mit denen wieder vereint würden, die sie liebten, in einer Art von unendlichem Paradies. Ein netter Gedanke, aber er kam ihr viel zu naheliegend vor, um glaubwürdig zu sein.
Der Orden predigte, dass jene, die starben, eins mit dem Chaosmeer würden, der Essenz, die den Funken des erloschenen Lebens zündete, damit er sich mit dem universellen Ganzen verband, aus dem die Alten Götter selbst geboren worden waren. Diese Theorie hatte etwas Anziehendes – Tod als Erlösung von allem, einschließlich seines eigenen Gefühls von Existenz. Und vielleicht würde sie irgendwann ein solches Schicksal auch willkommen heißen. Aber jetzt begrüßte sie noch den Schmerz der Erinnerung an Norr. Das war alles, was ihr von ihm geblieben war, und sie wollte das noch nicht für ewiges Vergessen aufgeben.
Sie blieb weiterhin vollkommen ruhig liegen, als Keegan zurückkam und sich auf die andere Seite des glühenden Torffeuers legte. Sie hielt ihre Täuschung aufrecht, bis der junge Mann anfing, leise zu schnarchen. Trotz ihrer Vorsichtsmaßnahmen hatte sie jedes Wort gehört, als Jerrod und er über sie geredet hatten. Dank des Schwertes waren all ihre Sinne geschärft.
Die Vorstellung, dass Norrs Tod durch die Nachwirkung von Keegans Zauberspruch verursacht worden war, war ihr nicht neu. Aber sie hatte die Möglichkeit nicht in Betracht gezogen, dass Keegan die Nachwirkung absichtlich auf ihren Geliebten geleitet haben könnte. Aber selbst wenn er es getan hatte, würde das nichts ändern.
Norr hatte sein Leben geopfert, weil er wirklich glaubte, dass Keegan so etwas wie ein Erlöser war. Wenn sie ihn jetzt betrachtete, fiel es ihr schwer, das in ihm zu sehen. Er war hager, fast ausgemergelt. Sein schwarzes Haar und seine dunklen, tief in den Höhlen liegenden Augen hoben sich in deutlichem Kontrast von seiner Haut ab, die um diese Stellen herum weiß wie Schnee war. Seine Wangen waren so glatt und haarlos, dass er mehr wie ein Junge wirkte, nicht wie ein echter Mann.
Und außerdem hat er nur eine Hand!
Doch trotz all dem konnte Scythe sich keine Zweifel an seiner Bestimmung erlauben. Oder an ihrer. Sie hatte Keegans Macht erlebt, aber nicht das war es, was ihrem Glauben Nahrung gab. Es existierte nur eine einzige Möglichkeit, dass Norrs Tod irgendeinen Sinn ergab, eine einzige Sichtweise, in der er überhaupt eine Bedeutung oder einen Zweck hatte, und zwar die, dass Jerrod recht hatte. Um Norrs Gedenken willen war Scythe bereit, an die Prophezeiung dieses wahnsinnigen Mannes zu glauben, ganz gleich, wie oft er die Einzelheiten verändert hatte. Sie war fest entschlossen, diese Sache bis zum Ende durchzustehen, ganz gleich, was es auch kostete.
Ich werde euch nach Callastan folgen, während ihr versucht, Cassandra zu überzeugen, sich uns anzuschließen. Wenn sie sich weigert, werde ich sie mit dem Schwert töten und mir selbst die Krone aufsetzen, wenn das notwendig sein sollte.
Und am Ende, wenn du entscheidest, dass die Welt nur gerettet werden kann, wenn Keegan und ich uns opfern, dann wird eben genau das passieren. Und wenn Keegan nicht bereit ist, diesen Preis zu zahlen, werde ich ihn mit Freuden selbst auf den Weg schicken.
Norr war der edelste, großzügige und freundlichste Mann gewesen, den sie je getroffen hatte, und jetzt war er tot. Er war ein besserer Mensch gewesen als sie selbst; er war besser gewesen als sie alle. Wenn er für diese Sache sterben musste, warum sollte sie das nicht auch tun? Oder Keegan? Warum sollten nicht alle anderen ebenfalls sterben müssen?
Sie war keine Prophetin. Nicht einmal seit sie sich mit dem Schwert bewaffnet hatte, hatte sie irgendwelche geheimnisvollen Träume oder Visionen gehabt. Nachts träumte sie nur von Erinnerungen an die Zeit, in der Norr noch am Leben war. Aber irgendwie wusste sie, dass dieses bereits jetzt schon tragische Unterfangen nicht ohne noch mehr Blutvergießen enden würde. Und sie war bereit, ja sogar begierig darauf zu sehen, wie die roten Ströme flossen.
2
Vaaler und Shalana gehörten zu den Ersten, die zum angesetzten Treffen der Clanchefs kamen. Nur Roggen war noch vor ihnen da. Vaaler war nicht sonderlich überrascht darüber. Der neu ernannte Anführer der Sonnenklingen war für gewöhnlich der Erste bei solchen Veranstaltungen.
Die Versammlungshalle war eine Konstruktion aus Tierhäuten, die auf einen Rahmen aus Knochen gespannt worden waren, und zwar in der Mitte der unterschiedlichen Stammeslager, die sich rund um den Schlund des Giganten verteilten. Es gab keine Feuerstelle, die das Innere gewärmt hätte. Es war so kalt in dem Raum, dass Vaaler seinen Atem sehen konnte. Aber wenigstens boten die Häute Schutz vor dem Wind und auch vor dem unaufhörlichen Schneetreiben.
Roggen stand in der gegenüberliegenden Ecke des Zeltes, regungslos, ruhig und offensichtlich unbehelligt von der Kälte. Er trug die übliche Kleidung eines Ausländers: hohe, schwere Stiefel, einen knielangen Kilt aus Tierhäuten und eine ärmellose Weste. Seine muskulösen Arme waren unbedeckt. Sein dichter schwarzer Bart und sein langes ungezähmtes Haar verliehen ihm ein brutales Aussehen. Aber Vaaler wusste, dass sich hinter diesem derben Äußeren eine scharfe Intelligenz verbarg.
Shalana und Vaaler waren ähnlich gekleidet. Allerdings hatte Vaaler einen Umhang aus zusammengenähten Pelzen über die Schultern geworfen, um sich warmzuhalten. Shalanas helle Haut und ihr kupferfarbenes Haar, das sie zu einem langen Zopf geflochten über der rechten Schulter auf ihrer Brust trug, waren unter den Clans weit verbreitet. Aber Vaaler hätte niemand für einen Eingeborenen gehalten, selbst wenn er keine zusätzlichen Pelze gegen die Kälte getragen hätte. Obwohl er ebenso groß war wie Shalana, war er hager und drahtig. Das bildete einen starken Kontrast zu dem stämmigen, massigen Körperbau der Ostländer. Seine Haut hatte wie die aller Danaan einen grünlich-braunen Ton, und obwohl er sich seit Wochen nicht rasiert hatte, war sein Gesicht bis auf einen leichten Flaum an seinem Kinn vollkommen glatt.
Und doch fühlte sich Vaaler zwischen diesen Menschen weit heimischer, als er sich je unter den Angehörigen seiner eigenen Rasse gefühlt hatte. Roggen und die anderen Häuptlinge akzeptierten und respektierten ihn, und wenn irgendjemand seine Beziehung mit Shalana ablehnte, war er klug genug, in seiner Gegenwart kein Wort darüber zu verlieren … oder in ihrer.
»Seid ihr euch sicher?« Roggen kam zu ihnen und packte Shalanas Unterarm zum Kriegergruß.
»Du klingst so, als würdest du Schwierigkeiten erwarten«, erwiderte Vaaler.
»Es werden nicht alle über das erfreut sein, was du zu sagen hast.«
»Dennoch muss es gesagt werden«, beharrte Shalana. Roggen nickte zustimmend.
Es war nicht das erste Treffen der Clanhäuptlinge seit der letzten Schlacht gegen die Danaan, obwohl Vaaler wusste, dass dieses Treffen anders verlaufen würde als alle anderen. In der Woche seit dem Sieg über den Feind hatten sich die Anführer aller Clans fast jeden Abend getroffen, um Neuigkeiten auszutauschen und Pläne zu schmieden, was sie als Nächstes tun wollten. Die neuen Allianzen zwischen den ehemaligen Rivalen hielten immer noch, und bis jetzt waren sie in der Lage gewesen, unter den Nachwirkungen ihres kostspieligen Sieges gemeinsam zu handeln.
Und es gibt immer noch einen gemeinsamen Feind, der sie auslöschen will. Der brutale Winter hat, wie zuvor die Danaan, die Häuptlinge vereint.
Während des Feldzugs gegen Vaalers ehemaliges Volk hatten sie gewaltige Verluste erlitten, die von dem Clan einen hohen Tribut gefordert hatten. Die Nahrungsmittel waren knapp geworden, ebenso die Zahl der gesunden Männer und Frauen, die in der Lage gewesen wären, die umliegenden Steppen und nahen Berge nach Wild abzusuchen. Selbst Terramon hatte zugestimmt, dass sie alle zusammenarbeiten und versuchen sollten, den Winter gemeinsam als Gruppe hier im Schlund des Giganten zu überstehen.
Das zeigt, wie verzweifelt unsere Situation ist, erkannte Vaaler. Wenn selbst Shalanas Vater Kooperation für die einzige Möglichkeit hält.
Einer nach dem anderen trafen die anderen Clanhäuptlinge und ihre Ratgeber ein und füllten allmählich das improvisierte Zelt. Die Wärme ihrer Körper in dem engen Raum ließ die Temperatur allmählich ansteigen. Vaaler beobachtete sie aufmerksam, als er versuchte, ihre Stimmung einzuschätzen, während sie eintraten.
Die meisten betrachteten Shalana immer noch als ihre inoffizielle Anführerin, eine Rolle, die sie mit Vaalers Hilfe während des Krieges gegen die Danaan eingenommen hatte. Aber als sich der Fokus der Häuptlinge mehr auf alltägliche Sorgen als auf Schlachtstrategien und Taktik richtete, hatte er eine leichte Verschiebung ihrer Loyalität in Richtung Roggen gespürt.
Shalana hatte nicht versucht, dagegen anzugehen. Stattdessen war sie nur zu bereit, ihm diese Rolle zuzugestehen. Denn während des letzten Jahrzehnts war Roggen letztendlich der Anführer der Sonnenklingen gewesen, des größten und mächtigsten Clans im Eisigen Osten. Auch wenn er sich bei größeren Entscheidungen dem ehrenwerten Hadawas gebeugt hatte, war er derjenige gewesen, der über den Alltag seines Volkes gewacht hatte.
Und Shalana war im Innersten eine Kriegerin. Sie wusste, wie man kämpfte und wie sie ihre Than für ihre Sache sammeln konnte. Aber Roggen war weit besser in der Lage als sie, die Suche nach Nahrung zu organisieren, sich um die Versorgung der Kranken und Verwundeten zu kümmern und dauerhafte Schutzhütten zu errichten, die selbst den unausweichlichen Blizzards widerstanden, die sie unter Eis und Schnee zu begraben drohten. Und wenn es Zwist zwischen den Häuptlingen gab, war er weit erfahrener in der subtilen Politik der Führerschaft als sie.
Die Clans werden in guten Händen sein, wenn wir weggehen, versicherte sich Vaaler. Dieses Wissen half ihm, ruhig zu bleiben, obwohl er immer noch Angst vor dem hatte, was jetzt kommen würde.
Shalana stand neben ihm und drückte beruhigend seine Hand.
Ist meine Nervosität so offensichtlich?, fragte er sich. Oder kennt sie mich einfach nur schon so gut?
»Es wird Zeit«, flüsterte sie, ließ seine Hand los und trat in den kleinen Kreis, der sich ganz natürlich in der Mitte der Menge gebildet hatte. Vaaler holte tief Luft und wünschte seiner Geliebten Glück bei dem, was jetzt kam.
Shalana ließ den Blick einmal über die mehr als 20 Gesichter im Raum gleiten, bevor sie das Wort ergriff. Die versammelten Häuptlinge und eine Handvoll ihrer vertrautesten Berater – die erst kürzlich vereinigten Anführer des Eisigen Ostens – warteten geduldig darauf, dass sie begann. Zu ihrer Erleichterung konnte sie ihren Vater in der Menge nirgendwo erkennen. Doch bevor sie anfangen konnte, schlüpfte eine weitere Gestalt in letzter Sekunde durch den Eingang des Versammlungszeltes.
Terramon entschuldigte sich nicht für seine Verspätung. Ohne ein Wort zu sagen oder die anderen auch nur eines Blickes zu würdigen, schob er sich rücksichtslos an die Spitze der Versammelten. Shalana bemerkte, dass Vaaler ihm einen gereizten Blick zuwarf, und unterdrückte ein Seufzen.
Obwohl ihr Vater keinen offiziellen Titel mehr führte, erkannten ihn nahezu alle Clans an, auch wenn sie ihm nicht unbedingt trauten oder ihn nicht mochten. Dass seine Anwesenheit bei den Treffen der Clanhäuptlinge akzeptiert wurde, war eine Verbeugung vor seinem Ruf, auch wenn er nicht regelmäßig teilnahm.
Aber natürlich ist er heute Nacht hier. Er muss immer alles schwierig machen.
Sie hatte gehofft, dass Terramon diese Versammlung nicht besuchen würde. Sie vermutete, es wäre weit einfacher gewesen, wenn er nicht dabei war. Aber es war nicht sinnvoll, es noch länger hinauszuzögern. Vaaler machte sich Sorgen, dass sie vielleicht schon zu lange gewartet hatten.
»Willkommen, meine Häuptlinge!«, rief Shalana, nachdem sich ihre Zuhörer nach dem späten Eintreffen ihres Vaters wieder beruhigt hatten. »Ich weiß, dass ihr alle darauf wartet, die Nachrichten von den Jagdgruppen zu hören, die wir ausgeschickt haben. Ich werde schon bald das Wort an Roggen übergeben, der ihre Bemühungen koordiniert hat.
Aber zuerst«, fuhr sie fort, »müssen wir euch etwas mitteilen.«
Sie warf einen kurzen Blick zurück zu Vaaler, der aufmunternd nickte.
»Wie ihr alle wisst, hat Vaaler bei unserem Sieg über die Eindringlinge der Danaan eine entscheidende Rolle gespielt. Ohne ihn wäre keiner von uns jetzt hier.«
Ihre Worte riefen spontane Jubelrufe unter ihren Zuhörern hervor, und sie musste unwillkürlich lächeln. Vaaler war kein Fremder mehr; für ihr Volk war er ein Held geworden. Was das, was sie sagen wollte, noch schwieriger machte.
»Aber Vaaler ist nicht hierhergekommen, um uns vor dem Baumvolk zu warnen. Er kam zusammen mit Norr und den Gefährten, um die Hilfe der Steingeister für etwas weit Wichtigeres zu suchen.
Vor langer Zeit hat sich etwas Großes, Böses erhoben«, erklärte Shalana. »Ein Tyrann namens Daemron der Schlächter hat das Entsetzen der ChaosBrut auf die Welt losgelassen und einen Kataklysmus verursacht, der diese Welt fast zerstört hätte.
Und nun, nach Jahrhunderten der Verbannung, droht der Schlächter zurückzukehren. Deshalb kamen Norr und Vaaler überhaupt zu uns: Sie suchten einen Weg, ihn ein für alle Mal zu besiegen.«
Ein verblüfftes Schweigen hatte sich in dem Raum ausgebreitet, als die Thans versuchten zu begreifen, was sie ihnen erzählte.
»Der Krieg gegen die Danaan ist vorbei«, spann sie den Faden weiter. »Aber es gibt einen anderen Krieg, der geführt werden muss. Und die Clans müssen in diesem Krieg mitkämpfen.«
Zuerst antwortete niemand, obwohl sie das verwirrte Murmeln und die Unzufriedenheit ihrer Zuhörer hörte. Dann sprach Terramon das aus, was viele der Thans dachten.
»Wir haben genug reale Probleme, denen wir uns stellen müssen, auch ohne uns über Mythen und Legenden den Kopf zu zerbrechen«, erklärte ihr Vater.
»Wie kannst du das behaupten, nach dem, was auf dem Schlachtfeld passiert ist?« Shalana versuchte, das Argument ihres Vaters zu entkräften, bevor andere sich ihm anschlossen. »Du hast selbst gesehen, wie der Wächter sein Leben geopfert hat, um uns zu retten! Du weißt, dass die Legenden real sind. Wir haben den Beweis selbst gesehen.«
Die Zuhörer murmelten zustimmend. Den Anblick des gewaltigen blauäugigen Titanen, der aus den Bergen herabstieg, um mit dem monströsen Oger zu kämpfen, würde keiner von ihnen so schnell vergessen.
»Selbst wenn einige Legenden real sind«, Terramon gab nicht nach, »verändert das nicht alles. Der Winter ist da. Die einzigen Feinde, um die wir uns Moment kümmern müssen, sind Erfrierungen und Hungersnot!«
»Du darfst nicht einfach wegsehen«, mischte sich Vaaler warnend in die Diskussion ein. »Der Oger hat zu viele von deinen Leuten getötet, als dass du diese Bedrohung leugnen könntest.«
»Der Oger wurde in den Wäldern des Baumvolks geboren!«, konterte Terramon. »Und der Wächter war ein Relikt aus einem vergessenen Zeitalter. Sie haben vielleicht einmal in unseren Ländern gekämpft, aber sie hatten hier keinen Platz. Und jetzt sind sie beide verschwunden – verschwunden wie die Geister der uralten Historie, aus der sie stammten.«
»Der Oger ist nicht der Erste der ChaosBrut, der sich erhoben hat«, warnte ihn Vaaler. »Und er wird auch nicht der Letzte sein. Bevor ich mein Volk verlassen habe, sah ich, wie ein Drache erwachte und eine ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt hat, bevor er bezwungen werden konnte.«
»Du bestätigst nur meine Argumente!«, rief Terramon. »Die Prophezeiung, der du und Norr folgen, stammt von dem Orden. Ihr lasst eure Handlungen von den blinden Mönchen bestimmen, die die Südlande beherrschen, und ihr habt Krieg zu eurem Volk gebracht … und zu unserem! Wie viele von uns müssen noch für ihre Sache sterben?
Wir sind schon einmal in den Krieg eines anderen hineingezogen worden«, erinnerte er seine Gefährten. »Sind wir so dumm, dass wir es noch einmal geschehen lassen?«
»Hadawas hat die Gefahr begriffen, von der Shalana und Vaaler sprechen.« Roggen trat offen auf ihre Seite, bevor einer der anderen Thans sprechen konnte. »Von uns allen hatte allein er die Fähigkeit, die Zukunft zu erblicken, auch wenn seine Visionen schwach und dunkel waren. Aber er wusste, dass eine Zeit großer Unruhen bevorstand.
Deshalb hat er dieses Konklave einberufen. Deshalb hat er Norr und die anderen auf ihrer Suche nach dem Dämonenschwert begleitet, nachdem er von ihrer Unternehmung erfahren hat. Er wusste, dass die Rückkehr des Schlächters den nächsten Kataklysmus über diese Welt bringen würde, und dass die Clans genauso darunter leiden würden wie jene im Norden und im Süden.«
»Selbst die tapfersten Krieger können des Kampfes müde werden«, gab Shalana zu und sprach damit offen aus, was sie alle empfanden. »Aber es kommt eine neue Bedrohung auf uns zu. Wenn wir sie mit der Ausrede ignorieren, dass es wichtiger sei, diesen Winter zu überleben, wird keiner von uns einen weiteren Winter erleben.«
Shalana machte eine Pause und betrachtete die Gesichter der Thans in dem verzweifelten Versuch, ihre Reaktionen abzuschätzen. Sie fürchtete, dass sie Ungläubigkeit oder Verachtung sehen würde. Stattdessen jedoch zeichneten sich auf den Gesichtern der Gefolgsleute Sorge und Furcht ab.
»Was sollen wir deiner Meinung nach tun?«, ertönte eine Stimme aus dem Hintergrund.
»Der Wächter hat zu uns gesprochen, bevor er starb«, erwiderte Shalana. »Er sagte, er hätte das Dämonenschwert Norr und den anderen gegeben. Sie sind jetzt auf dem Weg nach Callastan, wo sie nach jemandem suchen, der sich mit ihnen vereinigen wird, um den Schlächter zu besiegen. Aber ohne unsere Hilfe werden sie keinen Erfolg haben.«
»Welche Hilfe könnten wir ihnen schon leisten?« Terramon klang bitter. »Der Krieg mit den Danaan hat uns kaum etwas gelassen.«
»Vaaler war von Anfang an ein Teil von ihnen«, erklärte Shalana. »Sein Schicksal ist an jene gebunden, die versuchen, Daemrons Rückkehr zu verhindern. Wir müssen ihn zu den Südlanden begleiten, damit er sich wieder mit seinen Freunden vereinigen kann.«
»Diese Reise wird sehr gefährlich werden«, gab Vaaler zu. »Aber ich kann sie nicht allein bewältigen. Zwischen hier und meinen Freunden gibt es zu viele Feinde. Der Orden verfolgt sie … und mich jagt er möglicherweise ebenfalls.«
»Das ist Wahnsinn!«, giftete Terramon. »Wenn wir in die Südlande einmarschieren, werden sie das als einen kriegerischen Akt betrachten! Und nachdem wir so wenige sind, hätten wir keine Chance gegen ihre vereinigten Armeen!«
»Wenn wir eine Invasionsarmee losschickten, wäre das allerdings selbstmörderisch«, räumte Vaaler ein. »Aber eine kleine Gruppe von Kriegern, die schnell und beweglich reist, schafft es vielleicht nach Callastan, ohne auf nennenswerten Widerstand zu treffen.«
»Wir bitten nur um ein Dutzend Krieger, die uns begleiten sollen«, sagte Shalana.
»Du gehst mit ihm?« Terramon schüttelte ungläubig den Kopf. »Ich hätte gedacht, mein eigenes Fleisch und Blut besäße genug Verstand, um sein Leben nicht wegzuwerfen.«
Sein missbilligender, angewiderter Tonfall war Shalana nur zu vertraut. Sie hatte ihn ihr ganzes Leben lang gehört. Aber jetzt besaß er keine Macht mehr über sie, und sie würdigte ihn nicht einmal mehr einer Antwort.
»Wir können Vorräte für den ersten Teil der Reise erübrigen«, warf Roggen ein. »Jedenfalls genug, dass Shalana und ihre Ehrenwache die Südlande erreichen können. Danach müssen sie mit dem vorliebnehmen, was sie selbst erbeuten können.«
»Roggen wird hierbleiben, um euch durch diesen Winter zu führen«, nahm Shalana den Faden wieder auf. »Es sei denn, es gäbe einen unter euch, der das Gefühl hat, er könnte das besser tun als er.«
Es war nicht sonderlich überraschend, dass sich niemand meldete – auch wenn Terramon mürrisch auf die Versammelten starrte, als wollte er irgendjemanden zwingen vorzutreten.
»Wie Vaaler euch bereits gesagt hat«, fuhr Shalana dann fort, »wird die Reise nach Callastan sehr gefährlich. Es ist gut möglich, dass wir sterben, statt den Sieg davonzutragen. Aber auch wenn das Risiko hoch ist, müssen wir den Versuch wagen. Das Schicksal der Clans und der ganzen Welt steht hier auf dem Spiel.
Wir werden morgen früh aufbrechen«, schloss Shalana. »Geht nach diesem Treffen zu euren Thans und Clans und sagt ihnen, was getan werden muss. Wenn einer eurer Krieger sich uns anschließen will, ist er willkommen … Aber sie müssen wissen, dass sie vielleicht nie wieder zurückkehren.«
Am Morgen ihrer Abreise war es klar, aber bitterkalt. Shalana hatte erwartet, dass ihre Eskorte hauptsächlich aus Kriegern der Steingeister bestehen würde. Zu ihrer Überraschung jedoch hatten sich fast fünfzig Frauen und Männer bereit erklärt, sich ihnen anzuschließen. Und zwar von nahezu jedem Clan hier im Schlund des Giganten. Es war schwierig gewesen, ein Dutzend von ihnen auszuwählen, sieben Männer und fünf Frauen, aber zum Glück hatte die große Zahl der Freiwilligen es ihnen erlaubt, sich für jene zu entscheiden, deren Mut und Fähigkeiten die beste Chance auf Erfolg versprachen.
Trotz der Kälte und der frühen Stunde hatte sich eine große Menge von Männern, Frauen und Kindern versammelt, um sie zu verabschieden, unter ihnen auch Roggen und die anderen Häuptlinge. Selbst Terramon war da. Er stützte sich auf seinen Stock und blickte finster drein.
Man hatte zwei kleine Schlitten mit Vorräten beladen: Felle und Decken, in die sie sich einwickeln konnten, wenn sie nachts ein Lager aufschlugen, etliche Torfbrocken für ein Feuer, um die Kälte abzuwehren, und genug Proviant, um sie bis an den Rand der Südlande zu bringen.
Danach werden die Schlitten uns nicht mehr viel nützen, dachte Shalana. Dann müssen wir sie zurücklassen.
Ihre Hoffnung war, in den dichter bevölkerten Gegenden genug Proviant zu finden, um ihre Reise fortsetzen zu können. Wie genau sie das allerdings bewerkstelligen sollten, hatten sie sich noch nicht überlegt. Ebenso wenig wussten sie, wie sie durch Hunderte von Meilen feindlichen Territoriums reisen sollten, ohne in den Kerker geworfen oder getötet zu werden.
Vaaler war zuversichtlich, dass sie einen Weg finden und Erfolg haben würden. Shalana vertraute ihm genug, dass sie das ebenso glaubte, obwohl alle Umstände für das Gegenteil sprachen.
Und alle, die uns begleiten, glauben genug an mich, um meiner Führung zu folgen.
Die Eskorte machte sich daran, die Vorbereitung der Schlitten abzuschließen. Es wurde Zeit aufzubrechen. Da trat Roggen aus der Menge und hob Ruhe gebietend die Hand.
»Wir haben uns hier versammelt, um Shalana und Vaaler ein günstiges Schicksal zu wünschen!«, rief er. Seine Stimme drang klar und deutlich durch die kalte, frische Morgenluft. »Zusammen haben sie sich einem fast aussichtslosen Kampf gestellt und uns zum Sieg geführt, als alles verloren schien!«
Er machte eine Pause, und die Menge jubelte laut. Shalana hob die Hand, um die Aufmunterung zu erwidern, aber ihr Blick fiel auf Terramon, der regungslos und stumm an der Spitze der Gruppe stand.
»Hadawas, Norr und die anderen sind bereits vorausgegangen«, fuhr Roggen fort. »Und jetzt müssen diese tapferen Kämpfer sich ihnen anschließen, denn ihr Schicksal liegt weit im Süden.«
Roggen trat vor und packte erst Vaalers und dann Shalanas Unterarm. Als er wieder sprach, redete er leiser; seine Worte waren nicht für die Menge, sondern nur für die beiden bestimmt.
»Jeder Winter muss dem Frühling weichen. Wenn das Eis schmilzt, werden wir hier sein und eure Rückkehr erwarten.«
Weder Vaaler noch Shalana antworteten darauf. Alles, was gesagt werden musste, war bereits gesagt. Roggen nickte, wandte sich ab und trat wieder in die Menge zurück.
Bevor Shalana das Signal zum Aufbruch geben konnte, trat Terramon vor. Bei jedem Schritt rammte er wütend seinen Gehstock in die verschneite Erde.
»Was will er denn jetzt noch?«, zischte Vaaler neben ihrem Ohr. Aber sie zwang sich, ruhig zu bleiben.
Der Streit ist vorbei. Wir haben gewonnen. Nichts, was er jetzt noch sagt, kann meine Meinung ändern.
Terramon ging weiter auf sie zu und blieb erst unmittelbar vor ihr stehen. Er stützte sich auf seinen Gehstock und packte mit seiner freien Hand fest ihre Schulter.
»Ich halte das immer noch für Wahnsinn«, sagte er. Aber er sprach nicht so laut, dass die Menge ihn hätte hören können. Das hier war keine letzte politische Rede.
»Sei vorsichtig unter all diesen Fremden«, setzte er zu ihrer Überraschung hinzu. »Es sind Barbaren ohne Ehre.«
»Das bin ich.« Sie war leicht irritiert.
»Und lass dich von Vaaler führen. Er kennt sich mit ihnen aus. Wenn jemand dich beschützen und zurückbringen kann, dann er.«
»Wir passen aufeinander auf«, versprach Vaaler, der neben sie getreten war.
Terramon nickte, umklammerte aber immer noch ihre Schulter.
»Du bist meine Tochter«, fuhr er dann nach kurzem Zögern fort. »Ganz gleich, was passiert, vergiss das nie!«
Dann ließ er seine Hand fallen, drehte sich um und marschierte davon, bis er in der Menge verschwand. Verblüfft sah Shalana ihm nach. Sie wusste nicht genau, ob sie tatsächlich eine Träne in seinem Auge gesehen hatte, unmittelbar bevor er sich abwandte.
»Ich nehme an, das ist seine Art, dir zu sagen, dass er stolz auf dich ist«, sagte Vaaler leise, nachdem Terramon verschwunden war.
»Vermutlich«, stimmte Shalana ihm zu.
Nach einem letzten Blick auf die Gesichter ihres Volkes, auf Gesichter, die sie vielleicht nie wiedersehen würde, gab sie das Zeichen, und Vaaler, ihr auserwähltes Dutzend und sie selbst fuhren in den Schnee hinaus.
3
»Pass auf, Cassandra.«
Rexols Stimme war leise, aber nachdrücklich. Der ChaosMagus beugte sich über sie, ein kleines blondes Mädchen mit smaragdgrünen Augen, das winzig neben diesem großen, hageren Mann wirkte. Seine dunkle Haut und sein Umhang ließen ihn im flackernden Licht der einsamen Kerze, die den kleinen runden Raum erhellte, fast wie einen Schatten aussehen. Sein langes schwarzes Haar war zu unregelmäßigen Zöpfen geflochten, die willkürlich über seine Stirn und seine Schultern fielen. Nur seine hellen weißen Zähne, die zu scharfen Spitzen geschliffen waren, und seine großen wilden Augen leuchteten in der Dämmerung.
»Sieh auf die Symbole auf dem Boden«, instruierte er sie. Cassandra senkte den Blick. Zu ihren Füßen befand sich eine Reihe von sich überlappenden, unterschiedlich großen Kreisen. In jedem davon stand eine unbekannte Rune.
»Du musst lernen, die Worte der Macht zu lesen, bevor du das Chaos deinem Willen beugen kannst.«
Obwohl Cassandra noch ein Kind war, wusste sie, dass er ihr nicht die ganze Wahrheit sagte. Die Runen waren nur eine Gedächtnishilfe. Sie halfen Gedankenmuster zu erzeugen, die es dem Verstand erlaubten, sich richtig zu fokussieren. Aber die wahre Macht, die das Chaos kontrollierte, kam von innen.
»Sei nicht so dickköpfig, Kind«, sagte Rexol, obwohl sie ihre Zweifel nicht einmal laut ausgesprochen hatte. »Die Krone ist viel zu mächtig, als dass man sie ohne richtige Ausbildung benutzen könnte. Lass mich dir helfen.«
»Nein!«, schrie Cassandra. Das Geräusch ihrer eigenen Stimme in dem Traum weckte sie auf.
Cassandras blinde Augen öffneten sich. Es war ein instinktiver Reflex, der eigentlich keinen Zweck mehr erfüllte. Die Welt ihres Traums versank rasch, als ihre übernatürliche Wahrnehmung die fehlenden Stücke ihrer Umgebung hervortreten ließ. Sie lag unter einer Decke auf einem kleinen Bett. Ihre Beine waren geschient und bandagiert. Ein niedriges Feuer brannte in einer Ecke des Zimmers. In der anderen standen ein Tisch und ein Schreibpult. Die Krone lag neben ihr auf der Matratze, vor neugierigen Augen durch den einfachen Sack verborgen, in dem sie sie seit ihrer Flucht aus dem Monasterium getragen hatte.
Die einzige Tür zu der Kammer war geschlossen, aber mit dem Auge ihres Verstandes konnte sie Methodis erkennen, den gelehrten Heiler, der sich um sie kümmerte. Er werkelte in der Apotheke herum, die auf der anderen Seite lag. Er bewegte sich zielstrebig und ruhig, als er den Inhalt von Phiolen und Krügen auf den vielen Regalen überprüfte.
Er hofft, dass er dir die Krone stehlen kann!, warnte sie Rexols Stimme in ihrem Kopf.
Cassandra ignorierte ihn. Hätte Methodis tatsächlich das Artefakt haben wollen, hätte er es ihr leicht wegnehmen können, als er sie fand. Sie hatte bewusstlos in den Trümmern des Erdbebens gelegen, das Rexol ausgelöst hatte, als der wahnsinnige Hexer versucht hatte, sich ihres Körpers zu bemächtigen, um seiner Gefangenschaft in der Krone zu entkommen.
Ich habe dich gerettet!, protestierte Rexol. Ich habe die kriechenden Zwillinge aufeinander gehetzt. Wäre ich nicht gewesen, hätten sie dich in Fetzen gerissen.
»Und dann hast du fast Callastan ausgelöscht, als die Krone dich überwältigt hat«, flüsterte Cassandra und gab ihren Versuch auf, ihn zu ignorieren.
Aber du bist stärker als ich, konterte Rexol. Ich verstehe das Chaos auf eine Art und Weise, wie es der Orden niemals vermag. Ich kann dich lehren, wie du deine Macht beherrschen kannst. Und damit die Krone.
Statt den Streit fortzuführen, dachte Cassandra wieder an ihren Traum. Es war keine Erinnerung, jedenfalls keine echte. Der Orden hatte sie von Rexol fortgebracht, als sie erst sechs Jahre alt gewesen war. Aber in dem Traum war sie älter gewesen, mindestens neun oder zehn Jahre. Und in diesem Traum hatte sie auch noch ihre strahlend smaragdgrünen Augen statt der weißen Augäpfel, die Cassandras freiwilliges Opfer symbolisierten, als sie ihre Sehkraft aufgab, um die mystische Sicht des Ordens zu erlangen.
Ich habe dir gezeigt, was hätte sein können, fuhr Rexol hartnäckig fort. Was hätte passieren sollen, wenn du mir nicht weggenommen worden wärest.
»Versuchst du jetzt auf diese Art, mich zu beherrschen?«, wollte sie wissen. »Durch meine Träume?«
Rexol antwortete nicht, und eine Sekunde später klopfte jemand an die Tür. Mit ihrer Wahrnehmung sah Cassandra ganz deutlich Methodis auf der anderen Seite, der geduldig darauf wartete, bis sie antwortete. In einer Hand hielt er einen Becher mit einer dicken wolkigen Flüssigkeit. Unter dem anderen Arm klemmte eine Rolle Tuch, das den Bandagen ähnelte, mit dem die Schienen an ihre Beine gebunden waren.
»Herein!«, rief sie.
»Ich hoffe, ich störe dich nicht«, sagte Methodis, als er die Tür öffnete und in den Raum trat. »Aber ich habe dich reden hören und folgerte daraus, dass du schon wach bist.«
Er fragte sie nicht, mit wem sie gesprochen hatte, obwohl außer ihr niemand in dem Raum war.
Habe ich oft mit Rexol geredet?, fragte sie sich unwillkürlich. Obwohl sie jetzt einen klaren Kopf hatte, war die Erinnerung an die letzten Tage immer noch ein wenig undeutlich. Es war durchaus möglich, dass er häufig ihre einseitige Unterhaltung belauscht hatte. Er muss mich für verrückt halten oder denken, dass ich wegen meiner Verletzungen im Fieberwahn geredet habe.
»Wie lange bin ich hier gewesen?«, fragte sie laut.
»Neun Tage sind verstrichen, seit ich dich in den Trümmern dieses Gefängnisses gefunden habe«, antwortete der Heiler. Er ging durch den Raum und stellte den Becher auf den Tisch neben ihrem Bett, nur ein paar Zentimeter von dem Beutel entfernt, in dem die Krone lag.
Er humpelt, bemerkte Rexol. Er klang fast eifersüchtig. Schwach, aber erkennbar. Eine alte Verletzung, die nie richtig verheilt ist.
Wenn er das versteckt, fuhr der Hexer nach einer Weile fort, was enthält er dir dann wohl noch vor? Welche anderen Täuschungsmanöver wird er versuchen?
Cassandra erkannte die Paranoia in seinen Selbstgesprächen und ging nicht darauf ein.
Der Heiler setzte sich auf den Rand ihres Bettes und legte die Bandagen neben sich. Dabei achtete er darauf, seine Patientin nicht mehr zu bewegen oder zu stören, als absolut notwendig war.
»Ich kann nicht glauben, dass ich schon neun Tage hier bin«, bemerkte Cassandra. Nach dem, woran sie sich erinnerte, hätte sie vermutet, dass es sich höchstens um drei oder vier Tage handelte.
»Ich habe dir etwas verabreicht, um den Schmerz zu lindern«, erklärte Methodis und deutete auf den Becher mit der wolkigen Flüssigkeit auf dem kleinen Tischchen. »Du hast sehr viel von dieser Zeit verschlafen.«
»Du hast mich die ganze Zeit hier behalten? Und dich um mich gekümmert?«
Er nickte.
»Weiß noch jemand, dass ich hier bin?«
»Möglich«, antwortete er. »Aber ich habe dich, in einen Umhang gewickelt, aus dem Gefängnis geschleppt. Dasselbe habe ich mit den Resten der Wächter getan. Die Leute im Viertel glauben, dass es keine Überlebenden gegeben hat. Aber wenn der Orden nach dir sucht«, fuhr er fort, »würdest du wahrscheinlich erheblich schneller merken als ich, ob sie dich hierher verfolgen können.«
Nicht nur der Orden sucht nach dir, rief Rexol ihr ins Gedächtnis.
Obwohl sie ihm nicht antwortete, war ihr klar, dass seine Worte zutrafen. Die kriechenden Zwillinge waren nicht die einzigen Knechte, die der Schlächter ins Reich der Sterblichen geschickt hatte. Die Schattenjägerin, die sie durch den Eisigen Osten verfolgt hatte, konnte durchaus immer noch nach ihr suchen. Und vielleicht gab es sogar noch andere.
»Es ist nicht sicher, wenn ich bleibe.« Sie bemühte sich, trotz ihrer geschienten Beine aufzustehen.
Methodis legte sanft eine Hand auf ihren Arm und hielt sie auf.
»In deinem Zustand kannst du nirgendwohin gehen«, erinnerte er sie. Er deutete mit dem Kopf auf ihre geschienten Beine. »Du musst still liegen bleiben.«
Ich werde dich verstecken, versicherte Rexol ihr. Ich habe die Krone benutzt, um ein Labyrinth aus falschen Spuren durch die ganze Stadt zu legen. Wenn du mich lässt, kann ich dir zeigen, wie du das selbst ebenfalls tun kannst.
Diese Spuren haben aber die kriechenden Zwillinge nicht täuschen können, erinnerte Cassandra ihn. Früher oder später wird ein anderer Knecht von Daemron nach mir suchen.
Ich kann dich lehren, die Krone zu benutzen, um sie zu vernichten!, erinnerte Rexol sie.
»Ich würde gern die Verletzungen an deinen Beinen untersuchen«, sagte Methodis und brach das Schweigen, das sich wegen ihres lautlosen Dialogs in dem Raum ausgebreitet hatte. »Um mich davon zu überzeugen, dass sie richtig heilen.«
Cassandra nickte, und der kleine Mann lächelte beruhigend.
»Ich versuche, vorsichtig zu sein«, warnte Methodis sie. »Aber es kann trotzdem wehtun. Du hattest sehr schwere Verletzungen.«
Er machte sich behutsam daran, den Verband abzuwickeln, der die Schiene an ihrem linken Bein hielt. Er berührte sie sanft, aber zuversichtlich und geübt, und so dauerte es nicht lange, bis er den Verband entfernt hatte und das Bein vor ihm lag.
»Das … habe ich nicht erwartet«, sagte er, als er fertig war. Er klang verdutzt.
»Stimmt etwas nicht?«
»Ganz im Gegenteil. Deine Verletzung heilt viel besser, als ich hätte hoffen können.«
Sein Tonfall sagte Cassandra, dass er ihr etwas verschwieg. »Ist das nicht gut?«
Methodis zögerte, bevor er antwortete.