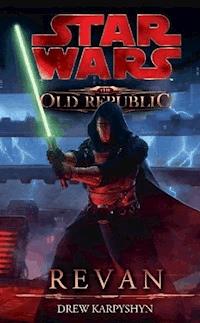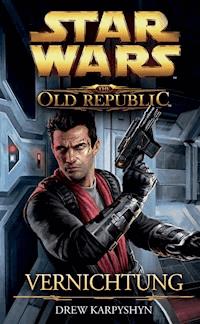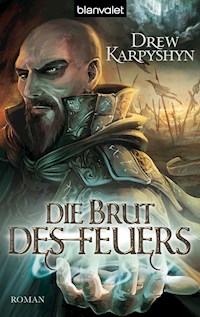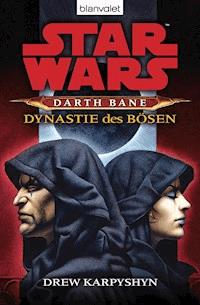
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Darth Bane
- Sprache: Deutsch
Der dritte Bestseller-Roman um den düsteren, geheimnisvollen Darth Bane
Darth Bane selbst schuf die Regel der Zwei – ein Sith-Lord, ein Schüler. Nur wenn ein Schüler seinen Meister tötet, kann er selbst zum Lord aufsteigen. Darth Bane erkennt, dass die Herausforderung seiner Schülerin Zannah kurz bevorsteht. Doch er hat bereits Hinweise auf ein Wissen gesammelt, das ihn unbezwingbar machen würde. Kein Sith könnte ihn dann noch herausfordern – und die Herrschaft der dunklen Seite der Macht über die Galaxis wäre gesichert!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Drew Karpyshyn
Dynastie des Bösen
Darth Bane 3
Aus dem Englischen
von Andreas Kasprzak
Für meine Frau Jennifer.
Jetzt, da wir ein neues Kapitel unseres Lebens beginnen,
gibt es niemanden, mit dem ich es lieber teilen würde.
Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis …
Dramatis Personae
DARTH BANE; Dunkler Lord der Sith (Mensch)
DARTH ZANNAH; Sith-Schülerin (Mensch)
DIE JÄGERIN; Attentäterin (Iktotchi)
LUCIA; Leibwächterin (Mensch)
SERRA; Prinzessin (Mensch)
SET HARTH; Dunkler Jedi (Mensch)
Prolog
Darth Bane, der aktuelle Dunkle Lord der Sith, trat die Decke beiseite, schwang seine Füße über die Bettkante und setzte sie auf den kalten Marmorboden. Er neigte den Kopf von einer Seite zur anderen, um die Verspannungen im muskelbepackten Nacken und in den Schultern zu lösen.
Schließlich erhob er sich mit einem vernehmlichen Murren. Er nahm einen tiefen Atemzug, atmete langsam wieder aus und reckte die Arme hoch über den Kopf, als er sich zur vollen Größe von zwei Metern aufrichtete. Er konnte das knackende Popp-Popp-Popp förmlich spüren, mit dem sich jeder einzelne Wirbel entlang des Rückgrats beim Strecken lockerte, bis seine Fingerspitzen schließlich über die Decke strichen.
Zufrieden ließ er die Arme sinken und schnappte sich sein Lichtschwert vom verschnörkelten Nachttisch neben dem Bett. Das geschwungene Heft in seinem Griff fühlte sich beruhigend an. Vertraut. Zuverlässig. Dennoch verhinderte der Umstand, die Waffe zu halten, nicht, dass seine freie Hand unmerklich zitterte. Stirnrunzelnd ballte er die linke Hand zur Faust. Die Finger gruben sich in das Fleisch der Handfläche – eine grobe, aber wirkungsvolle Methode, das Zittern zu bändigen.
Er glitt lautlos aus der Schlafkammer und in die Gänge der Villa hinaus, die er jetzt sein Zuhause nannte. Hell leuchtende Wandteppiche bedeckten die Mauern, und bunte, handgewebte Läufer säumten die Flure, als er sich seinen Weg an einem Raum nach dem anderen vorbei bahnte, von denen jeder einzelne mit maßgefertigten Möbelstücken, seltenen Kunstgegenständen und anderen unverkennbaren Symbolen für Wohlstand dekoriert war. Er brauchte fast eine Minute, um das Gebäude zu durchqueren und zur Hintertür zu gelangen, die hinaus auf das unter freiem Himmel gelegene Grundstück führte, das sein Anwesen umgab.
Barfuß und von der Hüfte aufwärts nackt, fröstelte er und blickte auf das abstrakte Steinmosaik des Hofs hinab, das vom Licht der Zwillingsmonde von Ciutric IV erhellt wurde. Gänsehaut kroch über sein Fleisch, doch er ignorierte den Nachtfrost, aktivierte sein Lichtschwert und begann, die aggressiven Angriffsformen des Djem So zu trainieren.
Seine Muskeln ächzten protestierend, seine Gelenke knackten und knirschten, als er gewissenhaft eine Vielzahl von Schlagabfolgen durchging. Hieb. Finte. Stoß. Seine Fußsohlen schlugen leise auf die Oberfläche des Hofpflasters, ein sporadisch einsetzender Rhythmus, der den Fortschritt jedes Angriffs und jedes Rückzugs gegen seinen imaginären Widersacher markierte.
Die letzten Überbleibsel von Schlaf und Müdigkeit klammerten sich hartnäckig an seinen Leib, stachelten die winzige innere Stimme an, die ihn drängte, sein Training aufzugeben und in die Behaglichkeit seines Bettes zurückzukehren. Bane brachte die Stimme zum Schweigen, indem er im Stillen die Eröffnungszeile des Sith-Kodex rezitierte: Frieden ist eine Lüge, es gibt nur Leidenschaft.
Zehn Standardjahre waren vergangen, seit er seine Orbaliskenrüstung verloren hatte. Zehn Jahre, seit sein Körper durch die verheerende Kraft von Machtblitzen, die er selbst entfesselt hatte, fast bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war. Zehn Jahre, seit der Heiler Caleb ihn von den Klippen des Todes zurückgeholt und Zannah, seine Schülerin, Caleb und die Jedi abgeschlachtet hatte, die gekommen waren, um ihn zu suchen.
Dank Zannahs manipulativer Machenschaften glaubten die Jedi jetzt, dass die Sith ausgelöscht seien. Das Jahrzehnt, das seit jenen Ereignissen vergangen war, hatten Bane und seine Schülerin darauf verwandt, diesen Mythos zu nähren: Sie hielten sich im Verborgenen auf, mehrten ihre Ressourcen und bewahrten sich ihre Kraft für den Tag, an dem sie zum Gegenschlag gegen die Jedi ausholen würden. An diesem glorreichen Tag würden sich die Sith zu erkennen geben, während sie ihre Feinde in tödliches Vergessen fegten.
Bane wusste, dass er womöglich nicht lange genug leben würde, um jenen Tag zu erleben. Er war jetzt Mitte vierzig, und die ersten schwachen Narben der Zeit und des Alters hatten ihre Male auf seinem Körper hinterlassen. Dennoch gab er sich ganz der Vorstellung hin, dass die Sith – seine Sith – eines Tages über die Galaxis herrschen würden, selbst wenn es bis dahin Jahrhunderte dauern mochte.
Während er weiter das Ziehen und die Schmerzen ignorierte, die die erste Hälfte seines nächtlichen Trainings begleiteten, wurden Banes Bewegungen allmählich schneller. Die Luft zischte und knisterte, als sie ein ums andere Mal von der blutroten Klinge gespalten wurde, die zu einer Verlängerung seines unbeugsamen Willens geworden war.
Er war nach wie vor eine beeindruckende Gestalt. Die kräftigen Muskeln, die im Laufe einer Jugend voller Arbeit in den Minen von Apatros aufgebaut worden waren, wogten unter der Haut, wölbten sich bei jedem Hieb und Stoß seines Lichtschwerts. Gleichwohl, ein kleines bisschen der brachialen Kraft, die er einst besaß, war im Laufe der Zeit verloren gegangen.
Er sprang hoch in die Luft, und sein Lichtschwert beschrieb über seinem Kopf einen Bogen, bevor es geradewegs nach unten hackte, in einem einzigen Schlag, der wuchtig genug war, um einen Gegner in zwei Hälften zu spalten. Er kam mit einem scharfen, abrupten Klatschen der Füße auf der harten Oberfläche des Hofpflasters auf. Bane bewegte sich immer noch mit grimmiger Anmut und Furcht einflößender Intensität. Sein Lichtschwert schwirrte noch immer mit verblüffender Flinkheit umher, als er seine Kampfübungen absolvierte, auch wenn er heute einen winzigen Bruchteil langsamer war als ehedem.
Der Alterungsprozess war subtil, aber unausweichlich. Bane fand sich damit ab – was er an Kraft und Tempo eingebüßt hatte, konnte er mit Weisheit, Wissen und Erfahrung mühelos wettmachen. Doch es war nicht das Alter, welches Schuld war an dem unfreiwilligen Zittern, das zuweilen seine linke Hand befiel.
Ein Schatten schob sich vor einen der Zwillingsmonde, eine schwere, dunkle Wolke, die die Drohung eines heftigen Gewitters in sich trug. Bane hielt inne und erwog flüchtig, sein tägliches Ritual zu verkürzen, um dem bevorstehenden Regenguss zu entgehen. Indes, seine Muskeln waren jetzt warm, und das Blut pumpte wild durch seine Venen. Die unbedeutenden Schmerzen waren verschwunden, verbannt vom Adrenalinschub intensiven körperlichen Trainings. Jetzt war nicht der Moment, um aufzuhören.
Als er eine Bö kalten Windes heranrauschen fühlte, kauerte er sich tief nieder und öffnete sich der Macht, um sie durch sich hindurchfließen zu lassen. Er zapfte sie an, um sein Bewusstsein so weit auszudehnen, dass es jeden individuellen Regentropfen umfasste, der vom Himmel herabfiel, entschlossen, dafür zu sorgen, dass kein einzelner Tropfen sein nacktes Fleisch berührte.
Er konnte spüren, wie sich die Kraft der Dunklen Seite in ihm aufstaute. Wie immer begann es mit einem schwachen Funken, einem winzigen Aufflackern von Helligkeit und Wärme. Muskeln spannten sich an und verkrampften sich vor Erwartung, er nährte den Funken, befeuerte ihn mit eigener Leidenschaft, sorgte dafür, dass Wut und Zorn die Flamme in ein Inferno verwandelten, das nur darauf wartete, entfesselt zu werden.
Als die ersten dicken Tropfen rings um ihn her auf das Hofpflaster prasselten, explodierte Bane förmlich. Er gab den auf das Überwältigen des Gegners ausgelegten Kampfstil des Djem So auf und verfiel auf die flinkeren Bewegungsfolgen des Soresu. Sein Lichtschwert drehte über dem Kopf in einer Reihe von Bewegungen enge Kreise, die eigentlich dazu gedacht waren, feindliche Blasterschüsse abzufangen.
Der Wind schwoll zu einem heulenden Sturm an, und die vereinzelten Tropfen wurden rasch zu einem Platzregen. Körper und Geist wurden eins, und er kanalisierte die grenzenlose Energie der Macht, um dem peitschenden Regen zu trotzen. Winzige Wolken zischenden Wasserdampfs bildeten sich, als Banes Klinge die herabfallenden Tropfen auffing, während er herumwirbelte, sich verbog und den Körper verdrehte, um den paar Tropfen auszuweichen, die es schafften, durch seine Verteidigung zu schlüpfen.
In den nächsten zehn Minuten kämpfte er gegen den niederprasselnden Sturm und badete in der Kraft der Dunklen Seite. Und dann war das Gewitter so unvermittelt vorüber, wie es eingesetzt hatte – die dunkle Wolke wurde von der Brise fortgetragen. Schwer atmend deaktivierte Bane das Lichtschwert. Seine Haut glänzte vor Schweiß, doch kein einziger Tropfen Regen hatte sein bloßes Fleisch berührt.
Auf Ciutric traten plötzliche Unwetter fast jede Nacht auf, besonders hier, in dem üppigen Wald in den Außenbereichen der Hauptstadt Daplona. Jedoch fiel diese unbedeutende Unannehmlichkeit nicht weiter ins Gewicht, wenn man die ganzen Vorzüge dagegenhielt, die der Planet zu bieten hatte.
Im Äußeren Rand gelegen, weit weg vom Zentrum der galaktischen Macht und den neugierigen Augen des Jedi-Rats, hatte Ciutric das Glück, am Knotenpunkt mehrerer Hyperraum-Handelsrouten zu liegen. Auf dem Planeten machten regelmäßig Raumschiffe Halt, was eine kleine, aber hoch profitable Industriegesellschaft nach sich gezogen hatte, die sich auf Handel und Transport konzentrierte.
Noch wichtiger für Bane war, dass der stete Strom von Reisenden aus Regionen überall in der Galaxis ihm leichten Zugriff auf Kontakte und Informationen verschaffte, was es ihm erlaubte, sich ein Netzwerk von Informanten und Handlangern aufzubauen, das er persönlich beaufsichtigen konnte.
Wäre sein Körper noch immer von Orbalisken bedeckt gewesen – einer Schar chitingepanzerter Parasiten, die sich im Austausch für die Kraft und den Schutz, den sie boten, an seinem Fleisch labten –, wäre ihm das unmöglich gewesen. Seine lebendige Rüstung hatte ihn im Kampf Mann gegen Mann praktisch unbesiegbar gemacht, doch ob des monströsen Aussehens musste er sich vor den Augen der Galaxis verborgen halten.
Damals waren seine Pläne, Reichtum, Einfluss und politische Macht zu erlangen, von seiner körperlichen Abnormität zunichtegemacht worden. Zu einem Leben in Einsamkeit gezwungen, damit die Jedi nichts von seiner Existenz erfuhren, hatte er sich Boten und Laufburschen bedienen müssen, um seine Angelegenheiten zu regeln. Er hatte sich darauf verlassen, dass Zannah als seine Augen und Ohren fungierte. Alle Informationen, die er erhielt, erreichten ihn durch sie. Jedes Vorhaben und jede Aufgabe erledigten ihre fähigen Hände. Als Folge davon war Bane gezwungen gewesen, vorsichtiger vorzugehen, seine Bemühungen zu verlangsamen und seine Pläne hinauszuschieben.
Jetzt lagen die Dinge anders. Er war immer noch eine Respekt gebietende Gestalt, wenn man ihn sah, jedoch nicht mehr als jeder andere Söldner, Kopfgeldjäger oder Soldat im Ruhestand. In die typischen Gewänder ihres angenommenen Heimatplaneten gekleidet, fiel er eher wegen seiner Größe ins Auge als wegen irgendetwas anderem – auffällig, aber schwerlich einzigartig. Er war imstande, mit der Menge zu verschmelzen, sich mit jenen abzugeben, die Informationen besaßen, und Beziehungen zu nützlichen politischen Verbündeten zu schmieden.
Er musste sich nicht länger verstecken, da er jetzt in der Lage war, sein wahres Selbst hinter einer Scheinidentität zu verbergen. Zu diesem Zweck hatte Bane ein kleines Anwesen ein paar Minuten außerhalb von Daplona erworben. Zannah und er gaben sich als die Geschwister Allia und Sepp Omek aus, wohlhabende Import-Export-Händler, und es war ihnen gelungen, ihre neuen Identitäten in den einflussreichen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Kreisen des Planeten zu kultivieren.
Ihr Anwesen war nah genug bei der Stadt, um ihnen leichten Zugang zu allem zu gewähren, was Ciutric zu bieten hatte, lag jedoch isoliert genug, um Zannah zu erlauben, ihre Studien der Wege der Sith fortzusetzen. Stagnation und Selbstgefälligkeit waren die Saat, die zur ultimativen Vernichtung der Jedi führen würden. Als Dunkler Lord musste Bane sorgsam darauf bedacht sein zu verhindern, dass sein eigener Orden in dieselbe Falle tappte. Es war notwendig, seine Schülerin nicht bloß auszubilden, sondern auch die eigenen Fähigkeiten und das eigene Wissen weiter zu mehren.
Ein frostiger Hauch wehte über den Hof, um Banes schweißgebadeten Leib abzukühlen. Für heute Abend war sein körperliches Training abgeschlossen. Jetzt war es an der Zeit, mit der wirklich wichtigen Arbeit zu beginnen.
Ein paar Dutzend große Schritte führten ihn zu einem kleinen Anbau an der Rückseite des Anwesens. Die Tür war verschlossen, mit einem codierten Sicherheitssystem verriegelt. Er tippte die Ziffern ein, stieß die Tür behutsam auf und betrat das Gebäude, das ihm als Privatbibliothek diente.
Das Innere des Anbaus bestand aus einem einzigen quadratischen Raum von fünf Metern Länge, der allein vom weichen Schein einer einzigen Lichtquelle erhellt wurde, die von der Decke hing. Die Wände wurden von Regalen gesäumt, die sich unter dem Gewicht von Schriftrollen, Folianten und Manuskripten bogen, welche er im Laufe der Jahre zusammengetragen hatte: die Lehren der alten Sith. In der Mitte des Raums thronten ein großes Podest und ein kleines Pult. Auf dem Pult ruhte der größte Schatz des Dunklen Lords: sein Holocron.
Das Holocron, eine vierseitige Kristallpyramide, die klein genug war, dass sie auf der Handfläche Platz fand, barg die Summe von Banes ganzem Wissen und Verstand. Alles, was er je über die Wege der Dunklen Seite gelernt hatte – all seine Lehren, all seine Philosophien –, waren in das Holocron übertragen worden, gespeichert für alle Ewigkeit. Das war sein Vermächtnis, eine Möglichkeit, ein ganzes Leben an Weisheit mit jenen zu teilen, die ihm in der Linie der Sith-Meister nachfolgen würden.
Nach seinem Tode würde das Holocron an Zannah fallen – vorausgesetzt, sie konnte eines Tages beweisen, dass sie stark genug war, ihm die Position des Dunklen Lords abzuringen. Bane war sich nicht mehr so sicher, dass dieser Tag noch kommen würde.
In der einen oder anderen Form hatten die Sith Tausende von Jahren lang existiert. Im Laufe ihrer Existenz hatten sie einen endlosen Krieg gegen die Jedi geführt … und gegeneinander. Wieder und wieder hatten ihre eigenen Rivalitäten und internen Machtkämpfe den Anhängern der Dunklen Seite einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Durch die lange Geschichte des Sith-Ordens zog sich eins wie ein roter Faden: Jeder große Anführer würde unvermeidlich von einem Bündnis der eigenen Gefolgsleute gestürzt. Und wenn ihnen ein starker Anführer fehlte, wandten sich die niederen Sith rasch gegeneinander, um den Orden so noch mehr zu schwächen.
Von allen Sith-Meistern hatte einzig und allein Bane die unausweichliche Sinnlosigkeit dieses Kreislaufs begriffen. Und bloß er war stark genug gewesen, um ihn zu durchbrechen. Unter seiner Führerschaft waren die Sith wiedergeboren worden. Nun waren sie immer bloß zu zweit – ein Meister und ein Schüler. Einer, der die Macht verkörpert, ein anderer, der sie begehrt.
Auf diese Weise würde die Macht der Sith stets vom Stärksten an seinen würdigsten Nachfolger übergehen. Banes Regel der Zwei stellte sicher, dass die Macht des Meisters und des Schülers von Generation zu Generation wuchs, bis die Sith schließlich imstande sein würden, die Jedi auszulöschen und die Galaxis in ein neues Zeitalter zu führen.
Das war der Grund, warum Bane Zannah zu seiner Schülerin erkoren hatte: Sie besaß das Potenzial, eines Tages selbst seine eigenen Fähigkeiten zu übertreffen. An jenem Tage würde sie ihn als Dunklen Lord der Sith vom Thron stoßen und sich einen eigenen Schüler erwählen. Bane würde sterben, doch die Sith würden weiterleben.
Zumindest hatte er das einst geglaubt. Jetzt jedoch regten sich Zweifel in seinem Kopf. Zwei Jahrzehnte waren vergangen, seit er das damals zehnjährige Mädchen auf den Schlachtfeldern von Ruusan aufgelesen hatte, doch Zannah schien immer noch damit zufrieden, bloß zu dienen. Sie hatte seine Lektionen in sich aufgesogen und eine unglaubliche Verbundenheit mit der Macht gezeigt. Im Laufe der Jahre hatte Bane ihren Fortschritt sorgsam verfolgt, und nun vermochte er nicht mehr mit Gewissheit zu sagen, wer von ihnen beiden einen Zweikampf überleben würde. Doch ihr Widerwille, ihm die Stirn zu bieten, hatte dafür gesorgt, dass ihr Meister sich fragte, ob es Zannah an dem unerbittlichen Ehrgeiz mangelte, der nötig war, um seine Nachfolge als Dunkler Lord der Sith anzutreten.
Er betrat die Bibliothek und streckte seine linke Hand aus, um die Tür hinter sich zu schließen. Dabei bemerkte er das allzu vertraute Zittern seiner Finger. Er riss die Hand unwillkürlich zurück und ballte sie ein weiteres Mal zur Faust, als er die Tür zutrat.
Das Alter forderte langsam seinen Tribut von Bane, doch das war nichts, verglichen mit der Last, die seinem Körper bereits dadurch zu schaffen machte, seine Kraft jahrzehntelang von der dunklen Seite der Macht bezogen zu haben. Er konnte nicht umhin, die grausame Ironie dieses Umstands zu belächeln: Durch die Dunkle Seite hatte er Zugriff auf nahezu grenzenlose Kraft, doch diese Kraft hatte einen schrecklichen Preis. Fleisch und Knochen mangelte es an der Stärke, der unfassbaren Energie standzuhalten, die von der Macht entfesselt wurde. Das unauslöschliche Feuer der Dunklen Seite verzehrte ihn, verschlang ihn Stück für Stück. Nachdem er ihre Kraft jahrzehntelang fokussiert und kanalisiert hatte, baute sein Körper nun mehr und mehr ab.
Sein Zustand wurde noch verschlimmert durch die andauernden Folgewirkungen der Orbaliskenrüstung, die ihn praktisch umgebracht hatte, während sie ihn gleichzeitig mit unglaublicher Stärke und Gewandtheit segnete.
Dieselben Parasiten, die seinen Körper weit über die natürlichen Grenzen hinaus angetrieben hatten, ließen ihn vor seiner Zeit altern und verstärkten den Verfall, den die Macht der Dunklen Seite ohnehin schon bei ihm bewirkte. Die Orbalisken waren jetzt fort, doch der Schaden, den sie angerichtet hatten, ließ sich nicht wieder ungeschehen machen.
Die ersten äußerlichen Anzeichen seiner nachlassenden Gesundheit waren unscheinbar gewesen: Seine Augen waren eingesunken und hatten abgespannt gewirkt, seine Haut war einen Hauch blasser und pockennarbiger geworden, als es für sein Alter üblich war. Letztes Jahr jedoch hatte sich der Verfall verschlimmert und in dem ungewollten Zittern gegipfelt, das seine linke Hand mit zunehmender Regelmäßigkeit befiel.
Und es gab nichts, was er dagegen tun konnte. Die Jedi konnten sich auf die Helle Seite berufen, um Verletzungen und Krankheiten zu kurieren. Doch die Dunkle Seite war eine Waffe; die Kranken und Schwachen verdienten es nicht, geheilt zu werden. Allein die Starken waren des Überlebens würdig.
Er hatte versucht, das Zittern vor seiner Schülerin zu verbergen, doch Zannah war zu gescheit, zu schlau, um ein derart offensichtliches Zeichen der Schwäche bei ihrem Meister zu übersehen.
Bane hatte erwartet, dass das Zittern der Auslöser sein würde, den Zannah brauchte, um gegen ihn aufzubegehren. Aber selbst jetzt, wo sein Körper unleugbare Anzeichen seiner zunehmenden Verletzlichkeit zeigte, schien es ihr zu genügen, den Status quo zu bewahren. Bane wusste nicht, ob sie sich aus Furcht, Unentschlossenheit oder vielleicht sogar aus Mitgefühl ihrem Meister gegenüber so verhielt – doch keiner dieser Charakterzüge war bei jemandem hinnehmbar, der sein Vermächtnis fortführen sollte.
Natürlich gab es noch eine andere mögliche Erklärung – die jedoch die beunruhigendste von allen war. Es war möglich, dass Zannah seine nachlassenden Fähigkeiten bemerkt und einfach beschlossen hatte zu warten. In fünf Jahren würde sein Körper bloß noch eine verkümmerte Schale sein, und dann konnte sie ihn praktisch ohne Risiko erledigen.
Unter den meisten Umständen hätte Bane diese Strategie bewundert, doch in diesem Fall widersprach sie dem fundamentalsten Grundsatz der Regel der Zwei. Ein Schüler musste sich den Titel des Dunklen Lords verdienen, indem er ihn seinem Meister bei einem Zweikampf abrang, der beide an die Grenzen ihrer Möglichkeiten trieb. Falls Zannah beabsichtigte, ihm erst die Stirn zu bieten, wenn Krankheit und Gebrechen ihn zeichneten, dann hatte sie nicht das Zeug dazu, seine Nachfolgerin zu werden. Dennoch war Bane nicht gewillt, ihre Konfrontation selbst vom Zaun zu brechen. Denn wenn er fiel, würden die Sith in diesem Fall von einer Meisterin beherrscht werden, die die Grundprinzipien nicht akzeptierte oder verstand, auf denen der neue Orden gegründet worden war. Und falls er siegte, würde er ohne einen Schüler zurückbleiben, und sein Körper würde ihm den Dienst versagen, lange bevor er sich einen neuen suchen und ihn angemessen ausbilden konnte.
Es gab bloß eine Lösung: Bane musste eine Möglichkeit finden, sein Leben zu verlängern. Er musste einen Weg finden, seinen Körper wiederherzustellen und zu verjüngen … oder ihn zu ersetzen. Vor einem Jahr hätte er gedacht, dass so etwas unmöglich sei. Jetzt wusste er es besser.
Er nahm einen dicken Folianten von einem der Regalbretter herunter, dessen Ledereinband vernarbt war, die Seiten gelb und vom Alter brüchig. Mit sorgsamen Bewegungen legte er den Band auf das Pult und schlug ihn bei der Seite auf, die er letzte Nacht markiert hatte.
Wie die meisten der Bücher in den Regalen seiner Bibliothek, hatte er auch dieses von einem privaten Sammler erworben. Die Galaxis mochte vielleicht glauben, die Sith seien ausgerottet, doch die Dunkle Seite übte nach wie vor eine unerbittliche Anziehungskraft auf die Psyche von Männern und Frauen aller Spezies aus, und unter den Reichen und Mächtigen florierte das Geschäft mit illegalen Sith-Requisiten.
Die Bemühungen der Jedi, alles aufzuspüren und zu beschlagnahmen, was mit den Sith in Verbindung gebracht werden konnte, hatten lediglich die Preise in die Höhe getrieben und die Sammler dazu gezwungen, über Mittelsmänner zu agieren, um ihre Anonymität zu wahren.
Das passte perfekt in Banes Plan. Es war ihm gelungen, seine Bibliothek zusammenzutragen und auszubauen, ohne Angst haben zu müssen, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen: Er war bloß ein weiterer Sith-Fetischist, ein weiterer anonymer Sammler, der von der Dunklen Seite besessen und bereit war, ein kleines Vermögen auszugeben, um verbotene Manuskripte und Artefakte in seinen Besitz zu bringen.
Das meiste von dem, was er erworben hatte, war kaum von Nutzen: Amulette oder Schmuckstücke mit geringer Macht; Abschriften von Geschichtsbänden, die er sich schon vor langer Zeit während seiner Studien auf Korriban eingeprägt hatte; unvollständige Werke, die in unlesbaren, seit Langem toten Sprachen verfasst worden waren. Hin und wieder jedoch hatte er das Glück, auf einen Schatz von ungeheurem Wert zu stoßen.
Das abgegriffene, zerfledderte Buch vor ihm war ein solcher Schatz. Einer seiner Handlanger hatte es vor einigen Monaten erworben – ein Ereignis, das zu zufällig gewesen war, um als Glück durchzugehen. Die Wege der Macht waren unergründlich, und Bane glaubte, dass das Buch dazu bestimmt gewesen war, ihm in die Hände zu fallen – als Lösung für sein Problem.
Wie beim Großteil seiner Sammlung handelte es sich dabei um einen historischen Bericht über die alten Sith. Die meisten Seiten enthielten Namen, Daten und andere Informationen, die für Bane keinen praktischen Nutzen besaßen. Allerdings gab es einen kurzen Abschnitt, der einen flüchtigen Hinweis auf einen Mann namens Darth Andeddu enthielt. Dem Bericht zufolge hatte Andeddu jahrhundertelang gelebt, indem er die Dunkle Seite der Macht benutzte, um sein Leben zu verlängern und seinen Körper weit über seine natürliche Zeitspanne hinaus zu bewahren.
Gemäß der typischen Tradition der Sith vor Banes Reformen, hatte Andeddus Herrschaft schließlich ein gewaltsames Ende gefunden, als er von seinen Gefolgsleuten betrogen und gestürzt worden war. Allerdings war sein Holocron, der Verwahrungsort seiner größten Geheimnisse – einschließlich des Geheimnisses des nahezu ewigen Lebens –, niemals gefunden worden.
Das war alles: insgesamt weniger als zwei Seiten. In dem kurzen Abschnitt wurde nicht erwähnt, wo oder wann Andeddu gelebt hatte. Man erfuhr nicht, was aus seinen Anhängern geworden war, nachdem sie ihn gestürzt hatten. Doch eben dieser Mangel an Informationen war es, der Banes Fundstück so unwiderstehlich machte.
Warum gab es so wenige Einzelheiten? Warum war er in den ganzen vorigen Jahren seiner Studien niemals auf irgendwelche Hinweise auf Darth Andeddu gestoßen?
Dafür gab es bloß eine einzige sinnvolle Erklärung: Den Jedi war es gelungen, ihn aus den galaktischen Aufzeichnungen zu löschen. Im Laufe der Jahrhunderte hatten sie jedes Datapad, jede Holodisk und jedes Schriftwerk gesammelt, in dem Darth Andeddu Erwähnung fand, und sie in die Jedi-Archive verbannt, um sie für alle Zeiten zu verbergen, auf dass seine Geheimnisse niemals ans Licht gelangen würden.
Nichtsdestotrotz hatte dieser eine Hinweis in einem alten, vergessenen und ansonsten unbedeutenden Manuskript überlebt, um seinen Weg in Banes Hände zu finden. In den letzten zwei Monaten, seit dieser Foliant in seinen Besitz gelangt war, hatte der Dunkle Lord sein nächtliches Kampftraining stets mit einem Besuch in der Bibliothek beendet, um über das Geheimnis von Andeddus verschwundenem Holocron nachzugrübeln. Indem er von dem Manuskript vor sich Querverweise zu der umfangreichen Menge an Wissen zog, das sich über tausend andere Bände seiner Sammlung erstreckte, hatte er versucht, die Stücke des Puzzles zusammenzusetzen, bloß um ein ums andere Mal zu scheitern.
Dennoch weigerte er sich, seine Suche aufzugeben. Alles, wofür er gearbeitet hatte, alles, das er aufgebaut hatte, hing davon ab. Er würde den Fundort von Andeddus Holocron ausfindig machen. Er würde das Geheimnis des ewigen Lebens entschlüsseln, um sich Zeit zu verschaffen, sich einen anderen Schüler zu suchen und ihn auszubilden.
Ohne das Holocron würde er verkümmern und sterben. Zannah würde den Titel des Dunklen Lords unrechtmäßig erlangen, um die Regel der Zwei zu verhöhnen und das Schicksal des Ordens in die Hände einer unwürdigen Meisterin zu legen.
Falls er Andeddus Holocron nicht fand, waren die Sith dem Untergang geweiht.
1. Kapitel
»… gemäß der Regeln, die durch die im Vorangegangenen umrissenen Vorgehensweisen bestimmt werden, sowie sämtlicher nachfolgenden Klauseln. Unsere sechste Forderung lautet, dass einem Gremium aus …«
Medd Tandar rieb sich mit einer langfingrigen Hand über die ausgeprägte Stirn seines hohen, konischen Schädels, in der Hoffnung, die bedrohlichen Kopfschmerzen wegzumassieren, die sich in den letzten zwanzig Minuten aufgebaut hatten.
Gelba, das Wesen, wegen dem er auf den Planeten Doan gekommen war, die Frau, mit der er verhandeln wollte, hielt beim Lesen ihres Bittgesuchs inne, um zu fragen: »Stimmt etwas nicht, Meister Jedi?«
»Ich bin kein Meister«, erinnerte der Cereaner die selbsternannte Anführerin der Rebellen. »Ich bin bloß ein Jedi-Ritter.« Mit einem Seufzen ließ er die Hand sinken. Nachdem er einen Augenblick lang geschwiegen hatte, zwang er sich hinzuzufügen: »Mir geht es gut. Bitte, fahr fort!«
Mit einem knappen Nicken nahm Gelba das Verlesen ihrer scheinbar endlosen Liste von Ultimaten wieder auf. »Unsere sechste Forderung lautet, dass einem Gremium aus gewählten Vertretern der Minenarbeiterklasse die völlige Zuständigkeit für die nachfolgenden elf Punkte gewährt wird: erstens, die Festlegung von Gehältern in Übereinstimmung mit den galaktischen Normen. Zweitens, die Festlegung einer wöchentlichen Grundarbeitszeit, die ein Angestellter zur Arbeit herangezogen werden kann, in Stunden bemessen. Drittens, eine genehmigte Liste von Schutzkleidung, die zur Verfügung gestellt werden muss durch …«
Die kleinwüchsige, muskulöse Menschenfrau salbaderte weiter. Ihre Stimme hallte sonderbar von den unregelmäßigen Wänden der unterirdischen Höhle wider. Die anderen anwesenden Menschen – drei Männer und zwei Frauen, die sich dicht um Gelba drängten – wirkten wie gebannt von ihren Worten. Medd konnte nicht umhin zu denken, dass die Minenarbeiter einfach die Stimme ihrer Anführerin benutzen könnten, um durch das Gestein zu schneiden, falls ihre Werkzeuge jemals versagen sollten.
Offiziell war Medd hier, um zu versuchen, den Gewalttätigkeiten zwischen den Rebellen und der Königsfamilie ein Ende zu bereiten. Wie alle Cereaner besaß er eine binäre Hirnstruktur, die es ihm erlaubte, beide Seiten eines Konflikts gleichzeitig zu betrachten. Theoretisch machte ihn das zu einem idealen Kandidaten, um in komplexen politischen Situationen zu vermitteln und Konflikte zu lösen – wie beispielsweise den, der auf diesem kleinen Bergbauplaneten entbrannt war. Allerdings musste er feststellen, dass es in der Praxis wesentlich schwieriger war, die Rolle eines Diplomaten zu spielen, als er sich das ursprünglich vorgestellt hatte.
Doan, im Äußeren Rand gelegen, war ein hässlicher, brauner Felsbrocken. Mehr als achtzig Prozent der planetaren Landmasse waren in gewaltige Tagebauanlagen umfunktioniert worden. Selbst aus dem All war die Verschandelung der Welt auf den ersten Blick zu erkennen. Fünf Kilometer breite und Hunderte von Kilometer lange Furchen verliefen unheilbaren Wunden gleich kreuz und quer durch die aufgerissene Landschaft. Gewaltige, aus dem Erdboden gehauene Steinbrüche reichten Hunderte Meter weit in die Tiefe, hinterließen irreparable Narben auf dem Antlitz des Planeten.
Befand man sich in der von Smog beherrschten Atmosphäre, wurde die unaufhörliche Betriebsamkeit der riesigen Maschinen sichtbar. Grabungsgeräte eilten wie übergroße Insekten umher, um sich immer wieder in den Boden zu buddeln und die Erde aufzuwühlen. Hoch aufragende Bohrer standen auf mechanischen Beinen, um Tunnel in bislang nicht ausgelotete Tiefen zu treiben. Gigantische Schwebefrachter warfen Schatten, die die blasse Sonne auslöschten, während sie geduldig darauf warteten, dass ihre hallengleichen Frachträume mit Erde, Staub und pulverisiertem Gestein gefüllt wurden.
Über den Planeten verstreut standen eine Handvoll fünf Kilometer hoher Säulen aus unregelmäßigem, dunkelbraunem Gestein, die einen Durchmesser von mehreren hundert Metern aufwiesen. Sie ragten aus der verwüsteten Landschaft empor wie Finger, die sich zum Himmel ausstrecken. Die flachen Plateaus oben auf diesen natürlichen Säulen wurden von Ansammlungen von Villen, Burgen und Palästen beherrscht, die den ökologischen Trümmerhaufen weiter unten überblickten.
Die seltenen Mineralvorkommen und der zügellose Bergbau hatten den kleinen Planeten zu einer sehr wohlhabenden Welt gemacht. Allerdings konzentrierte sich dieser Wohlstand nahezu ausschließlich in den Händen der Adelsfamilien, die in den vornehmen Anwesen lebten, die über dem Rest des Planeten thronten. Der Großteil der Bevölkerung bestand aus den niederen gesellschaftlichen Klassen von Doan, aus Lebewesen, die dazu verdammt waren, ihr Leben mit fortwährender körperlicher Arbeit oder in untergeordneten Dienstpositionen zu verbringen, ohne irgendeine Aussicht auf Aufstieg.
Das waren die Leute, die Gelba repräsentierte. Im Gegensatz zur Oberschicht hausten sie unten auf der Planetenoberfläche in winzigen, behelfsmäßigen Hütten, umringt von den offenen Gruben und Spalten, oder in kleinen Höhlen, die in den felsigen Grund gegraben waren. Medd hatte bereits in dem Moment einen kleinen Eindruck von ihrem Leben erhalten, als er die klimatisierte Bequemlichkeit seiner Raumfähre verließ. Er war von einer Wand drückender Hitze empfangen worden, die vom nackten, sonnenversengten Boden aufstieg. Er hatte sich rasch ein Stofftuch um den Kopf gewickelt, um Nase und Mund zu verdecken als Schutz gegen die wirbelnden Staubwolken, die die Luft aus seiner Brust zu drängen drohten.
Der Mann, den Gelba geschickt hatte, um ihn zu begrüßen, hatte sein Gesicht ebenfalls verdeckt, was die Kommunikation inmitten des Gepolters der Bergbaumaschinen noch schwieriger machte. Zum Glück gab es keinen Grund, sich miteinander zu unterhalten, während sein Führer ihn quer durch die Anlage führte: Dem Jedi waren beim schieren Ausmaß der Umweltschäden schlichtweg die Augen übergegangen.
Sie hatten ihren Weg schweigend fortgesetzt, bis sie zu einem kleinen, grob gehauenen Tunnel gelangt waren. Medd musste in die Hocke gehen, um sich an der schartigen Decke nicht den Kopf zu stoßen. Der Tunnel war mehrere hundert Meter lang und führte sanft abwärts, bis er schließlich in einer großen, natürlichen, von Glühleuchten erhellten Höhle endete.
Werkzeugspuren fanden sich in Wänden und Boden. Sämtliche wertvollen Mineralablagerungen in der Höhle waren schon vor langer Zeit abgebaut worden. Alles, was übrig geblieben war, waren Dutzende unregelmäßiger Felsformationen, die vom unebenen Boden aufragten, manche weniger als einen Meter hoch, während sich andere die vollen zehn Meter bis zur Decke hinauf erstreckten. Hätten sie nicht allesamt genau dasselbe langweilige Braun gehabt, das die Oberfläche von Doan dominierte, wären sie vielleicht sogar hübsch gewesen.
Im provisorischen Rebellenhauptquartier fanden sich keine Einrichtungsgegenstände, doch die hohe Decke erlaubte es dem Cereaner immerhin, aufrecht zu stehen. Noch wichtiger war, dass die unterirdische Kammer eine gewisse Zuflucht vor der Hitze, dem Staub und dem Lärm der Oberfläche bot, was es ihnen allen erlaubte, die Tücher abzulegen, die ihre Gesichter bedeckten und ihre Worte dämpften. Angesichts Gelbas schriller Stimme war sich Medd allerdings nicht so sicher, ob das eine so gute Sache war.
»Unsere nächste Forderung ist die unverzügliche Abschaffung der Königsfamilie und die Übergabe all ihrer Besitztümer an die gewählten Repräsentanten, die unter Punkt drei, Abschnitt fünf, Unterabschnitt C benannt werden. Darüber hinaus sollen Geld- und Konventionalstrafen verhängt werden gegen …«
»Bitte hör auf!«, bat Medd und hielt eine Hand hoch. Gnädigerweise kam Gelba seiner Aufforderung nach. »Wie ich bereits erklärt habe, kann der Jedi-Rat nichts tun, um diese Forderungen durchzusetzen. Ich bin nicht hier, um die Königsfamilie zu eliminieren. Ich bin bloß hier, um bei den Verhandlungen zwischen eurer Gruppe und dem Adel von Doan meine Dienste als Vermittler anzubieten.«
»Sie weigern sich, mit uns zu verhandeln!«, rief einer der Minenarbeiter.
»Kann man ihnen das verübeln?«, hielt Medd dagegen. »Ihr habt den Kronprinzen getötet.«
»Das war ein Versehen«, meinte Gelba. »Wir hatten nicht die Absicht, seinen Luftgleiter zu zerstören. Wir wollten ihn bloß zu einer Notlandung zwingen. Wir haben versucht, ihn lebend zu ergreifen.«
»Eure Vorsätze sind jetzt irrelevant«, entgegnete ihr Medd. Er hielt seine Stimme ruhig und gelassen. »Durch die Ermordung des Thronerben habt ihr euch den Zorn der Königsfamilie zugezogen.«
»Verteidigt Ihr ihre Taten etwa?«, wollte Gelba wissen. »Sie jagen mein Volk wie Tiere! Sie sperren uns ohne Prozess ein! Sie foltern uns, um an Informationen zu gelangen, und richten uns hin, wenn wir Widerstand leisten! Jetzt verschließen selbst die Jedi die Augen vor unserem Leid. Ihr seid nicht besser als der Galaktische Senat!«
Medd verstand die Frustration der Minenarbeiter. Doan war jahrhundertelang ein Mitglied der Republik gewesen, doch weder der Senat der Republik noch irgendeine andere Regierungsinstitution hatte je ernsthafte Bemühungen unternommen, um die sozialen Missstände ihrer Gesellschaftsstruktur zu beheben. Da die Republik Millionen von Mitgliedswelten umfasste, jede mit ihren ureigenen Traditionen und einem eigenen Regierungssystem, vertrat man dort den Grundsatz, sich außer in den extremsten Fällen nicht einzumischen.
Offiziell verurteilten Idealisten den Mangel einer demokratischen Regierung auf Doan. Historisch betrachtet waren der Bevölkerung jedoch seit jeher die Grundbedürfnisse des Lebens gewährt worden: Nahrung, Obdach, Freiheit von der Sklaverei und sogar Rechtsmittel in Fällen, in denen ein Adeliger die Privilegien seines Rangs missbrauchte. Obgleich die Reichen auf Doan die Armen zweifellos ausbeuteten, gab es etliche andere Welten, auf denen die Situation viel, viel schlimmer war.
Doch die Weigerung des Senats, sich hier einzumischen, hatte den Bemühungen jener kein Ende gemacht, die danach strebten, den Status quo zu ändern. Im Laufe des letzten Jahrzehnts war in den unteren Klassen eine Bewegung aufgekommen, die nach politischer und sozialer Gleichberechtigung verlangten. Naturgemäß regte sich im Adel Widerstand dagegen, und kürzlich waren die Spannungen in Gewalt eskaliert, die schließlich vor drei Standardmonaten in der Ermordung des Kronprinzen von Doan gipfelten.
Als Reaktion darauf hatte der König das Kriegsrecht ausgerufen. Seitdem hatte es einen steten Strom beunruhigender Berichte gegeben, die Gelbas Vorwürfe stützten. Allerdings wuchs die Sympathie für die Rebellen in der Galaxis nur langsam. Viele im Senat hielten sie für Terroristen, und so viel Mitgefühl Medd auch für ihre Notlage hatte, war er ohne die Vollmacht des Senats dennoch außerstande, irgendetwas zu unternehmen.
Die Jedi waren durch das galaktische Gesetz rechtlich dazu verpflichtet, sich bei sämtlichen Bürgerkriegen und internen Machtkämpfen neutral zu verhalten, es sei denn, dass sich die Gewalttätigkeiten auf andere Welten der Republik auszudehnen drohten. Sämtliche Experten waren sich einig, dass das Risiko dafür in diesem Fall ausgesprochen gering war.
»Was deinem Volk angetan wird, ist falsch«, stimmte Medd zu. Er wählte seine Worte mit Bedacht. »Ich werde tun, was in meiner Macht steht, um den König davon zu überzeugen, die Hetzjagd auf dein Volk aufzugeben. Doch ich kann nichts versprechen.«
»Warum seid Ihr dann hier?«, wollte Gelba wissen.
Medd zögerte. Letzten Endes entschied er, dass es der einzig gangbare Weg war, unumwunden die Wahrheit zu sagen. »Vor ein paar Wochen hat eins eurer Teams eine kleine Gruft freigelegt.«
»Doan ist voll von alten Grüften«, entgegnete Gelba. »Vor Jahrhunderten haben wir unsere Toten traditionell begraben … damals, bevor der Adel beschloss, den ganzen Planeten umzugraben.«
»In dieser Gruft befand sich ein kleines Behältnis mit Artefakten«, fuhr Medd fort. »Ein Amulett. Ein Ring. Einige alte Pergamentrollen.«
»Alles, was wir ausgraben, gehört uns!«, rief einer der Minenarbeiter wütend.
»Das ist eins unserer ältesten Gesetze«, bestätigte Gelba. »Selbst die Königsfamilie ist klug genug, nicht im Ansatz dagegen zu verstoßen.«
»Mein Meister glaubt, dass diese Artefakte von der Dunklen Seite ergriffen sein könnten«, erklärte Medd. »Ich muss sie in unseren Tempel auf Coruscant bringen, um sie dort sicher zu verwahren.«
Gelba starrte ihn mit zusammengekniffenen Augen an, sagte aber nichts.
»Natürlich werden wir dafür bezahlen«, fügte Medd hinzu.
»Ihr Jedi stellt Euch selbst als Wächter hin«, erwiderte Gelba. »Als Behüter der Schwachen und Unterdrückten. Doch Euch liegt mehr an einer Handvoll goldener Schmuckstücke als an den Leben von Männern und Frauen, die leiden.«
»Ich werde versuchen, euch zu helfen«, versprach Medd. »Ich werde in eurem Namen mit dem König sprechen. Aber zuerst brauche ich diese …«
Er hielt abrupt inne, während das Echo seiner Worte noch in der Höhle nachhallte. Irgendetwas stimmt nicht. Ausgehend von seiner Magengrube verspürte er plötzlich Übelkeit, ein Gefühl drohender Gefahr.
»Was?«, forschte Gelba. »Was ist los?«
Eine Erschütterung der Macht, dachte Medd. Seine Hand fiel auf das Lichtschwert am Gürtel. »Es kommt jemand.«
»Unmöglich. Die Wachen draußen vor dem Tunnel hätten – argh!«
Gelbas Worte wurden vom unverkennbaren Geräusch eines Blasterschusses abgeschnitten. Sie taumelte nach hinten und stürzte zu Boden, ein rauchendes Loch in der Brust. Mit alarmierten Rufen liefen die anderen Minenarbeiter auseinander, um hinter den Felsformationen in Deckung zu gehen, die die Höhle füllten. Zwei von ihnen schafften es nicht. Sie wurden von tödlich zielgenauen Schüssen niedergestreckt, die sie geradewegs zwischen die Schulterblätter trafen.
Medd blieb, wo er war, aktivierte sein Lichtschwert und spähte in die Schatten, die die Höhlenwände säumten. Außerstande, die Dunkelheit mit den Augen zu durchdringen, öffnete er sich der Macht – und wankte zurück, als hätte ihm jemand in den Magen geschlagen.
Normalerweise spülte die Macht über ihn hinweg wie eine warme Woge weißen Lichts, die ihn stärkte, ihn zentrierte. Diesmal jedoch traf sie ihn wie eine eisige Faust in den Magen.
Ein weiterer Blasterschuss schwirrte an seinem Ohr vorbei. Medd ließ sich auf die Knie fallen und kroch hinter der nächstbesten Felsformation in Deckung, bestürzt und verwirrt. Als Jedi hatte er sein ganzes Leben lang dafür trainiert, sich in einen Diener der Macht zu verwandeln. Er hatte gelernt, sich von der Hellen Seite durchdringen zu lassen, damit sie ihm Kraft gab, seine körperlichen Sinne verstärkte, seine Gedanken und Taten lenkte. Jetzt schien eben dieser Quell seiner Kraft ihn verraten zu haben.
Er konnte Blasterladungen hören, die als Querschläger durch die Höhlenkammer zischten, als die Minenarbeiter das Feuer auf ihren unsichtbaren Gegner erwiderten, doch er verdrängte den Gefechtslärm aus seinem Bewusstsein. Er begriff nicht, was mit ihm passiert war. Er wusste bloß, dass er irgendeine Möglichkeit finden musste, dagegen anzukämpfen.
Keuchend rezitierte der Jedi im Geiste die ersten Zeilen des Jedi-Kodex, bemüht, seine Fassung wiederzugewinnen. Es gibt keine Gefühle, es gibt Frieden. Das Mantra seines Ordens erlaubte es ihm, die Atmung wieder unter Kontrolle zu bekommen. Einige Sekunden später fühlte er sich gefasst genug, um erneut vorsichtig mit der Macht in Kontakt zu treten.
Anstatt Frieden und Gelassenheit fühlte er bloß Zorn und Hass. Instinktiv setzte sein Verstand wieder ein, und Medd wurde klar, was geschehen war. Irgendwie war die Kraft, aus der er seine Stärke zog, von der Dunklen Seite verdorben worden, korrumpiert und vergiftet.
Er konnte es noch immer nicht erklären, doch jetzt wusste er zumindest, wie er versuchen konnte, den Auswirkungen der Dunklen Seite zu widerstehen. Der Jedi verbannte seine Furcht und erlaubte der Macht abermals einem leisen, sorgsam kontrollierten Tröpfeln gleich durch ihn hindurchzufließen. Dabei konzentrierte er sich darauf, seinen Verstand von den Verunreinigungen zu säubern, die seine Sinne überwältigt hatten. Allmählich fühlte er, wie die Kraft der Hellen Seite über ihn hinwegspülte … wenn auch wesentlich schwächer, als er es gewohnt war.
Er trat hinter den Felsen hervor und rief mit lauter Stimme: »Zeige dich!«
Ein Blasterschuss zischte aus der Dunkelheit auf ihn zu. In letzter Sekunde wehrte er ihn mit dem Lichtschwert ab, um die Salve harmlos in die Ecke abzulenken – eine Technik, die er schon vor Jahren gelernt hatte, als er noch ein Padawan gewesen war.
Zu nah, dachte er bei sich. Du bist langsam, zögerlich. Vertraue auf die Macht!
Die Energie der Macht umschloss ihn, doch etwas daran fühlte sich falsch an. Ihre Stärke flackerte und verebbte wie bei einer von Statik heimgesuchten Übertragung. Irgendetwas – oder irgendjemand – störte seine Fähigkeit, sich zu fokussieren. Über sein Bewusstsein hatte sich ein dunkler Schleier herabgesenkt, der seine Gabe beeinträchtigte, die Macht für seine Zwecke zu nutzen. Für einen Jedi gab es nichts Furchterregenderes, doch Medd hatte nicht die Absicht, den Rückzug anzutreten.
»Lass die Minenarbeiter in Ruhe!«, rief er. Seine Stimme gab nichts von der Unsicherheit preis, die er empfand. »Zeige dich, und stell dich mir!«
Eine junge Iktotchi löste sich aus den Schatten in der hinteren Ecke der Höhle. In jeder Hand hielt sie eine Blasterpistole. Sie trug einen schlichten schwarzen Umhang, hatte ihre Kapuze jedoch nach hinten geworfen, um die nach unten geschwungenen Hörner freizulegen, die seitlich aus ihrem Kopf ragten und sich direkt über den Schultern zu einer scharfen Spitze hin verjüngten. Ihre rötliche Haut wurde von schwarzen Tätowierungen auf dem Kinn noch betont – vier spitzen, dünnen Linien, die Fangzähnen gleich von ihrer Unterlippe weg verliefen.
»Die Minenarbeiter sind tot«, verkündete sie. Etwas Grausames lag in ihrer Stimme, als würde sie ihn mit diesem Wissen verhöhnen.
Als Medd behutsam auf die Macht zurückgriff, um sein Bewusstsein auszudehnen, wurde ihm klar, dass sie recht hatte. Als würde er durch einen alles verdunkelnden Dunst schauen, gelang es ihm gerade so, die Leichen der Minenarbeiter auszumachen, die in der Kammer verstreut lagen, jeder von einem tödlichen Treffer in den Kopf oder die Brust gezeichnet. In den wenigen Sekunden, die er gebraucht hatte, um sich zu sammeln, hatte sie sie alle niedergemetzelt.
»Du bist eine Attentäterin«, mutmaßte er. »Von der Königsfamilie geschickt, um die Rebellenführer zu töten.«
Sie nickte zustimmend und öffnete den Mund, wie um zu sprechen. Dann feuerte sie ohne Vorwarnung eine weitere Blastersalve auf ihn ab.
Der Trick funktionierte beinahe. Hätte die Macht ihn durchströmt, hätte er ihre Täuschung gespürt, lange bevor sie handelte, doch welche Kraft auch immer seine Fähigkeit störte, sie hatte ihn angreifbar gemacht.
Anstatt den Versuch zu unternehmen, die Schüsse ein zweites Mal abzuwehren, warf Medd sich zur Seite und landete hart auf dem Boden.
Du bist so ungeschickt wie ein Jüngling, tadelte er sich, als er sich wieder aufrappelte.
Nicht bereit, sich einem weiteren Sperrfeuer auszusetzen, stieß er die freie Hand mit der Handfläche nach außen vor. Mithilfe der Macht riss er die Waffen aus dem Griff seiner Gegnerin. Die Anstrengung schickte einen schneidenden Blitz der Pein durch seinen gesamten Schädel, der ihn zusammenzucken und einen halben Schritt zurückweichen ließ. Doch immerhin, die Blaster segelten durch die Luft und landeten ohne ihn weiter zu gefährden auf dem Boden neben ihm.
Zu seiner Überraschung wirkte die Attentäterin unbekümmert. Konnte sie seine Furcht und Unsicherheit spüren? Die Iktotchi waren für ihre beschränkten präkognitiven Fähigkeiten bekannt. Es hieß, sie könnten sich die Macht zunutze machen, um flüchtige Blicke in die Zukunft zu werfen. Von einigen wurde gar behauptet, sie seien Telepathen. War es möglich, dass sie ihre Fähigkeiten irgendwie benutzte, um seine Verbindung zur Macht zu unterbrechen?
»Wenn du dich ergibst, verspreche ich dir einen fairen Prozess«, erklärte er ihr und versuchte, absolute Zuversicht und Selbstvertrauen auszustrahlen.
Sie lächelte ihn an und zeigte ihm ihre scharfen, spitzen Zähne. »Es wird keinen Prozess geben.«
Die Iktotchi katapultierte sich nach hinten, in einen Handstand. Ihr Gewand flatterte, als sie hinter einem breiten Steinvorsprung außer Sicht schnellte. Im selben Augenblick gab einer der Blaster zu Medds Füßen ein durchdringendes Piepsen von sich.
Der Jedi hatte geglaubt, seine Widersacherin entwaffnet zu haben, doch stattdessen war er in ihre geschickt ausgelegte Falle getappt. Ihm blieb gerade noch genügend Zeit, um zu erkennen, dass die Energiezelle so eingestellt worden war, dass sie sich überlud und schließlich explodierte. Mit seinem letzten Gedanken versuchte er, sich auf die Macht zu konzentrieren, auf dass sie ihn vor der Detonation abschirmen möge, doch er war außerstande, den lähmenden Nebel zu durchdringen, der seinen Verstand umwölkte. Er fühlte nichts als Furcht, Wut und Hass.
Als die Explosion seinem Leben ein Ende setzte, begriff Medd schließlich das wahre Grauen der Dunklen Seite.
2. Kapitel
Der Alptraum war ihr vertraut, aber immer noch Furcht einflößend.
Sie ist wieder acht Jahre alt, ein kleines Mädchen, das sich in die Ecke der kleinen Hütte drängt, die sie sich mit ihrem Vater teilt. Draußen, hinter dem zerfledderten Vorhang, der ihnen als Tür dient, sitzt ihr Vater am Feuer und rührt seelenruhig in einem Kochtopf.
Er hat sie angewiesen, drinnen zu bleiben, außer Sicht, bis der Besucher geht. Sie kann ihn durch die winzigen Löcher im Vorhang sehen, wie er über ihrem Lager aufragt. Er ist riesig. Größer und breiter als ihr Vater. Sein Kopf ist kahl rasiert, seine Kleidung und seine Rüstung sind schwarz. Sie weiß, dass er einer von den Sith ist. Sie kann sehen, dass er stirbt.
Deshalb ist er hier. Caleb ist ein großer Heiler. Ihr Vater könnte den Mann retten … Aber er will es nicht.
Der Mann spricht nicht. Das kann er nicht. Gift hat seine Zunge anschwellen lassen. Doch auch so ist offensichtlich, was er braucht.
»Ich weiß, wer Ihr seid«, sagt ihr Vater zu dem Mann. »Ich werde Euch nicht helfen.«
Die Hände des großen Mannes fallen auf das Heft seines Lichtschwerts, und er tritt einen halben Schritt vor.
»Ich fürchte den Tod nicht«, erklärt Caleb ihm. »Ihr könnt mich foltern, wenn Ihr wollt.«
Ohne Vorwarnung taucht ihr Vater eine Hand in den Topf, der über dem Feuer brodelt. Ausdruckslos lässt er sein Fleisch Blasen schlagen und verbrühen, bevor er sie wieder herauszieht.
»Schmerzen bedeuten mir nichts.«
Sie kann sehen, dass der Sith verwirrt ist. Er ist ein Grobian, ein Mann, der sich Gewalt und Einschüchterung zunutze macht, um zu bekommen, was er will. Diese Dinge funktionieren bei ihrem Vater nicht.
Die Hand des großen Mannes dreht sich langsam in ihre Richtung. Verängstigt kann sie spüren, wie ihr Herz hämmert. Sie kneift die Augen fest zusammen, versucht, den Atem anzuhalten.
Ihre Augen springen abrupt auf, als sie von einer grässlichen, ungesehenen Macht umgefegt wird, die sie in die Luft hochhebt und sie nach draußen trägt. Kopfüber hält eine unsichtbare Hand sie über den blubbernden Kochtopf. Hilflos, zitternd, kann sie spüren, wie Fahnen heißen Dampfs aufsteigen und über ihre Wangen kriechen.
»Papi«, wimmert sie, »hilf mir!«
Den Ausdruck in Calebs Augen hat sie bei ihrem Vater noch niemals zuvor gesehen – Furcht.
»Also gut«, murmelt er resigniert. »Ihr habt gewonnen. Ihr werdet Eure Heilung bekommen.«
Serra schreckte abrupt aus dem Schlaf auf und wischte die Tränen fort, die ihre Wangen hinabliefen. Selbst jetzt, zwanzig Jahre später, erfüllte der Traum sie immer noch mit Schrecken. Indes, ihre Tränen waren keine der Angst.
Die ersten Strahlen der Morgensonne strömten durch das Palastfenster herein. Im Wissen, dass es ihr nicht gelingen würde, wieder einzuschlafen, schlug Serra die Schimmerseidendecke beiseite und stand auf.
Die Erinnerung an die Konfrontation erfüllte sie stets mit Scham und einem Gefühl der Schande. Ihr Vater war ein starker Mann gewesen – ein Mann von unbeugsamem Willen und ebensolchem Mut. Sie war diejenige, die schwach gewesen war. Wäre sie nicht gewesen, hätte er sich dem dunklen Mann widersetzt, der zu ihnen gekommen war.
Wäre sie stärker gewesen, hätte er sie nicht fortschicken müssen.
»Eines Tages wird der dunkle Mann zurückkehren«, hatte ihr Vater sie an ihrem sechzehnten Geburtstag gewarnt. »Er darf dich nicht finden. Du musst gehen. Verlasse diesen Ort, ändere deinen Namen, ändere deine Identität! Vergeude nie wieder einen Gedanken an mich!«
Natürlich war das unmöglich. Caleb war ihre ganze Welt gewesen, ihr ganzes Leben. Alles, was sie über die heilenden Künste wusste – und über Leiden, Krankheiten und Gifte –, hatte sie von klein auf von ihm gelernt.
Sie ging durch den Raum zu ihrem Kleiderschrank und durchstöberte ihre gewaltige Kleidersammlung, während sie zu entscheiden versuchte, was sie anziehen sollte. Ihre gesamte Kindheit über hatte sie schlichte, funktionelle Kleidung getragen, die sie immer bloß dann abgelegt hatte, wenn sie endgültig zu fadenscheinig und verschlissen geworden war, um sie nochmals auszubessern. Jetzt kam sie einen ganzen Monat aus, ohne dieselben Stücke zweimal zu tragen.
Sie träumte nicht jede Nacht von dem dunklen Mann. Für eine Weile, im ersten Jahr ihrer Ehe, hatte sie praktisch überhaupt nicht von ihm geträumt. Im Laufe der letzten paar Monate jedoch war der Traum wieder regelmäßiger geworden … und damit auch das stetig wachsende Verlangen, mehr über das Schicksal ihres Vaters zu erfahren.
Caleb hatte sie aus Liebe fortgeschickt. Das verstand Serra. Sie wusste, dass ihr Vater bloß das Beste für sie gewollt hatte. Aus diesem Grund hatte sie sich seiner Bitte gebeugt und war nie zurückgekehrt, um ihn zu sehen. Doch sie vermisste ihn. Sie vermisste das Gefühl seiner kräftigen, schwieligen Hände, die ihr Haar zerzausten. Sie vermisste das Geräusch seiner ruhigen, aber festen Stimme, die die Lektionen seines Handwerks wiedergab, den süßen Geruch von Heilkräutern, der stets von seinem Hemd aufgestiegen war, wenn er sie umarmte.
Doch am meisten von allem vermisste sie das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, das sie gehabt hatte, wann immer er in der Nähe war. Jetzt sehnte sie sich mehr als je zuvor danach, ihn sagen zu hören, dass alles in Ordnung kommen würde. Aber das würde niemals passieren. Stattdessen musste sie sich an die Erinnerung der letzten Worte klammern, die er je zu ihr gesagt hatte.
»Es ist schrecklich, wenn ein Vater nicht für sein Kind da sein kann. Das tut mir leid. Aber es gibt keinen anderen Weg. Bitte wisse, dass ich dich immer lieben werde, und ganz gleich, was geschieht: Du wirst immer meine Tochter sein.«
Ich bin Calebs Tochter, dachte sie bei sich, während sie weiterhin müßig die Unmenge ihrer Garderobe durchforstete. Ich bin stark, genau wie mein Vater.
Schließlich entschied sie sich für eine schwarze Hose und ein blaues Oberteil, auf dem die Insignien der doanischen Königsfamilie prangten … ein Geschenk ihres Ehemanns. Ihn vermisste sie ebenfalls, wenn auch auf andere Weise als ihren Vater. Caleb hatte sie fortgeschickt, aber Gerran war ihr von den Rebellen genommen worden.
Als sie sich ankleidete, versuchte Serra, nicht an ihren Kronprinzen zu denken. Der Kummer war zu groß, seine Ermordung noch zu frisch. Die für den Angriff verantwortlichen Minenarbeiter waren immer noch da draußen … aber nicht mehr allzu lange, wie sie hoffte.
Ein leises Klopfen an der Tür unterbrach ihren Gedankengang.
»Herein!«, rief sie, in dem Wissen, dass bloß eine einzige Person so früh am Morgen vor der Tür ihres Privatgemachs stehen konnte.
Ihre persönliche Leibwächterin Lucia betrat den Raum. Auf den ersten Blick wirkte die Soldatin eher unscheinbar: eine sportliche, dunkelhäutige Frau in den frühen Vierzigern, mit kurzem, lockigem schwarzem Haar. Unter dem Stoff ihrer Uniform der Königlichen Garde jedoch konnte man feste, wohldefinierte Muskeln erahnen, und in ihrem Blick lag eine Intensität, die einen davor warnte, dass sie niemand war, den man auf die leichte Schulter nehmen sollte.
Serra wusste, dass Lucia vor zwanzig Jahren in den Neuen Sith-Kriegen gekämpft hatte. Als Scharfschützin der berühmten Zwielichtkrieger-Einheit hatte sie tatsächlich auf der Seite der Bruderschaft der Dunkelheit gedient, der Armee, die gegen die Republik gefochten hatte. Doch wie Caleb seiner Tochter bei vielen Gelegenheiten erklärt hatte, unterschieden sich die Krieger, die in dem Konflikt kämpften, sehr von ihren Sith-Meistern.
Die Sith und die Jedi lieferten sich einen ewig währenden Krieg über philosophische Ideale, einen Krieg, an dem sich ihr Vater nicht beteiligen wollte. Für die Durchschnittssoldaten jedoch, die die große Masse der Armeen bildeten, ging es in dem Krieg um etwas anderes. Jene, die auf der Seite der Sith standen – Männer und Frauen wie Lucia –, taten es aus dem Glauben heraus, dass die Republik ihnen den Rücken zugewandt hatte. Vom Galaktischen Senat entrechtet, hatten sie Krieg geführt, um sich von dem zu befreien, was sie als die tyrannische Herrschaft der Republik betrachteten.
Sie waren gewöhnliche Leute, die zu Opfern von Kräften wurden, die weit über ihre Kontrolle hinausgingen, entbehrliche Schachfiguren, die in Schlachten niedergemetzelt wurden, die von jenen geführt wurden, die von sich selbst glaubten, groß und mächtig zu sein.
»Wie hast du geschlafen?«, fragte Lucia, die in den Raum trat und die Tür hinter sich schloss, um ihre Privatsphäre zu wahren.
»Nicht gut«, gab Serra zu.
Es gab keinen Anlass, die Frau zu belügen, die in den vergangenen fünf Jahren ihre nahezu dauerhafte Begleiterin gewesen war. Lucia hätte sie ohnehin mühelos durchschaut.
»Wieder die Alpträume?«
Die Prinzessin nickte, sagte jedoch nichts weiter dazu. Sie hatte Lucia gegenüber niemals den Inhalt dieser Träume enthüllt – oder ihre wahre Identität –, und die ältere Frau respektierte sie genug, um nicht danach zu fragen. In ihrer beider Vergangenheit gab es dunkle Zeiten, über die sie zu schweigen vorzogen. Das war eins der Dinge, die sie zueinandergeführt hatten.
»Der König wünscht mit dir zu sprechen«, informierte Lucia sie.
Wenn der König so früh nach ihr schickte, musste es wichtige Neuigkeiten geben.
»Was will er?«
»Ich denke, es hat etwas mit den Terroristen zu tun, die deinen Ehegatten ermordet haben«, entgegnete ihre Leibwächterin und nahm einen erlesenen schwarzen Schleier vom Ständer in der Ecke des Raums.
Serras Herz machte einen Satz, und ihre Finger fummelten am letzten Knopf ihres Oberteils herum. Dann gewann sie die Kontrolle über ihre Emotionen zurück und stand vollkommen reglos da, als die ältere Frau den Schleier oben auf ihren Kopf setzte. Gemäß doanischem Brauch musste Serra den Trauerschleier nach dem Tod ihres Mannes ein volles Jahr lang tragen … oder bis ihr Liebster gerächt wurde.
Lucia bewegte sich mit geübter Präzision, platzierte rasch Serras langes schwarzes Haar unter dem Schleier und steckte es fest. Die Soldatin war bloß von durchschnittlicher Größe – etwas kleiner als ihre Herrin –, sodass sich Serra ein Stückchen vorbeugen musste.
»Du bist eine Prinzessin«, schalt Lucia sie. »Steh gefälligst gerade!«
Serra konnte nicht umhin zu lächeln. Im Laufe der letzten sieben Jahre war Lucia für sie zu der Mutter geworden, die sie nie hatte – wenn man einmal annahm, ihre Mutter hatte während der Sith-Kriege als Scharfschützin bei den sagenumwobenen Zwielichtkriegern gedient.
Lucia zupfte den Schleier zurecht und trat zurück, um ihr Werk einer letzten Prüfung zu unterziehen.
»Bezaubernd wie immer«, verkündete sie.
Eskortiert von ihrer Leibwächterin bahnte sich Serra ihren Weg durch den Palast zum Thronsaal, wo der König auf sie wartete.
Als sie durch die Flure der Burg gingen, fiel Lucia auf ihre übliche Position zurück, einen Schritt links hinter der Prinzessin. Da die meisten Leute Rechtshänder waren, verschaffte es ihr die beste Chance, den eigenen Körper zwischen ihre Herrin und eine Klinge oder einen Blaster zu bringen, der von einem sich von vorn nähernden Möchtegernattentäter abgefeuert wurde, wenn sie sich auf Serras linker Seite befand. Nicht, dass die Gefahr sonderlich groß gewesen wäre, dass irgendjemand hier in den Mauern des Königshauses etwas Dummes versuchte, doch Lucia war stets willens und bereit, zum Wohle ihres Schützlings ihr Leben zu geben.
Nach dem Zusammenbruch der Bruderschaft der Dunkelheit zwei Jahrzehnte zuvor war Lucia wie so viele ihrer Kameraden, die in den Sith-Armeen dienten, eine Kriegsgefangene geworden. Sechs Monate lang war sie auf einem Arbeitsplaneten inhaftiert gewesen, um zu schweißen und Raumschiffe zu reparieren, bis der Senat all jenen eine Generalamnestie gewährte, die in den Reihen der Armeen der Bruderschaft als gewöhnliche Soldaten ihren Dienst getan hatten.
In den nächsten dreizehn Jahren hatte Lucia als Leibwächterin, freischaffende Söldnerin und schließlich als Kopfgeldjägerin gearbeitet. Dabei war sie Serra das erste Mal begegnet … und hatte sich die lange, wulstige Narbe eingefangen, die von ihrem Bauchnabel bis hoch zum Brustkorb verlief.
Sie hatte Salto Zendar aufgespürt, einen von vier Meerianer-Brüdern, die auf den kurzsichtigen Plan verfallen waren, einen hochrangigen Muun-Funktionär aus dem Hauptquartier des InterGalaktischen Bankenclans zu entführen und ein Lösegeld für ihn zu erpressen. Das unter einem überaus schlechten Stern stehende Vorhaben hatte dazu geführt, dass zwei der Brüder von Sicherheitskräften getötet worden waren, als sie versuchten, in die IGBC-Büros auf Muunilinst einzubrechen. Der dritte wurde lebend gefangen, während der vierte – Salto – trotz des Umstands, dass er von den Sicherheitskräften schwer verwundet worden war, entkommen konnte.
Die Belohnung, die der IGBC für seine Ergreifung aussetzte, war hoch genug, um sogar Kopfgeldjäger aus dem weit entfernten Mittleren Rand auf den Plan zu rufen, und Lucia war da keine Ausnahme gewesen. Mithilfe von Kontakten aus ihren Tagen bei den Zwielichtkriegern machte sie Salto in einem Krankenhaus auf dem nahe gelegenen Planeten Bandomeer ausfindig, wo seine Verletzungen behandelt wurden.
Als Lucia allerdings versuchte, ihn in Gewahrsam zu nehmen, war eine junge Menschenfrau, die als Heilerin in dem Hospital arbeitete, zwischen sie und ihre Beute getreten. Ungeachtet des Waffenarsenals auf Lucias Rücken hatte sich die groß gewachsene, dunkelhaarige Frau geweigert, aus dem Weg zu gehen, und erklärt, dass sie nicht zulassen würde, dass der Patient bewegt wurde, solange er sich in kritischem Zustand befand.
Die Heilerin hatte keine Furcht gezeigt, selbst dann nicht, als Lucia den Blaster gezogen und ihr befohlen hatte beiseitezutreten. Sie hatte bloß den Kopf geschüttelt und sich nicht von der Stelle gerührt.
Damals hätte es enden können. Lucia war nicht bereit gewesen, eine unschuldige Frau zu erschießen, nur um die Belohnung einzustreichen, die auf Saltos Kopf ausgesetzt war. Doch unglücklicherweise war sie an jenem Tag nicht die einzige Kopfgeldjägerin vor Ort. Salto war so schlecht darin gewesen, seine Spuren zu verwischen, wie er sich auf Entführungen verstand.