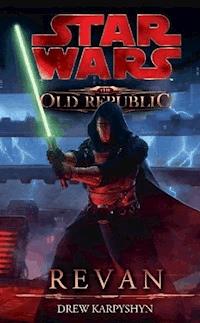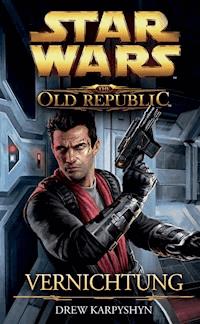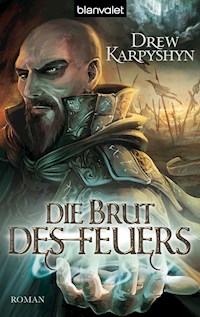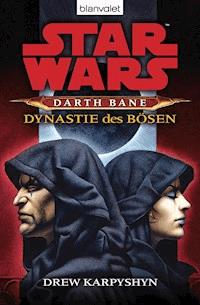8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kinder des Chaos
- Sprache: Deutsch
Wer Chaos sät, erntet brennende Zerstörung
Sie sind die Kinder des dunklen Gottes Daemron: Vier Geschwister, auserkoren, ihrem Erzeuger zu helfen und die Welt ins Chaos zu stürzen. Doch noch ahnen sie nicht, was ihr Vater mit ihnen plant. Auf der Jagd nach uralten Talismanen setzen sich die vier Helden gegen sterbliche wie dämonische Gegner zur Wehr. Als Daemrons Brut endlich seinen Ring in den Händen hält, entfesselt sie einen Ausbruch an Chaosmagie, die Tod und Zerstörung über das Land bringt – und den Hass einer mächtigen Königin nach sich zieht. Welche Katastrophe wird geschehen, wenn Daemrons Schwert als nächster Talisman gefunden wird?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Vor langer Zeit vertrauten die Götter dem großen Krieger Daemron drei Talismane an, um die Welt der Sterblichen gegen die Mächte des Chaos zu schützen. Doch als Daemron sich auf die Seite des Bösen schlug, wurden ihm die Talismane entrissen. Um sie zurückzubekommen, schuf er vier Kinder: die Brut des Feuers. Mit ihrer Hilfe will er die von den Göttern geschaffene Barriere zwischen der Niederwelt und dem Reich der Menschen einreißen und die Macht übernehmen.
Doch die vier Geschwister widersetzen sich seinem Willen und flüchten sich in die Ostlande. Dort finden sie Zuflucht, doch ein mächtiger Clanführer verfolgt seine eigenen Pläne und will sich die Brut des Feuers zunutze machen. Scythe, Vaaler, Keegan und Cassandra läuft die Zeit davon. Sie müssen Daemrons Schwert finden, bevor das Reich der Menschen völlig vom Krieg zerstört wird …
Autor
Drew Karpyshyn ist der New-York-Times-Bestsellerautor des Star-Wars-Universums und fraglos auch der erfolgreichste. Vor allem durch seine Darth-Bane-Romane schuf er sich eine große Fangemeinde. Er arbeitet zudem als Videospiel-Entwickler. Nachdem er den Großteil seines Lebens in Kanada verbracht hat, hatte er irgendwann genug von den langen kalten Wintern dort und zog nach Süden. Drew Karpyshyn lebt heute mit seiner Frau in Texas.
Außerdem von Drew Karpyshyn bei Blanvalet lieferbar:
Star Wars™ Darth Bane 1. Schöpfer der Dunkelheit
Star Wars™ Darth Bane 2. Die Regel der Zwei
Star Wars™ Darth Bane 3. Dynastie des Bösen
Die Brut des Feuers
Besuchen Sie uns auch auf
www.blanvalet.de,
www.facebook.com/blanvalet und
www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
Drew Karpyshyn
Die dunkle Flamme
Roman
Aus dem Amerikanischen von Wolfgang Thon
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »The Scorched Earth« bei Del Rey / Random House, Inc., New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung April 2016 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 8, 81673 München
Copyright © 2014 by Drew Karpyshyn
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016 by Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Umschlaggestaltung und -illustration: © Melanie Miklitza, Inkcraft
JB · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-641-17380-7V001www.blanvalet.de
Für meine Mutter Vivian.Stärke manifestiert sich in vielen Formen,und dein Mut ist eine Inspiration.
Prolog
Er blickt von den Zinnen seiner Burg auf die kleinen gedrungenen Gebäude der Stadt hinab. Die verlassenen Straßen sind eng und gewunden, gesäumt von einstöckigen Hütten aus braunem Lehm und grauem Stein. Winzig im Vergleich zu der prachtvollen Burg, schmiegen sie sich an deren hohe Mauern, kümmerlich und hässlich. Bis hin zum öden Horizont gibt es keine anderen Bauwerke.
Nach siebenhundert Jahren des Exils hat sich die Zahl seiner Anhänger verzehnfacht, die Stadt jedoch ist nicht in gleichem Maße gewachsen. Das Land ihrer Verbannung ist eine Niederwelt, die leere Hülle einer Welt. Die meisten seiner Untertanen leben jetzt in den unterirdischen Höhlen und Labyrinthen, die die Landschaft wie Pockennarben überziehen.
Keine Tierherden ziehen über die grauen Steppen, keine Vogelschwärme sieht man am Himmel. Seine Anhänger ernähren sich von einem kaum genießbaren Schlamm, der sich um einige wenige unterirdische Becken mit stinkendem, abgestandenem Wasser konzentriert. Bei den häufigen Stürmen wird der graue Himmel unvermittelt schwarz, und ein sintflutartiger Wolkenbruch setzt ein. Aber der Regen ist ebenso tödlich und verseucht wie alles andere in diesem gottverlassenen Land.
Keiner seiner Untertanen erinnert sich an die glorreichen Wunder der Welt, die sie verlassen haben. Im Unterschied zu ihrem Gottkönig trennen sie zahllose Generationen von den Sterblichen, die ihm ursprünglich gefolgt sind. Sie sind die Nachfahren vieler Geschlechter von Nachfahren. Aber Geschichten wurden weitergegeben, Erzählungen von Flüssen und Ozeanen, von Hügeln, Feldern und Wäldern, in denen es von Leben nur so wimmelte. Aber für seine Untertanen sind diese Geschichten kaum mehr als Mythen und Legenden; die Schönheit dessen, was sie verloren haben, ist verblasst in all den Jahrhunderten im Exil.
Ebenso wie Daemrons eigene Macht. Nachdem er jahrhundertelang in dieser selbst geschaffenen Unterwelt gefangen war, ist der göttliche Funke des Chaos, der ihn nährte, allmählich erloschen. Nur noch ein schwaches Flackern seines einstigen Glanzes ist ihm geblieben.
Selbst ein Unsterblicher kann sterben.
Aber noch ist er nicht tot. Und sobald das Vermächtnis zerfällt und er seine Artefakte wieder in Händen hält – falls er sie zurückerobern kann –, wird er neugeboren sein. Die Macht der Alten Götter lodert immer noch stark in diesen Artefakten. Er kann sie spüren in dem fernen Land, das er einst beherrscht hat. Zuerst wurde die Krone wiederentdeckt, ein Leuchtfeuer, das ihn über die Brennende See hinweg rief und so den Zauber leitete, der Orath und seine anderen Knechte in die Welt der Sterblichen schickte.
Der Ring wurde ebenfalls gefunden. Erst vor wenigen Tagen spürte er, wie seine Wut entfesselt wurde, ein Sturm aus schrecklicher Magie, der dunkle Wolken über Daemrons Königreich schickte und einen ätzenden Regen auf das Land herniedergehen ließ.
Seine Untertanen fühlten es ebenfalls. Sie wissen jetzt, dass die Zeit ihrer möglichen Rückkehr näher kommt. Und er weiß auch, dass einige von ihnen sich fragen, ob ihr Gottkönig noch lange genug leben wird, um daran teilhaben zu können.
Möglicherweise irrten sie sich nicht einmal. Irgendwann wird die Zeit knapp werden, und noch sind viele Fragen unbeantwortet. Warum und wie wurde der Ring erweckt? Geschah es durch eines der Kinder des Feuers? Haben die Samen des Rituals, das er vor so vielen Jahren vollzog, endlich Früchte getragen? Oder war es das Werk von Orath und seinen Knechten?
Er hat von ihnen nichts mehr gehört, seit er sie in die Welt der Sterblichen geschickt hat. Die Mühe dieses Rituals hat fast den gesamten Rest seiner Macht verzehrt. Allein der Versuch, über die Brennende See hinweg noch einmal mit Orath zu kommunizieren, könnte ihn jetzt überfordern. Er muss geduldig sein, sich Zeit lassen, seine Kräfte schonen.
Langsam dreht er sich von den Zinnen weg, und sein schlangenartiger Schwanz zischt leise durch die Luft, als er seine gewaltigen, fledermausartigen Schwingen spreizt und die Schultern rollt. Was aus ihm geworden ist, frustriert ihn.
Einst war er furchtlos. Beherrscher der Welt der Sterblichen. Kühn. Mutig. Sogar tollkühn. Er wagte es, die Alten Götter selbst herauszufordern … Nur um dann ins Exil verbannt zu werden, als er wie ein Feigling vor der letzten Schlacht flüchtete.
Er hat überlebt, sie dagegen nicht. Und jetzt ist er der Letzte seiner Art, der einzig wirkliche Unsterbliche, der noch übrig ist. Sein Leben ist zu kostbar, um es für ein närrisches Unterfangen aufs Spiel zu setzen.
Langsam geht er zu der schweren hölzernen Tür, die in das Innere seiner Burg führt. Seine gespaltenen Hufe kratzen über die blanken Steine. Er streckt eine klauenförmige Hand aus, hält jedoch inne, bevor er die Pforte öffnet.
Jemand lauert auf der anderen Seite.
Er wittert den schwachen Funken des Chaos, der in allem Lebenden glimmt. Wie die Artefakte, spricht auch dieser Funke zu ihm. Daemron konzentriert sich, fokussiert seine Aufmerksamkeit auf den Raum hinter der geschlossenen Tür. Es sind drei seiner Untertanen, aber er erkennt keinen von ihnen.
Eindringlinge. Meuchelmörder.
Wut flammt in ihm hoch, als er von der Tür zurücktritt und seine Hände zum Himmel hebt. Dann legt er seinen gehörnten Schädel in den Nacken und flüstert Worte der Dunklen Macht. Eine Sekunde später reißt er die Arme herunter und setzt den Bann frei. Die Tür explodiert nach innen.
Die Wucht schickt einen tödlichen Schauer scharfer Holzsplitter in das Treppenhaus hinter der Tür. Sie zerfetzen und durchbohren den Meuchelmörder, der am dichtesten an der Tür steht. Sein Leben endet, noch bevor er auch nur einen Schrei ausstoßen kann.
Die beiden anderen zögern nur eine Sekunde, bis sie mit gezückten Waffen angreifen. Sie sind mit Kurzschwertern bewaffnet, in die uralte Symbole eingeätzt sind. Relikte, die einst in der Welt der Sterblichen geschmiedet und im Exil von Generation an Generation weitergegeben wurden. Die Magie dieser Waffen besitzt genug Macht, um ihn zu verwunden oder sogar zu töten. Die beiden, die sie schwingen, sind jedoch längst nicht so gefährlich für ihn.
Sie ähneln mehr Hunden als Menschen: Wölfe mit fingerartigen Klauen, die ihre Waffen umklammert halten. Bruder und Schwester, vereint in dem Verlangen, den Despoten zu töten, der sie beherrscht. Tapfer genug, um sich gegen einen Gott aufzulehnen. Kühn genug, um zu sterben.
Knurrend und zähnefletschend greifen sie mit rücksichtsloser Verzweiflung an: wilde Schemen aus Fell, Reißzähnen und magischen Kurzschwertern. Aber er ist ihr Gott, und sie sind ein Nichts vor ihm.
Er stellt sich ihrem Angriff. Mit einer Klaue schlägt er die Klingen der Schwester beiseite und packt mit der anderen ihre Kehle. Der Bruder wird von der mit scharfen Dornen besetzten Spitze von Daemrons Schweif aufgespießt. Sie durchbohrt sein Herz.
Er stürzt zu Boden, während das Blut aus der klaffenden Wunde in seiner Brust sprudelt. Die Schwester windet sich in Daemrons Griff und schlägt schwach mit ihrer Waffe auf seinen Arm ein, während er seine Finger langsam um ihre Kehle schließt.
Er ignoriert die Schnitte und Wunden an seinem Arm und trägt sie zum Rand der Zinnen. Ihr Gewicht hält er mühelos mit einer Hand. Am Rand der Bastion schlägt er ein paarmal mit seinen Schwingen, und aufgrund der zusätzlichen Last seiner Möchtegern-Mörderin gelingt es ihm nur, sich ein kleines Stück in die Luft zu erheben. Aber das genügt.
Mit einer kurzen Handbewegung schleudert er die Schwester in die Tiefe hinab. Ihr Schrei klingt wie ein Heulen, als sie hinabstürzt, bis sie schließlich mit einem schwachen Klatschen auf dem Boden aufschlägt.
Daemrons Arm blutet aus etlichen tiefen Wunden, aber keine davon ist so ernst, dass sie ihm Sorge bereiten würde. So kehrt er zu ihrem Bruder zurück, der immer noch atmet, und blickt einen Moment schweigend in die Augen des Sterbenden. Dort sieht er blankes Entsetzen, als die Kreatur endlich vollkommen begreift, was sie getan hat.
Die Rebellen haben es gewagt, ihn anzugreifen. Sie haben versucht, einen Gott zu töten, und sind gescheitert. Und damit haben sie nicht nur ihr eigenes Leben verwirkt. Ihre Verbündeten, ihre Freunde, ihre Familien – sie alle werden für das leiden, was hier soeben geschah.
Als Daemron schließlich davon überzeugt ist, dass der Meuchelmörder die schreckliche Vergeltung begreift, die all jene treffen wird, die ihm lieb sind, hebt er seinen massiven Huf und zerschmettert seinen Schädel.
1
Ferlhame lag in Trümmern. Hunderte, vielleicht Tausende Danaan waren tot; vom Feuer verbrannt oder von den herabfallenden Trümmern der gewaltigen hölzernen Wohntürme zerschmettert, die einst die Straßen gesäumt hatten. Aber es gab nur ein einziges Todesopfer, das Orath interessierte.
Er war allein nach Ferlhame gegangen und hatte Gort und Draco befohlen, in den Wäldern vor der Stadt zu warten. In der Dunkelheit konnte Orath als Danaan durchgehen, und außerdem waren die Frauen und Männer, die voller Panik durch die Straßen rannten, viel zu schockiert, um die fledermausartigen Gesichtszüge im Schatten seiner Kapuze wahrzunehmen. Seine Gefährten dagegen waren alles andere als unauffällig.
Der Körper des Drachen war durch die Gewalt des Rings förmlich in winzige Fetzen gerissen worden. Blutige Fleischbrocken lagen zwischen den Leichen der Danaan und den Trümmern; im Umkreis von hundert Metern rings um die Stelle, wo der Drache auf den Boden geprallt war, war alles von einer warmen schwarzen Säure überzogen.
Die Überreste dieser Kreatur der ChaosBrut zitterten immer noch vor Magie. Orath spürte es, als er durch die dunklen Straßen schritt. Die Magie war noch da, ebenso die beißenden Rauchwolken, die die Luft verpesteten. Obwohl der Drache tot und zerfetzt war, konnte Orath ermessen, wie herrlich er einmal gewesen sein musste.
Doch was sagte das über den Sterblichen, der ihn besiegt hatte? Orath hatte angenommen, dass er die Artefakte einfach gewaltsam an sich bringen könnte, sobald er und seine Knechte ihren Aufenthaltsort aufgespürt hätten. Aber jetzt, nach der blutigen Auseinandersetzung um Ferlhame, war er gezwungen, seinen Plan zu ändern.
Ihr Sieg über den Pontiff und die anderen Inquisitoren im Monasterium hatte ihm ein trügerisches Gefühl von Überlegenheit vermittelt. Doch zu diesem Zeitpunkt war noch reichlich Chaos in ihrem Blut gewesen und hatte ihnen Stärke verliehen. In den Wochen, die auf dieses Gemetzel folgten, hatte Orath gespürt, wie seine Macht schwand.
Hier, auf der anderen Seite des Vermächtnisses, war es viel schwieriger, das Chaos freizusetzen. Die Barriere, die seinen Herrn im Exil festhielt, vereitelte auch seine Bemühungen, Kraft aus den magischen Feuern der Brennenden See zu ziehen. Je länger er und die anderen Knechte hierblieben, desto schwächer würden sie werden.
Kein Wunder, dass der Pontiff und seine Anhänger so schwach und hilflos waren, angesichts der vielen Jahrhunderte fernab von der Macht des Chaos.
Doch nicht alle Sterblichen waren schwach und hilflos, rief er sich ins Gedächtnis. Eine Handvoll war vom Bann Daemrons gezeichnet: die Brut des Feuers. Berührt vom Chaos, konnten sie die wahre Macht der Artefakte freisetzen. Eine Macht, die groß genug war, um selbst einen Drachen zu vernichten. Oder einen Knecht.
Hat Raven diese Lektion mit ihrem Leben bezahlt? Ist sie deshalb nicht mit der Krone zurückgekehrt? Ist unsere Zahl noch mehr geschrumpft?
Wäre er noch im Vollbesitz seiner Kräfte gewesen, hätte er einen Bann wirken können, um mit ihr Kontakt aufzunehmen, selbst über die gesamte Spanne der Welt der Sterblichen hinweg. Und es war auch jetzt vielleicht noch möglich. Nur war Orath nicht bereit, den Versuch zu wagen. Jede Anrufung, jeder Bann, den er wirkte, nahm ihm etwas von seiner Kraft. Er musste seine Energie bewahren; er musste die letzten Reste des Chaos in seinem Blut so lange wie möglich hüten.
Ist den anderen das klar? Haben sie das allmähliche Versiegen ihrer Kräfte gespürt?
Doch selbst wenn nicht, bestand keine Notwendigkeit, sie zu warnen. Noch nicht. Nicht, solange sie noch nützlich sein konnten.
Nach Ravens Verschwinden hatte er die kriechenden Zwillinge der Krone hinterhergeschickt. Einzeln konnten sie zwar mit Ravens Macht nicht mithalten, aber zu zweit waren sie ihr überlegen. Und was ihnen an Intelligenz mangelte, glichen sie mit ihren wilden Instinkten und ihrer unerschütterlichen Loyalität aus.
Doch wenn Raven nun von dem Sterblichen vernichtet worden war, der die Krone bei sich hatte? Würde es in dem Fall den kriechenden Zwillingen besser ergehen? Und, wichtiger noch, würde er selbst bestehen können?
Er mochte noch stark genug sein, den Ring mit Gewalt zu erbeuten, aber Daemron hatte ihn nicht nur wegen seiner Stärke zum Anführer jener Knechte bestimmt, die er in die Welt der Sterblichen geschickt hatte. Orath war bedachtsam und listig. Obwohl er wahrnahm, dass der Ring ständig nach Osten zog, hatte er nicht die Absicht, ihm überstürzt zu folgen und ein ähnliches Schicksal zu erleiden wie dieser Drache.
Er bog in eine Gasse ein und sah einen Mann in Uniform, der einem halben Dutzend anderer Soldaten Befehle zubrüllte, während sie durch das Gemetzel irrten.
Diese Sterblichen sind durchaus nützlich, dachte er und hüllte sich mit einem Funken Chaos in eine Aura von Macht und Autorität.
»Du da!«, rief er. »Ich muss mit deinem Herrscher sprechen!«
»Ich bitte Euch, Eure Entscheidung zu überdenken, meine Königin.« Andars Stimme war nur ein leises Flüstern, als fürchtete er, die Kreatur, die in ihrem privaten Ratszimmer wartete, könnte sie irgendwie belauschen.
»Wenn Ihr nicht wollt, dass ich mich mit diesem Orath treffe, warum habt Ihr mir dann von seinem Ersuchen berichtet?« Rianna sah ihren Hohen Zauberer nicht an, als sie neben ihm zielstrebig durch die Hallen des Palastes schritt. »Und warum habt Ihr ihn überhaupt hereingelassen?«
»Ich hatte Angst, ihn unbeaufsichtigt durch die Straßen streifen zu lassen«, gab der Hohe Zauberer zu. »Und außerdem habt Ihr das Recht zu erfahren, was in Eurem Königreich vorgeht«, ergänzte er.
»Vor allem habe ich auch das Recht zu entscheiden, was für mein Königreich das Beste ist«, konterte sie. »Wir befinden uns in einer Krise. Unsere Hauptstadt ist zerstört, und unser Volk trauert. Wir benötigen dringend Verbündete. Mächtige Verbündete.«
»Orath ist eine Missgeburt«, warnte Andar sie. »Eine Kreatur, die vom Chaos pervertiert wurde.«
»Der Orden behauptet das Gleiche von uns«, rief ihm die Königin ins Gedächtnis.
Als sie um die letzte Ecke bogen, blieb Rianna wie angewurzelt stehen. Die schwere Eichentür der Ratskammer war geschlossen, und an den Wänden zu beiden Seiten stand ein halbes Dutzend Soldaten der königlichen Wache mit grimmigen Gesichtern und gezückten Schwertern.
»Ist Orath ein Gast oder ein Gefangener?«, erkundigte sie sich.
»Er ist gefährlich, meine Königin«, erklärte Andar. »Trotz der Anwesenheit der königlichen Wache könnte ich nicht für Eure Sicherheit garantieren.«
»Dann wird die Leibgarde vor der Kammer warten«, entschied Rianna und hob die Hand, um Andars obligatorischen Einspruch abzuwehren.
»Öffne die Tür!«, befahl sie.
Der Soldat direkt neben der Tür gehorchte ihrem Befehl, aber mit einem winzigen Zögern, währenddessen er Andar einen Blick zuwarf.
Bin ich bereits so tief gefallen?, dachte Rianna. Dennoch konnte sie die Reaktion des Mannes verstehen. Es war ihr nicht gelungen, ihr Volk vor dem Drachen und dem Zerstörer der Welten zu beschützen. Tausende ihrer Untertanen lagen tot auf den Straßen, und ihr eigener Sohn hatte sein Volk verraten.
Ich war Vaaler gegenüber schwach. Ich sah die Gefahr in meinen Träumen, aber statt seine Hinrichtung anzuordnen, habe ich ihn nur verbannt. Ich habe wie eine Mutter gehandelt, nicht wie eine Königin. Ich habe das Leben meines Sohnes über das meines Volkes gestellt.
Diesen Fehler würde sie nicht noch einmal begehen. Ihr Herz war verhärtet, ihre Entschlossenheit eisern.
Trotzdem stockte sie, als sie sah, was jenseits der Tür auf sie wartete. Andar hatte sie vorgewarnt und ihr gesagt, dass Orath weder ein Danaan noch ein Mensch wäre. Nach eigenem Bekunden war er ein Knecht. Aber auch diese Bezeichnung hatte sie nicht auf seine beklemmende Erscheinung vorbereiten können.
Er war groß und hager, fast so klapperdürr wie ein Skelett, und trug einen langen schwarzen Umhang. Beides bildete einen auffallenden Kontrast zu seiner alabasterfarbenen Haut. Er hatte ein langes schmales Gesicht und keine Haare auf dem Kopf. Seine Gesichtszüge erinnerten entfernt an die einer Fledermaus. Die spitzen Ohren waren viel zu klein und eng an seinen Schädel gepresst, seine Nase war eingefallen; die Nasenlöcher bildeten nur zwei diagonale Schlitze mitten in seinem Gesicht. Die Pupillen seiner gelben Augen waren klein und dunkel, und in seinem lippenlosen Mund schimmerten viel zu viele scharfe, spitze Zähne.
Doch noch beunruhigender als sein missgestaltetes Gesicht war die Aura von Magie, die er ausstrahlte. Das Chaos umhüllte ihn wie ein Kokon. Es war dieselbe Macht, die ihre Stadt zerstört hatte.
Was nützt die Gabe der Prophezeiung, wenn mir die Überzeugung fehlt, mich danach zu richten?
Mit einem tiefen Atemzug betrat Rianna den Raum. Eine Sekunde später folgte ihr Andar. Die Königin machte eine kurze Handbewegung, ohne sich umzusehen, und im nächsten Moment schloss einer der Wachposten die Tür hinter ihr und sperrte die drei in dem kleinen Ratszimmer ein.
»Ich bin Rianna Avareen, Königin der Danaan!«, erklärte die Frau.
Ihre Stimme war kräftig und selbstbewusst, aber Orath spürte ihren Widerwillen, so wie er ihn auch in dem Hohen Zauberer gewittert hatte, als er sich diesem vorgestellt hatte. Er hätte einen Bann wirken können, um sein Äußeres zu verändern, und mithilfe einer einfachen Illusion wie ein Danaan aussehen können. Aber das hätte seine Macht unnötig beansprucht. Außerdem sollten die Sterblichen wissen, dass er keiner von ihnen war. Sie sollten begreifen, dass er ihnen Dinge anbieten konnte, die kein anderer vermochte.
»Ich bin Orath«, erwiderte er auf die Worte der Königin. »Ich bin gekommen, um einen Pakt vorzuschlagen.«
»Gekommen? Woher?«, wollte der Hohe Zauberer wissen.
Er hatte Angst und war argwöhnisch, genauso wie die Königin. Aber in Letzterer witterte Orath noch etwas anderes. Eine Gier, die er zu befriedigen wusste. Mit einem lautlosen Machtwort verstärkte er die Aura um sich herum. Ein kleines Opfer seiner Macht, um ein Abbild noch größerer Autorität zu erzeugen, eine subtile Ausstrahlung, die dabei helfen konnte, die Sterblichen mit seinen Argumenten auf seine Seite zu ziehen.
»Ich komme aus den Tiefen der Nördlichen Waldungen«, behauptete er.
»Unsere Patrouillen kennen jeden Fingerbreit des Nordforsts«, erwiderte die Königin. »Wir haben noch nie Berichte über eine Kreatur wie dich erhalten.«
Orath lachte leise. »Eine Kreatur wie ich«, murmelte er. »Einst war ich wie Ihr. Bin ich jetzt so grauenvoll geworden?«
»Du bist ein Danaan?« Andar klang vollkommen ungläubig.
»Kein Danaan. Ich bin vor langer Zeit durch diese Wälder geschritten, als Menschen und Danaan noch ein Volk waren. In der Zeit vor dem Kataklysmus.«
»Damit müsstest du weit über siebenhundert Jahre alt sein«, spottete Andar.
»Ich habe nicht sieben Jahrhunderte wirklich erlebt«, gab Orath zu. »Den größten Teil dieser Zeit habe ich … geschlafen. Ich wurde vom Vermächtnis in ewige Starre versetzt.«
»Du hast mit Daemron gegen die Alten Götter gekämpft!« Rianna setzte rasch die kleinen Stückchen von Oraths Lüge zu einem Bild zusammen, wie er es gehofft hatte.
»Nicht alle Anhänger des Schlächters wurden bei seinem Sturz mit ihm verbannt«, erklärte Orath. »Nach dem Kataklysmus haben etliche von uns dem Gemetzel des Krieges den Rücken gekehrt. Doch wir waren ebenfalls vom Chaos berührt worden. Als die alten Götter das Vermächtnis schufen, sind wir wie die ChaosBrut in einen ewigen Winterschlaf gefallen.«
»Aus welchem der Ring dich geweckt hat«, flüsterte die Königin. »Wie er auch den Drachen erweckte.«
Orath nickte, sagte jedoch nichts. Ihm war klar, dass es besser war, möglichst wenig zu reden. Seine Lügen würden erheblich mehr Gewicht haben, wenn die Königin glaubte, sie wäre selbst hinter die Wahrheit gekommen.
»Du hast von einem Pakt gesprochen«, drängte sie ihn fortzufahren.
»Ich kann Euch helfen zurückzuerlangen, was rechtmäßig Euch gehört. Ich kann Euch helfen, den Ring zurückzubekommen.«
»Warum willst du uns helfen?«, wollte Andar wissen. »Welchen Vorteil ziehst du aus diesem Pakt?«
Der da traut mir nicht, dachte Orath. Die Aura wirkte bei einigen besser als bei anderen. Aber es war auch nicht nötig, ihn auf seine Seite zu ziehen. Die Loyalität des Hohen Zauberers seiner Monarchin gegenüber würde ihn zwingen, trotz seiner persönlichen Zweifel ihren Anordnungen Folge zu leisten.
»Über Jahrhunderte habt Ihr und Euer Geschlecht den Ring gehütet.« Orath sprach zur Königin und ignorierte Andar. »Ihr habt seine Macht unter Kontrolle gehalten. Jetzt befindet er sich in den Händen einer Person, die es nicht versteht, das Chaos zu beherrschen. Was in Eurer Stadt geschah, war nur der Anfang«, spann er seinen Faden weiter. »Wird der Ring noch einmal benutzt, wird er ganze Armeen von schlafender ChaosBrut erwecken. Sie werden Tod und Vernichtung über die Welt bringen, und zwar in einem Ausmaß, das Ihr Euch nicht im Entferntesten vorstellen könnt.
Ich habe einen Kataklysmus miterlebt. Ich weiß, dass ein weiterer die Welt zerstören wird und mich mit ihr.«
»Woher wissen wir, dass du den Ring nicht für dich selbst haben willst?« Andar war noch nicht zufriedengestellt.
»Er würde mich zerstören, wenn ich ihn benutzen würde.« Das entsprach nur zur Hälfte der Wahrheit. Daemrons Artefakte zu benutzen war gefährlich und unberechenbar. Ihre Macht war dafür gedacht, gemeinsam eingesetzt zu werden, wobei jedes einzelne Artefakt die Macht der beiden anderen in der Balance hielt. Er würde es nur wagen, ihre Macht freizusetzen, wenn er den Ring, das Schwert und die Krone vereint in seinem Besitz hatte.
»Wenn ich den Ring selbst zurückholen könnte, würde ich das tun«, gab der Knecht zu. »Um ihn sicher zu behüten«, setzte er dann noch rasch hinzu. »Aber ich bin nicht stark genug, um gegen jemanden bestehen zu können, der die Macht des Rings gegen mich richtet. Ebenso wenig wie Euer Königreich das vermag.«
Er spürte ihre Unsicherheit, ihre Verwirrung und ihre Furcht. Sein Zauber war zwar nicht stark genug, um eine Person zu zwingen, ihm zu gehorchen, aber er konnte diese Person in eine Richtung drängen, in die sie ohnehin bereits tendierte; sie fühlte sich verloren und suchte verzweifelt nach jemandem, der ihr sagte, was sie tun sollte.
»Glaubst du, dass wir ihn zurückbekommen, wenn wir zusammenarbeiten?«, erkundigte sich die Königin.
»Das kommt auf Euch an, meine Königin.« Orath verbeugte sich tief. »Wie weit seid Ihr bereit zu gehen, um Euer Volk zu beschützen? Was seid Ihr bereit zu tun, um den Ring wiederzuerlangen?«
»Alles!«, stieß Rianna hervor. »Alles«, wiederholte sie.
2
Keegan konnte sich nicht bewegen. Er lag wie betäubt auf dem Schlachtfeld, das einst ein Strand gewesen war, umringt von Leichen. Nicht alle Toten waren Menschen. Über ihm stand eine titanische Gestalt, umhüllt vom Feuer des Chaos. Die blauen Flammen loderten so intensiv, dass sie in Keegans Augen brannten. Ein ohrenbetäubendes Dröhnen übertönte alle anderen Geräusche – das Vermächtnis zerfiel.
Verängstigt und hilflos vermochte der junge ChaosWirker nicht, den Blick abzuwenden. Er war unfreiwilliger Zeuge der ungeheuren Zerstörung, die die freigesetzte Macht des Artefakts bewirkte.
Er schrak aus dem Schlaf hoch. Sein Herz hämmerte, und Schweißtropfen liefen ihm über die Stirn. Der Stumpf seines linken Arms pochte heiß vor Schmerz, und er spürte, wie die Phantomfinger seiner abgehackten Hand sich unwillkürlich krampfhaft zur Faust ballten.
In dem schwachen Licht der Glut des Lagerfeuers konnte er undeutlich Vaalers Gestalt erkennen. Der junge Mann kniete neben ihm.
»Was ist los?«, fragte Vaaler. »Geht es dir nicht gut?«
Keegan atmete mehrmals durch, um sich zu beruhigen. »Es ist nichts«, erwiderte er dann. »Nur ein schlechter Traum.«
»Deine Träume sind erheblich mehr als nichts«, erinnerte ihn der verbannte Kronprinz der Danaan.
»Ich bin müde«, protestierte Keegan, schob seinen Stumpf unter seinen anderen Arm und rollte sich auf die Seite, um Vaaler den Rücken zuzukehren. »Ich muss schlafen.«
Vaaler stand auf und ging zur anderen Seite des Lagers, ließ ihn in Ruhe. Der Schlaf übermannte Keegan rasch, und glücklicherweise kam der Traum nicht zurück.
Scythe warf sich unruhig von einer Seite auf die andere, während ihr Verstand unaufhörlich arbeitete. Als sie hörte, wie Keegan sich herumwälzte und im Schlaf stöhnte, wäre sie fast aufgestanden, um nach ihm zu sehen. Aber Vaaler kam ihr zuvor, also blieb sie lieber, wo sie war.
Dass Norr neben ihr fest schlief, machte alles nur noch schlimmer. Normalerweise half ihr sein tiefes, rhythmisches Schnaufen, sich zu entspannen, aber in dieser Nacht hatten seine lauten Atemzüge den gegenteiligen Effekt.
Das ist nicht seine Schuld, ermahnte sie sich. Schuld ist diese ganze verfluchte Situation.
Anders als ihr barbarischer Liebhaber, der selbst den Kataklysmus verschlafen hätte, verbrachte sie ihre Nächte in rastloser Sorge, seit sie mit ihren vier Gefährten nach der Vernichtung von Ferlhame geflüchtet waren.
Sie hatten zwei Tage gebraucht, um den Rand des Forsts von Danaan zu erreichen, und dann einen weiten Bogen nach Nordosten geschlagen, um den FreiStädten auszuweichen. Die Bäume waren nicht allmählich lichter geworden, wie man hätte erwarten können; stattdessen wirkte die Grenze des Waldes scharf gezogen und unnatürlich. Mit nur wenigen Schritten traten sie aus einem dichten Wald, dessen Blätterdach den größten Teil der Sonne fernhielt, und standen dann auf den weiten Ebenen des eisigen Ostens.
Hier war es deutlich kälter als in dem feuchten, stickigen Wald, und während der ganzen Reise hing eine Nebeldecke über dem Land. Die Tundra erstreckte sich bis zum Horizont, flach und konturlos; nur ein paar Gruppen von Büschen und einige Hügel waren in der Ferne gerade eben zu erkennen. Keegan wurde immer kräftiger, und Jerrod hatte versucht, ihr Tempo zu steigern, seit sie den Wald verlassen hatten. Aber die Pferde hatten Mühe, auf dem Permafrost Halt zu finden. Ihre Hufe sanken bei jedem Schritt in den halb gefrorenen Schlamm. Dazu behinderte ein eisiger Gegenwind ihr Fortkommen, der seit drei Tagen kein bisschen nachgelassen hatte. Um die verlorene Zeit aufzuholen, ritten sie jeden Tag von Tagesanbruch bis lange nach Sonnenuntergang.
Dieser endlose Ritt forderte allmählich seinen Tribut. Doch obwohl ihr Körper jeden Tag vollkommen ausgelaugt war, wenn sie vom Pferd stieg, fand Scythe trotzdem keine Ruhe, wenn sie sich hinlegte. Sie konnte einfach nicht aufhören darüber nachzudenken, in was Norr und sie da hineingeraten waren. Jerrod hatte die anderen davon überzeugt, dass Keegan der Retter der Welt war, aber bei ihr hatten die Worte des wahnsinnigen Mönchs nicht dieselbe Wirkung gehabt.
Der junge ChaosWirker hatte einen Drachen vernichtet und die Hauptstadt der Danaan zerstört, aber als er den Ring benutzte, den Vaaler der Königin der Danaan gestohlen hatte, hätte ihn das fast das Leben gekostet. Scythe war der festen Überzeugung, dass Keegan praktisch Selbstmord begehen würde, sollte er versuchen, den Ring noch einmal einzusetzen.
Vielleicht gehört das ja zu seinem Schicksal, von dem Jerrod ständig redet, dachte sie. Vielleicht muss Keegan auch zum Märtyrer werden, wenn er der Retter sein will. Es würde mich nicht überraschen, wenn Jerrod ihm das verschwiegen hätte.
Sie traute dem Mönch nicht. Er benutzte Keegan. Aber keiner der anderen sah das so, nicht einmal Norr. Also war sie diejenige, die ihn im Auge behalten musste.
Aber vielleicht stehst du doch nicht ganz alleine da.
Vaaler war ihr vorhin zuvorgekommen, als sie nach Keegan hatte sehen wollen. Er hatte alles aufgegeben, sein Volk, seine Familie und sein Königreich, um sich ihrer Unternehmung anzuschließen. Wenn sie es schaffte, ihn dazu zu bringen, Jerrod mit ihren Augen zu sehen, konnten sie beide zusammen vielleicht Keegan daran hindern, irgendetwas Dummes zu tun.
Es war kalt. Der Herbst stand vor der Tür, und es würde nicht mehr lange dauern, bis der erste Schnee fiel. Scythe wappnete sich gegen die Kälte, rollte sich aus ihren Decken und ging zu Vaaler, der am Lagerfeuer saß und die Glut anfachte.
Als sie in der ersten Nacht, nachdem sie den Forst verlassen hatten, ein Lager aufschlugen, hatte Norr ihnen gezeigt, wie man ein Loch in das Eis grub, um an den schwarzen, lehmigen Torf darunter zu gelangen. Dieser Torf brannte nur langsam, entwickelte zu viel Rauch, stank sonderbar und spendete nicht genug Wärme, aber hier in der Tundra gab es nichts anderes, das sie hätten verbrennen können.
Der Danaan blickte hoch, als sie näher kam. Seine Augen wirkten in den spärlichen Flammen eingefallen und blickten gehetzt.
Vielleicht ist Keegan ja nicht der Einzige, der jemanden braucht, der auf ihn aufpasst.
»Habe gehört, wie du aufgestanden bist«, erklärte sie, als sie zu ihm trat und sich neben ihn ans Feuer hockte, um das bisschen Wärme aufzunehmen, das aus der Grube drang. »Geht es Keegan gut?«
»Er hat Albträume«, gab Vaaler leise zurück. »Aber er will nicht darüber reden.«
»Kann man ihm das verdenken? Nach allem, was er durchgemacht hat, will er wahrscheinlich einfach nur eine Weile vergessen.«
Vaaler schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass es einfache Erinnerungen sind. Keegan hat die Gabe der Sicht. Er ist nicht nur ein Zauberer, er ist auch ein Prophet. Ich glaube, er hatte eine Vision. Und die hat ihm Angst gemacht.«
»Vielleicht überwältigt ihn einfach nur dieses ganze Gerede davon, dass er der Retter der Welt wäre.«
»Er ist der Erretter der Welt«, gab Vaaler zurück.
»Du klingst wie Jerrod.« Scythe blickte hastig über ihre Schulter, um sich davon zu überzeugen, dass der Mönch nicht in der Nähe war. Sie konnte ihn nicht sehen. In den meisten Nächten bezog er etwas abseits vom Lager Position und benutzte seine magische Sicht, um in der Dunkelheit Wache zu halten.
Also konnten Vaaler und sie ungestört miteinander reden. »Ist dir jemals der Gedanke gekommen«, fragte sie leise, »dass Jerrod sich vielleicht auch irren könnte?«
»Ich habe gesehen, wozu Keegan in der Lage ist«, erinnerte Vaaler sie. »Wir haben zusammen bei Rexol studiert, dem mächtigsten ChaosMagus in den gesamten Südlanden.«
»Warum hilft er uns dann nicht bei dieser Unternehmung?«
»Weil er tot ist«, erklärte Vaaler. »Er hat versucht, eines der Artefakte zu benutzen, und das hat ihn das Leben gekostet. Jerrod hat es mir erzählt.«
»Und du fürchtest nicht, dass Keegan das Gleiche widerfahren könnte?«
Vaaler blickte wortlos in das Feuer.
»Ich zweifle nicht an deinem Freund«, versicherte ihm Scythe. »Ich denke einfach nur, dass Jerrod möglicherweise etwas zurückhalten könnte. Er ist der Sache ergeben, nicht Keegan.«
»Woher kommt dieses plötzliche Interesse an Keegans Wohlergehen?« Vaaler hob den Blick und sah ihr in die Augen. »Nach allem, was ich gehört habe, hast du vor Kurzem selbst versucht, ihn umzubringen.«
»Die Lage hat sich geändert«, erwiderte sie. Aber ihr war klar, dass dies nicht genügen würde, wenn sie ernsthaft Vaaler auf ihre Seite ziehen wollte.
»Ich bin ziemlich gut darin, Leute einzuschätzen«, fuhr sie nach einer kurzen Pause fort. »Ich weiß, dass er in seinem Herzen im Grunde ein guter Junge ist.«
Vaaler lachte. »Ein Junge? Er ist genauso alt wie du und ich.«
»Aber er wirkt irgendwie jünger. Naiver. Als wäre er vor der wirklichen Welt beschützt worden.«
»In dem Punkt kann ich dir nicht widersprechen«, räumte Vaaler ein.
»Ich habe mitbekommen, wie sehr du auf ihn achtgibst«, spann sie ihren Faden weiter. »Als wäre er dein kleiner Bruder. Du willst ihn beschützen. Und ob du es glaubst oder nicht, dasselbe will ich auch.«
Der Prinz dachte ein paar Sekunden über ihre Worte nach. »Und du glaubst nicht«, fragte er dann, »dass Jerrod auch so empfindet?«
»Ich glaube, dass Jerrod alles versucht, um seinen sogenannten Erretter zu finden, und dass er vor nichts zurückschreckt, um das zu erreichen.«
»Du hast recht«, sagte Jerrod, der kaum einen Schritt hinter ihm stand.
Scythe und Vaaler sprangen auf und wirbelten zu ihm herum. Keiner von ihnen hatte ihn kommen hören.
Einige Sekunden lang herrschte Schweigen, ein peinliches, beklemmendes Schweigen. Scythe spürte, dass ihre Wangen vor Verlegenheit und Gewissensbissen brannten, und sie versuchte hastig, sich eine Entschuldigung und eine Erklärung auszudenken. Dann drehte sich Jerrod weg.
»Weckt die anderen!«, befahl er, als er davonging. »Wir müssen aufbrechen. Wir werden verfolgt.«
3
Jerrod spürte, wie sich ihre Verfolger näherten, aber er konnte nichts daran ändern. Es war stockfinster, der Mond nur eine dünne silberne Sichel, die den dichten Nebel kaum durchdringen konnte, der ihnen seit dem Forst gefolgt war. Es war für die Pferde zu gefährlich, auf diesem unebenen Gelände schneller als in einem langsamen Trott zu laufen. Da die fünf nur vier Pferde bei sich hatten, saßen Scythe und Keegan auf einem Pferd. Denn selbst zusammen waren sie nicht so schwer wie Norr. Jerrod hatte darauf geachtet, dass die Reiter ständig die Pferde tauschten, damit kein Tier überstrapaziert wurde. Aber ohne Futter, um wieder zu Kräften zu kommen, standen sie auf verlorenem Posten.
Der Mönch fokussierte seine mentalen Energien und versuchte, mit seiner Zweiten Sicht ein Bild von den Jägern zu bekommen. Aber es war schwierig, ein klares Bild zu erzeugen. Die Aura der Alten Magie, die sich noch im Nordforst von Danaan hielt, hatte dort seine Vision getrübt. Hier war sie ebenfalls begrenzt, aber auf eine ganz andere Art und Weise.
Der Orden versuchte zwar, es geheim zu halten, aber die Mönche zogen ihre Kraft ebenso aus dem Chaos wie jede Hexe oder jeder ChaosWirker. Statt sie jedoch auf die Welt loszulassen, nutzten sie es, um ihre Wahrnehmung der Umgebung zu schärfen. Sie setzten es ein, um unglaubliche Schnelligkeit, Stärke und Ausdauer zu erhalten, und verwendeten es im Kampf, um die Bewegungen und Angriffe eines Widersachers zu antizipieren und zu kontern, bevor sie überhaupt stattfanden.
Doch das Chaos auf den Ebenen des Eisigen Ostens war schwach und dünn, wie die Luft auf einem hohen Berggipfel, wo man nur mühsam Luft in die Lunge pumpen kann. Jerrod hatte viele Theorien gehört, warum das Chaos hier so schwach war, aber keine davon hatte viel Sinn ergeben. Allerdings spielte der Grund für ihn auch keine große Rolle; ihn interessierte nur, auf welche Weise es ihn beeinflusste.
Alles war schwieriger, als es hätte sein sollen. Sein Körper wurde langsamer und viel zu schnell müde. Er konnte seine Körpertemperatur nicht richtig regulieren, was bedeutete, dass er in der kalten Nacht ständig zitterte. Seine allumfassende Sicht war auf einen Radius von einigen Hundert Metern beschränkt, und statt instinktiv die Umgebung wahrzunehmen, musste er sich konzentrieren, damit sich die Welt um ihn herum nicht in ein graues Nichts auflöste.
Deshalb hatte er die Jäger auch nicht früher bemerkt. Er hatte sie erst registriert, als er in tiefe Meditation gefallen war, nachdem sie ihr Lager aufgeschlagen hatten. Es handelte sich um ein halbes Dutzend Inquisitoren, die zu Fuß unterwegs waren und der Fährte durch die Tundra folgten, die ihre Pferde in dem weichen Boden hinterließen.
Wie Jerrod waren auch sie von der schwachen Kraft des Chaos eingeschränkt. Aber auch geschwächte Inquisitoren waren ihm und seinen Gefährten bei Weitem überlegen … vor allem, da Keegan immer noch unter den Folgen seines Kampfes mit dem Drachen litt.
Er stieß dem Pferd die Absätze in die Flanken und trieb es voran. Langsam trabte er von ganz hinten an Keegan und Scythe, dann an dem Danaan-Prinzen vorbei und blieb neben Norr. Jerrod hatte gehofft, dass dessen Vertrautheit mit dem Land ihnen einen Vorteil gegenüber ihren Verfolgern bieten würde, aber es war klar, dass selbst unter der Führung des Barbaren die Jagd sehr bald zu Ende sein würde.
»Sie kommen näher«, sagte Norr, als Jerrod ihn eingeholt hatte. Seine Worte waren eine Feststellung, keine Frage.
»Unsere Verfolger kommen schneller zu Fuß voran als wir mit den Pferden«, erwiderte Jerrod.
»Das gilt auch für mein Volk«, meinte Norr. »Pferde sind für dieses Land nicht besonders geeignet.«
»Gut! Ich habe es satt, immer nur wegzulaufen!«, rief Scythe.
Das Pferd, auf dem Keegan und sie saßen, war ein paar Längen hinter die anderen zurückgefallen, aber in der ruhigen Nacht trugen die Worte so weit, dass sie das Gespräch mitbekommen hatte. Sie saß vor dem jungen ChaosWirker, die Hände an den Zügeln, während er hinter ihr seine Arme locker um ihre Taille geschlungen hatte, um das Gleichgewicht zu behalten.
»Schicken wir diese Wäldler doch zurück in den Forst«, fuhr sie fort. »Nichts für ungut«, setzte sie mit einem Nicken zu Vaaler hinzu, als sie ihr Pferd neben ihn trieb.
»Wir werden nicht von den Danaan gejagt«, stellte Jerrod richtig. »Es ist der Orden. Inquisitoren.«
»Wie viele sind es?« Keegan schob seinen Kopf über Scythes Schulter, damit man ihn hören konnte.
»Sechs.«
Norr lachte. »Sechs? Sind das alle? Nicht mal genug, dass wir ins Schwitzen kommen!«
»Das sind keine einfachen Söldner«, wies Jerrod ihn zurecht. »Dein Volk ist nicht mit dem Chaos im Blut geboren, deshalb hatte der Orden keinen Grund, jemals in dein Land einzudringen. Du hast keine Ahnung, wozu Inquisitoren fähig sind.«
»Ich habe Geschichten über sie gehört«, warf Scythe ein. »Die kamen mir schon immer ein bisschen übertrieben vor.«
»Sind sie aber nicht.« Vaaler sprang Jerrod zu Hilfe.
»Woher willst du das wissen?«
»Der Orden will mein Volk ausradieren. Wir wären Narren, wenn wir sie nicht studiert hätten, um Fakten von Fiktionen unterscheiden zu können. Und die Kampftechnik und Kühnheit der Inquisitoren ist sehr real.«
»Vergiss nicht, wie leicht es mir gefallen ist, dich in der Taverne zu besiegen«, erinnerte Jerrod Norr. »Diese Inquisitoren haben eine ganz ähnliche Ausbildung.«
»Du hast mich nur überrumpelt«, protestierte Norr, aber er klang wenig überzeugend.
»Haben wir eine Chance, sie zu besiegen?«, erkundigte sich Vaaler.
»Ihre Macht wird hier ebenfalls schwächer sein«, meinte Jerrod. »Etwas an diesem Land ist … sonderbar. Dadurch werden sie ihre Fähigkeiten nicht so gut einsetzen können wie gewöhnlich.«
»Also werden wir kämpfen!« Scythe grinste bösartig.
»Statt zu kämpfen, sollten wir lieber versuchen uns zu verstecken«, schlug Vaaler vor. »Gibt es hier in der Nähe eine Höhle oder eine Senke?«
Jerrod schüttelte den Kopf. »Wir können uns vor den Inquisitoren nicht verstecken. Ihre Wahrnehmung ist in diesem Land zwar begrenzt, aber da sie jetzt unsere Spur aufgenommen haben, können sie uns überallhin folgen, wohin wir gehen.«
»Wir müssen irgendwo einen guten Standort finden«, bemerkte Scythe. »Eine Stelle, wo sie sich weder an uns heranschleichen noch uns von der Seite angreifen können.«
»Du wärst nicht so scharf auf einen Kampf, wenn du wüsstest, womit wir es zu tun haben«, warnte Jerrod sie. »Es ist sehr unwahrscheinlich, dass einer von uns den nächsten Morgen noch erleben würde.«
»Wir können uns nicht verstecken, und wir können ihnen nicht entkommen.« Scythe zuckte die Achseln. »Wenn ein Kampf also die einzige Möglichkeit ist, sollten wir uns zumindest darauf vorbereiten. Außerdem«, sie deutete mit dem Daumen über die Schulter auf den jungen ChaosWirker, »haben wir ihn auf unserer Seite.«
»Nein!« Jerrod kam Keegan zuvor. »Er hat sich noch nicht erholt. Wenn er versucht, das Chaos zu beschwören, wird es ihn vernichten!«
»Ich bin vielleicht noch nicht stark genug, um den Ring wieder benutzen zu können«, protestierte Keegan, »aber ich könnte die Macht von Rexols Stab einsetzen.«
»Das würde nicht viel nützen, ohne dass du vorher Hexwurz genommen hast«, widersprach Vaaler. »Und ich stimme Jerrod zu. Du bist immer noch zu schwach, um Magie anzuwenden.«
»Du willst also sagen, ich soll einfach untätig dasitzen, während ihr anderen um unser Leben kämpft?«
»Du darfst dich nicht in Gefahr bringen«, sagte Jerrod. »Du bist der Erretter der Welt. Dein Leben ist wichtiger als das Leben von uns allen anderen zusammen.«
»Sprich gefälligst nur für dich selbst«, murrte Scythe.
»Je länger wir streiten, desto näher kommen unsere Feinde«, mischte sich Vaaler ein, bevor Jerrod etwas darauf erwidern konnte.
»Scythe hat recht«, meinte Norr. »Wenn wir kämpfen müssen, sollten wir eine Stelle finden, die uns einen taktischen Vorteil gewährt.«
»Wie gut kennst du diese Gegend?«, wollte Vaaler wissen. »Gibt es so einen Platz irgendwo in der Nähe?«
Der Barbar strich mit seiner mächtigen Hand über seinen dichten Bart. »Ich glaube, wir sind in der Nähe des Flusses Gruun. Auf der anderen Seite liegt ein kleines Plateau, auf dem sich in alten Zeiten die Clanführer getroffen haben. Der Gerscheld, was in unserer Sprache ›der Hohe Ort‹ bedeutet. Es gibt nur einen Weg hinauf.«
»Wie weit ist es bis dorthin?«, erkundigte sich Jerrod.
»Zwei, vielleicht drei Stunden von hier aus.«
»Zwei müssen genügen«, beschied ihn der Mönch.
Keegan hatte seine Arme fest um Scythes Taille geschlungen, als sie durch die Nacht galoppierten. Das Tier war vollkommen erschöpft. Es trat unsicher auf, und sein Gang war unregelmäßig. Zusammen mit dem unbekannten Terrain, den beiden Reitern auf seinem Rücken und der Dunkelheit war es ein kleines Wunder, dass das Tier sich nicht schon längst ein Bein gebrochen und sie beide auf den Boden geschleudert hatte.
Keegan hielt sich fest, so gut er konnte, was ihm, wegen seiner fehlenden Hand, nicht besonders gut gelang. Um das zu kompensieren, drückte er Kopf und Brust fest gegen Scythes Rücken. Er spürte den schlanken, straffen Körper unter ihrem Hemd, der sich im Rhythmus des Pferdegalopps bewegte.
Mit ihr zu reiten ist das einzig Gute daran, ein verkrüppelter Invalide zu sein, dachte er verbittert.
Er wusste, dass Scythe und Norr ein Paar waren, aber er fühlte sich trotzdem zu der unbestreitbar attraktiven jungen Frau hingezogen. Sie hatte einen athletischen Körper, und die Gesichtszüge der Insulanerin verliehen ihr ein exotisches, mysteriöses Aussehen. Aber es war nicht nur ihr Äußeres, das ihn faszinierte. Sie hatte ein Feuer in sich, eine wilde Leidenschaft, die sich selbst bei den einfachsten Tätigkeiten zeigte. Sie bewegte sich schnell und präzise, und jede ihrer Aktionen und Äußerungen zeugte von Entschlossenheit und Selbstbewusstsein.
Es ist kein Wunder, dass sie sich zu Norr hingezogen fühlt.
Der rothaarige Hüne besaß eine ganz ähnliche, wenn auch etwas weniger feurige Selbstsicherheit.
Wahrscheinlich fürchtet sich jemand von seiner Größe vor gar nichts.
Stark, selbstbewusst und tapfer – Norr war alles, was Keegan eindeutig nicht war.
Und wenn ich nicht einmal das Chaos beschwören kann, wozu bin ich dann von Nutzen?
»Ich werde nicht einfach nur dasitzen, während ihr anderen kämpft, um mich zu beschützen«, erklärte Keegan plötzlich. Er sprach gerade laut genug, dass nur Scythe ihn hören konnte.
»Komm ja nicht auf irgendwelche dummen Ideen«, antwortete Scythe, ohne sich zu ihm umzudrehen. Ihr Blick war auf den undeutlichen Umriss des galoppierenden Pferdes vor ihr gerichtet. »Der Mönch mag in vielerlei Hinsicht ein bisschen weich in der Birne sein, aber in diesem Punkt hat er vermutlich recht. Überlass uns die Sache und versuche uns nicht in die Quere zu kommen.«
»Ich werde nicht zulassen, dass ihr euer Leben opfert, um mich zu retten«, widersprach Keegan. »Ganz gleich, was Jerrod sagt.«
»Es geht nicht immer nur um dich, kapiert?« Scythe war verärgert. »Die Inquisitoren wollen unser Blut. Wir stecken alle mit drin. Und jetzt halt die Klappe! Ich muss mich konzentrieren.«
Rot vor Verlegenheit schwieg Keegan für den Rest des Rittes.
Scythe war nicht dumm. Sie erkannte Keegans unbeholfene Erklärungen als das, was sie waren. Es hatten sich schon viele Männer und auch Frauen in sie verliebt. Sie war sich nicht zu schade, diese Tatsache in der richtigen Situation für sich auszunutzen, aber das hier war weder die Zeit noch der Ort für romantische Spielchen.
Jetzt hatte sie Gewissensbisse, weil sie dem jungen ChaosWirker so über den Mund gefahren war. Er war einfach nur ein dummer Junge, der es nicht besser wusste, und er hatte bereits mehr als genug Schmerz und Verlust erlitten. Aber die Situation in ihrer kleinen Gruppe war bereits ziemlich angespannt, und sie wollte die Angelegenheit nicht weiter verkomplizieren.
Um Norr machte sie sich dabei keine Sorgen. Ihr Liebhaber war nicht eifersüchtig, und er kannte Scythe gut genug, um sich zurückzuhalten und es ihr zu überlassen, sich auf ihre Art um diese Probleme zu kümmern. Er hatte nur gelächelt und mit seiner tiefen Stimme ein leises Glucksen von sich gegeben, als sie ihm von Keegans Gefühlen für sie erzählt hatte.
Vaaler würde das wahrscheinlich ebenfalls nicht kümmern. Der Danaan-Prinz hatte genug andere Dinge im Kopf, angesichts seiner Verbannung und der Schrecken, die sein Volk getroffen hatten.
Jerrod jedoch sah darin vielleicht etwas mehr als nur eine harmlose Verliebtheit. Wahrscheinlich würde er sie beschuldigen, eine Ablenkung darzustellen, eine Verlockung, die seinen auserwählten Retter vom rechten Pfad der Tugend abbringen wollte, oder er würde irgendeinen anderen Blödsinn erzählen.
Nicht dass es Scythe kümmerte, was irgendein eingebildeter Mönch über sie dachte. Aber Keegan hörte auf Jerrod. Wenn der Mönch zu der Ansicht gelangte, sie wäre eine Gefahr für die Bestimmung des jungen Mannes, kam er vielleicht auf die Idee, ihn gegen sie aufzubringen.
Oder vielleicht machte er etwas noch Drastischeres.
Der Mönch hatte klargemacht, dass für ihn Keegans Leben über dem von allen anderen stand. Sie glaubte zwar nicht, dass er sie vor den Augen der anderen angreifen würde, dafür war er zu gerissen. Aber Jerrod schien nie zu schlafen. Wenn Keegan und Vaaler eines Morgens aufwachten und feststellten, dass Norr und sie verschwunden waren, würde es dem Mönch zweifellos nicht sonderlich schwerfallen, die anderen davon zu überzeugen, dass sie sie einfach zurückgelassen hätten.
Sie war zwar nicht vollkommen überzeugt, dass er tatsächlich so etwas machen würde, aber sie traute es ihm durchaus zu.
Glaubst du wirklich, dass Keegans Gefühle einfach so verschwinden, weil du ihm befohlen hast, die Klappe zu halten? Diese Sache ist noch nicht vorbei.
Scythe grinste und fletschte die Zähne in der eisigen Nachtluft, während ihr Pferd weitergaloppierte.
Vielleicht habe ich ja Glück und die Inquisitoren bringen uns alle um, sodass ich mich damit nicht auch noch herumplagen muss.
Sie lachte leise über ihren Witz, und sie wusste, dass kein anderer ihn komisch finden würde. Selbst Norr schätzte ihren Galgenhumor nicht sonderlich.
So verzweifelt ihre Lage auch war, sie hatte keine Angst. Natürlich wollte sie nicht sterben. Aber aus irgendeinem Grund war sie fest davon überzeugt, dass sie diese gefährliche Situation relativ unbeschadet überstehen würden. Statt die Konfrontation zu fürchten, freute sie sich darauf. Sehr sogar.
Methodis hatte sie gelehrt, was Adrenalin bewirkte. Sie wusste, dass es ganz natürlich war, in Zeiten der Gefahr oder der Anspannung Erregung zu empfinden. Aber das hier war etwas anderes. Sie hatte es gefühlt, seit sie den Nordforst verlassen hatten, und je weiter sie nach Osten geritten waren, desto stärker war dieses Gefühl geworden. Etwas an diesem abweisenden Land sprach zu ihr, sie fühlte sich wieder belebt. Lebendig.
Sie stellte sich vor, dass Norr es ebenfalls fühlte, obwohl er nichts davon zu ihr gesagt hatte. Immerhin war es das Land seines Volkes, sein Heimatland.
Vielleicht empfindet er seine Rückkehr aber auch als bittersüß.
Norr hatte niemals gesagt, warum er den Eisigen Osten verlassen hatte und in die Südlande gegangen war. Scythe vermutete, dass es alte Wunden gab, und sie hatte nicht vor, am Schorf zu kratzen … nicht, wo sie selbst so viele eigene Wunden hatte.
Im nächsten Moment waren all ihre Gedanken wie weggefegt, weil die Pferde stürzten.
Jerrod hatte seine Sicht aufgeteilt zwischen ihrer unmittelbaren Umgebung und den Feinden, die sie verfolgten. Aber er war aufmerksam genug, um auf das scharfe Knacken reagieren zu können, mit dem das Fußgelenk von Norrs Pferd unter seinem Gewicht brach.
Das Tier wieherte schrill, als es zu Boden stürzte und seinen Reiter mitriss. Vaaler hatte zu dicht aufgeschlossen, weil sie es so eilig hatten, den Gerscheld zu erreichen, konnte er nicht mehr ausweichen und prallte gegen Norrs Tier.
Jerrod war der Dritte und versuchte, sein Pferd zur Seite zu lenken. Aber das Tier teilte die übernatürlich schnelle Reaktion des Mönchs nicht. Es war fast am Ende seiner körperlichen Kräfte und stolperte, als es auf das plötzliche Kommando seines Reiters zu reagieren versuchte. Sein Fußknöchel gab zwar nicht nach, trotzdem verlor das Tier das Gleichgewicht und stürzte vornüber.
Jerrod sprang hastig aus dem Sattel, um nicht von seinem eigenen Tier zerquetscht zu werden. Der Aufprall bei der Landung raubte ihm den Atem, aber er schaffte es gerade noch, die Beine anzuziehen und sich abzurollen, um etwas von der Wucht aufzufangen.
Scythe und Keegan hinter ihnen landeten ebenfalls in dem Gewühl. Das Pferd trug zwei Menschen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es mit voller Wucht in die anderen am Boden liegenden Pferde galoppierte und stürzte.
Eben noch saß Keegan hinter Scythe und verwünschte sich leise für all die dummen Dinge, die er gesagt hatte. Im nächsten Moment segelte er durch die Luft. Er schlug einen halben Purzelbaum, bevor er auf die eisige Erde prallte. Hals und Schultern bekamen den größten Teil des Aufpralls ab.
Orientierungslos und benommen lag er auf dem Rücken, während er in den dunklen Himmel über sich starrte. Ein brennender, kribbelnder Schmerz lief von seinem Rückgrat durch seine Gliedmaßen, und einen Augenblick lang fürchtete er, er hätte sich das Genick gebrochen. Doch kurz darauf gelang es ihm, sich umzudrehen und auf die Knie aufzurichten. Seine Arme und die Finger waren zwar taub, funktionierten jedoch noch.
Dann erregte das schrille, entsetzliche Wiehern der Pferde seine Aufmerksamkeit, und als er sich umdrehte, bot sich ihm ein chaotischer Anblick aus miteinander verschlungenen Leibern. Er wusste nicht, wie viele Pferde am Boden lagen. In der Dunkelheit waren die Leiber und die zuckenden Hufe nicht zu unterscheiden. Aber er konnte auch andere Gestalten in dem Tumult erkennen, die Reiter, die mit ihren Pferden gestürzt waren.
Immer noch zu benommen, um stehen zu können, kroch er vorwärts, um seinen Freunden zu helfen. Im nächsten Moment war Jerrod neben ihm und hielt ihn fest.
»Zu gefährlich!«, schrie er. »Ein Tritt könnte dir den Schädel zertrümmern!«
Keegan wusste, dass der Mönch recht hatte, und außerdem hatte er ohnehin nicht genug Kraft, um sich ihm zu widersetzen. Hilflos musste er zusehen, wie sich dieses Knäuel aus Körpern und Gliedmaßen allmählich entwirrte. Eins der Pferde sprang auf die Füße. Es war zwar nicht verletzt, aber vollkommen panisch und galoppierte in die Nacht hinaus.
Eine hünenhafte Gestalt, Norr, kroch auf Händen und Knien aus dem Durcheinander. Er hielt kurz inne, um eine dunkle Gestalt aufzuheben, die regungslos am Boden lag. Er zog das bewusstlose Opfer aus dem Chaos, bevor er ein paar Schritte weiter zusammenbrach.
Ein anderes Pferd konnte sich aufrichten. Wie das erste rannte es ebenfalls davon, in die entgegengesetzte Richtung. Keegan sah, dass es schrecklich lahmte.
Die restlichen Pferde kreischten vor Schmerz. Sie waren zu verletzt, um aufzustehen. Aber Keegan ignorierte ihre grausamen Leiden; seine Aufmerksamkeit war auf die beiden dunklen Gestalten neben ihm gerichtet.
Norr hat jemanden herausgezogen. War es Vaaler oder Scythe?
In der Dunkelheit wirkte die andere Person klein und zierlich neben Norr, aber neben dem Barbaren sah jeder wie ein Zwerg aus. Aus dieser Entfernung konnte man unmöglich erkennen, um wen es sich handelte.
Keegan schüttelte Jerrods Hand ab, stand auf und ging zu seinen gestürzten Freunden. Der Mönch folgte ihm auf dem Fuße. Als er näher kam, erkannte er Vaaler in der Gestalt neben Norr.
Der Danaan-Prinz war jetzt bei Bewusstsein. Die beiden Männer saßen auf dem Boden und tasteten ihre Körper vorsichtig nach gebrochenen Knochen oder anderen ernsthaften Verletzungen ab. Keegans Erleichterung darüber, dass sein engster Freund noch am Leben war, wich rasch seiner Sorge um das fehlende fünfte Mitglied ihrer kleinen Gruppe.
»Wo ist Scythe?«, wollte er wissen.
Vaaler war immer noch zu erschüttert, um antworten zu können, aber Norr schüttelte den Kopf.
»Ich habe sie nicht gesehen. Sie muss vorher abgesprungen sein.«
Bevor Keegan auch nur vorschlagen konnte, nach ihr zu suchen, tippte ihm Jerrod auf die Schulter.
»Da«, sagte er und deutete auf die am Boden liegenden Pferde.
Keegan erkannte undeutlich Scythes Silhouette, als sie die verletzten Tiere umkreiste. Sie duckte sich dicht am Boden, wie ein Raubtier, bereit zum Angriff. Die Pferde waren fast wahnsinnig vor Schmerzen und traten wie verrückt um sich. Ihre gebrochenen Gliedmaßen standen zuckend in unnatürlichen, abscheulichen Winkeln ab.
Plötzlich sprang Scythe vor und direkt wieder zurück. Eines der Pferde schüttelte sich und blieb ein paar Sekunden später regungslos liegen. Mittlerweile hatte Scythe bereits der zweiten gequälten Kreatur die Kehle durchgeschnitten. Diese kam ebenfalls zur Ruhe, während sie ausblutete. Dann drehte sich die junge Frau von den Tieren weg, die sie hatte töten müssen, und ging zu ihren Gefährten.
»Wie schlimm ist es?«, fragte sie.
»Mir geht es gut«, versicherte Norr. Er grunzte, als er sich aufrichtete.
»Du weißt, dass du ein schrecklicher Lügner bist«, warnte ihn Scythe.
»Ein paar angeknackste Rippen vielleicht«, gab ihr Liebhaber zu. »Ein verdrehtes Knie. Nichts Ernstes.«
»Und du, Vaaler?«, erkundigte sich Keegan. »Du hast dich nicht bewegt, als Norr dich da rausgezogen hat.«
»Ich habe mich gerade gefragt, wie ich hierhergekommen bin.« Die Worte des Prinzen klangen ein wenig undeutlich. »Danke«, setzte er dann mit einem anerkennenden Nicken in Richtung des Barbaren hinzu.
»Du hast meine Frage nicht beantwortet«, hakte Keegan nach. »Bist du verletzt?«
»Ich hab einen unangenehmen Schlag auf den Kopf bekommen. Sonst scheint mir nichts passiert zu sein.«
»Lass mich mal sehen.« Scythe trat zu ihm und untersuchte rasch die Verletzung. »Du hast eine Platzwunde, die ziemlich stark blutet. Aber Wunden am Kopf sind immer eine Sauerei. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Das heilt rasch.«
Keegan war mit Scythes Diagnose zufrieden, streckte seine gesunde Hand aus und zog Vaaler auf die Füße.
»Was machen wir jetzt?«, erkundigte sich der Danaan. »Die Inquisitoren verfolgen uns immer noch.«
»Wir sind nur eine Meile vom Gerscheld entfernt«, meinte Norr.
»Vielleicht teilen sie sich auf, um den Pferden zu folgen, die weggelaufen sind«, spekulierte Scythe. »Das würde unsere Chancen verbessern.«
»Das werden sie nicht tun«, enttäuschte Jerrod sie. »Sie sind schon so nah, dass sie uns jetzt wahrnehmen können, so wie ich sie sehe. Nehmt den Pferden alles ab, was ihr tragen könnt«, befahl der Mönch. »Wir gehen zu Fuß weiter.«
4
Von den beiden toten Pferden konnten sie nicht allzu viel mitnehmen. Der größte Teil ihrer Nahrungsmittel hatte sich auf den Tieren befunden, die in Panik geflüchtet waren, und sowohl die Schlafdecken als auch die restliche Lagerausrüstung würde sie auf ihrem Fußmarsch nur behindern.
Soweit es Keegan betraf, war das einzig Wertvolle ohnehin nur Rexols Stab. Wie durch ein Wunder hatte er den Sturz unbeschadet überstanden; selbst der gehörnte Gorgonenschädel war unversehrt. Ob das nur Glück gewesen war oder ein Zeichen für die Macht, die er beinhaltete, wusste Keegan nicht. Aber er war dankbar dafür, diesen Zauberstab bei sich zu haben, als sie weiter durch die Nacht marschierten.
Scythe schnitt rasch ein paar Tuchstreifen von den Bettrollen ab und bandagierte damit Norrs verletztes Knie. Dann gingen sie im Gänsemarsch weiter, angeführt von dem Barbaren. Trotz des festen Verbandes humpelte er leicht, aber mit seinen langen Beinen konnte er ein Tempo vorlegen, dem die anderen nur mit Mühe zu folgen vermochten. Schon kurz darauf sahen sie die Umrisse des Gerscheld vor sich aufragen, der sich, etwa zwanzig Meter hoch, vor dem bläulichen Himmel abhob, der den Tagesanbruch verkündete.